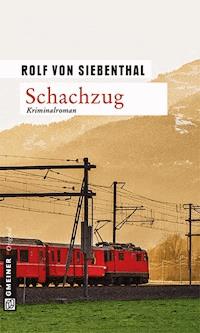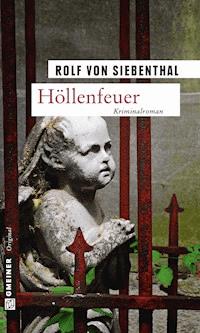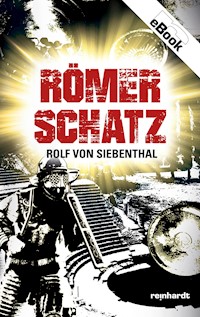
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Raab ist ein Gauner aus Überzeugung. Doch er ist ein ehrenhafter Dieb, der Einbrüche ohne Waffen und Gewalt plant. Heckt Raab nicht gerade seinen nächsten Coup aus, hilft er bei Schülergrabungen in Augusta Raurica mit. Als dabei ein Skelett gefunden wird, berichten die Medien darüber und verbreiten Raabs Gesicht in alle Welt. Das bringt eine Verbrecherbande auf seine Spur, auf deren Abschussliste Raab seit Jahren steht. Der Bandenchef stellt ihn vor die Wahl: Entweder treibt Raab die verschollenen Stücke des Silberschatzes von Augusta Raurica auf oder er stirbt. Eine gefährliche Suche beginnt…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROLF VON SIEBENTHAL
Römerschatz
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Umschlaggestaltung: Bernadette Leus
eISBN 978-3-7245-2646-9
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2516-5
www.reinhardt.ch
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Anmerkungen
1
Der Lackaffe trug braune Cowboystiefel, kunstvoll zerrissene hellblaue Jeans, ein rosa Hemd mit offenem Kragen und eine schwarze Lederjacke. Die Frisur hatte er hochgekämmt wie ein Gockel, die Arroganz stand ihm ins Gesicht geschrieben. Breitbeinig stand er hinten an der Absperrung zum Grabungsfeld und checkte die Lage ab. Raab musterte den Kerl und wusste: Anfänger-Arschloch.
Raab presste die Kiefer aufeinander. Das verdammte Foto! Vor zwei Wochen hatte es ein Schüler aufgenommen, ganz in der Nähe, mit einem beschissenen Smartphone. Das Foto ihres tollen Fundes, Schädel, Fingerknochen, mit Raab im Hintergrund, weil er nachlässig geworden war. Tausendfach auf Papier gedruckt und per Internet in alle Welt geschickt. Nur deswegen war der Kerl hier. Dessen ganzes coole Gehabe – das Tippen mit der Fussspitze, das Fummeln an der Sonnenbrille – stank geradezu nach Berlin-Neukölln.
Raab zog seine Baseballmütze tiefer ins Gesicht und guckte einem Mädchen über die Schulter.
«Ich habe etwas gefunden», rief die Viertklässlerin begeistert.
«Sieht nach einer Scherbe aus», meinte Raab. «Vielleicht von einem Krug.»
«Oder einem Nachttopf», rief ein Junge.
Die Schülerinnen und Schüler um Raab herum lachten und gruben sich weiter in die Vergangenheit vor. Es waren Kinder der Basler Primarschule St. Johann, die an diesem Mittwochmorgen mit Feuereifer Erde abtrugen. Denn Raab hatte ihnen bei der Einführung garantiert, dass auch sie etwas fänden in Augusta Raurica. Etwas, das zuletzt ein Römer oder eine Römerin in den Händen gehalten hatte. Ein paar Kinder waren bereits auf Keramikstücke gestossen und hofften auf eine Speerspitze, eine Fibel, ein Goldstück.
Raab stand auf, seine Gelenke knackten so laut, dass ein paar der Kinder ihre Köpfe drehten. Er stieg aus der Grube und genoss die Sonne im Gesicht; ein perfekter Tag für eine Schülergrabung.
Das interessierte den Fatzke da vorn natürlich nicht. Er stand etwa dreissig Meter entfernt mit dem Rücken zur Curia, dem römischen Rathaus, und beobachtete die Menschen zwischen den antiken Mauerresten. Früher oder später würde er Raab entdecken. Wieso bloss hatten sie so ein Milchbubi losgeschickt?
«Frau Alioth, ich vertrete mir kurz die Beine», rief Raab der Lehrerin zu.
Alioth blickte hoch aus der Grube, einst eine römische Küche, und winkte kurz. «Kein Problem, lassen Sie sich Zeit.» Ein hübsches junges Ding mit struppigen braunen Haaren und einem Gesicht voller Sommersprossen. Sie hatte sich mit dem gleichen Feuereifer wie die Kinder in die Arbeit gestürzt und immer ein Lob auf den Lippen. Bei so jemandem hätte Raab in seiner Schulzeit bestimmt weniger Stunden geschwänzt.
Er schritt fünfzig Meter zur Hütte am Rand des Grabungsfeldes und liess seinen Blick über die angrenzende Wiese gleiten. Hier hatte sich einst das Forum befunden, das politische und religiöse Zentrum. Weite Teile davon sowie von ganz Augusta Raurica lagen bis heute praktisch unberührt in der Erde. Experten sprachen deswegen von der besterhaltenen römischen Stadt nördlich der Alpen.
Das Bürschchen zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch gegen den Himmel.
Raab betrat die Hütte und nahm einen Schluck Wasser aus der Trinkflasche. Früh an diesem Junimorgen war ein Regenschauer niedergegangen. Jetzt, um halb elf, hatten sich die Wolken verzogen, das Thermometer vor dem Fenster stand bei vierundzwanzig Grad. Durch ein Fenster sah er den Gockel herantänzeln, Anfang zwanzig mochte er sein. Mit seinen feinen Zügen hätte er den Gigolo in einer libanesischen Seifenoper spielen können, wäre sein Mund nicht zu schmal und die Nase einen Tick kleiner gewesen. Er fischte ein Smartphone aus der Innentasche seiner Jacke und warf einen Blick darauf.
Raab machte drei Schritte zur ehemaligen Anrichte, die jetzt als Werkzeugschrank diente. Er ging in die Knie, öffnete die unterste Schublade und begutachtete ein paar Schraubenzieher und Kellen, schob sie zur Seite. Er brauchte etwas anderes. Ganz hinten lag ein schmaler Spatel für das Ausritzen. Er holte ihn heraus und fuhr mit dem Finger über die Klinge, schmal und spitz, fast wie ein Stilett. Raab verbarg ihn in seiner Handfläche, legte die Baseballmütze auf die Anrichte, verliess die Hütte und schritt auf den jungen Kerl zu.
Der hob den Kopf vom Bildschirm, runzelte die Stirn und checkte nochmals sein Handy. Herrgott! Viel dümmer konnte der sich nun wirklich nicht anstellen.
Raab marschierte an ihm vorbei, nickte und lächelte, als ob er ihn für einen Museumsbesucher hielte. Er folgte einem Pfad weg von der Grabungsstätte und überquerte unterhalb der Curia eine abschüssige Wiese, die nach fünfzig Metern von einem Wäldchen am Violenbach begrenzt wurde. Spaziergänger gab es hier keine. Raab kletterte die Uferböschung hinunter und setzte sich auf den dicken Stamm einer gefällten Eiche. Dann hielt er das Gesicht in die Sonne und schloss die Augen.
Es dauerte nicht lange, bis er Laub rascheln und Äste knacken hörte. Die Schritte stoppten ein paar Meter entfernt, plötzlich war es still. Das Bubi musste sich grossartig fühlen, weil es sein Opfer sitzend antraf. So arglos, hilflos.
«Hallo Raab.»
Er drehte den Kopf, guckte die Böschung hoch. «Guten Morgen. Kennen wir uns?»
Drei Meter über ihm stand der Kerl, in der rechten Hand hielt er eine Glock mit Schalldämpfer und zielte auf Raab. «Klar. Du bist eine Legende im Kiez. Jeder hasst dich.»
«Interessant.» Ganz langsam breitete Raab die Arme seitlich aus und legte sie auf den Stamm.
«Du wirst mich berühmt machen, Alter.» Der Bursche kam herunter, bis er auf gleicher Höhe mit Raab stand. Dann hob er die Pistole.
Raab liess den Spatel mit einer Armdrehung aus dem Handgelenk schnellen. Nicht, dass er damit irgendwelchen Schaden anrichten würde. Dafür lag viel zu wenig Kraft in seiner Bewegung.
Aber instinktiv schützte der Bursche sein Gesicht mit beiden Armen. Der Spatel prallte ab, landete im Laub.
Die halbe Sekunde genügte. Raab sprang hoch und trat dem Burschen die Beine weg.
Dessen Oberkörper klappte zur Seite, eine Wange landete in Tannennadeln und Dreck. «Uff.»
Der Vollständigkeit halber rammte ihm Raab noch eine Faust auf die Nase, was ein knackendes Geräusch verursachte.
Der Junge jaulte auf, die Waffe flog ins Laub. Er presste eine Hand aufs Gesicht, Blut quoll zwischen den Fingern hervor.
Raab nahm die Pistole und den Spatel auf, dann drehte er den Angreifer auf den Rücken und kniete sich auf dessen Brust. Aus der Lederjacke fischte er das Mobiltelefon, einen Schlüsselbund und ein Portemonnaie. Er klappte es auf und griff nach dem Personalausweis. Nader Said, Berlin. Sein Gespür hatte Raab nicht getäuscht. «Wie gefällt dir die Schweiz, Said?»
Blut und Tränen liefen ihm über Wangen und Ohren. «Ya ibn el kalb», näselte Said.
Das arabische Wort für Hundesohn kannte Raab. «Was willst du hier?»
«Fick dich.»
Raab seufzte, warf Schlüsselbund und Portemonnaie zwischen die Bäume, steckte die Glock und das Mobiltelefon ein. «Das hier kann sehr schmerzhaft für dich werden.» Raab hielt die Spitze des Spatels wenige Millimeter über Saids linke Pupille. «Wer schickt dich?»
Said zitterte merklich unter Raabs Knien. «Arif.»
Der Weise? So liessen sich viele in Berlin beweihräuchern. «Wer?»
«Arif Massoud … aus Moabit.»
Raab stutzte. Er kannte den Clanchef aus dem Berliner Moabit-Quartier nur vom Hörensagen. Aber mit dem hatte er sich doch gar nicht angelegt, damals. Ihm hatte er eher einen Gefallen getan. «Dieser Massoud hat dir den Auftrag gegeben, mich umzubringen?»
Said keuchte und wich seinem Blick aus. «Er will mit dir reden.»
So war das also. Verdelli. Der Kleine war bloss ein ruhmsüchtiger Botenjunge. «Was will Massoud von mir?»
«Keine Ahnung.»
Raab setzte die Spitze des Spatels auf Saids unteres Augenlid und übte gerade so viel Druck aus, dass Blut aus der Haut tropfte. «Verarsch mich nicht.»
Said wimmerte. «Ich schwöre, ich weiss sonst nichts.»
«Und Massoud denkt tatsächlich, dass ich jetzt einfach so nach Berlin fahre?»
«Nein, er ist hier … In Basel … Im Hotel Drei Könige. Du sollst dorthin kommen. Jetzt gleich.»
Raab nahm die Klinge weg und richtete den Spatel auf ihn. «Sag deinem Chef, dass ich darüber nachdenken werde. Falls ich Massoud treffe – und ich betone falls –, dann geschieht es zu meinen Bedingungen. Verstanden?»
Wie eine Schildkröte zog Said den Kopf ein und nickte.
Raab stand auf und steckte den Spatel in die Gesässtasche seiner Arbeitshosen. «Und jetzt hau ab.» Er deutete über den kleinen Bach, weg von der Ausgrabungsstätte und den Kindern. «Da lang.»
Er sah zu, wie sich Said aufrappelte und über das flache Gewässer davonhumpelte. Stiefel und Hosenaufschläge sogen sich mit Wasser voll. Genugtuung bereitete ihm das nicht. Denn Raab wusste, dass er tief in der Scheisse steckte.
2
Vom Turm des Basler Münsters aus beobachtete Raab kurz vor fünfzehn Uhr den Platz siebzig Meter unter sich, die mittelalterlichen Gebäude, die schmalen Gassen, den Baumhain.
Dem Rhein entlang über die Augustinergasse müsste Massoud kommen, wenn er zu Fuss vom Hotel Drei Könige über den Rheinsprung zum Münsterplatz hochspazierte – so, wie es Raab per Textnachricht angeordnet hatte. Massouds Nummer hatte er auf Saids Mobiltelefon unter Boss gefunden. So ein Idiot!
Unter normalen Umständen wäre Raab jetzt unterwegs in eine andere Stadt oder ein anderes Land. In den Schliessfächern von drei Banken lagen falsche Pässe, passende Kreditkarten, Führerscheine, Pistolen, Munition und jeweils zehntausend Franken in bar.
Doch etwas hielt ihn zurück.
Raab liess den Blick über den Fluss und die Mittlere Brücke schweifen, in der Ferne ragten die beiden weissen Roche-Türme wie die Spinnaker riesiger Segelschiffe in den Himmel. Den grössten Teil seines Lebens hatte er in Glasgow, Dublin und Berlin verbracht, aus der deutschen Hauptstadt hatte er sich vor sechs Jahren nach Brüssel absetzen müssen. Dann, vor zwei Jahren, war er doch in die Schweiz zurückgekehrt, in die Stadt am Rheinknie, seine Heimat. Hier lebte Raab unter falschem Namen und half zum Zeitvertreib als Freiwilliger in Augusta Raurica bei Grabungen aus. Klar konnte einem Basel mit seiner Kleinräumigkeit und Selbstverliebtheit, der Ruhe und Gemütlichkeit gehörig auf den Wecker gehen. Die hitzigsten Debatten drehten sich hier um die Zahl der Parkplätze, die abgebaut werden sollten. Trotzdem wollte Raab, mittlerweile zweiundfünfzig Jahre alt, den Rest seines Lebens in dieser Stadt verbringen. Denn es war seine. Wenn er allerdings noch einen Fehler wie mit diesem Foto beging, konnte dieser Rest sehr kurz ausfallen.
Eine Mutter mit Kinderwagen spazierte über den Münsterplatz in die Augustinergasse. Dort kreuzte sich ihr Weg mit einer schmalen Figur im Anzug, einem alten Mann, wie es schien. Raab wartete, bis der den Platz erreicht hatte und am Rand des Baumhains stehen blieb. Er drückte die Schnellwahltaste auf Saids Mobiltelefon und sah, wie unten der Alte in seiner Manteltasche kramte.
«Ja!», hörte Raab ihn im Mobiltelefon mit kräftiger Stimme.
«Quer über den Platz siehst du das Restaurant Zum Isaak. Geh hin und bleib am Telefon.»
«Niemand gibt mir Befehle.»
«Willst du mich treffen oder nicht?»
«Du hast echt Nerven, Raab.» Der Alte marschierte los.
Raab beobachtete die Zugänge zum Münsterplatz, den Schlüsselberg, die Rittergasse und den Münsterberg.
Massoud blieb vor dem Strassencafé beim Isaak stehen.
«Warte dort eine Minute.»
Massoud blickte sich um. «Willst du dich über mich lustig machen?»
«Ich will sichergehen, dass du alleine gekommen bist.»
«Ich halte meine Versprechen.»
Seit wann? In den 80er-Jahren waren diese Männer vor dem Bürgerkrieg im Libanon nach Berlin geflohen. Dort hatten sie am Rand der Gesellschaft gelebt, keine Arbeitserlaubnis erhalten. Also hatten sie sich kriminelle Geschäftsfelder aufgetan und durch den Nachzug von Clanmitgliedern ausgebaut. Heute beherrschten die Massouds von Berlin ganze Stadtviertel. «Nach der Begegnung mit deinem kleinen Said habe ich guten Grund, misstrauisch zu sein.»
Massoud schüttelte unten auf der Gasse den Kopf. «Was ist geschehen?»
«Er wollte mich umbringen.»
Massoud seufzte. «Said ist ein dummer Junge. Aber er weiss, was du in Berlin getan hast.»
Wie jeder aus den Clans. «Was willst du von mir?»
«Nicht am Telefon.»
Nochmals inspizierte Raab den Platz und die Gassen. Es schien, als habe Massoud Wort gehalten und seine Leibwächter zurückgepfiffen. «Rechts vom Münster befindet sich der Kreuzgang. Dort treffen wir uns.»
Massoud trennte die Verbindung vor Raab.
Der steckte das Telefon ein und eilte die Turmtreppe hinunter, zweihundertfünfzig steile und enge Stufen. Massoud hatte sein Geld im Drogen- und Waffenhandel gemacht, das hatte Raab mit ein paar Anrufen herausgefunden. Er galt sogar als feinsinniger Mensch, der viel Geld für Kunstwerke und Antiquitäten ausgab. Deswegen hatte er den Beinamen Arif erhalten. Der Weise.
Unten angekommen verliess Raab das Münster. Er wandte sich nach links, ging um die Kathedrale herum und betrat den Kreuzgang.
Massoud stand vor der Gedenktafel von Jakob Bernoulli. «Ein grosser Mann», sagte Massoud, ohne sich umzudrehen. «Wusstest du, dass Bernoulli neben Newton und Leibniz als der wichtigste Mathematiker im siebzehnten Jahrhundert galt?»
«Ja.»
«Das überrascht mich nicht.» Massoud drehte sich um.
Trotz der sommerlichen Wärme trug er einen grauen Anzug mit Weste, weissem Hemd und dunkelblauer Krawatte. Er musste über achtzig sein, sein Körper schien ausgezehrt. Auf den schmalen Schultern ruhte ein zerfurchtes Gesicht mit gestutztem weissem Bart, die blasse Haut betonte seine dunklen Augen. Massoud sah aus wie ein biederer, jovialer Pensionär. Doch Raab wusste, dass es zu den üblichen Geschäftspraktiken dieses so seriös wirkenden Herrn gehörte, Menschen verschwinden zu lassen.
«Es heisst, du seist ein kluger Kerl, Raab. Heute wollte ich mir die Ausstellung in der Fondation Beyeler ansehen, doch stattdessen kommandierst du mich herum. Wenige Menschen haben mich je so respektlos behandelt. Sie sind jetzt tot. Vielleicht bist du doch nicht so klug.»
«Was erwartest du, wenn dein Bote eine Glock zückt?»
«Wie gesagt, das war ein Fehler.» Massoud hob eine Hand, die zierlich wirkte. «Lass uns das vergessen und einen neuen Anfang machen. Erzähl mir etwas über dich. Deine Familie stammt aus der Schweiz?»
Raab redete nie über sich. Er hatte es schon immer so gehalten. Je weniger die Menschen wussten, desto weniger Macht besassen sie über ihn. «Was willst du von mir?»
Massoud studierte sein Gesicht, als wäre es eine Strassenkarte. «Du machst es einem schwer, dich zu mögen. Gehen wir ein Stück.»
Sie spazierten Seite an Seite durch den Kreuzgang, Massoud legte die Hände auf den Rücken und las hin und wieder eine Inschrift. «Ich bin nicht hier, um alte Geschichten auszugraben. Was damals in Berlin passiert ist, interessiert mich nicht. Aber es gibt viele, viele andere Leute, die dich tot sehen möchten.»
«Ich weiss.»
«Denen ich Gefallen schulde.» Massoud deutete auf einen Anbau der Kathedrale am Ende des Kreuzgangs. «Ist das eine Kapelle?»
«Die Niklauskapelle. Darin fand im 15. Jahrhundert das Basler Konzil statt.»
«Darüber habe ich gelesen.» Er hob den Zeigefinger wie ein Lehrer. «Das Konzil hat 1460 zur Gründung der Universität Basel geführt.»
«Suchst du eine gute Uni für deine Enkel?»
«Nein, nein.» Bedächtig schüttelte Massoud den Kopf. Er senkte den Blick auf Raabs Hände. «Sind deine Finger immer noch so flink? Man erzählt sich, dass du jedes Schloss innerhalb einer Minute knacken konntest.»
«Brauchst du mich für einen Bruch?»
Massoud steckte eine Hand in sein Jackett, fischte einen Zettel heraus und faltete ihn auseinander. «Ein interessanter Artikel. Und das Foto erst …» Es war eine Kopie aus der Basler Zeitung.
«Du liest die BaZ?»
«Ja, seit ich weiss, dass du hier lebst.»
Einmal mehr verfluchte Raab seinen Fund.
«Archäologie fasziniert mich. Es gibt einen Mediendienst, der mir Fachartikel aus aller Welt schickt. Wie den hier.» Er wedelte mit dem Papier in der Hand.
Das Foto über dem Text zeigte drei Kinder. Sie hatten sich um einen Fingerknochen gruppiert, der aus dem Boden ragte. Unter der Anleitung von Raab waren die Fünftklässler bei einer Schülergrabung in Augusta Raurica auf ein Skelett gestossen. Alle regionalen Medien hatten darüber berichtet, einzelne nationale Zeitungen hatten das Thema aufgegriffen.
Raab hatte gehofft, dass niemand dem Mann Beachtung schenken würde, der hinter den Kindern stand. «Was willst du mit alten Knochen?»
«Im Internet habe ich gelesen, dass sie gar nicht so alt sind.» Massoud nahm den Spaziergang unter den Bögen des Kreuzganges hindurch wieder auf.
«Aus der Römerzeit stammen sie bestimmt nicht. Die Gerichtsmediziner schätzen, dass sie weniger als hundert Jahre in der Erde lagen.»
Massoud hielt den Artikel hoch. «Was ist mit dem Silberschatz, von dem hier die Rede ist?»
«1961 wurde in Augusta Raurica ein römischer Schatz gefunden. Er ist das Prunkstück des Römermuseums.»
«Hier steht, dass ein Teil des Silbers bis heute verschwunden ist.»
«Stimmt. Aber den grössten Teil kannst du dir im Museum ansehen.»
«Dort war ich schon.» Massoud leckte sich die Lippen. «Eine faszinierende Geschichte. Ein unbekannter Toter, ein Geheimnis und ein Schatz … Ich will, dass du mir genau diesen besorgst.»
Raabs Lachen hallte durch den Kreuzgang. «Ich soll das Silber aus dem Römermuseum stehlen? Hast du keine Leute mehr?»
In aller Ruhe zog Massoud ein weisses Stofftaschentuch aus dem Jackett und schnäuzte sich. «In meiner Sammlung habe ich chinesische Jadefiguren, geschnitztes Elfenbein aus Phönizien, griechische Münzen. Weisst du, was daran so besonders ist?»
Raab breitete die Arme aus. «Du wirst es mir bestimmt gleich sagen.»
Er wischte sich die Nase und steckte das Taschentuch wieder ins Jackett. «Niemand weiss davon. Oder fast niemand. Die Objekte gelangten vom Finder über einen Händler direkt zu mir. Und nur ich bekomme sie zu Gesicht. Ein erhabenes Gefühl. Diesen Schatz im Römermuseum, den haben schon Tausende begafft und fotografiert. Der interessiert mich nicht. Ich will, dass du mir die verschwundenen Teile bringst.»
Raab schüttelte den Kopf. «Das ist verrückt. In den letzten sechzig Jahren haben ihn viele gesucht. Ohne Erfolg.»
«Jetzt kannst du zeigen, ob du wirklich so schlau bist.»
«Mit einer unmöglichen Schatzsuche? Vergiss es.»
Massouds Blick wurde hart. «Das ist keine Bitte.» Mit einem Finger tippte er auf das Papier. «Wenn das hier in die falschen Hände in Berlin gerät, bist du am Arsch. Klar, du denkst, dass du jederzeit untertauchen kannst. Bestimmt hast du Geld und falsche Papiere irgendwo gebunkert. Aber meinst du, dein Freund Kemal Aydin hat das auch?» Er fischte ein Mobiltelefon aus seinem Jackett, tippte ein paar Mal darauf und hielt Raab das Display hin.
Der Film zeigte unverkennbar Kemal. Mit dem dreijährigen Cem hüpfte er auf einem Gartentrampolin herum. Die Kamera schwenkte zum Sitzplatz des Reihenhauses, wo Kemals Frau Leila den Tisch deckte.
«Die Aufnahme stammt von gestern. Dich beobachten wir seit neun Tagen. Netterweise hast du am Freitag ein Paket nach Bruckberg geschickt, ein Angestellter der Poststelle hat uns die Adresse gegeben. Hat uns bloss zweihundert Franken gekostet, ein Schnäppchen. Mittlerweile wissen wir, wann Kemal zur Arbeit fährt und beim SC Bruckberg trainiert. Wir kennen Leilas Friseurin und die Krippe des kleinen Cem.»
Verdamisiech! Das Paket mit dem Geburtstagsgeschenk für Cem, Raabs Patenkind. Sein Magen fühlte sich an, als hätte er glühende Holzkohle geschluckt. Er griff nach der Pistole im Holster unter seiner Jacke.
Massoud verzog keine Miene. «Lass stecken, meine Männer sind schneller. Sie beobachten uns die ganze Zeit.»
Raab hätte es wissen müssen.
«Und was deinen Freund Kemal betrifft: Ich muss nur mit den Fingern schnipsen, und meine Leute bringen ihn um. Danach werden sie sich die hübsche Frau und den Kleinen vornehmen. Schnipsen kann ich auch noch aus dem Grab heraus, falls du auf dumme Gedanken kommen solltest.»
Raab presste die Kiefer so hart zusammen, dass es schmerzte. Massoud hatte seinen einzigen wunden Punkt getroffen.
Massoud trat nahe an Raab und pikste ihn mit dem Zeigefinger in die Brust. «Besorg mir diesen Schatz. Am Sonntag in einer Woche, in elf Tagen, komme ich wieder in die Schweiz. Dann will ich ihn haben.» Er wandte sich ab und schlenderte aus dem Kreuzgang.
Raab sah ihm nach und überlegte fieberhaft. Ob er Kemal warnen sollte? In dem Fall bräuchte er einen guten Fluchtplan für die Familie. Oder ob er nicht doch das gestohlene Silber auftreiben könnte? Wie zum Teufel sollte er das anstellen? Es schien ausweglos.
Trotz allem bereute Raab keine Sekunde, was er in Berlin getan hatte. Den Anfang genommen hatte alles vor sieben Jahren in einer lauen Herbstnacht.
3
Am heruntergezogenen Rollo in seinem Schlafzimmer nahm Raab eigenartige Lichteffekte wahr. Zunächst sah er ein pulsierendes Rot, das kurz danach von Blau und Gelb durchzogen war. Er setzte sich im Bett auf und zog das Ding hoch. Aus dem Haus schräg gegenüber in der Silbersteinstrasse in Berlin-Neukölln, einem hässlichen Betonblock aus den 1970er-Jahren, quoll Rauch im zweiten Stock hervor. Hinter den Fenstern tanzten orange-rote Flammen.
Raab riss das Fenster auf, hörte drüben das Knacken von Gebälk und Splittern von Glasscheiben. Unten auf dem Gehsteig vor seiner Wohnung stand ein Paar, die Frau sprach hektisch in ein Telefon.
Seit dem Konkurs eines Start-ups, einem Lieferservice für Tiefkühlmahlzeiten, stand das obere Stockwerk des brennenden Hauses leer. Doch im Erdgeschoss befand sich Popeye, ein Fitnessstudio ohne Stepper oder Dampfbad. Nur Hanteln, Gewichtsscheiben und Magnesium. Mit den vergilbten Postern von Palmenstränden an den Wänden schien es wie aus der Zeit gefallen. Doch Raab gefiel genau das, weshalb er dort mehrmals pro Woche trainierte. Zu den Vorteilen von Popeye gehörte zudem, dass es täglich bis dreiundzwanzig Uhr geöffnet war.
Raab warf einen schnellen Blick auf den Wecker auf dem Nachttisch: erst halb zwölf. «Scheisse.» Kemal Aydin, der Besitzer, hockte spätabends oft noch über der Abrechnung.
Er schlüpfte in seine Crocs und verliess in T-Shirt und Boxershorts die Wohnung, rannte zwei Stockwerke hinunter und auf die Strasse.
«Haben Sie die Feuerwehr gerufen?», fragte er das Paar auf dem Trottoir.
«Ja, soeben», antwortete die Frau, die einen blauen Schal gegen den Rauch an die Nase presste.
Raab hörte noch keine Sirene, sonst waren die doch schnell. Er überquerte die Strasse, spürte die Hitze der Flammen auf seiner nackten Haut. Das Feuer, so schien es durch die Glastür, hatte das Erdgeschoss noch nicht erreicht. Er riss sie auf. «Kemal, bist du noch da drin?», rief er mit aller Kraft.
Raab mochte Kemal, einen Hungerhaken, der stets ein zerknittertes weisses Hemd trug wie ein Student, und das noch mit über dreissig. In den vierzehn Monaten, in denen Raab hier trainierte, hatte ihn Kemal nie mit dummem Gequatsche belästigt.
Hellgrauer Rauch waberte im Entrée, Raab schoss hindurch, linker Hand lagen die Garderoben, geradeaus ging es zum Kraftraum. Er zog die schwere Metalltür auf, die einst zu einer Druckerei geführt hatte. Prompt brannte dicker Qualm in seinen Augen, der Raab zum Husten brachte. Er sah kaum weiter als ein, zwei Meter. «Kemal!»
Raab liess sich auf die Knie fallen. Unten am Boden war die Luft leichter zu atmen, auch wenn die Sicht schlechter und schlechter wurde. Er rief sich den Grundriss in Erinnerung. Der Eingang befand sich in der Ecke des Haupttrainingsraums von vielleicht hundertfünfzig Quadratmetern. Von seiner Position aus links standen die Bänke, Lang- und Kurzhanteln, rechts davon lagerten Stangen und Metallscheiben. Irgendwo da vorn, wenn Kemal noch drin war, musste er sein. Raab streckte den Arm aus und spürte die Wand. Vielleicht fünf Meter geradeaus stand der Tresen, hinter dem Kemal immer sass.
Auf allen Vieren kroch Raab vorwärts. Er durfte sich nicht von der Wand entfernen, sonst verlöre er die Orientierung im dunkelgrauen Rauch, der in seinen Lungen ätzte. Also behielt er den rechten Fuss an die Wand gestreckt, mit den Händen tastete er den Boden ab.
Raab wurde schwindlig. Doch er schob sich weiter vor, bis er mit dem Kopf gegen etwas Hartes stiess. Das Gefühl in den Fingerkuppen bestätigte ihm, dass es der Tresen war. Raab robbte dahinter, erfühlte Stuhlbeine, einen Papierkorb, Stromkabel, aber keinen Körper. Von der Decke her hörte er ein lautes Krachen, die Hitze im Kraftraum nahm zu.
«Kemal!»
Ganz in der Nähe hörte Raab ein Stöhnen.
Er kroch um den Tresen herum, hielt auf das Geräusch zu und legte sich flach auf den Bauch. Die Fingerspitzen seiner linken Hand berührten Bartstoppeln. Kemal lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden.
«Halt durch!»
Raab robbte weiter vor, setzte sich auf, spürte noch mehr Hitze in Kopfhöhe. Seine Lungen drohten vom Rauch zu platzen. Er packte Kemal unter den Achselhöhlen, zerrte ihn halb auf sein rechtes Bein und robbte rückwärts in Richtung Tresen. Raab schob seinen Hintern Stück für Stück vor und schleppte Kemal nach. Möglichst flach am Boden kam er nur langsam vorwärts. Den Tresen oder die Mauer müsste er doch jetzt erreicht haben, verdammt. Raab legte sich ganz auf den Rücken und streckte die Arme über dem Kopf aus, spürte nichts. Scheisse! Er wagte kaum zu atmen in dem ätzenden Rauch, bald würde er das Bewusstsein verlieren. Wo war nur die beschissene Wand zur Strasse hin – links oder rechts?
Da hörte er Sirenen von links. Raab änderte die Richtung, zerrte Kemal hinter sich her, dessen Kopf über den Boden schrammte, zwei Meter, drei weiter, bis er mit dem Rücken gegen Ziegelsteine stiess.
Nur noch ein kurzes Stück! Er schleifte den schlaffen Körper wie wild weiter, bis er die Metalltür am Ellenbogen spürte. Raab drückte sie einen Spalt auf, spürte kühlere, atembare Luft im Gesicht. Grelle Lampen im Entrée blendeten ihn.
«Ich hab ihn», hörte er einen Mann schreien.
Der Feuerwehrmann wollte Raab am Arm rausziehen.
Doch der riss sich los. «Da ist noch einer!», krächzte er. Er kam hoch auf beide Beine, griff nach Kemal, packte ihn am Hemd und zerrte.
Der Feuerwehrmann packte an den Beinen mit an, und gemeinsam schleppten sie Kemal nach draussen.
Dort empfingen sie weitere Feuerwehrmänner, die den bewusstlosen Kemal übernahmen. Raab hockte sich hinter das Feuerwehrauto auf den Bordstein und schnaufte, die Luft in der Silbersteinstrasse war die herrlichste, die er jemals eingeatmet hatte.
Raab kam mit einer leichten Rauchvergiftung davon, Kemal lag zwei Wochen im Krankenhaus. Doch bereits einen Tag nach dem Brand hing ein Strauss Blumen an Raabs Klinke. Ein paar Tage später war es eine Schachtel Pralinen, die der Postbote brachte.
Als er Kemal im Spital besuchte und auf die Geschenke ansprach, zuckte dieser leicht verlegen mit den Schultern. «Meine Mutter», sagte er.
In den kommenden Wochen verwöhnte Kemals Mutter Raab regelmässig mit Selbstgekochtem. Und er erfuhr, dass die Eltern ein kleines Lebensmittelgeschäft an der Hermannstrasse führten. Als er sich dort eines Tages für die Leckereien bedankte, drückte ihn Mutter Irmak, eine schlaksige Frau mit pinkfarbenen Turnschuhen, an ihre Brust. Sie lud ihn gleich zum Essen in der Wohnung über dem Laden ein. So lernte Raab die Aydins kennen, Mutter Irmak, Vater Ersan und Sohn Kemal.
Die Herzlichkeit überrumpelte Raab. Traue niemandem! So hatte das Mantra seines Vaters gelautet. Der hatte ihm von klein auf eingetrichtert, Distanz zu Menschen zu wahren und Gefühle zu unterdrücken. Ein Kleinkrimineller war der Alte gewesen, mit Sozialhilfe und Gaunereien hatte er sich durchs Leben geschlagen. Seine Mutter kannte Raab nicht, sie war sieben Monate nach der Geburt auf dem Fahrrad von einem abbiegenden Lastwagen überfahren worden. Bis dahin hatte Raab Beziehungen betrachtet wie Haustiere: Kann man haben, muss man nicht.
Doch die Aydins liessen ihm keine Wahl. Irmak überhäufte ihn mit Köfte und Baklava, Ersan und Kemal schleppten ihn mit zu Fussballspielen von Union Berlin, es gab Einladungen zu Geburtstagsfeiern und Hochzeiten. Nach und nach gab Raab seinen Widerstand auf und wurde zu einem Mitglied der Familie Aydin.
Bis alles den Bach runterging.
4
Knapp zwei Stunden nach seinem Treffen mit Massoud spritzte sich Raab im Badezimmer kaltes Wasser ins Gesicht und wischte es mit einem Handtuch weg. Dann untersuchte er seine kurz geschnittenen, pechschwarzen Haare, in die sich immer mehr grau mischte. Mit den kühlen blauen Augen, dem markanten Kinn, der schmalen Nase und dem bräunlichen Teint sah er jünger aus als zweiundfünfzig. Das bekam er jedenfalls oft zu hören. Es mochte auch daran liegen, dass er seinen Körper gut in Schuss hielt. Hanteltraining gab ihm Kraft, regelmässiges Jogging sorgte für Ausdauer, Gymnastik für die Beweglichkeit. Bei einer Körpergrösse von eins sechsundsiebzig achtete Raab darauf, dass sein Gewicht nie auf siebzig Kilo stieg. Wendigkeit gehörte zum Einmaleins des Jobs.
Er betastete sein stoppeliges Kinn und beschloss, dass die Rasur für seinen Termin nicht nötig war. Im Flur schlüpfte Raab in seine schwarze Lederjacke, dann zog er die Türe seiner Drei-Zimmer-Wohnung an der Haltingerstrasse hinter sich zu. Kleinbasel bot ihm Ruhe und ein Quartier mit kleinen Geschäften und Cafés. Zudem hatte es den Vorteil, dass er zu Fuss in fünfzehn Minuten im Stadtzentrum oder am Badischen Bahnhof sein konnte.
Er schlenderte vorbei am Aziz Imbiss, über die Klybeck- und die Florastrasse gelangte er zur Flora-Buvette am Rhein. Dort kaufte er zwei Kaffees im Pappbecher. Auf einer Bank am Fluss nippte er an einem Becher und sah zu, wie die Klingental-Fähre langsam über das Wasser glitt. Gegenüber, am Ufer vor den Häusern am St. Johanns-Rheinweg, hatte das Feuerwehrschiff angelegt.
Raab stand auf und machte vor der Bank ein paar Schritte. Er verfluchte sich dafür, dass er Kemal und dessen Familie in Gefahr gebracht hatte. Doch wenn er Kemal vor der Überwachung durch den alten Massoud warnen würde, geriete der bestimmt in Panik. Seit sein Freund ins bayrische Bruckberg geflüchtet war, schlief er schlecht, schluckte Tabletten. In wenigen Tagen einen tauglichen Fluchtplan für eine Familie auszuhecken, war fast unmöglich. Also würde Raab Kemal vorerst in seiner vermeintlich sicheren Blase leben lassen.
«Ich hoffe, es ist dringend.» Pirmin Gutzwiler kam mit seinem gemeisselten Seniorengesicht unter vollem, schlohweissem Haar auf ihn zu. Er betrieb ein Antiquitätengeschäft auf der anderen Flussseite, das er als Auftraggeber für Einbrüche und als Hehler am Leben hielt. «Hab schliessen müssen.»
«Sei doch froh, wenn du mal aus der stickigen Bude kommst.» Gutzwiler öffnete den Mund zum Protest, doch Raab streckte ihm den zweiten Becher entgegen. «Mit Zucker, ohne Rahm.»
Gutzwiler nahm den Becher und liess sich mit einem Seufzer auf die Bank fallen. «Danke.»
«Wieso passt dein Angestellter nicht auf den Laden auf?»
«Ist krank.» Mit einer Hand malte Gutzwiler ein Anführungszeichen in die Luft. «Wieder mal. Diese jungen Leute …»
Raab setzte sich neben ihn. «Du klingst wie ein verbitterter Alter.»
«Bin ich das denn nicht?» Gutzwiler war siebenundsiebzig, er trug einen massgeschneiderten Anzug aus Leinen, der seinen Bauchansatz verbarg, und einen Panamahut auf dem Kopf. Er winkte ab. «Entschuldige die miese Laune. Das Traurige ist ja, dass ich mein Geschäft problemlos schliessen kann. Seit Montag hatte ich ganze drei Kunden. Und gekauft hat keiner etwas.» Er nahm einen Schluck und drehte das Gesicht für ein paar Sekunden der Sonne zu. «Ich wusste gar nicht, wie schön es heute ist.» Dann musterte er Raab. «Ich hätte da wieder einen Psychiater, in Bern. Sieht vielversprechend aus.»
Ab und zu brach Raab im Auftrag von Gutzwiler in die Praxis eines Psychiaters oder Psychologen ein. Dort klaute er die Dossiers von prominenten Patienten, die vorzugsweise Chefposten innehatten oder sonst wie in der Öffentlichkeit standen. Gutzwiler erpresste die Psychiater im Anschluss mit der Drohung, die Akten zu veröffentlichen. Praktisch jeder bezahlte eine hübsche Summe, zumeist zwanzig- bis vierzigtausend Franken, und bekam die Unterlagen zurück. Danach liess Gutzwiler nie mehr von sich hören. Erpresser würden erwischt, weil sie den Hals nicht vollkriegen könnten, pflegte er zu sagen. Raab kassierte jeweils einen Viertel des erpressten Geldes. «Suchst du Arbeit?»
Raab mochte die Jobs, weil sie einfach waren. «Zurzeit nicht, danke. Ich brauche deine Hilfe bei einer anderen Sache. Was weisst du über den Silberschatz von Kaiseraugst?»
Gutzwiler blies die Backen auf und stiess geräuschvoll Luft aus. «Der wurde 1961 bei irgendwelchen Bauarbeiten gefunden, glaube ich. Wochenlang erkannte niemand den Wert der Stücke, Spaziergänger liessen viele mitgehen. Es hat ein paar schöne Sachen darunter, sie sind im Römermuseum in Augst ausgestellt.»
«Richtig. Der Schatz besteht aus zweihundertsiebzig Teilen. Darunter gibt es wunderbar verzierte Platten, Teller, Becher, Löffel, Toilettengeschirr, Münzen, einen Kandelaber und ein paar Silberbarren. Alles in allem etwa sechzig Kilo schwer.»
Gutzwiler stiess einen Pfiff aus. «Ich wusste gar nicht, dass es so viel ist. Ist nicht später nochmals etwas aufgetaucht?»
«Doch, 1995. Über einen Anwalt gelangten weitere achtzehn Stücke ans Römermuseum, darunter vier grosse und zwei kleinere Platten. Die Bedingung war, dass der Spender anonym bleiben durfte. Die Archäologen liessen sich darauf ein. Trotzdem ist der Schatz noch immer nicht komplett. Das weiss man, weil die Stücke gestapelt in der Kiste lagen. Sie hinterliessen Abdrücke aufeinander.»
Gutzwilers braune Augen leuchteten auf vor Hehler-Glück. «Und du weisst, wo die sind.»
«Nein. Aber ich will es herausfinden. Du hast doch die Kontakte. Wurde in der Schweiz jemals so etwas angeboten oder verkauft?»
Gutzwiler kratzte sich am Kinn. «Nicht, dass ich wüsste. Mit den Stücken liesse sich gutes Geld verdienen. Wenn du willst, kann ich mich umhören. Unter einer Bedingung …» Er hielt einen Zeigefinger hoch. «Wenn du etwas beschaffen kannst, überlässt du es mir.»
«Sorry.» Raab schüttelte den Kopf. «Den Abnehmer habe ich bereits. Aber wenn du etwas herausfindest, wird es nicht dein Schaden sein.»
Die Furchen in Gutzwilers Gesicht vertieften sich, die Enttäuschung war ihm anzusehen. «Schade.» Er begann zu husten, ein tiefes kehliges Geräusch. Sein Leben lang war er ein starker Raucher gewesen. «Du weisst ja gar nicht, wie gut es dir geht.»
«Doch, doch, absolut.»
«Dann gebe ich dir einen Rat: Geniess es, so gut du kannst! Bedanke dich täglich bei Gott oder Allah oder dem Universum. Denn mit jedem guten Tag neigt sich deine Waage auf eine Seite. Je besser es dir geht, desto mehr gerät sie aus der Balance. Und irgendwann gleicht sich alles wieder aus.»
«Du bist ein echter Sonnenschein heute.»
«Ach …» Gutzwiler winkte ab und trank einen Schluck. «Es ist bloss … Ich lebte wie ein kleiner Prinz und wusste es nicht zu schätzen. Bis es dann mit der Gesundheit bachab ging. Hüfte, Lunge, Prostata, alles im Eimer. Halte nichts für selbstverständlich, das ist mein Rat.»
«Habe ich nie getan.» Raab hatte immer gewusst, dass seine Welt jederzeit aus den Fugen geraten konnte. Massoud stellte nur einen weiteren Beweis dafür dar.
Gutzwiler schwieg für eine Weile und schaute über den Fluss. «Weiss man, wann dieser Schatz vergraben wurde?»
«Das muss in der Mitte des vierten Jahrhunderts gewesen sein. Einige Stücke tragen Inschriften, eine Platte war ein Geschenk von Kaiser Constans. Der regierte von 337 bis 350. Vergraben hat das Silber vermutlich ein römischer Offizier, die Kiste lag an der Kastellmauer. Das Römische Reich löste sich damals auf, die Germanen drängten über den Rhein. Vielleicht wurde der Offizier abkommandiert, vielleicht starb er im Kampf. Sein Besitz blieb jedenfalls liegen.»
Gutzwiler nickte. «Ich werde ein paar Anrufe machen. Im Gegenzug will ich mir die Stücke aber wenigstens ansehen, falls du sie auftreiben kannst.»
«Abgemacht.»
In angenehmem Schweigen blieben sie noch ein paar Minuten in der Sonne sitzen. Doch Raab konnte den Augenblick nicht geniessen. Denn das Treffen hatte ihm nicht das gebracht, was er sich erhofft hatte. Er würde den Schatz auf einem anderen Weg aufspüren müssen. Und dafür seine Talente nutzen.
5
Am Donnerstagmorgen um halb elf stellte Raab seinen VW Golf in Augst auf dem Parkplatz beim Römermuseum ab. Bei bedecktem Himmel spazierte er die noch immer feuchte Giebenacherstrasse hoch. In der Nacht hatte es geregnet, der Wetterbericht sagte einen Mix aus Sonne und Niederschlägen voraus. Links der Strasse befand sich eine rekonstruierte römische Villa, in deren Anbau das Museum mit dem Silberschatz sowie die Verwaltung von Augusta Raurica untergebracht waren. Eine Schulklasse stand vor dem Eingang Schlange.
Rechts von Raab, rund hundert Meter vom Museum entfernt, lag das halbkreisförmige szenische Theater, in dem zur Römerzeit bis zu zehntausend Zuschauer Platz gefunden hatten. Ein junges Paar schoss Selfies davor. Raab folgte der Strasse, die um das Theater herumführte, schritt vorbei an den Überresten einer Taberna mit gut erhaltenem römischem Backofen und bekräftigte seinen Entschluss: Er würde Kemal nicht kontaktieren. Ihm fehlte die Zeit, einen tauglichen Fluchtplan für die Familie auszuhecken.
Er kam zum Forum, blieb aber auf der anderen Strassenseite vor einem neuzeitlichen Einfamilienhaus stehen. Dessen Besitzer wollte eine Garage errichten, was die Archäologen auf den Plan gerufen hatte. Sie gruben sich in die Tiefe, bevor die Bauarbeiten an die Hand genommen werden durften. Gitterzäune sperrten das Grundstück ab, im Garten hantierten unter Zeltdächern drei Männer und Claudia Dill, die Raab von Vorträgen kannte. Sie stand in einer rechteckigen Grube, die etwa vier mal fünf Meter mass, und kratzte mit einer Kelle sorgfältig Erde aus den Zwischenräumen einer Mauer. In der Grube daneben füllten die Kollegen Aushub in Schubkarren und brachten ihn beiseite.
Raab beobachtete sie, für Archäologie hatte er sich seit jeher interessiert. Die Ausgrabungen gaben Auskunft über das Leben und den Alltag von Menschen in der Vergangenheit. Das liess sich mit seinem Beruf vergleichen. Akribisch erkundete Raab das Umfeld von Leuten, bevor er in deren Wohnungen einstieg. Oft stellte er sich dabei Fragen, die nichts mit dem Einbruch zu tun hatten. Hatten sie Kinder, liebten sie ihren Job, was taten sie in der Freizeit? Trat Raab dann in Aktion, überprüfte er seine Mutmassungen und erlebte manchmal wunderbare Überraschungen. Wie bei der Pfarrerin, die ein Faible für Lack und Leder hatte. Oder beim Juraprofessor, der eine grosse Sammlung an Micky-Maus-Comics besass. Raab liebte solche Schnappschüsse aus dem Leben – wie die Archäologen auch.
Dill hob den Kopf und lächelte ihn an. Sie trug ein schwarzes Baumwollhemd, Jeans und Wanderschuhe. «Herr Keller, wollen Sie mal wieder mithelfen? Wir könnten noch zwei kräftige Hände brauchen.»
Nach zwei Jahren als Roman Keller fühlte sich der Tarnname ganz natürlich an. «Dafür habe ich leider keine Zeit. Ich wollte nur schnell gucken, wie weit Sie hier gekommen sind.»
Die vielleicht vierzigjährige Archäologin kletterte hoch und kam ans Gitter. Dill hatte das sonnengegerbte Gesicht von jemandem, der oft draussen arbeitete. Sie war schlank und gross wie eine Hochspringerin, die dunkelbraunen Haare hatte sie streng zurückgekämmt und zu einem Knoten gedreht. Mit ihrem Lächeln und ihrer freundlichen Art konnte sie Menschen für sich einnehmen. «Dafür fahren Sie die zehn Kilometer von Basel hierher?»
«Spontane Neugier.» Er hob die Schultern. «Ich bin unterwegs zu einer Besprechung, Augst liegt auf dem Weg.»
«Der mysteriöse Herr Keller.» Sie zeigte ihre schönen Zähne. «Wissen Sie eigentlich, dass einige von uns regelmässig Mutmassungen über Sie anstellen? Ich gehöre auch dazu, wie ich gestehen muss. Wir fragen uns, womit Sie eigentlich Ihr Geld verdienen, wo Sie doch tagsüber oft hier aushelfen. Einige meinen, Sie arbeiten als Nachtwächter in einem Kunstmuseum. Mein Favorit ist aber, dass Ihre Familie superreich ist und Sie nur Ihre Hobbys pflegen.»
«Leider muss ich Sie enttäuschen, die Wahrheit ist ganz banal. Ich bin selbstständig, berate Firmen oder Hausbesitzer in Sicherheitsfragen. Deswegen kann ich mir meine Zeit selber einteilen.» Für diese Fassade hatte Raab Visitenkarten gedruckt und eine Webseite eingerichtet, ab und zu nahm er sogar Aufträge an.
«Soso, Sicherheitsexperte.» Sie strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. «Und was tun Sie so in der Freizeit? Gehen Sie auch mal ins Kino oder ein Konzert?»
«Nicht sehr oft. Ich bin eher der Bücherwurm und mag mein Zuhause.» Mit dem Kinn deutete er auf die Gruben. «Sind Sie auf etwas Interessantes gestossen?»
Sie zeigte mit dem Daumen über ihre Schulter. «Hier lagen die Frauenthermen. Das wussten wir schon von Ausgrabungen auf benachbarten Grundstücken.» Dill wies auf die Grube, aus der sie gestiegen war. «Das war eine Piscina, ein grosses Badebecken. Und das daneben muss ein Frigidarium gewesen sein, ein Becken mit kaltem Wasser.»
«Scheint alles gut erhalten.» Er richtete den Finger auf eine hellbraune Verfärbung, die quer durch die Erde verlief. «Das könnten Heizungsrohre gewesen sein.»
«Richtig. Und schauen Sie sich die Wand auf der anderen Seite an, der Mörtel wäre auch heute noch wasserdicht. Leider sind keine Bodenfliesen erhalten geblieben. Die müssen schon vor Jahrhunderten geplündert worden sein.»
«Haben Sie schon die Abflüsse überprüft?»
«Ah, der Experte spricht.» Dill hob einen Mundwinkel, ein silberner Stecker glänzte im Flügel ihrer schmalen Nase. «Haarnadeln, Reste von Parfümfläschchen, Knöpfe. Und das hier …» Sie griff in ihre Hosentasche und zog ein Plastiksäckchen heraus. Darin steckte ein kleiner eckiger Gegenstand. «Ein Spielwürfel.»
«Hübsch. Ich hoffe, Sie finden noch mehr.» Er kratzte sich am Kopf. «Was ich Sie fragen wollte. Ich beschäftige mich gerade etwas eingehender mit dem Silberschatz aus dem Museum. Wie er gefunden wurde, liest sich wie ein Krimi. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Lebt noch jemand, der damals mit dabei war?»
Dill runzelte die Stirn. «Ein paar alte Forscher gibt es schon noch. Professor Iselin vermutlich, der war lange Zeit der Chef hier. Er kommt ab und zu vorbei und erzählt Geschichten von früher. Ich schätze, der ist um die achtzig. Er ist nicht mehr gut zu Fuss, aber das Hirn ist noch picobello.» Sie tippte sich an die Stirn. «Der wäre bestimmt eine gute Anlaufstelle. Er wohnt in Basel, Sie können ihm gerne einen Gruss von mir ausrichten.»
«Vielen Dank, das werde ich tun. Also dann …» Er wollte sich abwenden.
«Haben Sie vom Skelett gehört?»
Er horchte auf. «Schon wieder eines?»
«Nein, nein, ich meine das, das Sie ausgegraben haben. Das sorgt für ganz schönen Wirbel, ständig fragen Leute danach.» Sie trat näher zum Zaun und senkte die Stimme. «Die Polizei hat uns eingeschärft, dass wir nicht darüber reden sollen. Das müssen Sie also für sich behalten.»
Raab zwinkerte ihr einfach zu.
«Die Pathologen sagen, dass es eine Frau ist. Sie muss jung gewesen sein bei ihrem Tod, höchstens zwanzig Jahre alt. Die Analyse zeigt, dass sie mehr als fünfzig, aber weniger als siebzig Jahre in der Erde lag.»
«Weiss man, wie sie gestorben ist?»
«Keine Ahnung.» Dill verschränkte die Arme vor der Brust und starrte ins Leere. «Mein Gott, sie war so jung. Weshalb hat man sie bloss hier verscharrt?
«Die Polizei weiss nichts?»
«Zumindest sagt sie nichts. Sie gleicht den Zahnabdruck und die DNA mit ungelösten Kriminalfällen aus den 50er- und 60er-Jahren ab. Wer weiss, vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang mit dem Silberschatz.»
Ein interessanter Gedanke. «Ob damals jemand von hier verschwunden ist? Jemand, der zum Beispiel im Römermuseum arbeitete?»
«Sie meinen, dass die Frau …» Ihr Mund formte ein stummes O. «Vielleicht weiss Professor Iselin etwas.»
Raab nickte. «Falls ich ihn treffe, werde ich ihn danach fragen.»
«Und dann geben Sie mir Bescheid, ja?» Sie hob die Augenbrauen. «Wir könnten das ja bei einem Abendessen besprechen.»
«Das liesse sich bestimmt machen.» Er lächelte und winkte zum Abschied. «Ich melde mich.»
6
Das zweistöckige Haus lag ein Stück zurückversetzt von der Strasse, der Hof war mit Kopfsteinpflaster bedeckt und von einer dicken Mauer umgeben. Über dem Eingang stand das Baujahr: 1566.
Raab checkte den Sitz der Jacke und der Polster darunter. Er konnte nicht ausschliessen, dass er Lorenz Iselin schon über den Weg gelaufen war. Oder dass der sein Foto in der Zeitung gesehen hatte. Deswegen hatte Raab sein Gesicht mithilfe von Schminke und Hautkleber älter und pummeliger gestaltet. Eine braune Perücke sowie eine randlose Brille machten ihn zu einem übergewichtigen, abgespannten Mann über sechzig. Er hob den goldenen Löwenkopf-Türklopfer und liess ihn auf das dunkelbraune Holz prallen. Ein dumpfer Knall hallte durch die Basler St. Alban-Vorstadt.
Es dauerte gefühlte zwei Minuten, bis die Türe geöffnet wurde. Die Frau vor Raab war Mitte fünfzig und auf eine künstliche Art attraktiv: modisch geschnittenes Haar mit blonden Strähnen, operativ gestraffte Haut, studio-gleichmässige Bräune. Ihr dunkelblaues Kostüm passte perfekt und betonte ihre schlanke Figur.
«Ich bin …»
«Sein Termin für vierzehn Uhr.»
Dabei wandte sich die Frau ab und stieg im Entrée links eine knarrende Treppe hoch. Mit der rechten Hand wedelte sie über das Geländer in Richtung Flurende. «Dort hinten.»
Raab ging an einem gusseisernen Schirmständer und einer handbemalten Kommode vorbei, warf noch einen routinemässigen Blick auf das Display der Alarmanlage und gelangte in ein geräumiges Wohnzimmer mit Steinboden und Balkendecke. Es war vollgestopft mit antiken französischen Möbeln, achtzehntes Jahrhundert, schätzte Raab.
Auf einem dreisitzigen, roten Canapé mit weissem Blumenmuster lag ein Mann im blauen Trainingsanzug, dessen Rücken zwei dicke Kissen stützten. Auf einem kleinen Tischchen vor ihm stand eine leere Tasse, daneben lag eine NZZ.
«Hat Carla Sie reingelassen?», fragte Professor Iselin. Mit den schlaffen Backen, dem hängenden Mund und den tiefen Krähenfüssen um die Augen wirkte sein Gesicht auf fast komische Weise schwermütig. Die Jacke spannte sich über seinem Bauch, an den Füssen trug er Sandalen mit Klettverschlüssen über schwarzen Wollsocken. Er musste über achtzig sein.
«Ja. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen.»
Er schüttelte den Kopf. «Hat nicht viel geredet, was?»
«Nein.»
«Ich sollte sie nach Worten bezahlen.»
«Ihre Haushälterin?» Raab stand noch immer vor dem Couchtisch herum.
«Meine Frau.» Iselin zog die Augen zusammen, als ob er eine neue Brille ausprobiere. «Kenne ich Sie von früher?»
«Nein, ich habe am Vormittag angerufen und–»
Er winkte ab. «Ich bin nicht senil. Aber Sie könnten ja bei mir studiert haben.»
«Habe ich nicht, nein.»
«Setzen Sie sich, sonst bekomme ich einen steifen Hals.» Er deutete auf den Stuhl vor dem Tischchen. «Für den Spiegel arbeiten Sie also.»
«Richtig.» Raab fischte ein Visitenkärtchen aus seinem Portemonnaie, auf das er das Spiegel-Logo, Thomas Jannsen, Redakteur, und die Anschrift in Hamburg gedruckt hatte. Der Name stammte aus dem Impressum der Zeitschrift. «Für Spiegel Geschichte.»
Iselin inspizierte das Visitenkärtchen. «Sie publizierten doch vor ein paar Jahren schon mal ein Heft über das Alte Rom.»
Mist. «Das war vor meiner Zeit. In der Ausgabe, die wir jetzt planen, wollen wir das Leben in den römischen Provinzen ins Zentrum stellen.»
Iselin schien Sehprobleme zu haben, sein linkes Auge zielte über Raabs Schulter. «Ein bisschen seicht für meinen Geschmack, Ihr Heft. Aber Sie müssen ja Geld verdienen.»
«Da kann ich Ihnen nicht widersprechen. Jedenfalls will ich einen grösseren Text über Augusta Raurica schreiben. Deswegen habe ich heute ein paar Gespräche im Museum geführt. Und dabei tauchte Ihr Name auf. Weil ich am Abend bereits wieder nach Hamburg fliege, kam meine Anfrage so kurzfristig. Danke nochmals.» Das fokuslose Auge irritierte Raab. Er verspürte den Drang, sich umzudrehen.
Iselin grunzte. «Es ist ja nicht so, dass ich einen vollen Terminkalender hätte.» Er richtete sich leicht auf. «Also, was wollen Sie wissen?»
«Ab wann haben Sie sich für die Römerstadt engagiert?»
«1953. Zwanzig war ich damals, ein Jungspund, und begann mein Studium hier an der Uni. Bei Professor Laur-Belart, dem führenden Schweizer Archäologen zu der Zeit. Er leitete das Institut für Ur- und Frühgeschichte. Das Grabungsgelände in Augst war damals noch eine Stiftung und auf Gönner angewiesen. Doch damit waren wir total überfordert, das Gelände ist ja riesig. Zum Glück übernahm später der Kanton Baselland, 1975 war das.»
Jetzt guckte Iselin mit beiden Augen knapp über Raabs Schulter. Der gab dem Drang nach und drehte sich um.
Frau Iselin lehnte sich mit verschränkten Armen gegen den Türrahmen. «Ich gehe ins Wellness.»
Iselin schnaubte. «Was für eine Überraschung.»
Sie begutachtete ihren Nagellack. «Brauchst du etwas?»
«Ein Schinkensandwich vom Sutter Begg.»
Sie stiess sich vom Türrahmen ab und wandte sich zum Gehen. «Sorry, der liegt nicht auf meinem Weg.»
«Was soll denn das heissen? Den gibt es überall in der Stadt.»
«Ich fahre aber nicht in die Stadt. Ich will ins Sole Uno nach Rheinfelden.»
Iselins Kopf nahm eine ungesunde Röte an. «Wieso fragst du mich denn überhaupt, verflucht nochmal?»
Die Pumps seiner Frau klapperten auf den Fliesen, Sekunden später fiel die Haustüre krachend ins Schloss.
Iselins Hände zitterten, er atmete ein paar Mal tief durch. «Sind Sie verheiratet?»
«Nein.»
«Gut für Sie. Sie wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem sie mich verscharren kann. Doch den Gefallen tue ich ihr nicht, noch lange nicht. Nur schon aus Trotz werde ich hundert Jahre alt …»
Raab nickte stumm. So fühlte sich also die Ehe-Hölle an. «Im Museum habe ich einiges über den Fund von 1961 erfahren, den Silberschatz. Ein interessanter Aspekt, den wir im Heft beleuchten möchten. Wie war das 1995, als ein zweiter Teil als Schenkung zum Vorschein kam?»
Mit der flachen Hand glättete Iselin die schütteren weissen Haare. «Eine grosse Überraschung. Ich bekam einen Anruf von Dr. Pfister, einem Basler Anwalt. Ich kannte den Mann nicht. Er erzählte, dass jemand uns achtzehn Gefässe aus einer Erbschaft überlassen möchte. Aber nur, wenn der Besitzer anonym bleiben könne. Wir überprüften einige der Stücke, sie gehörten zweifellos zum Silberschatz. Also gingen wir darauf ein.»
Endlich eine Spur. Ob dieser Anwalt noch am Leben war? «Und Sie wissen bis heute nicht, wer der Stifter war?»
«Das war mir egal. Zudem hoffte ich natürlich, dass es Nachahmer gäbe. Es fehlt ja immer noch einiges. Leider hat sich später niemand mehr gemeldet.»
«Haben Sie eine Vermutung, wo der Rest sein könnte?»
«Nein. 1961 konnte sich ja jeder bedienen, der am Bauplatz vorbeikam. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.»
«Bestimmt haben Sie vom Skelett gehört, das vor zwei Wochen bei einer Schülergrabung gefunden wurde.»
Iselin nickte.
«Offenbar stammt es von einer Frau, die in den Fünfziger- oder Sechzigerjahren gestorben ist. Wissen Sie, wer das sein könnte?»
Er zog die Augenbrauen zusammen. «Was hat denn das mit Ihrem Artikel zu tun?»
«Es wäre ein interessanter Nebenaspekt. Ist damals jemand in Augusta Raurica verschwunden, den Sie kannten?»
Iselin griff nach dem Visitenkärtchen auf dem Tisch. «Sie arbeiten wirklich für den Spiegel? Oder suchen Sie bloss Skandalgeschichten für ein Schmierblatt?»
«Sie können sich gerne in Hamburg nach mir erkundigen.»
Iselin hielt das Kärtchen dicht vor seine Augen. «Das werde ich. Gleich jetzt.» Er fischte ein Mobiltelefon aus seiner Jackentasche.
Raab machte sich keine Sorgen. Denn Iselin würde bei einer Computerstimme landen, die ihn zum Warten auf den nächsten freien Spiegel-Mitarbeiter aufforderte – endlos. Doch er begriff, dass hier nichts mehr zu holen war. «Ich muss jetzt leider gehen, sonst verpasse ich meinen Flug. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.» Er erhob sich. «Auf Wiedersehen.»
Mit dem Handy am Ohr verfolgte ihn Iselin mit finsterem Blick.
Beim Hinausgehen checkte Raab noch mit dem Blick das Esszimmer rechts, wo eine vermutlich echte Giacometti-Statue stand. Danach liess er die schwere Türe hinter sich ins Schloss fallen.
Auf dem Weg zur Tramhaltestelle überdachte er das Gespräch. Wenigstens einen Namen hatte es ihm eingebracht, Dr. Pfister. Und die Erkenntnis, dass die Frage nach dem Skelett Iselin gar nicht geschmeckt hatte. Was wohl der Grund dafür gewesen war?
7
Ganz in Schwarz gekleidet und mit Turnschuhen an den Füssen schritt Raab auf das Reihenhaus in der Basler St. Johanns-Vorstadt zu. Um zwei Uhr nachts war keine Menschenseele unterwegs. Die wichtigste Regel für Einbrecher lautete: Lass dich nicht erwischen! Bisher war dies Raab gelungen, indem er eine zweite Regel strikt befolgte: Sei schnell!
Er setzte den Timer seiner Armbanduhr auf zwanzig Minuten und drückte den Startknopf. Nach Ablauf der Zeit würde sie vibrieren und ihm das Signal geben, sich vom Acker zu machen. Zum Glück lag der Eingang ein wenig zurückversetzt von der Strasse und bot guten Sichtschutz.
Vor dem Eindunkeln war Raab schon mal vorbeispaziert und hatte die Lage gecheckt. Ein einfaches Zylinderschloss sicherte die Haustüre. So etwas könnte er mit geschlossenen Augen knacken. Mit dünnen Latex-Handschuhen an den Händen griff er nach der Bauchtasche unter seinem Pullover, öffnete den Reissverschluss und fischte ein kleines Lederetui heraus. Im Innern befand sich sein Arbeitswerkzeug: kleine schwarze Metall-Dietriche, die mit Elastikbändern über den Griffen am Etui befestigt waren. Er nahm den Spanner heraus, einen dünnen Stift in L-Form. Dann griff er nach dem Haken, dessen Ende leicht gebogen war. Raab schob das kurze Ende des Spanners ins Schloss und drehte das lange Ende im Uhrzeigersinn. So setzte er den Zylinder unter Druck. Mit der anderen Hand steckte Raab den Haken in den Zylinder, erspürte aus jahrelanger Erfahrung die Sicherungsstifte des Schlosses und drückte sie sanft hinunter, einen nach dem anderen. Plötzlich bewegte sich der Spanner und die Türe war offen. Die Aktion hatte keine dreissig Sekunden gedauert.
Er betrat den Flur, ein Verzeichnis der Mieter an der Wand wies ihm den Weg: Anwaltskanzlei Dr. Pfister, 2. Stock
Bevor er auf die Treppe zusteuerte, schloss er die Augen, atmete durch den Mund und lauschte. Du musst ein Gespür für das Gebäude bekommen, hatte ihm sein Mentor René eingetrichtert.
Nachdem Raab die obligatorische Schulzeit beendet hatte, war er in keine Lehre gegangen – oder zumindest war es nicht das gewesen, was man üblicherweise darunter verstand. Sein Vater bildete ihn aus. Von ihm lernte Raab unter anderem, wie man Menschen ausspionierte und geheime Zeichen – Gaunerzinken – an deren Häusern hinterliess. Doch damit erschöpfte sich Vaters Wissen weitgehend. Deswegen brachte er Raab mit Kumpeln zusammen, jeder ein Experte auf seinem Gebiet. Von Gusti lernte Raab, wie man Pistolen und Gewehre pflegte, lud und abfeuerte. Alex, ein ehemaliger Basler Kantonalmeister im Karate, zeigte ihm Tricks für Zweikämpfe. Die schöne Leonie, in die der Siebzehnjährige schrecklich verliebt gewesen war, lehrte ihn, wie man Menschen ablenkte und ihnen das Portemonnaie aus der Tasche zog. Doch der Mann, der schliesslich Raabs Pfad bestimmte, hiess René Niggli. Der hatte eine richtige Obsession für Schlösser entwickelt. René, gedrungen, mit Hasenscharte und einem messerscharfen Verstand, war ein sehr fordernder Lehrmeister. Er brachte Raab alles über Schlösser und einiges über Tresore bei. Und er war es gewesen, der dem Jungen mit den kohlrabenschwarzen Haaren und der schnellen Auffassungsgabe den Spitznamen Raab verpasst hatte.
Eine gute Minute richtete Raab sein Gehör auf die Geräusche im Gebäude. Irgendwo summte eine Stromquelle, in der Ferne grölte ein Mann auf der Gasse – nichts Ungewöhnliches für ein nächtliches Haus. Licht der Strassenlampen aus der St. Johanns-Vorstadt erhellte das Rauchglas der Eingangstür und gab dem Treppenhaus einen kühlen, leicht rötlichen Farbton. Geradeaus führte die Treppe nach oben, links davon ging es hinunter in den Keller, rechts verlief der Aufzugschacht. Den Boden bedeckten grauweisse Fliesen, LED-Spots waren in die Decke eingelassen. Hinter einer blau gestrichenen Türe links befand sich ein Grafikbüro. Das Schloss wäre leicht zu knacken, dort bot sich ein möglicher Fluchtweg über ein Fenster in die St. Johanns-Vorstadt. Und auf der Rückseite des Gebäudes käme er über das Vordach einer Garage ebenfalls hinaus, hatte Raab auf seinem Spaziergang am Rheinweg entdeckt.
Das gehörte zu einer ordentlichen Vorbereitung, wie ihm René vor langer Zeit beigebracht hatte. Raab erkundete das Objekt, die Sicherungseinrichtungen und die Bewohner. In Aktion trat er erst, wenn sein Gefühl stimmte. Doch diesmal musste alles schnell gehen, viel zu schnell. Und Raab verstiess gegen eine weitere von Renés goldenen Regeln: Scheiss nicht vor deine eigene Haustüre! Bisher hatte sich Raab daran gehalten und keine Brüche in Basel gemacht. Doch nur hier in der Anwaltskanzlei würde er den Namen des anonymen Schatzspenders in Erfahrung bringen können, wenn überhaupt.
Raab stieg die Treppe hoch und begutachtete im ersten Stock kurz den Eingang einer Immobilienfirma. Hier hatte jemand Geld investiert, das Schloss hatte vier Reihen Stahlverbinder und eine Gehäusearmierung mit Sicherheitsstiften. Das wäre eine Herkulesaufgabe. Die Anwaltskanzlei einen Stock höher lag hinter einer selbstschliessenden Glastür mit Rillenschliff. Raab atmete auf, als er das Schloss betrachtete: ein Zylinder wie an der Haustüre, ein Kinderspiel. Nach weniger als einer Minute schob er die Türe am Knauf auf. Sie machte ein fegendes Geräusch, als sie über den Teppich im Gang strich.