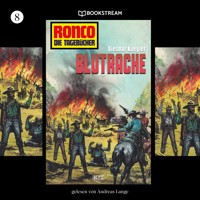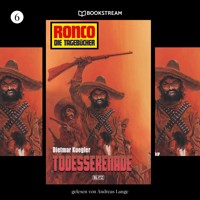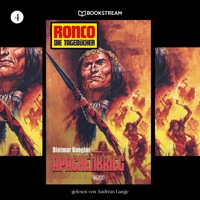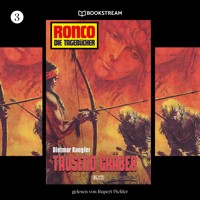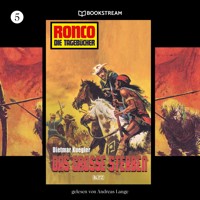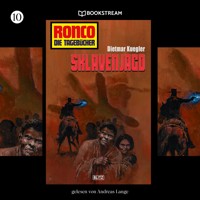3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)
- Sprache: Deutsch
Dumpfer Hufschlag. Das Trommeln eines monotonen Todesmarsches.Zum ersten Mal ritt ich in einem richtigen Angriff der Apachen mit. Ich stieß lautes Kriegsgeschrei aus, wie die Krieger neben mir. Ich war ein Apache. Ich kämpfte für mein Land. Für meine Freiheit. Für unsere Art zu leben.Plötzlich traf mich eine Kugel und riss mich aus dem Sattel. Ich stürzte zu Boden.Das Tagebuch eines Mannes, für den Blut, Leid und Verzweiflung zum Alltag geworden waren.Dieser Band enthält die folgenden Romane:Roter Bruder, toter Bruder (7)Blitzender Tod (8)Die Texte wurden vom Autor überarbeitet.Die Printausgabe umfasst 246 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt
2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache
2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber
2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg
2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben
2706 Dietmar Kuegler Todesserenade
Dietmar Kuegler
Apachenkrieg
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2019 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-153-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Roter Bruder, toter Bruder
2. November 1878.
Ich befinde mich wieder einmal in Gefangenschaft. Diesmal nicht in einem schmutzigen Gefängnis, sondern in einem Kriegslager der Apachen. Ich habe die Freiheit, mich im Camp zu bewegen, solange ich keinen Fluchtversuch unternehme. So kann ich ungehindert weiter an meinem Tagebuch schreiben.
Wenn ich mich umschaue, fühle ich mich in meine Kinderzeit und frühe Jugend zurückversetzt.
Bei den Apachen hat sich nicht viel verändert. Noch immer sind sie Verbannte, noch immer müssen sie kämpfen, um zu leben.
Aus der Wüste streicht ein heißer Wind heran. Hier und da flackern Kochfeuer. Ich denke an die Zeit, als ich bei den Indianern lebte, als ich selbst ein Apache war, ein weißer Apache ...
1.
Die dünne Rauchsäule war in der hitzeflimmernden Luft kaum wahrzunehmen. Es herrschte fast völlige Windstille. Unter den Hufen unserer Pferde hob sich der feinkörnige Sand der Wüste bei jeder Bewegung. Er ballte sich zu feinen gelben Wölkchen, die fast steigbügelhoch über dem Boden schwebten und sich nur zögernd wieder senkten.
Wir waren sieben. Alles Apachen. Dass meine Haut heller war als die der anderen, hatte ich längst vergessen.
Schnelltöter führte uns an. Er war noch jung, aber seine Erfahrungen waren groß. Als er jetzt den Kopf wandte und uns anschaute, schimmerte die gezackte Narbe auf seiner linken Wange im grellen Sonnenlicht fast schwarz. Er redete nie mehr als unbedingt nötig. Auch diesmal sagte er kein Wort, wir wussten auch so, was wir zu tun hatten.
Ich zog mein Pferd herum. Es war ein narbiges, hageres Armeepferd, das ich ritt, seit ich Shita im Kampf verloren hatte. Ich hatte dem braunen Hengst nicht zu viel zugetraut, hatte jedoch inzwischen feststellen können, dass er an Zähigkeit den kleinen, stämmigen Apachenponys nicht nachstand und sich gut mit dem Wüstenklima abgefunden hatte. Außerdem war er willig und bereitete mir keine Schwierigkeiten. Ich war zufrieden mit ihm und begann, mich mit ihm anzufreunden, obwohl mir noch kein Name für ihn eingefallen war.
Ich ritt eine flache Düne hinauf, während auch die anderen Krieger ausschwärmten. Vor mir hatte ich quer über den Knien meinen kurzen Spencer-Karabiner liegen. Die Metallteile mit der fleckigen Brünierung waren heiß von der Sonnenbestrahlung. Der zerkratzte Holzschaft aus dunklem Nussbaum mit dem Armeestempel schimmerte matt.
Ich nahm das Gewehr fest in die Rechte. Mit der linken Hand hielt ich den Zügel und dirigierte den Hengst.
Auf meiner rechten Schulter drückte der schwere Patronengurt, den ich schräg um den Oberkörper geschnallt hatte. Schweiß rann mir über das Gesicht und über meine Brust und wurde vom Stoff meines Kalikohemdes aufgesogen.
Wir folgten der Spur des Rauches. Als vor uns eine breite Furche auftauchte, konnten wir den Rauch riechen. Dann fanden wir das Camp.
Es lag tief in der Bodenfurche, im Schatten einer überhängenden Sandsteinklippe. Wäre das Feuer nicht gewesen, hätten wir es gar nicht entdeckt.
Das Feuer war aus vertrockneten Zweigen abgestorbener Yuccapflanzen angefacht worden, die fast rauchlos abbrannten. Ein verbeulter, rußiger Kessel hing an einem Dreibein über den Flammen.
Ein Stück abseits standen die Pferde, und am Feuer saßen vier weiße Männer.
Sie fühlten sich sehr sicher. Sie sprachen, lachten ab und zu und tranken Kaffee aus Blechbechern. Sie redeten von Whisky aus Kentucky, von feinem Tabak aus Tennessee und von Frauen aus Texas, die Pfeffer im Hintern hätten und einige andere Vorzüge.
Ich betrachtete ihre Pferde und wusste, was für Männer wir vor uns hatten.
An den Sätteln hingen lange Skalpzöpfe, und an einigen Hautfetzen war das Blut noch nicht einmal eingetrocknet.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Bodenfurche sah ich Schnelltöter auftauchen. Er hielt seinen Bogen in der Rechten und legte einen Pfeil auf die Sehne.
Ich glitt aus dem Sattel und lief geduckt den Hang hinauf. Auf der Klippe über der Bodenfurche blieb ich stehen, den durchgeladenen Karabiner in den Fäusten.
Da sah ich auch die anderen Krieger. Wir hatten das Lager umzingelt – lautlos und schnell. Die weißen Männer hatten nichts bemerkt, und sie hatten keine Chance mehr.
Sie hatten Apachen der Skalpprämien wegen getötet. Das Risiko eines solchen Jobs war groß. Das wussten sie selbst. Wir hatten keinen Grund, gnädig mit ihnen zu verfahren.
Schnelltöter hob den Bogen. Da wusste ich, dass es nun so weit war. Ich fühlte eine leichte Nervenanspannung – wie immer vor einem Kampf.
Aber ich war nicht sonderlich beunruhigt. Angst kannte ich in solchen Situationen nicht.
In diesem Moment schnellte der Pfeil von Schnelltöters Bogen. Er bohrte sich in den Rücken eines der Männer. Der Kerl zuckte hoch, verharrte in halb aufgerichteter Stellung und kippte gurgelnd nach vorn. Er fiel mit dem Gesicht ins Feuer.
Die Flammen schlugen sofort hoch. Das halblange, dunkelbraune Haar des Mannes brannte ab. Binnen weniger Sekunden war sein ganzer Schädel schwarz. Das war das Letzte, was ich in diesem Moment von ihm wahrnahm, dann hob ich mein Gewehr an die Schulter.
Die drei Kumpane des Toten sprangen vom Feuer auf und rissen ihre Revolver aus den Holstern.
Ich feuerte, ohne lange nachzudenken, instinktiv, fast automatisch. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Die Männer unter mir hatten Apachen abgeschlachtet. Männer, Frauen und Kinder. Ich war ein Apache, und die Killer waren meine Feinde.
Ich traf den Mörder rechts von dem Toten in die Seite.
Der Mann brüllte laut und taumelte. Sein Hemd färbte sich dunkel, und Blut rann ihm über den Hosengurt an den Beinen hinunter. Er sank in die Knie und feuerte auf die Krieger, die in die Senke sprengten.
Seine beiden unverletzten Kumpane warfen sich verzweifelt hinter einigen Steinbrocken in Deckung.
Der Verletzte kroch auf allen vieren durch den Sand und schrie dabei wie irre. Schnelltöter ritt direkt auf ihn zu und schwang seinen Schädelbrecher. Der Verwundete schoss und tötete Schnelltöters Pferd. Schnelltöter wurde zu Boden geschleudert, richtete sich benommen auf und blickte direkt in die Mündung des Revolvers, den der verletzte Killer auf ihn richtete. Doch als er abdrückte, klickte es nur. Die Waffe war leergeschossen, und Schnelltöter schleuderte seinen Schädelbrecher nach vorn.
Ich zwang mich, den Blick abzuwenden, um nicht sehen zu müssen, wie der Mann starb.
Die anderen Mörder feuerten nun auch. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Sandbiber, ein dreißigjähriger Krieger, vom Rücken seines Pferdes gerissen wurde. Sein Oberkörper war nackt, und das Blut strömte aus einer großen Wunde in der Brust wie aus einem Schlauch. Er war tot, noch bevor er hart im Sand aufschlug. Da feuerte ich zum zweiten Mal.
Mit hässlichem Laut schrammte meine Kugel über einen Stein, hinterließ eine tiefe Furche und streifte einen der Skalpjäger seitlich am Schädel. Der Mann sackte flach in den Sand und bewegte sich nur noch schwach.
Ich ließ meinen Spencer sinken. Es war vorbei.
Der letzte Mann warf seine Waffe weg und wich vor der Lanze Tulanas bis an einen hohen Felsquader zurück. Hier blieb er stehen, am ganzen Körper zitternd.
Die Hitze schien sich in diesem Moment noch zu verstärken. Dichte Pulverdampfschwaden hingen über der Bodenfalte. Es stank nach verbranntem Menschenfleisch und Blut, das in der Hitze rasch zu einer Kruste gerann.
Der Bandit, der als Erster gestorben war, brannte wie eine Fackel. Seine Kleidung hatte Feuer gefangen. Niemand kümmerte sich um ihn, niemand bemühte sich, die Flammen zu löschen.
Die Pferde scheuten vor dem Gestank, der sich in der glühenden Luft noch verstärkte. Ich ritt hinunter in die Bodenfalte, als Chikula den Mann hochriss, den meine Kugel am Kopf verletzt hatte.
Er taumelte benommen und wimmerte leise. Seine linke Kopfseite war voller Blut.
Schnelltöter trat auf die beiden Weißen zu. Er war fast einen Kopf kleiner als sie, aber ihre Gesichter verzerrten sich, als sie in seine Augen schauten. Sie hatten Angst.
Schnelltöter zeigt auf die Pferde der Killer und auf die Skalps, die an den Sätteln baumelten.
„Wir haben doch die Skalpprämien nicht erfunden!“, schrie einer der Männer. „Wir haben die Gesetze nicht gemacht. Wir halten uns nur daran.“
Schnelltöter lachte. Er drehte sich zu uns um.
„Bringt sie weg“, sagte er in der kehlig klingenden Apachensprache.
Ich zog mein Pferd herum, während Tulana und Chikula die beiden weißen Killer aus der Bodenfalte trieben. Sie stolperten durch den knöcheltiefen Sand und stürzten häufig. Sie taumelten vor den Kriegern her und hielten nicht an. Sie rannten, als hofften sie, auf diese Weise ihr Leben zu retten.
„Ronco!“
Ich hörte Schnelltöters Stimme und wandte mich um.
„Nimm die Pferde“, sagte er. „Und die Waffen.“ Er lächelte etwas. „Gute Beute“, sagte er.
Ich nickte und stieg ab. Schnelltöter schwang sich auf das Pony des getöteten Sandbiber und ritt hinter den anderen Kriegern her, die die beiden Gefangenen auf eine Gruppe Saguaro-Kakteen zu jagten.
Ich nahm ein geflochtenes Lederlasso, ging zu den Pferden der Skalpjäger und befestigte ihre Zügel daran. Sie sträubten sich erst, mir zu folgen, aber ich zwang sie, stieg wieder in den Sattel meines Braunen und zerrte sie hinter mir her.
Wind kam auf, als ich aus der Bodenfalte ritt. Er war glühend und schien aus einem Backofen zu wehen, aber er vertrieb den Gestank von verbranntem Menschenfleisch. Feiner Sand wirbelte mir entgegen und setzte sich in dem dünnen Schweißfilm auf meinem Gesicht fest.
Als ich die Kakteengruppe erreichte, waren die beiden Skalpjäger nackt. Sie schrien und schlugen um sich.
Ich zügelte die Pferde und stieg ab. Da riss sich einer der beiden Männer los. Er rannte direkt auf mich zu und brüllte dabei. In seinem Gesicht war nichts Menschliches mehr zu entdecken.
Ich erschrak nicht einmal. Einen Sekundenbruchteil lang dachte ich daran, zur Seite zu treten, um ihn vorbeilaufen zu lassen. Dann aber dachte ich an die Apachen, die er ermordet hatte, deren Skalps am Sattel seines Pferdes hingen. Ich dachte daran, was mit mir geschehen würde: Ich wäre bei den Apachen erledigt gewesen, und der Mann hätte doch nichts davon gehabt. Er wäre ohnedies nicht weit gekommen.
Das alles schoss mir durch den Kopf, während er auf mich zuraste, ohne mich wirklich zu sehen.
Als er heran war, hob ich meinen Spencer-Karabiner und schlug zu. Ich war groß für mein Alter und sehr kräftig. Ich war zwölf Jahre alt, doch ich sah aus wie fünfzehn. Mein Schlag traf den Mörder in den Leib. Er schwankte, krümmte sich zusammen und kreischte, während seine Augen fast aus den Höhlen quollen. Ich presste die Lippen fest zusammen und schlug noch einmal zu.
Da stürzte er vor meinen Füßen in den Sand und wand sich wie ein Fisch. Büffelmann, mein erster Pflegevater bei den Chiricahuas, war ihm gefolgt. Er bückte sich, packte den Mann an den Schultern und riss ihn hoch. Er schleifte ihn zurück zu dem anderen, der apathisch dastand und nicht mehr wahrzunehmen schien, was mit ihm und um ihn herum geschah.
Schnelltöter hob die Rechte. „Zas-tee, Pinda-lick-o-yi“, sagte er. „Tötet die Weißaugen.“
Die Krieger trieben die Killer auf zwei einzeln stehende Saguaros zu. Der eine Mann wehrte sich noch immer. Lanzenspitzen schlitzten seine Haut auf, Stöße mit wuchtigen Schädelbrechern ließen ihn vorwärts taumeln. Der andere begann erst wieder zu schreien, als er an einen Saguaro-Kaktus gefesselt und sein Leib fest an den Kaktusstamm gepresst wurde. Die dolchspitzen Stacheln gruben sich in seinen Körper, und binnen weniger Sekunden bedeckte Blut seine helle Haut und benetzte den Kaktus.
Der zweite Mann schrie jetzt noch mehr und wehrte sich mit der Kraft der Verzweiflung. Er riss sich noch einmal los und wollte fliehen. Tulana stieß seine Lanze nach ihm. Sie bohrte sich tief in seine linke Kniekehle und zerschnitt seine Sehnen. Er brach aufheulend zusammen und versuchte, auf dem Bauch liegend weiterzukriechen.
Tränen strömten aus seinen Augen, und er schluchzte wild, als er zu dem Kaktus zurückgeschleift wurde. „Ihr Teufel!“, schrie er. „Ihr dreckigen roten Schweine ...“
Dann bohrten sich die fingerlangen Stacheln auch in seinen Rücken, in seine Beine, in sein Genick, in seine Arme. Was er rief, war nicht mehr zu verstehen. Sein Körper bäumte sich heftig auf, immer und immer wieder, bis Blut auf seinen Mundwinkeln floss. Sein Kumpan hatte das Bewusstsein verloren. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken.
Ich wandte mich schnell ab. An solche Szenen hatte ich mich noch immer nicht gewöhnt und würde ich mich auch nie gewöhnen.
Es war fast ein Wunder, dass die Mörder noch lebten, als wir wegritten. Wir hörten ihre Schreie noch, als wir sie längst nicht mehr sehen konnten.
2.
Die Chiricahuas kamen uns entgegen. Wir waren dem Zug als Kundschafter vorausgeritten und sahen die Kolonne wieder vor uns.
In langer Reihe bewegte sich die Karawane durch den Sand. An der Spitze und am Ende ritten die Krieger. Zwischen ihnen schritten die Frauen und die Kinder, für die es keine Pferde gab. Sie trugen schwere Lasten auf dem Rücken. Die Hitze schien sie nicht sonderlich zu behindern.
Wir trafen Black Hawk an der Spitze des Zuges. Groß und breitschultrig saß er in einem einfach gefertigten Holzsattel. Schnelltöter berichtete, was wir erlebt hatten und verwies auf die Beutestücke. Schweigend hörte der Häuptling zu. Er betrachtete die Pferde und Waffen nur flüchtig und schien zufrieden zu sein.
„Das Land vor uns ist leer“, sagte Schnelltöter. „Wir haben keine weiteren Spuren gefunden. Der Weg nach Westen ist frei.“
„Enju“, sagte Black Hawk. „Es ist gut.“ Und er nickte.
Wir reihten uns in den Zug ein und ritten Stunde um Stunde.
Mitten unter den Frauen und Kindern entdeckte ich Heulgesicht. Er war ein weißer Apache wie ich und ein Jahr älter. Doch wer ihn sah, glaubte das nicht. Er lebte seit Jahren unter den Apachen. Trotzdem war es ihm nicht gelungen, sich einen festen Platz zu erkämpfen und sich durchzusetzen. So war er nicht mehr als ein besserer Sklave, der Dreckarbeiten erledigen durfte, die sonst niemand verrichten wollte. Er litt umso mehr unter seiner hoffnungslosen Situation, zumal er ziemlich mickrig gewachsen sowie schmächtig und schwach war.
Mir tat er leid. Ich hatte schon ein paar Mal versucht, ihm zu helfen, was ihn mit großer Dankbarkeit erfüllt hatte.
Jetzt schleppte er einen Packen Decken auf seinem krummen Rücken und schien bei jedem Schritt mit seiner Last im Wüstensand zu versinken. Er schwankte hin und her wie ein Strohhalm im Wind. Ich trieb meinen Braunen an und lenkte ihn neben ihn.
„Hallo, Heulgesicht“, sagte ich.
Er hob mit viel Mühe den Kopf und blinzelte in die Sonne. Dann erkannte er mich. Sein Gesicht war wie immer weinerlich verzogen. Um seine Mundwinkel zuckte es verdächtig.
„Bist du müde?“, fragte ich. „Willst du ein Stück mit mir reiten?“
Er war so tief beeindruckt, dass ihm wirklich ein paar Tränen aus den Augen rollten.
„Meinst du wirklich ...“
„Steig auf“, sagte ich.
Er blieb stehen, und die Frau hinter ihm stieß gegen ihn, stolperte und keifte wütend.
„Was bleibst du stehen, du räudiger Kojote, du weiße Klapperschlange!“
Heulgesicht begann zu zittern, als er die Stimme seiner Pflegemutter hörte. Ich beachtete die Alte nicht, obwohl sie mich wütend anblitzte und dabei immer wieder ihren einzigen Zahn bleckte, als ob sie mich damit zu Hackfleisch zerkauen wollte.
Ich beugte mich im Sattel vor, griff nach Heulgesichts Hand und zog ihn hinter mich auf den Pferderücken.
„Komm runter“, kreischte die Alte. „Du hast zu laufen, du fauler Bastard!“
„Halt die Klappe“, sagte ich und trieb den Braunen an. Wir hörten die Frau noch lange keifen, und Heulgesicht flennte ein bisschen, weil er daran dachte, wie sehr sie ihn am Abend, wenn das Lager aufgeschlagen wurde, schikanieren würde. Doch er stieg nicht ab, denn er war am Ende seiner Kraft.
Wir ritten westwärts, der untergehenden Sonne entgegen. Als der Abend kam, färbte sich der Himmel rötlich, und die Dämmerung malte farbige Schatten in den hellen Sand der Wüste. Der Wind von Süden kühlte sich ab, die Temperaturen sanken fast schlagartig, je mehr das Tageslicht an Stärke verlor.
Ich lenkte den Braunen zurück zu den Frauen, wo ich Heulgesicht absetzen wollte.
Ich half ihm hinunter, und er rannte mit seinen dürren Beinen los, um sich wieder in den Zug einzureihen. Aus seinen wässerigen Augen blickte er mich dankbar an wie ein treuer Hund. Da traf ihn ein heftiger Schlag ins Genick, sodass er nach vorn torkelte und fast stürzte. Die alte Frau hinter ihm schrie auf ihn ein, mit so schriller Stimme und so schnell, dass ich kaum ein Wort verstand, obwohl ich längst die Sprache der Apachen wie ein geborener Indianer beherrschte. Sie keifte wie ein wilder Geier und schlug Heulgesicht noch mehrmals die hornige Rechte auf den Hinterkopf. Schweigend taumelte er vor ihr her und sagte kein Wort.
Ich hatte gute Lust, der alten Hexe ins Genick zu springen. Aber sie war nicht ganz richtig im Kopf und galt daher als etwas Besonderes. Es war zwecklos, sich mit ihr anzulegen und konnte höchstens Ärger einbringen.
Ich schaute rasch weg und trieb den Braunen an. Als ich die Spitze des Zuges erreichte, ließ Black Hawk halten. Wir hatten ein tellerartiges Tal erreicht, das sich, umgeben von Dünenwällen, vor uns erstreckte. Gerade versank die Sonne hinter den Tafelfelsen im Westen wie ein Rad aus Feuer.
Wir schlugen unser Nachtlager auf. Ich hobbelte den Braunen unweit der kleinen Feuer, die überall aufflackerten, an, und bereitete mir mit meiner Decke und dem Woilach auf dem nackten Boden das Nachtlager.
Da stand eine große Gestalt vor mir – wie aus dem Erdboden gewachsen.
Ich hatte ihn den Tag über nur immer von Weitem im Zug gesehen: Little Friend, hochgewachsen, breitschultrig, das scharf geschnittene, markante Gesicht, das so untypisch für einen Apachen war, ernst und verschlossen wirkend wie immer.
Er schaute mir zu, wie ich den braunen Hengst abrieb. Ich erwiderte seinen Blick und lächelte ihn an. Er war mein Freund, mehr noch, wir waren Blutsbrüder, und das war bei den Apachen so gut, als wären wir leibliche Brüder. Ich wohnte mit ihm zusammen.
„Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen werde“, sagte ich und deutete auf den Hengst. „Es ist gar nicht einfach, einen Namen für ein Pferd zu finden.“
„Es braucht keinen Namen“, sagte Little Friend. „Es ist ein gutes Pferd, und das genügt.“
„Vielleicht hast du recht.“ Ich klopfte dem Braunen auf den Hals und setzte mich neben mein Deckenlager. Little Friend ließ sich mir gegenüber nieder.
„Du hast heute gekämpft?“, sagte er. Es war eigentlich keine Frage, mehr eine Feststellung.
„Es war nichts weiter“, sagte ich. „Wir haben vier Pferde erbeutet, Gewehre, Revolver und einiges mehr.“
„Die Männer sind tot?“
„Es waren Skalpjäger“, sagte ich. „An ihren Sätteln hingen mindestens vierzig Skalps.“
Er nickte versonnen und blickte über mich hinweg in die Dunkelheit. „Wir mussten diese Männer töten“, sagte ich. „Es waren gemeine Mörder, die unsere Brüder und Schwestern getötet haben.“
„Cochise hat gesagt, wir kämpfen, um zu leben“, sagte Little Friend. „Solange die Weißen Geld für unsere Skalps bezahlen, wird sich das nicht ändern.“
„Kennst du Cochise?“, fragte ich.
„Du wirst ihn auch bald sehen“, sagte er. „Er hat eine von Mangas Coloradasʼ Töchtern zur Frau genommen.“
Little Friend blickte mich ernst an. „Ich habe mit Black Hawk gesprochen“, sagte er. „Wegen dir.“
Ich schwieg und wartete ab.
„Er meint wie ich, dass es jetzt Zeit für dich ist.“
„Zeit für was?“
„Medizin zu machen.“
Mein Herz schlug plötzlich schneller.
„Du reitest mit den Kriegern, du kämpfst mit ihnen. Du hast gezeigt, dass du ein guter Apache bist. Du weißt fast alles, was ein Krieger wissen muss. Du bist noch jung, aber dein Kopf und dein Herz sind über dein Alter längst hinausgewachsen.“
Ich hörte stumm zu. Mein Hals war ganz trocken.
Medizin machen, das bedeutete den endgültigen Eintritt in die Reihen der Krieger. Meist geschah dies im Alter von etwa vierzehn Jahren. Ich war erst zwölf.
Wenn ein Indianer erwachsen wurde, zog er einige Tage allein, nur auf sich gestellt, in die Wildnis, fastete, betete zu den Göttern und wartete darauf, dass ihm in Trance der Große Geist Hinweise auf sein weiteres Leben gab. Anhand dieser Vision stellte er seinen Medizinbeutel zusammen, den er von da an stets bei sich trug, der ihn vor Schaden bewahrte.
Medizin machen war das entscheidende Erlebnis im Leben eines jungen Kriegers, und ich war stolz, dass mir zugetraut wurde, diese Prüfung zu bestehen.
Little Friend schien zu ahnen, was ich dachte. Er legte seine Rechte schwer auf meine Schulter.
„Du kannst noch warten, wenn du dich noch nicht stark genug fühlst“, sagte er. „Es ist eine schwere Prüfung. Nicht jeder kann sie bestehen. Manchmal ist es besser, sich Zeit zu lassen und Geduld zu haben, statt zu scheitern. Denn das wäre schlimm.“
Ich nickte. Ein Versagen würde mich zum Außenseiter stempeln. Die Verachtung der Krieger und selbst der anderen Jungen würde mir sicher sein. In diesem Moment hatte ich ein wenig Furcht bei dem Gedanken. Ich las in Little Friends dunklen Augen Sorge und auch leise Zweifel an mir, obwohl er selbst Black Hawk vorgeschlagen hatte, mir die Prüfung aufzuerlegen. Das gab den Ausschlag.
„Ich werde es schaffen“, sagte ich. „Bestimmt.“
„Ich bin sicher“, sagte er. Der zweifelnde Unterton in seiner Stimme wich. Er blieb ernst. „Es wird bald soweit sein. Wenn wir das Lager von Mangas Coloradas erreicht haben. Bereite dich darauf vor. Es wird sehr, sehr schwer werden. Du bist kein geborener Apache, du bist nicht mit unseren Mythen erzogen worden. Deshalb wirst du es schwerer haben.“
„Ich weiß.“
„Ich wusste, dass du nicht warten würdest.“ Befriedigung lag in seinem Blick. „Man darf wichtigen Entscheidungen nicht ausweichen. Ich werde dir sagen, wenn es so weit ist.“
Jetzt lächelte er, und ich lächelte zurück. Dann ging er davon, während ich den Braunen weiter versorgte, bevor ich zu einem der Feuer ging, um zu essen. Doch was ich auch tat, ich konnte an nichts anderes mehr denken als an das, was Little Friend mir gesagt hatte.
Ich würde meinen Medizinbeutel erhalten, früher als manche geborenen Apachen. Das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, war groß. Ich wollte es nicht enttäuschen. Das schwor ich mir. Das war ich auch Little Friend schuldig, meinem Blutsbruder.
Ich aß ein Stück gebratenes Pferdefleisch und hörte nicht, dass ich angesprochen wurde. Plötzlich sah ich die wässerigen Augen Heulgesichts vor mir. Sie schwammen in Tränen.
„Sie hat mich geschlagen“, sagte er leise und schluchzte. „Sie hat mich schrecklich verprügelt, die alte Hexe, weil ich mit dir geritten bin.“
Ich schluckte den Rest meines Fleisches und richtete mich auf. Nicht einmal das konnte meine gute Stimmung mindern. „Gib ihr endlich einen Tritt in ihren fetten Hintern“, sagte ich. „Aber nicht zu sanft.“
„Du meinst ...?“ Er starrte mich ungläubig an.
„Sicher“, sagte ich. „Was denn sonst.“
Dann ging ich zu meinem Lager. In der Nähe sah ich Little Friend, der ebenfalls seine Decken am Boden ausbreitete. Ich sprach ihn nicht mehr an. In diesem Augenblick wollte ich allein sein. Ich streckte mich am Boden aus und rollte mich in meine Decke. Die Geräusche des Lagers, das Schnauben und Stampfen der Pferde, die Stimmen der Männer, die an den Feuern zusammensaßen, das Weinen der Säuglinge, die nach der Brust ihrer Mutter verlangten, das Knistern der Feuer – ich hörte das alles kaum. Meine Gedanken waren weit fort. Ich sehnte den Tag herbei, an dem ich allein in die Wildnis ziehen würde, um meinen Medizinbeutel zu erwerben.
Meine Augenlider wurden plötzlich zentnerschwer. Es war ein ereignisreicher Tag gewesen. Ich war müde. Meine Gedanken verschwammen immer mehr. Sanft und schwer kroch der Schlaf durch meine Glieder.
Da ertönte Geschrei im Lager. Eine Frau kreischte schrill, andere lachten laut. Dann hörte ich schnelle Schritte. Jemand rannte unweit von mir vorbei und schrie: „Heulgesicht hat die alte Hexe in den Hintern getreten. Sie ist mit dem Kopf in Pferdescheiße gefallen ...“
Mehr hörte ich nicht. Ich grinste nur und schlief ein.
*
Zwei Tage später erreichten wir eine Oase. Wir sahen Grashütten und Zelte. Dazwischen gab es viele Feuer. Struppige Hunde streunten herum. Kinder spielten zwischen den Wickiups und den Zelten, und Krieger waren mit ihren Waffen beschäftigt.
Ein Posten kündigte uns an. Kurz darauf ritten uns zehn oder zwölf Krieger entgegen.
Der Zug hielt an. Black Hawk sprach mit dem Anführer des kleinen Trupps. Wenige Minuten nur dauerte es. Dann konnten wir weiterziehen und ritten in das riesige Lager, lebhaft begrüßt von den anderen Stammesgruppen, die bereits vor uns angekommen waren.
Als ich vom Pferd stieg, sah ich Mangas Coloradas.
Noch niemals zuvor und auch später nicht habe ich einen so hünenhaften Apachen gesehen. Er maß gewiss weit über sechs Fuß und hatte mächtige, ausladende Schultern. Er trug ein schlichtes Wildledergewand ohne überflüssigen Schmuck, ohne Verzierungen. Sein Haar war grau wie das Gefieder einer Wildgans und wurde von einem schmalen Stirnband gehalten. Keine Feder, keine Perlen. Ich schaute in ein dunkles, faltenzerfurchtes, kühn geschnittenes Gesicht, das Energie ausstrahlte, Mut und auch Würde.
Jeder, der ihn sah, wusste, dass er ein Häuptling war. Er brauchte keine Zeichen seiner Macht mit sich herumzutragen. Seine bloße Erscheinung genügte.
Er ging an mir vorbei. Jung war er nicht mehr, doch sein Gang war elastisch und geschmeidig. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm wenden. Langsam drehte ich mich um und schaute ihm nach, als er in der Mitte des Lagers stehen blieb und wartete, bis Black Hawk auf ihn zu trat. Sie reichten sich die Hand und wechselten einige Worte.
Ich musste an die Geschichte denken, die mir Schnelltöter von Mangas Coloradas erzählt hatte.
Als bei Pinos Altos vor einigen Jahren Gold entdeckt worden war und Scharen von Abenteurern ins Land geströmt waren, hatte Mangas Coloradas versucht, sich friedlich mit den Goldgräbern zu einigen. Er war zu ihnen nach Copper Mines gegangen, allein und ohne Waffen. Doch sie hatten ihn gefangen und fast zu Tode gepeitscht.
Seitdem hatte er allen Weißen Todfeindschaft geschworen, seitdem zitterten die Siedler im Grenzland, wenn sie nur das Geräusch unbeschlagener Pferdehufe hörten, und verkrochen sich in ihren Hütten.
Hinter ihm sah ich jetzt einen zweiten Krieger auftauchen. Little Friend trat neben mich und legte mir die Rechte auf die Schulter.
„Das ist Cochise“, sagte er. „Der Häuptling aller Chiricahuas.“
Ich schaute den athletischen, schlanken Krieger mit dem harten, schmalen Gesicht und der kühn gebogenen Nase genauer an. Er war jünger als Black Hawk, doch auch er war eine Persönlichkeit, wie sie einem nur selten im Leben begegnet.
Cochise umarmte Black Hawk. Seine Begrüßungsworte waren herzlich. Als die Häuptlinge in einem großen Wickiup verschwanden, kamen Krieger zu uns, die uns unseren Platz in der Oase zeigten, wo wir unser Lager aufschlagen konnten.
Little Friend und ich machten uns zusammen an den Bau einer Laubhütte. Wir kamen gut dabei voran. Es gab Bäume aller Art in der Oase, durch die glühend der Wüstenwind strich. Wir schnitten biegsame Äste von einem Pecan-Baum, die wir in Form eines Kreises in den Boden steckten und an der Spitze zusammenbanden, sodass sie eine regelrechte Kuppel bildeten. Sodann flochten wir dünne, geschmeidige Zweige in das Gerüst. Nach knapp anderthalb Stunden waren wir fertig und räumten unsere Decken und Waffen hinein. Unsere Pferde weideten in kniehohem Grammagras, und knapp zweihundert Yards entfernt lag in einer Senke die Quelle für einen breiten Bach, der die Oase von Norden nach Süden durchschnitt und dann wieder im Boden versickerte.
Ich war sicher, dass fast sechshundert Indianer die Oase bevölkerten. Davon waren gewiss zweihundert Krieger. So viele Apachen auf einmal hatte ich vorher noch nie gesehen.
„Es werden noch mehr sein, wenn wir nach Norden ziehen“, sagte Little Friend. „Wir werden wie ein Hagelsturm über die Weißaugen herfallen.“
Ich schaute ihn an.
„Glaubst du, dass wir siegen?“
Er schwieg. Sein Gesicht war ausdruckslos. Er schien mich nicht zu sehen.
„Vielleicht siegen wir irgendwann“, sagte er nach einer Weile.
„Vielleicht ...“
„Auf jeden Fall dürfen wir nicht aufhören, zu kämpfen. Niemals. Wenn wir aufhören, zu kämpfen, werden wir nicht einmal mehr in der Wüste sicher sein.“
Er senkte den Kopf und schaute mich an. „Die Weißen fallen wie die Ameisen über das Land her. Wenn zehn von ihnen vernichtet werden, stehen gleich hundert andere wieder auf. Wenn aber bei uns einer fällt, gibt es niemanden, der ihn ersetzt. Wir werden weniger, die Weißen werden mehr.“
„Und trotzdem kämpfen wir?“
„Trotzdem, ja. Wir haben versucht, in Frieden mit den Weißen zu leben“, sagte Little Friend. „Das ist lange her. Die Weißen wollten keinen Frieden. Wer einen Krieger schlägt, muss wissen, dass er zurückschlägt. Gewalt wird immer aus der Gewalt selbst geboren. Deshalb können wir nicht aufhören, zu kämpfen.“
Ich schwieg.
„Vielleicht gibt es eines Tages doch Frieden“, sagte Little Friend. „Wenn du älter bist, wenn die Vernunft gewachsen ist.“
Ich nickte, und ich dachte nach über das, was Little Friend gesagt hatte. Alles hatte ich nicht verstanden. Doch ich war sicher, es eines Tages zu begreifen. Ich wusste, dass ich nicht vergessen würde, was er gesagt hatte.
Gewalt wird aus der Gewalt selbst geboren ...
Little Friend ging hinüber zu den Ratsfeuern in der Mitte der Oase, wo sich jetzt die Häuptlinge versammelten. Ich blickte mich um. Es wurde Zeit, dass ich mich mit der neuen Umgebung vertraut machte.
Unweit von unserer Grashütte hatte Schnelltöter mit seinen beiden Frauen sein Quartier aufgeschlagen. Sie stritten schon wieder. Das war nichts Besonderes. Als die beiden Frauen aufeinander losgingen, schien es interessant zu werden.
Doch da kroch bereits Schnelltöter aus dem halb fertigen Wickiup und verabreichte beiden schallende Ohrfeigen. Da wurden sie still, und ich zog los, um das Lager kennenzulernen.
*
Ich sah das Mädchen, als ich zur Quelle hinunterging. Sie tauchte plötzlich vor mir auf, mit zwei Ledereimern in den Händen. Wie angewurzelt blieb ich stehen und schaute ihr nach. Sie ging keine fünf Schritte entfernt an mir vorbei, ohne mich anzusehen. Dann verschwand sie hinter einer dichten Strauchgruppe.
Ich bemerkte erst jetzt, dass mir der Schweiß in dünnen Bahnen über das Gesicht rann.
Mir war, als hätte ich eine Luftspiegelung gesehen.
Ich ging zögernd einige Schritte, blieb hinter den Büschen stehen, atmete tief durch und umrundete das dichte Strauchwerk. Dahinter fiel ein Hang in eine flache Senke ab, durch die der Bach floss, der die Oase bewässerte. Gegenüber davon reckte sich wuchtig der Stamm einer Organ-Pipe-Kaktee in den heißen Himmel.
Unten am Bach sah ich sie wieder. Sie hockte bis zu den Knöcheln im Wasser und füllte die beiden Ledereimer. Ihr Schatten fiel in den hellen Ufersand.
Sie war vermutlich ein oder zwei Jahre älter als ich und etwas kleiner. Ihre Gestalt war nicht von jener muskulösen Stämmigkeit wie bei den älteren Apachenfrauen, deren Körper von dem harten Leben und der schweren Arbeit gezeichnet waren. Sie wirkte kräftig, war aber schlank und geschmeidig und bewegte sich leichtfüßig wie eine junge Antilope. Das dicke blauschwarze Haar flutete ihr lang auf die Schultern und rahmte ihr Gesicht ein, das nicht rund war wie das der meisten Frauen, sondern oval, sodass die schmalen Augen und die hohen Wangenknochen ihm einen eigenartigen Reiz verliehen. Ihre Füße waren klein und noch nicht vom vielen Laufen platt getreten. Ich konnte sie sehen, denn sie ging barfuß, und mein Mund wurde ganz trocken, als ich bemerkte, wie der helle Ufersand ihr durch die Zehen rieselte.
Sie trug ein schlichtes, knielanges Kleid aus Kaliko, das mit sparsamen Stickereien versehen war. Darunter zeichneten sich schwach ihre knospenden Brüste ab.
In meinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Ich wusste nicht, wann ich mich jemals früher so gefühlt hatte – und das beim Anblick eines Apachenmädchens. Einen Moment lang kam ich mir blöd vor. Aber das war schnell wieder vergessen, als sie sich unter mir aufrichtete und plötzlich den Kopf wandte.
Einen Augenblick lang schaute sie mich an und wandte sich dann wieder ihren Eimern zu. Mir wurde die Kehle eng. Ich begriff in diesem Moment nicht, dass ich im Begriff war, mich zum ersten Mal zu verlieben. Es hatte bisher auch keine Gelegenheit dazu gegeben, dazu waren die letzten Wochen und Monate viel zu sehr mit ständigem Kampf erfüllt gewesen. Und früher war ich allem, was nach Mädchen aussah, lieber aus dem Weg gegangen. Ich hatte nie geahnt, wie schnell sich das ändern konnte.
Ich war sicher, Blei in den Gliedern zu haben und mich nie mehr rühren zu können. Dass um mich herum Hunderte von Apachen waren, hatte ich in diesem Moment völlig vergessen. Ich sah nur das Mädchen und sonst nichts.
Sie hatte die beiden Eimer gefüllt und trat den Rückweg an. Das Wasser in den Eimern schwappte bei jedem Schritt über den Rand. Sie hatte es nicht einfach, als sie den steinigen Hang heraufstieg.
Ich nahm mir vor, sie anzusprechen, wenn sie oben angelangt war, und dachte krampfhaft darüber nach, was ich sagen sollte. Da stolperte sie plötzlich. Sie rutschte aus, stieß einen spitzen Schrei aus und fiel hin. Sie rollte den Hang ein Stück hinunter. Die beiden Eimer liefen aus. Das Wasser versickerte sofort im Boden.
Das war meine Chance. Ich hastete den Hang hinunter und hockte auch schon neben ihr, als sie gerade den Kopf hob.
„Kann ich dir helfen?“
Ich erkannte meine Stimme nicht wieder.
Sie schwieg, und ich fasste einfach nach ihren Händen und half ihr hoch. Sie ließ es sich gefallen.
„Hast du dir wehgetan?“
Ihre Knie waren leicht aufgeschrammt, und ihr Kleid war etwas staubig. Sonst schien ihr nichts zu fehlen.
„Es geht schon“, sagte sie, und als ich sie anschaute, errötete sie ein wenig.
Ich hob wortlos die beiden Eimer auf und ging zum Bach, wo ich sie ins Wasser hielt, bis sie wieder gefüllt waren.
Sie stand neben mir und schaute mir zu. Ich fühlte ihre Blicke in meinem Nacken brennen und verfluchte mich innerlich für meine Unsicherheit, die mir völlig neu war.
„Wir sind erst heute angekommen“, sagte ich, während ich mich umdrehte. „Ich gehöre zu Black Hawks Gruppe.“
„Ich weiß.“ Sie nickte und musterte neugierig mein blondes Haar.
„Ich heiße Ronco“, sagte ich. „Und du?“
„Kaktusblüte.“ Sie lächelte ein wenig. Für einen Moment sah sie wirklich aus wie der zarte Blütenkelch eines Saguaro, der sich nach einem der seltenen Regenfälle in der Wüste geöffnet hatte. Es dauerte nur wenige Sekunden, dann war sie wieder ernst.
„Gib mir die Eimer“, sagte sie. „Danke, dass du mir geholfen hast.“
„Ich kann die Eimer doch tragen“, sagte ich.
„Das ist Arbeit für eine Frau“, sagte sie sehr bestimmt.
„Wenigstens den Hang hinauf“, sagte ich. „Sonst stolperst du wieder.“
Sie zuckte mit den Schultern. „Wenn du willst.“
Ich ging neben ihr her und trug die Eimer, als seien sie mit rohen Eiern gefüllt. Dabei schaute ich starr geradeaus, obwohl ich Kaktusblüte gern angesehen hätte. Aber ein unerfindliches Gefühl hinderte mich daran. Dabei war ich sicher, dass Kaktusblüte mich die ganze Zeit anblickte und von oben bis unten musterte. Es war ein scheußliches Gefühl, und ich war so durcheinander, dass ich das Auftauchen des jungen Apachen vor mir erst sah, als ich fast gegen ihn stieß.