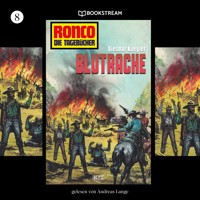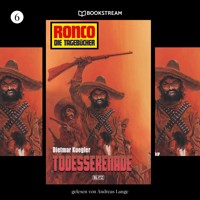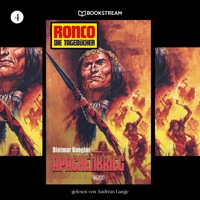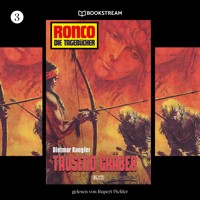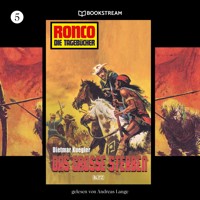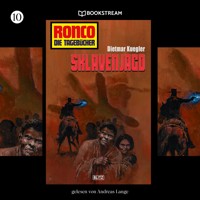3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist ihr Geschäft. Waffenhändler liefern ihre tödliche Ware an die Indianer und an die Armee. Egal, wer verliert – sie gewinnen immer. Sie haben mich zum Geächteten gemacht, weil ich ihnen bei den Apachen in die Quere gekommen bin. Jetzt reite ich auf ihrer Fährte. Meine Chance zu überleben ist so groß wie die eines Schneeballs in der Hölle. In Mexiko tobt die Revolution von Benito Juarez gegen Kaiser Maximilian. Auch hier rollen die Waffentransporte. Das Exekutionskommando der Juarez-Rebellen wartet auf mich.Dieser Band enthält die folgenden Romane:Todeswasser (55)Gewehre für Juarez (56)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
RONCO
In dieser Reihe bisher erschienen
2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt
2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache
2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber
2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg
2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben
2706 Dietmar Kuegler Todesserenade
2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes
2708 Dietmar Kuegler Blutrache
2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt
2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd
2711 Dietmar Kuegler Pony Express
2712 Dietmar Kuegler Todgeweiht
2713 Dietmar Kuegler Revolvermarshal
2714 Dietmar Kuegler Goldrausch
2715 Dietmar Kuegler Himmelfahrtskommando
2716 Dietmar Kuegler Im Fegefeuer
2717 Dietmar Kuegler Die Ratten von Savannah
2718 Dietmar Kuegler Missouri-Guerillas
2719 Dietmar Kuegler Höllenpoker
2720 Dietmar Kuegler Das Totenschiff
2721 Dietmar Kuegler Der eiserne Colonel
2722 Dietmar Kuegler Der Feuerreiter
2723 Dietmar Kuegler Die Ehre der Geächteten
2724 Dietmar Kuegler Der letzte Wagen
2725 Dietmar Kuegler Die Händler des Todes
2726 Dietmar Kuegler Das Massaker
2727 Dietmar Kuegler Jagd auf Ronco
2728 Dietmar Kuegler Gewehre für Juarez
2729 Dietmar Kuegler Der Weg nach Vera Cruz
2730 Dietmar Kuegler Am Ende aller Wege
Dietmar Kuegler
Gewehre für Juarez
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-177-9
Todeswasser
von Dietmar Kuegler
12. Mai 1882.
Ich bin immer unterwegs. Manchmal glaube ich, dass ich heute, da ich den Ranger-Stern trage, mehr im Sattel sitze als zu jener Zeit, als ich gejagt wurde, als es zu Unrecht einen Steckbrief von mir gab und ich nirgends lange bleiben konnte.
Heute jage ich selbst Männer, von denen es Steckbriefe gibt. Aber ich bin kein Bluthund: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Steckbrief wenig aussagt und eine Anklage nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Eine Beschuldigung ist schnell fertig. In meinem Fall war sie falsch. Und Behörden sind schwerfällig. Selbst als klar war, dass ich unschuldig war, weigerten sie sich, es zu glauben oder ihr Unrecht einzugestehen.
Ich weiß deshalb, dass ich Menschen vor mir habe, wenn ich auf die Jagd nach Outlaws gehe. Ich suche nicht nur die Schuld, wenn ich auf der Fährte eines Gesetzlosen reite, sondern auch nach Dingen, die seine Schuldlosigkeit beweisen. Das gehört dazu, wenn man das Gesetz vertritt. Viele, allzu viele vergessen das. Es gibt einen Unterschied zwischen dem geschriebenen Gesetz und der Gerechtigkeit. Es liegt an den Beamten, diesen Unterschied gering zu halten.
Ich hatte in meinem Leben nicht das Glück, oft mit solchen Beamten zu tun zu haben. Die meisten glaubten blind dem bedruckten Papier, manche hielten sich selbst für das Gesetz, und für andere war Gerechtigkeit eine Ware, die man verkaufen konnte.
Ich habe sie alle kennengelernt: Die sturen Männer mit dem Stern genauso wie die korrupten. Am schlimmsten aber waren jene, die auf eigene Faust ritten, um Rache zu üben und Selbstjustiz zu betreiben. Und die Kopfgeldjäger.
Ich kann darüber urteilen. Wenn ich an jene Jahre zurückdenke, ist das für mich jedes Mal eine Mahnung, nicht in die Fehler jener zu verfallen, deren Praktiken ich erleiden musste.
Mir wurde nichts geschenkt, nicht mal die Rehabilitierung. Ich musste alles selbst erkämpfen. Es war ein Kampf an vielen Fronten: Während die Häscher hinter mir her waren, suchte ich nach Beweisen für meine Unschuld, und jene Jäger, die unbeirrt an meine Schuld glaubten, zerschlugen mir in ihrem Fanatismus viele Fährten, die für mich lebenswichtig waren. Besonders schlimm war das für mich in den ersten Wochen meiner Flucht, damals, im Spätherbst 1866. Es war die Zeit, in der ich Glauben und Hoffen beinahe verlernte.
1.
Während des Tages war mir eine dünne Staubfahne aufgefallen. Sie wurde im Norden, wo ich gewesen war, mehrmals sichtbar. Aber ich wusste nicht, wie viele Reiter mich verfolgten. Doch dass ich verfolgt wurde, schien außer Frage zu stehen.
Kaltes Mondlicht lag über Arizona, als ich mich entschloss, mir Gewissheit zu verschaffen. Ich ritt über die sanfte Halde, die geborstenes Lavagestein bedeckte. Es klirrte immer wieder leise unter den Hufen des Pferdes. Ich hielt das Gewehr schussbereit in der Hand, zügelte das Tier auf der Höhe und schaute zu dem horstartigen Fichtengehölz hinunter. Das Silberlicht des Mondes zeichnete tiefe Schatten von den Bäumen auf den Boden. So erkannte ich den Widerschein eines Feuers, das da unten brannte.
In diesem Augenblick wurde auch schon geschossen. Ein jähes Krachen hallte über das Land. Neben dem Pferd schrammte die Kugel auf das Gestein. Sie prallte ab und flog jaulend am Kopf des Tieres vorbei.
Das Pferd wieherte. Ich musste nach dem Sattelhorn greifen, um bei einem plötzlichen Satz des Tieres nicht abgeworfen zu werden.
Am Waldsaum entluden sich zwei Gewehre gleichzeitig. Ein Pfeifen strich über mich weg.
Das Pferd raste mit trommelnden Hufen über die Höhe, auf der es mit mir sehr deutlich für die heimtückischen Schützen zu sehen sein musste. Es fielen wieder Schüsse. Auch ich feuerte zum Waldrand hinunter, hatte aber während des schnellen Rittes keine Chance, die Kerle zu treffen.
Im Galopp fegte ich über den Südhang der Erhöhung, schob das Gewehr in den Scabbard und versuchte, das erschrockene Pferd zu lenken und das halsbrecherische Tempo zu verlangsamen. Es dauerte lange, bis ich bemerkte, dass mir auch Erfolg beschieden war.
In einer buschbestandenen Senke gelang es mir, den Braunen zu zügeln. Das Echo des Hufschlags verklang, und das leise Murmeln eines Creeks schlug an meine Ohren. Es musste der San Domingo sein, der, aus der Sierra Nevada kommend, hier vorbeifloss.
Ich schaute zurück und lauschte, konnte aber keine Verfolger hören. So ritt ich weiter in die Senke hinunter und sah den Creek im kalten Mondlicht wie ein schimmerndes, gewundenes Band unterwegs nach Süden. Der San Domingo nahm nur noch den untersten Teil seines steinigen Betts ein. Rechts und links lag Geröll, das aus den Bergen heruntergetragen wurde und verriet, was für ein gewaltiger Strom dieses ruhige Flüsschen während der Schneeschmelze in den Bergen werden konnte. Sie lag zum Glück schon hinter uns für dieses Jahr.
Am Ufer stieg ich ab, kletterte über das klirrende Gestein, beugte mich über den Creek, tauchte die Hände ein und wusch mir das Gesicht. Die Bartstoppeln knisterten unter den Handflächen. Ich war müde. Hunger hatte ich auch.
Mein Blick wanderte zu der Höhe zurück, über die ich geritten war. Sicher handelte es sich um Kopfgeldjäger, die auf meinen Spuren ritten.
Männer, die sich die Prämie verdienen wollten, mit der auf mich ausgestellte Steckbriefe lockten.
Wasser tropfte mir noch aus dem Stoppelbart. Ich wischte mit dem Ärmel über das Gesicht. Als ich abermals zur Höhe blickte, sah ich zwei Reiter auftauchen. Scharf hoben sie sich vom Hintergrund für einen Augenblick ab. Sie schienen zu wissen, wo sie mich suchen mussten, denn sie ritten ohne Zögern über den Hügel und auf mich zu, die Flanke hinunter.
Ich lief zu meinem Braunen, zog das Gewehr aus dem Scabbard, repetierte und feuerte auf die Verfolger. Der Mündungsblitz blendete mich, so dass ich sekundenlang nichts als Feuerreigen vor den Augen sah. Die Detonationen hallten über das Land. Mein Pferd wieherte und stieg in die Höhe. Die Hufe wirbelten, und die Eisen schlugen hallend zusammen. Schwarzpulverrauch breitete sich zu einer Wolke aus.
Die beiden Verfolger galoppierten den Hügel schießend hinunter. Kugeln fetzten in der Nähe das Gestrüpp auseinander.
Der Braune floh durch den Creek. Wasser spritzte zu Fontänen in die Höhe.
Ich repetierte das Gewehr und schoss wieder. Aber bei dem ungewissen Nachtlicht treffen zu wollen, war aussichtslos. Höchstens durch Zufall konnte ich einen der Burschen erwischen. Dennoch schoss ich noch einmal, bevor ich dem Pferd nachlief.
Ein Geschoss traf dicht neben meinem Stiefel die Steinplatte und prallte ab. Splitter wurden mir gegen das Bein geschleudert.
Das Pferd wieherte und floh weiter nach Westen. Sagebüsche schlugen hinter dem Tier zusammen. Äste fielen zu Boden.
„Halt!“, rief ich dem Pferd nach und hoffte, es würde wirklich darauf reagieren.
Der Hufschlag der Verfolgerpferde hallte mir in den Ohren. Die Waffen der Männer entluden sich. Ein Pfeifen drang mir ins Ohr und entfernte sich. Ich hastete durch das Dickicht, erwischte das Pferd noch und schwang mich in den Sattel. Beinahe wäre mir das Gewehr dabei entfallen. Auf dem Hals des Tieres liegend, lenkte ich es nach Süden und jagte an der Buschreihe entlang. Hinter mir fetzten die Kugeln durch das Dickicht.
Ich schob das Gewehr in den Sattelschuh und trieb den Braunen zur Entfaltung seiner ganzen Kraft an.
Noch eine Weile wurde hinter mir geschossen. Dann verstummten die Gewehre. Doch jedes Mal, wenn ich das Pferd zügelte und lauschte, konnte ich den Hufschlag hören.
Sie gaben nicht auf.
Ich trieb das Pferd wieder an, durchbrach das Ufergestrüpp und ritt durch den Creek auf die andere Seite. Von dort wandte ich mich in die südöstliche Richtung der Peloncillo Range entgegen. Sicher gelang es mir dort am besten, meine Spuren gründlich zu verwischen.
Die Kerle schossen über den Creek weg zu mir herüber. Sie hatten aufgeholt.
„Vorwärts!“, rief ich dem Braunen zu. Ich musste die Sporen zu Hilfe nehmen, um ihn anzutreiben, denn es kam zunächst darauf an, den Vorsprung auszubauen.
Nach einer Viertelstunde schossen sie wieder. Ich schaute zurück und sah eine Mündungsflamme hinter mir. Sie waren zurückgefallen, befanden sich aber jetzt ebenfalls diesseits des San Domingo.
Sanft lenkte ich das Pferd weiter nach Osten. Das Gelände stieg an. Das Buschwerk nahm zu und deckte mich gegen die Sicht der Verfolger. Dennoch schienen sie mich sehen zu können, denn wieder konzentrierte sich das Feuer so sehr, dass mir die Kugeln wie Hornissen um die Ohren schwirrten. Das ließ mich so wütend werden, dass ich den Braunen zügelte und absprang.
Auf den Boden kniend, schlug ich das Gewehr an und feuerte Schuss um Schuss hinaus.
Scharf wieherte ein Pferd.
Ich richtete mich auf, repetierte die Waffe und blickte nach Norden. Offenbar hatte ich eins der Pferde erwischt. Minutenlang wurde auch nicht mehr geschossen. Langsam lief ich hinter dem Braunen her, der sich wieder entfernte. Mein Blick war jedoch nach Norden gerichtet. Sicher war ich dessen nicht, was ich annahm. Aber wenn sie wirklich ein Pferd eingebüßt haben sollten, musste sich dies an ihrem Zurückbleiben bald zeigen. Ich holte das Pferd ein und schwang mich in den Sattel.
Da feuerten sie wieder.
Ich trieb den Braunen an, durchbrach das Gestrüpp und ritt den Felsenhängen der Peloncillo Range entgegen.
Rasch entfernte ich mich von den schießenden Verfolgern. Eine Schlucht zwischen schroffen Granitwänden nahm mich auf. Nur ganz oben an den Zinnen und Graten des wild zerklüfteten Massivs war noch das silbrige Mondlicht zu erkennen. Vor mir war es stockdunkel. Nicht einmal den Kopf des eigenen Pferdes vermochte ich einwandfrei zu erkennen.
Hinter mir schoss niemand mehr. Ich war jetzt sicher, ein Pferd getroffen zu haben.
*
Der kleine Rancho lag in einer Gebirgsfalte, in der die Schmelzwasser in den Jahrtausenden eine beachtliche Erdschicht abgelagert hatten. Zwei der vier Talzugänge waren mit Latten verbaut worden.
Ich zügelte den Braunen, als ich im Morgengrauen das Tal erreichte. Nebelfelder zogen von den Bergen fallend durch das Tal, begannen sich aber in der rasch zunehmenden Wärme bereits aufzulösen.
An dem steilen Nordhang stand eine wurmstichige Hütte. Das mit Steinen beschwerte Dach hatte sich in der Mitte bereits derart nach innen gebogen, dass man fürchten musste, es könnte jeden Augenblick einstürzen.
Ein gutes Dutzend Rinder weidete im Süden, wo hohe Grasteppiche den satten Boden bedeckten. Im Westen stand ein Lattencorral mit vier Pferden darin.
Als ich weiterritt, schwang die Tür der Hütte auf, und ein älterer, abgerissener Mann mit Schlapphut auf dem Kopf und einem Henrygewehr in der Armbeuge trat heraus.
Langsam ritt ich auf ihn zu, zügelte das Pferd und tippte an meinen Hut, bemüht, ein freundliches Lächeln zu zeigen. In meiner Lage war aber auch das schon gar nicht mehr so einfach, denn das war eine Auswirkung der anhaltenden Verfolgung.
„Hallo.“ Ich blickte zu der Frau weiter, die hinter dem Mann in der Hütte sichtbar wurde. „Ich bin unterwegs nach Süden und habe keinen Proviant mehr.“
Die Frau trat heraus und schob mit gespreizten Fingern das angegraute Haar zurück. Genauso wie der Mann hatte sie ein von Falten zerfurchtes Gesicht, war ärmlich gekleidet und trug Sandalen an den Füßen. Aber beide sahen sie unfreundlich und abweisend aus, als hätten sie mit Fremden keine guten Erfahrungen gemacht.
Von mir wusste ich natürlich, ohne mein Spiegelbild betrachten zu müssen, dass ich alles andere als vertrauenerweckend aussah. Meine Kleidung hatte beträchtlich auf der Flucht gelitten. Ich grinste schief.
„Könnte ich etwas zu essen haben? Mein Proviant ist verbraucht. Ich werde dafür natürlich bezahlen, Mister.“
Das Gewehr in den Händen des Mannes war auf mein Gesicht gerichtet, sodass ich den Anfang der Züge im Lauf zu sehen vermochte.
„Sie wollen bezahlen?“, fragte die Frau.
„Ja, Madam.“
Sie schob sich an dem Mann vorbei. „Haben Sie denn Geld?“
Ich fischte einen halben Dollar aus der Tasche, beugte mich hinunter und gab ihn ihr. Sie wandte sich um und ging zurück. Der Mann nahm die Münze mit der Linken und biss hinein, bevor er sie kritisch in Augenschein nahm.
„Ist sie echt?“, fragte die Frau.
„Ja“, sagte er. „Also gut, Sie erhalten Brot, geräucherten Schinken und kalten Tee, Mister. Und dann verschwinden Sie wieder.“
„In Ordnung.“ Ich bemühte mich weiter um ein verbindliches Lächeln und wollte absteigen.
Doch das Gewehr zuckte in die Höhe. „He, wer hat davon was gesagt? Bleiben Sie auf dem Gaul sitzen!“
Die Frau ging ins Haus und brachte mir ein paar Minuten später in ein Säckchen verpackten Proviant. Sie nahm meine leere Flasche mit und verschwand wieder im Haus, um sie mit kaltem Tee zu füllen.
Während der ganzen Zeit bedrohte mich der Mann mit dem Gewehr und ließ in seiner gespannten Aufmerksamkeit keine Sekunde nach.
Die Frau erschien mit der Flasche und gab sie mir. „Entschuldigen Sie den Empfang, Mister. Hier findet sich meistens nur Gesindel ein. Unser Sohn wurde vor Jahren von Banditen getötet.“
„Vielen Dank, Madam.“
Ich lenkte das Pferd im großen Bogen um den Mann herum und verließ den Rancho in der Bergfalte durch den Canyon im Süden. Als ich zurückschauend von der Bergfalte nichts mehr sah, öffnete ich den Leinenbeutel und fiel heißhungrig über das Brot und den Schinken her.
*
„Schon wieder zwei“, murmelte der Mann, griff nach dem Henrygewehr und verließ die Hütte.
Die beiden Reiter saßen auf einem Pferd und hatten noch einen zweiten Sattel bei sich. Es waren zwei große, breitschultrige und finster aussehende Gestalten, die ebenfalls Gewehre in den Händen hielten.
Die Kerle ritten langsam in das Tal und schauten sich aufmerksam nach allen Seiten um.
Der Mann an der Hütte hob das Gewehr an und repetierte es. „Halt!“
Der vordere Reiter zügelte das Pferd. Sein stoppelbärtiges Gesicht war auf den Mann am Haus gerichtet, den er aus bernsteinfarbenen Augen scharf musterte.
Die Frau trat aus der Hütte.
Der zweite Reiter rutschte vom Pferd. Er war mit einem verknautschten Cordanzug bekleidet, trug einen tief geschnallten Revolver in schwarzem Holster und hatte den breitkrempigen Hut tief in die Stirn gezogen. Die Frau erschrak, als sie sein von Blatternarben entstelltes Gesicht sah, gab sich aber große Mühe, es nicht merken zu lassen. Mit dem Gewehr in der herabhängenden Hand trat der Mann näher.
Der Siedler richtete die Mündung auf ihn.
Der Mann blieb stehen. Sein Gesicht verzog sich zu einem Grinsen.
„Was wollt ihr?“, fragte der Besitzer der Hütte scharf.
„War ein Mann vor uns hier? Ein junger Kerl?“
Die Frau schaute ihren Mann an.
„Na?“ Der noch auf dem Pferd sitzende Mann lümmelte sich über das Sattelhorn.
„Ronco soll er sich nennen“, half der Blattnarbige weiter.
„Ja, er war hier“, sagte die Frau. „Aber wir konnten nicht wissen, dass ihn jemand sucht.“
„Wann war das?“
Die Frau schaute blinzelnd gegen die über den Bergen aufgetauchte Sonne, die bereits große Hitze ins Tal ausstrahlte und das Vieh veranlasst hatte, Schatten aufzusuchen. „Vor zwei oder drei Stunden.“
„Und wohin ist er?“
Die Frau deutete nach Süden.
„Hat er gesagt, welches Ziel er hat?“
„Nein.“
„Nannte er seinen Namen?“
„Nein, Mister. Er wollte nur etwas Proviant und hat einen halben Dollar dafür bezahlt.“
„Und wir brauchen ein Pferd“, erklärte der Mann im Sattel. Er schnalzte mit der Zunge und ritt näher heran.
Der Siedler wusste nicht, auf welchen der beiden er sein Gewehr richten sollte. Zudem trat der Blattnarbige dichter heran und schob die Waffe zur Seite, bevor er sie dem alternden Mann mit einem Ruck aus den Fingern riss.
Der Blattnarbige zeigte die Zähne, was seinem Grinsen eine teuflische Nuance verlieh. Der andere Verfolger Roncos warf den mitgebrachten Sattel direkt vor dem alternden Mann auf den Boden.
„Wir brauchen ein Pferd“, wiederholte der Blatternarbige. Er griff in die Tasche und warf ein paar goldene Münzen neben dem Sattel in den Sand. „Und wir bezahlen dafür. Vierzig Bucks. Mehr ist ein Gaul in dieser Gegend nicht wert.“
„Wir haben keine Pferde zu verkaufen“, entgegnete der Siedler.
Der Blatternarbige grinste ihn immer noch an. „Es ist doch schon bezahlt, alter Mann. Was redest du für dummes Zeug?“
„Ich brauche meine Pferde“, beharrte der Siedler. „Die Soldaten in Fort Bowie zahlen neunzig Dollar für ein gutes Pferd.“
„Hast du gute Pferde?“
„Es sind nur gute Tiere!“
„Umso besser.“ Der Blatternarbige drehte das Henrygewehr in der Hand hin und her, dann schleuderte er es über die Schulter. Es schrammte klirrend auf den Boden. Der Schuss löste sich. Das Krachen raste durch das Tal und weckte ein hundertfaches Echo. Die Pferde im Corral stoben am Zaun zurück. Die Rinder im Schatten der Felswand brüllten, blieben jedoch stehen. Die Frau und der Siedler waren zusammengezuckt. Der Kerl mit den bernsteinfarbenen Augen zog scharf die Zügel an, um sein Pferd zu bändigen.
Der Blatternarbige ging grinsend auf den Siedler zu. Der Mann wollte zurück, prallte jedoch gegen die Wand. Der Blatternarbige packte ihn und schmetterte ihm die Faust ins Gesicht. Zugleich ließ er los, der Mann taumelte in die Hütte und brach zusammen.
„Ist der ein Narr“, sagte der Blatternarbige zu der Frau, die grau aussah. Er spuckte auf den Boden, nahm seinen Sattel und ging zum Corral hinüber.
Der andere Fremde ritt seinem Kumpan nach. Der Blatternarbige hängte das Gatter aus und warf es einfach um. Er nahm ein Lasso, fing sich einen Rappen ein und sattelte ihn.
Der Siedler taumelte aus der Hütte. Seine Nase war geschwollen. Er blickte auf das Henrygewehr.
Seine Frau hielt ihn fest. „Lass sie! Es sind böse Menschen!“
Der Mann schaute zum Corral. Der Blatternarbige hatte den Rappen gesattelt und saß auf.
„Es ist mein bestes Pferd!‘‘, stieß der Mann hervor.
„Lass sie trotzdem! Solche Menschen töten auch, wenn es ihnen gerade einfällt!“
Der Mann fluchte leise, blieb aber bei der Frau stehen. Ihre Hände fielen von seinem Arm.
Die beiden Fremden trieben die Pferde an und ritten im Galopp zum südlichen Talausgang.
„Wir wollen Gott dafür danken, dass nichts weiter passiert ist“, murmelte die Frau.
2.
Eine riesige Dunst- und Staubwolke stand über der kleinen Stadt, die ich am frühen Nachmittag desselben Tages von einem Hügel aus südlich von mir sehen konnte. Die Wagenstraße der Butterfield Overland Mail durchschnitt das Nest von Norden nach Süden. Da unten, hinter den Kakteen und Ocotillos im Süden und Westen befand sich das Gebiet der Apachen, in dem die Armee ein großes Reservat einrichtete. Mehr schlecht als recht vegetierten die Indianer dort dahin. Ihres natürlichen Lebens in der freien Prärie beraubt, waren sie beinahe willenlose Objekte in den Händen gewissenloser Geschäftemacher geworden, die mit den Abfällen der vorgeschobenen Zivilisation versuchten, aus den Indianern herauszupressen, was von ihnen noch geholt werden konnte. Viel war es nicht.
Ich gab dem Braunen die Zügel frei, schnalzte mit der Zunge und ritt die Hügelflanke hinunter. Bald erreichte ich die Straße und folgte ihr.
Der Klang von Schüssen, Pferdewiehern und Menschengebrüll schallte aus der kleinen Stadt.
Am Wegrand war ein Pfahl in den Boden getrieben. Auf einem Brett darauf stand „Dry Camp“. Der Pfahl stand schief zum San Domingo Creek hingeneigt, der hier wieder in mein Blickfeld geriet.
Noch bevor ich die kleine Stadt erreichte, wurde mir klar, dass ich mitten hinein in ein Rodeo geriet, das offensichtlich schon seit Tagen im Gange war. Das konnte mir nur recht sein, da ich in dem bunten Treiben sicherlich kein Aufsehen erregte und vielleicht nicht einmal von den Menschen zur Kenntnis genommen wurde.
Vor der Stadt war ein Seilcorral aufgebaut worden, der, in mehrere Abteilungen untergliedert, Stieren, Pferden, Maultieren und mageren Longhorns als Aufenthaltsort diente. Sie wurden vermutlich für die verschiedensten Vorführungen gebraucht. Ein paar Cowboys mit ledernen Chaps über den Levishosen standen in der Nähe bei ihren Pferden, Zigaretten in den Mundwinkeln und die Hände auf den tief geschnallten Revolvern.
Ich ritt rasch vorbei und in den Trubel der Hauptstraße hinein.
Dry Camp bestand aus zumeist niedrigen Adobelehmhütten mit Flachdächern. Ein etwas korpulenter Marshal stand mit den Händen auf dem Rücken vor seinem Office.
Hastig saß ich ab, führte das Pferd und schob mich durch die Menge zur anderen Straßenseite, um dem Mann aus den Augen zu gehen.
Innerhalb eines hohen Brettercorrals galoppierte ein schwarz gekleideter Kunstreiter auf einem Wildpferd über den aufgewühlten Boden. Das Tier bewegte sich in Bocksprüngen vorwärts und krümmte den Rücken wie eine Katze. Der Kopf berührte fast den Boden. Es keilte aus, jagte an der Wand entlang und klemmte das Bein des Reiters ein.
Junge Männer, Weiße und Mexikaner, saßen rundum auf dem Zaun und brüllten anfeuernd.
Mitten im Corral warf das Pferd seinen Reiter ab und stob in die Box hinter einer Holztür, die geschlossen wurde. Der Reiter humpelte unter dem Gelächter der Schaulustigen hinterher.
Schnell führte ich den Braunen weiter.
Vor dem Saloon, einem hohen, zweistöckigen Adobelehmbau, prügelten sich torkelnde Cowboys, die ebenfalls von einer riesigen Menschenmenge angefeuert wurden. Der eine hieb seine Faust daneben und schlug gegen die Wand. Fenster klirrten.
Die Menge klatschte, und jemand rief: „Los, gib es ihm, Lemko!“
Doch der andere war genauso unsicher auf den Beinen und mit den Fäusten und schlug ebenfalls daneben. Er taumelte gegen den Widersacher. Beide gingen zu Boden.
Ich gratulierte mir noch einmal dazu, ausgerechnet hierher geraten zu sein. Es war ein Glücksfall für einen Mann, der untertauchen musste. Hinter dem Saloon fand ich einen Mietstall, in den ich den Braunen führte.
Der Stallmann saß mit mürrischem Gesicht in einer Ecke neben Eimern und von den Balken hängenden Zügeln, Lassos und Ketten im Stroh und schaute mir entgegen.
„Ich möchte das Pferd einstellen.“
Der Mann fluchte verhalten, erhob sich und trat mit schlurfenden Schritten näher.
Ich griff in die Tasche, lächelte verbindlich und gab dem Mann einen Dollar. Aber dessen Gesicht hellte sich deswegen nicht auf. Ich konnte mir denken, dass in diesen Jubeltagen der Stadt das Geld locker saß und ein Dollar nichts Besonderes sein musste. „Haben Sie noch ein Zimmer gekriegt?“
„Nein“, erwiderte ich.
„Kein Wunder. Alles vollgestopft mit Gaffern. Wenn Sie hier pennen wollen, kostet es noch einen Dollar.“
Ich zahlte ohne Umschweife, auch wenn der Preis eine Unverschämtheit war. Sie würden während des Rodeos in Dry Camp überall gewaltig hinlangen und abkassieren.
Das Gesicht des Stallmanns wurde freundlicher. Er nahm mir den Zügel ab und führte den Braunen in eine noch leere Box. „Sie können da hinten im Heu schlafen, Mister. Oder in einer freien Box, wenn Sie am Abend noch eine finden.“
„Danke.“
„Gehen Sie nur, und sehen Sie sich was an. Ich kümmere mich schon um das Pferd.“
Ich ging trotz dieser Worte hinter dem Mann her und sattelte den Braunen selbst ab.
„Das Gewehr können Sie hierlassen. Der Marshal sieht es nicht gern, wenn alle Leute bis an die Zähne bewaffnet durch die Stadt spazieren.“ Ich zog die Hand vom Gewehrkolben zurück, hängte den Sattel über die Trennwand und ging hinaus.
Neben dem Stall saßen Indianer auf dem Boden. Im Straßenstaub hatten sie ein paar alte, durchlöcherte, ehemals bunt gefärbte Decken ausgebreitet, auf denen sie aus Holz geschnitzte Figuren naiver Herstellung feilboten.
Ich ging schnell vorbei, um nicht in einen Handel verwickelt zu werden. Nach wenigen Yards erreichte ich bereits die nächste Attraktion. Ein Planwagen, fast genauso hoch wie lang, stand am Anfang eines von der Menge umringten Platzes. Am Ende stand eine kleine Bretterwand mit der Aufschrift Bigshot Dick Bullett ‒ Meisterschütze aus Arizona.
Es waren eine Menge Mexikaner um das Oval herum zu sehen. Ich dachte mir, dass sie sicher aus der Grenzregion hinter Fort Bowie stammten und nach dem Fest dorthin zurückkehren würden. Wenn ich mich unter sie mischte, musste es möglich sein, meine Spur endgültig und für immer zu verwischen.
Am bunt bemalten Planwagen sah ich die gleiche Aufschrift wie auf der Bretterwand. Aus dem Wagen kletterte ein junger, schwarzhaariger Bursche auf den Bock und sprang hinunter. Er hatte eine Handvoll Bowie Knifes dabei, als er in den Kreis trat.
Lautes Hallo begrüßte den jungen Burschen, der mit Levishosen, kariertem Hemd, hohem Hut und Texasstiefeln wie ein Cowboy gekleidet war, einen Patronengurt mit Holster und Colt trug und um den Hals ein brandrotes Halstuch gebunden hatte.
Ein zweiter Mann tauchte vor der Plane des Wagens auf, und abermals erfüllte das Hallo der Menge die nähere Umgebung.
Der Kunstschütze war ein großer, hagerer Mann mit kalt funkelnden Augen. Er trug einen Frack und auf dem Kopf einen Zylinder. Um seinen Leib spannte sich ein breiter Gurt mit funkelnden Geschossen in den Schlaufen. In zwei Holstern hingen schwere 45er an seinen Hüften.
Ich griff unwillkürlich nach dem alten Navy Colt, mit dem ich selbst bewaffnet war, und dachte, dass die Treffsicherheit dieses Mannes schon wegen der neuen Waffen bedeutend größer als meine eigene sein musste.
Der Kunstschütze mochte vierzig Jahre alt sein. Sein Gesicht erinnerte wegen der stark gekrümmten Hakennase an einen Falken. Aber auch sonst sah er alles andere als vertrauenerweckend aus.
Der Mann stieg vom Wagen und betrat das Oval zwischen den aufgespannten Seilen, das die Schaulustigen immer mehr zusammenschoben, bis es einen Schlauch zwischen dem Wagen und der Bretterwand glich.
Der junge Bursche gab dem Kunstschützen die Messer und stellte sich selbst an die Bretterwand. Er sah bleich aus, lächelte aber zuversichtlich.
In der Runde wurde es still.
Bullett, der Mann im Frack, wog das erste Messer in der Hand und warf es. Blitzend in der Sonne wirbelte die Klinge durch die Luft und bohrte sich neben dem Kopf des jungen Burschen in die Wand. Messer um Messer flogen hinter dem ersten her und rahmten den Körper des jungen Mannes ein.
Ein Sturm der Begeisterung brauste über den Wagen.
Der junge Mann zog eine Spielkarte aus dem Ärmel, hielt sie mit zwei Fingern in die Höhe und blickte auf Bullett.
Die Menge schwieg wieder.
Bullett zog beide Colts und feuerte zweimal. Beide Kugeln durchbohrten die Karte.
Neues Händeklatschen und Füßetrampeln. Staub trieb durch das längliche Oval.
Der junge Bursche warf eine Holzkugel in die Luft. Der Kunstschütze zog den linken Colt und feuerte. Von dem Geschoss zerfetzt, flogen die Stücke davon. In Pulverrauch gehüllt, nahm der Mann die neuen Ovationen der Menge entgegen.
Der junge Mann ging mit dem offenen Hut in der Hand herum und sammelte.
Ich sah, dass die Menschen nur Kupfermünzen in den Hut warfen, viele aber auch schnell verschwanden, um dem Bezahlen für die Vorstellung zu entwischen. Und so hatte ich den Verdacht, dass der Mann oder gar diese beiden Männer schwerlich davon leben konnten, mit dem Wagen von Rodeo zu Rodeo zu ziehen, ihre Künste vorzuführen und sich davon so gut zu kleiden, wie sie es hier zeigten.
Aber da das nicht meine Sache war, wandte ich mich ab und schlenderte weiter.
„Eine neue Vorstellung beginnt in wenigen Minuten, Leute!“, rief der junge Mann der sich rasch absetzenden Menge nach.
Belferndes Revolverfeuer schallte über die Straße. Schreie ertönten. Ich sprang gegen die weiße, von der Hitze aufgeladene Wand eines Hauses.
Reiter jagten schießend vorbei. Eine Frau drohte wütend hinter ihnen her.
Im Staub überquerte ich die Straße und steuerte eine kleine, überfüllte Kneipe an, um etwas zu trinken.
3.
Überrascht blieb ich stehen, als ich eine gute Stunde später den südlichen Stadtrand erreichte. Zwischen den schäbigen Bretterhütten der Ärmsten von Dry Camp stand der bunt bemalte Wagen des Kunstschützen. Bullett und sein junger Gehilfe sprachen mit zwei Mexikanern. Bullett warf dem einen etwas zu. Es funkelte wie eine Münze.
Die Mexikaner nickten und gingen davon.
Eine Frau zog ein kleines, weinendes Kind in eine Hütte. Die Tür schlug zu.
Das Viertel wirkte trotz des noch hellen Tages wie verlassen.
Ich trat zurück, um nicht bemerkt zu werden. Was mich hier interessierte, wusste ich selbst nicht. Doch dachte ich abermals an das Einsammeln der Kupfermünzen durch den jungen, wie einen Cowboy herausgeputzten Burschen. Ich schaute mir noch einmal genau den Wagen mit den beiden vorgespannten, prächtigen Pferden an.
Der Kunstschütze schob den Zylinder in den Nacken, lehnte sich an ein Vorderrad, steckte eine dünne Zigarre zwischen die Lippen und brannte sie an. Als er hinter sich schaute, trat ich noch weiter zurück und erreichte eine offene Haustür.
Ein älterer Mann in geflickter Kleidung stand drinnen und schaute mich an. „Suchen Sie was?“
„Nein.“
„Dann sollten Sie besser verschwinden“, sagte der Mann. „Hier gibt‘s nichts zu sehen.“
„Um was geht es denn?“
„Um nichts!“
Ich trat etwas von dem Haus weg und konnte den Wagen wieder sehen. Seltsam war das alles schon. Auch mein Interesse an diesen mir völlig fremden Menschen.
Dann erschienen die beiden Mexikaner wieder. An ihren durchlöcherten Strohhüten auf den rundlichen Köpfen erkannte ich sie sofort. Sie schleppten einen Indianer mit. Aber hinter den drei Männern tauchten noch mehr der in ausgebeulten Hosen und zerrissenen Hemden herumlaufenden Indianer auf. Sie trugen hohe Topfhüte mit Federn daran auf den nachtschwarzen Haaren. Die Indianer führten ein paar Maultiere mit sich.
Mit herrischen Bewegungen schickte Bullett, der Kunstschütze, die beiden offenbar nur als Vermittler fungierenden Mexikaner weg.
Noch immer ließ sich niemand aus den windschiefen Hütten sehen. „Allzu neugierig sein, ist oft tödlich“, sagte der Mann in der Hütte.
Ich war so gebannt, dass ich nicht mehr zuhörte.
Bullett sprach mit dem Indianer und rechnete offenbar an den Fingern etwas vor. Der Indianer nickte mehrmals, redete aber auch mit den anderen Stammesgenossen bei den Maultieren. Schließlich griff er unter das Hemd, brachte einen Beutel zum Vorschein, griff hinein und gab Bullett eine Handvoll goldener Münzen.
Der junge Bursche trat aufgeregt von einem Bein aufs andere. Schweiß brach ihm aus, als er auf das Geld blickte.
Bullett steckte die Münzen ein. Mit seinem Gehilfen und dem Indianer ging er zur Rückseite des Wagens und ließ den Jungen die Bordwand aushängen.
Die Apachen mit den Maultieren folgten ihnen.
Vom Wagen wurden zwei Kisten abgeladen und auf den Maultieren befestigt. Der Junge hängte die Bordwand ein. Die Indianer entfernten sich mit den Maultieren.
Mit einem Satz war ich an der Wand, als Bullett sich umdrehte. „Na, hat er Sie gesehen?“, fragte der Mann im Dunkel der Hütte.
„Nein, ich hoffe nicht.“ Vorsichtig schob ich mich vor und spähte um die Ecke.
Bullett schwang sich bereits auf den Bock, während der Gehilfe hinten noch mit der Befestigung der Planke beschäftigt war. Eine Peitsche knallte. Die Pferde zogen an. Der junge Kerl musste rennen, um den letzten Haken einhängen zu können. Er sprang, erwischte das überstehende Bodenbrett und kletterte in den Wagen.
Hinter einer Ecke verschwand das Gefährt.
Der Platz zwischen den jämmerlichen Hütten war wieder verlassen. Es dauerte nicht lange, dann öffneten sich verschiedene Fenster. Menschen blickten nach draußen.
„Sind sie weg?“, fragte der aus dem Haus schauende Mann, als die Geräusche der Hufe, Räder und der Peitsche verklangen.
„Ja.“
Der Mann trat ganz heraus. „Dann hatten Sie mehr Glück als Verstand, mein Freund.“
„War es Schnaps?“, fragte ich.
„Was?“
„Ob der Kunstschütze den Indianern Schnaps verkauft.“ Ich schüttelte den Kopf. „Verstehen Sie wirklich so schwer, oder wollen Sie nur nicht, Mister?“
„Mich geht das nichts an!“, maulte der Mann, drehte sich um und ging in die Hütte zurück.
Ich dachte an die Waffenschieber, denen ich auf die Schliche gekommen war. Was ich mit ihnen erleben musste, veranlasste mich, den Kunstschützen im Auge behalten zu wollen.
Die Tür der Hütte knallte zu. Die Leute übersahen diese Geschäfte und hatten vielleicht sogar Nutzen davon. Ein gelegentlicher Dollar ebnet viele Wege und lässt sehende Augen zeitweise blind werden. Das wusste ich freilich schon lange.
Ich folgte weiter der Straße und gelangte so aus der Stadt.
Die Indianer bewegten sich mit ihren Maultieren durch das Flimmern nach Süden. In der Hitze waberte es so sehr in der Luft, dass sich die Saguaro-Kakteen verzerrten und weite Wasserflächen das Sandland vor den Bergen zu bedecken schienen.
Einen Tagesritt entfernt lag Fort Bowie.
Die Indianer verließen mit den Tieren die Overlandstraße und verschwanden hinter den Ocotillos im Südwesten.
Ich schaute nach Osten. Dünner Staub trieb noch vor den jämmerlichen Hütten. Der Wagen schien diesen Weg genommen zu haben. Doch sehen konnte ich ihn nicht.
Der Mann lief hinter mir her, ergriff meinen Arm und schüttelte ihn.
„Junger Freund, kümmern Sie sich nicht um fremde Angelegenheiten. Das ist nicht gesund für Sie!“
„Kriegen Sie was dafür, wenn niemand die Geschäfte stört, die der Kunstschütze abwickelt?“
Der Mann ließ meinen Arm los. „Verrückt, was?“