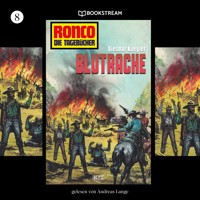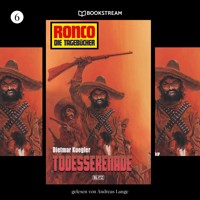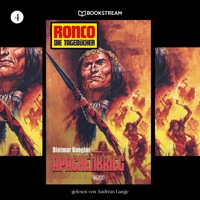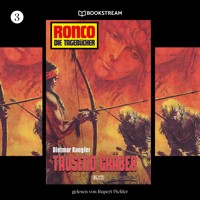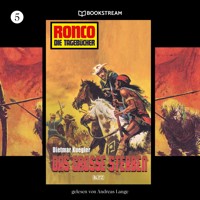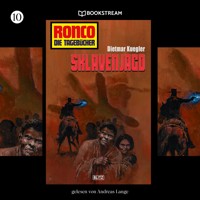3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)
- Sprache: Deutsch
Die Rurales hatten mich entdeckt. Sie preschten über die Hügel wie Schattenrisse von Todesengeln vor einem glühenden Horizont. Sie waren zu viert. Zu viele für mich.Der Kampf konnte kurz werden, aber ich war entschlossen, mich so teuer wie möglich zu verkaufen.Ronco, der weiße Apache, will zurück zu seinem Volk, den Chiricahuas. Der Weg führt direkt in die Hölle.Dieser Roman enthält die folgenden Romane:Todesserenade (11)Du musst kämpfen, Amigo (12)Die Texte wurden vom Autor überarbeitet.Die Printausgabe umfasst 248 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt
2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache
2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber
2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg
2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben
2706 Dietmar Kuegler Todesserenade
Dietmar Kuegler
Todesserenade
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2019 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-155-7Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Todesserenade
10. Dezember 1878
Ich reite nordwärts. Was hinter mir liegt, will ich schnell vergessen. Ich hatte geglaubt, mein Ziel fast erreicht zu haben. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass man sich nie zu früh freuen soll. Ich hatte es ja oft genug am eigenen Leibe erfahren.
Vor ein paar Tagen noch war ich so verflucht sicher. Zu sicher. Einige Tage lang schien Corpus Christi am Golf von Mexiko der Endpunkt meiner langen Flucht zu sein. Es war ein Irrtum. Mein Weg ist nicht zu Ende. Ich kann froh sein, noch zu leben.
Vieles an meiner jetzigen Situation erinnert mich wieder an meine Kindheit und Jugend, an das Jahr 1858, als mich nur mein blondes Haar und meine hellere Haut von einem waschechten Apachen unterschieden.
Damals, im Hochsommer dieses Jahres, hatte ich den Anschluss an meinen Stamm verloren. Die Krieger waren mit dem schwer verletzten Mangas Colorados weitergezogen, der in dem mexikanischen Kaff San Vincente von einem Arzt operiert worden war.
Ich war allein. Ich hatte nur eine Fährte von vielen unbeschlagenen Pferdehufen vor mir im Staub. Doch der beständig wehende Wind zerstörte bald auch diese Spur.
1.
Ich lehnte den Sharps-Karabiner an einen hüfthohen Felsbrocken. Er glitt daran ab und fiel klirrend zu Boden. Ich achtete nicht darauf, zog den Korken aus meiner Feldflasche, setzte sie an den Mund und trank einen Schluck von dem abgestandenen, lauwarmen Wasser. Nachdem ich die Flasche wieder verkorkt hatte, hielt ich sie an mein rechtes Ohr und schüttelte sie. Sie war fast leer.
Ich schaute mich um. Das Land war von der Sonne verbrannt, karg bewachsen, steinig und unwirtlich. Es sah nicht so aus, als würde ich bald auf Wasser stoßen und die Flasche neu auffüllen können.
Schweiß rann mir über Stirn und Wangen. Wind wehte von Süden wie ein Gluthauch der Hölle und trug den Staub in feinen Schleiern über das Land.
Seit zwei Tagen war ich unterwegs. Die Fährte vor mir, die die Apachen hinterlassen hatten, wurde schwächer und schwächer. Der ständig wehende Wind zerstörte die Abdrücke der unbeschlagenen Hufe im sandigen Boden. Die Spur führte schnurgerade nach Westen und schien weit vor mir in der Unendlichkeit zu versickern.
Die Sonne stand hoch, die Luft flimmerte und es war unerträglich heiß.
Ich hängte die Feldflasche an den Gürtel zurück und verschob den schweren Navy-Colt, der schräg in meinem Gürtel steckte und bei jeder Bewegung schmerzhaft gegen meine linke Hüfte drückte. Es war eine fleckige Waffe, die den Glanz der bläulichen Brünierung längst verloren hatte. Der Rahmen trug den Armeestempel. Im Griff steckten ein paar schmale Messingstifte, die ein S und ein H bildeten, vermutlich die Initialen des Soldaten, dem der Revolver einmal gehört hatte.
Ich bückte mich und hob den Sharps-Karabiner auf. Lustlos setzte ich mich wieder in Bewegung. Stiche durchzuckten meine Fußgelenke. Meine Mokassins waren nicht für lange Fußmärsche gearbeitet, und ich war das lange Laufen nicht mehr gewöhnt. Meine Fußsohlen schmerzten bei jedem Schritt. Ich biss die Zähne zusammen.
Obwohl ich gerade etwas getrunken hatte, war meine Kehle schon wieder trocken. Feinkörniger Sand knirschte zwischen meinen Zähnen.
Als ich den Hufschlag hörte, war ich keine zwanzig Schritte gegangen. Ich drehte mich um. In wenigen Hundert Yards Entfernung hing eine Staubwolke in der Luft, die rasch näher rückte.
Instinktiv begann ich zu laufen. Ich spürte auf einmal keine Schmerzen mehr in den Füßen. Ich lief leichtfüßig, als hätte ich stundenlang gerastet. Weit und breit gab es weder Baum noch Strauch und keine Deckung für mich.
Unvermittelt tauchte ein Arroyo vor mir auf. Ich rannte darauf zu. Als ich die Böschung erreichte, stolperte ich und schlug lang hin. Das Gewehr entfiel meinen Händen und rutschte klirrend über das scharfkantige vulkanische Geröll in das ausgetrocknete Flussbett. Ich selbst fand keinen Halt und stürzte hinterher. Meine Kalikohose zerriss, ich schrammte mir das rechte Knie auf. Mit dem Kopf prallte ich gegen einen Felsbrocken. Dann lag ich auf dem Grund des Arroyos, in den die Sonnenglut Falten und Risse gefressen hatte. In meinen Schläfen hämmerte das Blut. Mühsam raffte ich mich auf. Ich taumelte etwas. Der Hufschlag war lauter geworden.
Ich griff nach dem Sharps-Karabiner. Aus dem Schaft war ein handlanger Holzspan gebrochen. Ich fluchte leise und kroch die Böschung hoch, bis ich auf die Ebene hinausschauen konnte.
Da entdeckte ich die Reiter. Sie waren schon ziemlich nah und trugen grüne Uniformen. Es waren Rurales.
Eine kleine Patrouille nur, vier Mann. Zu viele für mich.
Sie hielten am Rand des Arroyos an, kaum fünfzig Yards von mir entfernt. Ich presste mich hart gegen die Böschung und wagte kaum zu atmen.
Der Wind trieb den Klang ihrer Stimmen und einzelne Wortfetzen herüber. Ein Pferd schnaubte.
Ich hätte gern ein Pferd gehabt, jetzt, in diesem Moment. Mit einem Pferd wäre alles leichter gewesen.
Ich dachte an meinen Braunen, diesen knochigen, hässlichen Armeehengst, der für mich das beste Pferd war, das es auf dieser Welt gab. Irgendeiner der Krieger würde ihn jetzt reiten. Vielleicht Little Friend, vielleicht Schnelltöter oder ein anderer. Es ist schon verrückt, an was man in solchen Situationen denkt.
Vor meinem Gesicht war plötzlich eine Spinne. Schwarz, mit dünnen hellen Streifen auf dem fingerkuppengroßen Körper. Sie turnte über das Gestein. Unwillkürlich zuckte ich mit dem Kopf zurück. Die Spinne streifte mich sacht und verschwand zwischen ein paar Steinen.
Hufschlag war wieder zu hören. Ich lauschte, bis er leiser wurde, und wandte den Kopf.
Die Rurales ritten westwärts. Sie hatten mich nicht bemerkt.
Erleichtert richtete ich mich auf. Ich strich mir mit der Rechten eine Haarsträhne aus der verschwitzten Stirn und wartete noch gut eine Viertelstunde im Arroyo, bevor ich ihn verließ und weiterlief. Von den Rurales war nichts mehr zu sehen.
*
Der kleine Rancho lag in der Dämmerung vor mir. Aus dem Kamin kräuselte sich Rauch. Die rot schimmernde Sonne spiegelte sich in den Fensterscheiben.
Im Corral neben dem Haus stand ein Pferd, ein brauner Wallach – genau das, was ich brauchte.
Ich schätzte meine Chancen ab. Sie waren nicht schlecht. Der Rancho lag in einer flachen Senke, in der Bäume und Buschwerk wuchsen. Die Abendsonne warf lange Schatten.
Ich beobachtete das Anwesen eine Weile. Dann huschte ich in die Senke hinunter. Es gab keine Schwierigkeiten. Nach kaum zehn Minuten lehnte ich an der Rückwand des Stalles. Ich lauschte auf den Hof. Dort war noch immer alles still. Ich fasste den Sharps-Karabiner mit beiden Fäusten und umrundete das einfache Holzgebäude.
Ein Eimer klapperte plötzlich, und ich erstarrte. Eine Tür wurde aufgestoßen, dann hörte ich eine Männerstimme und Schritte.
Schweiß rann mir in dichten Bahnen über das Gesicht. Dennoch fror ich. Ein paar Mücken tanzten über meinem Kopf, angelockt vom Geruch meines Schweißes. Ich rührte mich nicht.
Wieder klapperte ein Eimer. Quietschend bewegte sich die Winde am Brunnen.
Ich schob mich vorsichtig weiter vor. Sand knirschte unter Stiefelsohlen. Im selben Moment tauchte an der Stallecke ein Schatten auf.
Ein junger Mexikaner stand mir gegenüber. Er war noch keine zwanzig. Auf seiner Oberlippe wuchs dünner Flaum. Er trug ein löchriges Leinenhemd, das offen über seine viel zu kurze Hose hing. In den Händen hielt er einen Korb und mir war klar, dass er von einem nahen Holzhaufen Scheite hatte holen wollen.
Seine Augen weiteten sich, als er mich sah. Ich ließ ihm keine Chance. Ich sprang aus dem Stand auf ihn zu. Erst jetzt bemerkte ich die Steifheit meiner Glieder. Sie hatten vom langen Laufen ihre Geschmeidigkeit verloren. Trotzdem war ich schneller als der Mexikaner.
Er ließ seinen Korb fallen und vollführte eine Abwehrbewegung mit beiden Händen. Da stand ich schon vor ihm, riss die Sharps hoch und stieß ihm den Kolben mit aller Kraft in den Leib. Er riss den Mund weit auf. Ein scharfes Keuchen drang über seine Lippen. Die Augen quollen ihm fast aus den Höhlen. Ohne ein Wort beugte er sich nach vorn und presste beide Hände gegen den Magen.
Ich zögerte nicht und schlug ihm den Kolben in den Nacken.
Er fiel vor mir in den Staub, schlug mit dem Gesicht am Boden auf und war unfähig, den Sturz abzufangen. Stöhnend wälzte er sich auf die Seite, die Beine fest gegen den Leib gezogen. Sein Gesicht war zu einer Grimasse maßlosen Schmerzes verzerrt.
Ich lief an ihm vorbei zu dem Corral. Es waren nur wenige Schritte. Aber mir schien es so, als sei der Weg mehrere Meilen lang.
Ich kletterte die Corralstangen hoch und sprang in die Koppel.
Das Pferd hob den Kopf. Es schaute mich misstrauisch an und scheute. Ich roch nach ranzigem Fett, das ich mir als Sonnenschutz auf die Arme und den bloßen Oberkörper gerieben hatte. Der Wallach schien sich daran zu stören. Ich konnte keine Rücksicht darauf nehmen.
Er stieg jäh und wirbelte mit den Vorderhufen durch die Luft. Ich sprang hoch und packte das leichte Kopfgeschirr, das er trug. Er schleifte mich mit, als er sich unvermittelt herumwarf, aber ich ließ nicht los. Ich drückte ihm den Kopf nach unten und schwang mich auf den Rücken des Wallachs.
*
Der Junge fing plötzlich an zu schreien. Es war ein dumpfes, gequältes Brüllen, das sich aus seiner Kehle rang. Er lag noch immer am Boden, wälzte sich vor Schmerzen im Staub und versuchte, auf die Beine zu gelangen.
Ich trieb den Wallach an und ritt auf das Tor des Corrals zu. Am Fenster des kleinen Hauses erschien ein Mann. Ich sah das olivbraune Gesicht eines älteren Mexikaners verschwommen hinter den Scheiben, die das Licht der Abendsonne reflektierten.
Ich beugte mich auf dem Pferderücken nach vorn und riss die Verriegelung des Corralgatters auf. Dann trieb ich den Wallach auf den Hof.
Er war noch immer widerspenstig und versuchte, sich aufzubäumen Ich hämmerte ihm die Faust zwischen die Ohren. Da wurde er zahm. Zur selben Zeit sah ich den Mexikaner im Haus mit einem Gewehr am Fenster auftauchen.
Ich feuerte mit der Sharps. Der Rückschlag presste mir den Kolben hart an die Hüfte. Die Fensterscheibe zersplitterte unter der Kugel in tausend Stücke. Der Mexikaner dahinter verschwand. Im nächsten Moment sprang mich der Junge von der Seite an.
Sein Gesicht war schweißüberströmt und noch immer gezeichnet von heftigen Schmerzen. In seinen Augen glühte Hass. Er krallte beide Fäuste um mein rechtes Bein. Ich schlug mit der Sharps zu. Die eiserne Kolbenplatte traf den jungen Mexikaner auf den Schädel. Er grunzte wie ein sattes Schwein, als er rücklings zu Boden fiel. Dann ritt ich davon.
Weit gelangte ich nicht. Zwei Schüsse peitschten hinter mir. Eine Kugel strich sengend heiß an meinem Kopf vorbei. Die zweite streifte das Pferd an der Flanke. Es warf sich jäh herum und bäumte sich mit schrillem Wiehern auf. Ich hatte nicht damit gerechnet und wurde zu Boden geschleudert. Der Aufprall war hart. Brennend durchzuckte mich der Schmerz. Halb betäubt kam ich auf die Beine und sah durch einen rötlichen Nebel einen Mann vom Rancho heranlaufen.
Ich zog den Navy-Colt aus dem Gürtel, spannte den Hammer und feuerte.
Der Mexikaner drehte um und lief zurück. Ich schaute mich nach dem Pferd um. Der Wallach stand in etwa hundert Yards Entfernung und zupfte an den Spitzen des bräunlichen Grases, das am Rand der Senke wucherte. Es hatte wenig Sinn, hinter dem Tier herzulaufen. Ich hob meine Sharps auf, die ich beim Sturz verloren hatte, und lief zum Westrand der Senke.
Hinter mir krachte wieder ein Schuss. Die Kugel riss dicht neben mir eine hässliche Furche in den steinigen Boden und wirbelte eine Staubfontäne in die Luft.
Ich blieb nicht stehen, erreichte den Rand der Senke und lief auf die Ebene hinaus. Eine halbe Meile vor mir lag ein Waldgürtel. Die verglühende Sonne berührte bereits die Spitzen der Bäume. Ich rannte so schnell wie noch nie in meinem Leben und wunderte mich selbst darüber. Noch vor ein paar Minuten hatte ich mir eingebildet, die schmerzenden Füße nicht mehr heben zu können.
Wieder krachte ein Schuss. Die Kugel lag schlecht. Ich drehte mich gar nicht erst um. Dann klang Hufschlag auf.
Ich hatte gerade die Hälfte der Wegstrecke bis zum Wald zurückgelegt. Ohne anzuhalten, wandte ich den Kopf. Im Süden sprengten vier Reiter aus den Hügeln. Sie trugen große Hüte auf dem Kopf und grüne Uniformblusen. Es waren die Rurales, die ich gegen Mittag nach Westen hatte reiten sehen. Offenbar waren sie nicht weit geritten, vielleicht hatten sie mich sogar gesehen, wie ich im Arroyo gelegen hatte, waren weitergeritten und hatten im Hügelland gewartet, um herauszufinden, ob ich allein war oder ob sich weitere Krieger in der Nähe befanden.
Ich lief, bis ich kaum noch atmen konnte und Seitenstiche hatte. Die Sonne war bereits zur Hälfte hinter dem Wald versunken, als ich den Waldrand erreichte und ins Unterholz eindrang. Ich warf mich zu Boden, presste das heiße Gesicht ins kühle Moos und rang nach Atem. Meine Lunge schien zu platzen. Schwarze Punkte flimmerten vor meinen Augen. Mühsam richtete ich den Oberkörper auf. Ich langte nach der Feldflasche am Gürtel, riss den Korken mit fliegenden Fingern heraus und trank, bis sie leer war. Dann griff ich nach dem Gewehr. Ich öffnete die schwarze Ledertasche mit den Papierpatronen, klappte den Fallblock des Sharps-Karabiners hinunter und schob eine Patrone in den Lauf.
Auf der Ebene sprengten die Mexikaner durch die Dämmerung heran. Sie schienen zu glauben, leichtes Spiel mit mir zu haben. Diese Illusion würde ich ihnen nehmen.
2.
Sie schossen, obwohl sie mich gar nicht sehen konnten. Die orangefarbenen Mündungsblitze ihrer Gewehre zuckten wie Lichtfinger durch die sich verdichtende Finsternis. Die Reiter stoben heran, angestrahlt vom roten Glanz der Sonne, sodass sie wie scharf konturierte Schattenrisse wirkten.
Ich schoss nur zweimal, und ich zielte genau, denn ich musste Munition sparen.
Mit dem ersten Schuss traf ich ein Pferd in den Kopf. Das Tier stürzte im vollen Galopp und überschlug sich. Der Reiter wurde durch die Luft geschleudert, landete katzengleich auf den Beinen und stürmte schreiend auf den Wald zu.
Ich tötete ihn, als er noch zwanzig Yards vom Waldrand entfernt war. Das schwere Sharps-Geschoss wirbelte ihn einmal um die eigene Achse und warf ihn zu Boden.
Die drei anderen drehten ab.
Ich richtete mich auf, steckte den Navy wieder in den Gürtel, hob die leere Feldflasche auf und schulterte die Sharps. Dann drang ich tiefer in den Wald ein, obwohl meine Füße jetzt wieder heftig schmerzten und meine Knie manchmal vor Schwäche nachgaben.
Im Wald war es bereits dunkel. Ich konnte wenig sehen, stieß häufig an Bäume und lief mit dem Kopf gegen tief hängende Äste und Zweige. Aber ich blieb nicht stehen.
Irgendwann erreichte ich eine Lichtung. Das dichte Dach aus Blättern und Zweigen über mir öffnete sich. Ich sah den Himmel, an dem ein paar Sterne blinkten. Es war Nacht.
Ich blieb stehen und lauschte in die Dunkelheit. Es knackte im Unterholz. Wind raschelte in den Zweigen. Ein Vogel schrie, und der Flügelschlag einer Eule war zu hören. Es waren vertraute Geräusche, die in die Wildnis gehörten. Sonst war es still.
Ich ließ mich auf der Lichtung ins Gras sinken. Das Gewehr und den Colt legte ich griffbereit neben mich. Ich kramte eine von den eisernen Rationen hervor, die ich den toten Soldaten nach dem Kampf auf der Ebene von San Vincente abgenommen hatte.
Lustlos kaute ich den harten Zwieback, die getrockneten Früchte, das zähe Trockenfleisch. Ich war zu müde und zu erschöpft, um Hunger zu haben. Kraftlos sackte ich zurück, nachdem ich das karge Essen in mich hineingeschlungen hatte. Flach lag ich im Gras und schaute zum Himmel. Meine Sinne waren überreizt. Bei jedem verdächtig klingenden Geräusch zuckte ich zusammen. Nach und nach nur wurde ich ruhiger, meine innere Anspannung ließ nach.
Die letzten Tage waren ereignisreich gewesen, nachdem wir unseren Feldzug in Texas abgebrochen hatten und mit dem schwer verletzten Mangas Coloradas nach Mexiko zurückgekehrt waren.
Die Medizinmänner hatten versagt. Ein mexikanischer Arzt in San Vincente hatte Mangas Coloradas die Kugel aus dem Körper geholt und ihm das Leben gerettet. Nicht freiwillig, o nein. Wir hatten San Vincente erst erobern müssen.
Wir, das waren mehrere Hundert Krieger verschiedener Apachengruppen unter der Führung von Cochise, dem Oberhäuptling der Chiricahuas. Ich war ein Chiricahua, ein Apache, ein vollwertiger Krieger, obwohl ich erst knapp vierzehn Jahre alt war. Das war alt genug, um bei den Apachen als Mann zu gelten, und ich besaß bereits meinen Medizinbeutel.
Ein größenwahnsinniger Major der US-Armee war uns mit einer Kompanie Kavallerie über den Rio Bravo nach Mexiko gefolgt. Wir hatten ihn geschlagen, aber ich war in Gefangenschaft geraten und hatte erst entkommen können, als Rurales aufgetaucht waren und die amerikanische Kavallerie niedergekämpft hatten. Zu diesem Zeitpunkt aber waren die Apachen mit Mangas Coloradas bereits aus San Vincente abgezogen, um einem Kampf mit den Mexikanern aus dem Wege zu gehen, der unter Umständen Mangas Coloradasʼ Leben doch noch gefährdet hätte. So war ich zurückgeblieben und konnte von Glück sagen, dass ich überhaupt noch lebte. Deshalb war ich jetzt allein unterwegs, allein in Mexiko, in einem Teil des Landes, der mir völlig unbekannt war. Eine üble Situation, aber vorerst nicht zu ändern.
Wenn die Sonne aufging, würde ich weiterlaufen, falls die Rurales mir eine Gelegenheit ließen. Ich hoffte, sie würden sich mit einem Toten zufriedengeben, ahnte aber, dass das nicht so sein würde. Und ein Pferd hatte ich immer noch nicht.
Es waren also nicht gerade die besten Chancen, mit denen ich ausgestattet war. Aber darüber wollte ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht weiter den Kopf zerbrechen. Ich war zu erschöpft, und wenn ich am nächsten Morgen sterben sollte, so wollte ich vorher wenigstens ausgeschlafen haben. Es stirbt sich schlecht, wenn man müde ist.
*
Der erste Sonnenstrahl weckte mich. Es raschelte in einem nahen Gebüsch. Ich wälzte mich herum und war auf der Stelle hellwach. Meine Rechte glitt zu dem Navy-Colt, der neben meinem Kopf am Boden lag. Das Metall glänzte feucht vom Tau. Als ich mich mit dem Revolver in der Faust aufrichtete, sah ich einen Hasen davonspringen. Einen Moment juckte es mir im Zeigefinger, ihn abzuschießen. Allein der Gedanke an frisches Fleisch zog mir den Magen zusammen. Aber der Schuss hätte mich verraten. So steckte ich den Revolver zurück in den Gürtel. Ich erhob mich und nahm den Sharps-Karabiner auf. Ich aß ein wenig von dem zähen Trockenfleisch und nahm dann einen kleinen Stein in den Mund, den ich mit der Zunge hin und her bewegte, damit die Speicheldrüsen angeregt wurden und der Durst leichter zu ertragen war.
Über der Lichtung zerrissen die Nebelschwaden. Geblendet schloss ich die Augen, als das Frühlicht grell auf mich herunterflutete.
Ich schulterte den Karabiner und verließ die Lichtung nach Westen. Nach wenigen Schritten stieß ich auf einen Wildpfad, dem ich folgte. Ich gelangte ohne Schwierigkeiten voran. Nur mein Durst wurde stärker und stärker. Der Stein im Mund half ein wenig, war aber auf die Dauer natürlich kein Ersatz für einen richtigen Schluck Wasser. Wenigstens verhinderte er, dass sich die Mundhöhle entzündete.
Kurz vor Mittag, als vor meinen Augen bereits wieder schwarze Punkte tanzten und mein Kopf zu zerplatzen schien, stieß ich auf ein schmales Rinnsal. Ich stürzte mich gierig darauf, beherrschte mich dann aber und trank in kleinen Schlucken. Mein Gesicht war nass, und das Wasser rann mir in unzähligen kleinen Bächen über Kinn, Hals und Oberkörper, als ich mich aufrichtete. Ich fröstelte im ersten Moment, aber es tat gut. Es tat auch gut, dass Gewicht der neu gefüllten Feldflasche am Gürtel zu spüren, als ich weiterging.
Kaum eine halbe Stunde später stand ich am westlichen Waldrand. Vor mir erstreckte sich eine tellerartige Ebene, auf der kniehohes Büffelgras in dichten Büscheln wuchs. Dazwischen wucherten hüfthohes Dorngestrüpp und blühender Salbei. Hier und da ragten Pecan-Bäume aus dem Land.
Eine Meile im Westen buckelten sich grüne Hügel, im Süden erhoben sich kahle, rötlich-braune Felsmassive.
Die Ebene war menschenleer. Der Wind strich mit leisem Singen durch das hohe Gras.
Ich verließ den Schutz des Waldes. Meine Füße schmerzten jetzt wieder. Es war zu ertragen.
Die Sonne stand bereits hoch im Mittag. Die Hitze lastete auf dem Land und schien jedes Leben zu erdrücken. Ich hatte das Gefühl, Blei in den Gliedern zu haben. Mit jedem Schritt wurden das Gewehr, der Revolver und die Feldflasche schwerer. Nachdem ich fast eine Stunde in der Hitze dahingetappt war, verspürte ich den Zwang, einfach alles fortzuwerfen. Ich zog fast mit Gewalt die Schultern zurück und bemühte mich, an etwas anderes zu denken. Aber das Gewehr zerrte meinen rechten Arm wie ein Tonnengewicht nach unten.
Ich erreichte die Hügel, schleppte mich hinauf und drehte mich um. Da sah ich die drei Reiter.
Sie kamen vom Wald her. Es war so, wie ich es mir gedacht hatte. Sie hatten nicht aufgegeben. Sie hatten nur etwas länger gebraucht, um meine Spur zu finden, denn der Waldgürtel war groß, und sie hatten anscheinend die Ränder abgesucht.
Ich trank einen Schluck Wasser, drehte mich um und lief ins Hügelland. Eine Gruppe von Pecan-Bäumen tauchte vor mir auf. Ich rannte darauf zu und warf mich dahinter in Deckung.
Das Gras wucherte hier besonders hoch. Das Blätterdach der Bäume spendete Schatten. Es war die beste Deckung, die ich in diesem Moment finden konnte. Trotzdem standen meine Chancen mehr als schlecht. Die Rurales waren zu dritt. Ich war allein. Meine Vorräte waren begrenzt. Es gehörte nicht viel Verstand dazu, sich auszurechnen, wer am Ende siegen würde. Aber so leicht sollten sie mich nicht kriegen.
Ich würde kämpfen.
Die Zeit verstrich zäh. Die Minuten verrannen so träge wie flüssiges Wachs.
Dann hörte ich den Hufschlag, der vom hohen Gras etwas gedämpft wurde. Ich hegte keinen Zweifel daran, dass die Reiter, wenn sie mich vorhin nicht auf dem Hügel gesehen hatten, meine Spur im Gras gefunden hatten. Vielleicht ahnten sie noch nicht, wie nahe sie mir waren, vielleicht hatte ich Glück und konnte sie überraschen.
Sie waren plötzlich da. Der erste Reiter tauchte auf einem Hügel auf, bevor ich meine Sharps anlegen konnte. Ihre grünen Uniformen waren staubig und gezeichnet von dunklen Schweißflecken. Die Männer wirkten übermüdet, ihre Pferde abgetrieben und erschöpft.
Ich schoss, als sie kaum noch dreißig Yards entfernt waren. Es blieb mir gar nichts anderes übrig. Sie ritten direkt auf meiner Spur.
In dem Moment zog der Mann, auf den ich gezielt hatte, sein Pferd herum. Meine Kugel streifte ihn nur leicht am Hals. Er kippte nach hinten. Vor Schreck, nicht vom Anprall des Geschosses. Sein Pferd scheute. Er verlor den Halt im Sattel und stürzte rücklings ins Gras. Im nächsten Moment begannen die beiden anderen Reiter zu feuern.
Das heiße Blei pfiff über mich weg. Ich presste den Kopf tief ins Gras und spürte ab und zu den sengenden Luftzug der Kugeln im Nacken. Rechts und links von mir gruben sich die Geschosse in die Stämme der Pecan-Bäume und splitterten große Späne aus der Rinde.
Als sie nachladen mussten, hob ich den Kopf und legte meinen Karabiner an. Ich feuerte und traf eines der Pferde in die Brust. Es brach zusammen und begrub den Reiter unter sich. Der Mann schrie wie am Spieß. Ich feuerte wieder und verletzte ihn am linken Arm. Dann deckten mich die beiden anderen Männer wieder mit Kugeln ein.
Ich zog mich ein Stück zurück und blieb direkt hinter dem breiten Stamm eines Baumes liegen. Mir flogen die Späne der Rinde um die Ohren, aber das war nicht gefährlich. Ich trank einen Schluck aus meiner Feldflasche und lud meine Sharps auf. In der Ledertasche mit dem großen US-Stempel steckten jetzt noch fünfzehn Papierpatronen. Der Navy-Colt in meinem Gürtel war noch mit vier Kugeln geladen. Das war meine ganze Munition. Nicht gerade überwältigend. Ich gab mir selbst keine Chance mehr.
*
Die Rurales verfügten über reichlich Munition, so wie sie mich beschossen. Sie schienen das Gleiche von mir zu glauben. Außerdem schienen sie von meiner Treffsicherheit beeindruckt zu sein, denn sie trauten sich nicht näher. Immer, wenn einer von ihnen den Versuch unternahm, sich heranzuschleichen, gab ich einen Schuss ab. Das hielt sie mir vom Leib, und ich sparte Munition. Aber auf die Dauer war das keine Lösung für meine Lage.
Die Zeit verstrich. Die Sonne rückte langsam über den Zenit hinaus nach Westen. Meine Glieder wurden mit der Zeit steif vom Liegen.
Vor mir rührte sich wieder etwas. Ich hob den Karabiner an die Schulter und zielte in Richtung der Rurales. Die Spitzen des Grases bewegten sich dort. Ein Mann kroch auf allen vieren über den Boden. Ich konnte seinen Weg wenige Yards weit verfolgen, ohne ihn selbst zu sehen. Dann wurde es wieder still.
Ich fror plötzlich, obwohl die Sonne noch immer mit unverminderter Kraft vom Himmel brannte. Ich ahnte, was die Mexikaner sich ausgedacht hatten. Im Schutz der Hügel wollte einer in meinen Rücken gelangen.
Ich wandte den Kopf und beobachtete die Hügelrücken hinter mir. Da irgendwo musste gleich einer von den Rurales auftauchen. Mir blieben vielleicht noch zwei Minuten, vielleicht drei oder noch ein paar mehr. Dann hatte ich einen Gegner im Rücken, dem ich schutzlos ausgeliefert war. Ich saß in der Falle. Sie konnte jeden Moment zuschnappen.
Es blitzte plötzlich auf einem der Hügel metallisch im Sonnenlicht. Einen kurzen Moment nur. Dann bemerkte ich einen Schatten und sah die Krone eines Hutes. Wenig später schob sich ein Gewehrlauf durch das hohe Gras. Mir war jetzt alles egal. Ich war sicher, dass jetzt alles aus war.
Ich wälzte mich auf den Rücken und schoss, ohne zu zielen.
Ich traf. Es war wirklich ein reiner Glückstreffer. Das schwere Sharps-Geschoss prallte gegen den Lauf, der auf mich zielte, riss ihn hoch und wirbelte dem Mexikaner hinter dem Hügel das Gewehr aus den Fäusten.
Im selben Moment begannen die beiden anderen wieder zu schießen. Ihre Kugeln schlugen in die Pecan-Bäume oder rissen dicht neben mir lange Furchen in die Grasnarbe.
Die peitschenden Detonationen der Karabinerschüsse fingen sich zwischen den Hügeln. Stinkend erhob sich schmutzig grauer Pulverdampf, Hufschlag übertönte den Lärm der Schüsse. Ich ließ meinen Sharps-Karabiner sinken und zählte die Papierpatronen, die noch in der Ledertasche steckten. Es waren vier, und der Hufschlag signalisierte Verstärkung. Für wen, das war für mich keine Frage.
Aus den Augenwinkeln sah ich den Mexikaner, der versucht hatte, mich von hinten zu erschießen, auf einem Hügel auftauchen. Er hielt eine doppelläufige Reiterpistole in der rechten Faust. Ich kniete hinter einem Pecan-Baum und schob eine neue Patrone in den Lauf der Sharps. Noch immer kniend, feuerte ich aus der Hüfte und traf den Schnapphahn der Pistole. Die Kugel riss den Hahn ab und bohrte sich zusammen mit dem Hahn in die rechte Seite des Mexikaners. Er ließ die Pistole fallen, presste beide Hände auf die große Wunde, aus der das Blut wie aus einem Schlauch spritzte, und stürzte brüllend zu Boden.
Ich hatte nur noch drei Patronen und lud den Karabiner neu auf. Da sprengten zwei Reiter über die Hügel.
Ich erhob mich fast augenblicklich und verließ meine Deckung. Die beiden Rurales waren mir egal.
Die beiden Reiter waren Apachen. Meine Brüder.
Die Rurales erhoben sich ebenfalls und stürmten zu ihren Pferden.
Schüsse krachten. Die beiden Mexikaner taumelten. Der Sombrero des einen wirbelte durch die Luft. Dann sackte der Mann kraftlos wie ein Sack Lumpen zu Boden. Der andere schaffte es noch bis in den Sattel. Dort holte ihn eine Kugel ein. Er hielt sich dennoch, ließ sich nach vorn auf den Pferdehals fallen und trieb sein Tier an.
Wenig später war einer der Krieger neben ihm und schwang seinen Tomahawk. Ich wandte mich ab und lehnte mich erschöpft mit dem Rücken an einen Baumstamm.
Die beiden Krieger sprangen aus den Sätteln. Sie hielten ihre Gewehre im Hüftanschlag, als sie auf mich zuliefen. Misstrauisch schauten sie mich an, dann erkannten sie mich und ich sie.
Es waren Mimbreños aus dem Volk von Mangas Coloradas.
*
Es waren untersetzte Männer mit breiten Schultern und zerfurchten, narbigen Gesichtern. Sie trugen fadenscheinige Armeejacken, an denen die Rangabzeichen fehlten, und ausgebleichte Kalikohosen. Ihre hochschäftigen Mokassins reichten fast bis zu den Knien. Um die Hüften hatten sie sich Patronengürtel geschnallt. Sie waren staubig wie nach einem langen Ritt.
Ich hob matt die rechte Hand und zeigte zu dem Hügel hin, hinter dem der Rurale verschwunden war, den ich verwundet hatte. Einer der Krieger lief wortlos durch das Gras und verschwand hinter dem Hügel. Wenig später ertönte ein Schrei. Ein Schuss krachte. Es wurde wieder still. Ich fror auf einmal wieder.
„Wo kommt ihr her?“, fragte ich. „Seid ihr hinter den anderen her gewesen?“
„Cochise ist weit voraus“, sagte der eine. Er war höchstens achtzehn, sah aber zehn Jahre älter aus und nannte sich Mann-der-siegt.
„Wir waren auf der Jagd. Grünröcke tauchten auf, viele Grünröcke ...“
Er schwieg und blickte düster an mir vorbei ins Leere.
Ich verstand. Erst jetzt fielen mir die eingetrockneten Blutflecke an der Kleidung der beiden und die Schrammen in ihren Gesichtern auf.
„Ihr seid die Einzigen, die noch leben?“
„Ja.“
Der zweite Krieger war zurückgekehrt. Er lud seinen Karabiner, aus dessen Mündung sich ein dünnes Pulverwölkchen kräuselte. Mir fiel auch sein Name ein. Er hieß Mayos.
„Wie viele wart ihr?“
„Zehn.“
„Sind sie hinter euch her?“
„Vielleicht.“ Mann-der-siegt wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er blickte mich prüfend an. „Alle denken, dass du tot bist.“
„Ich habʼs auch schon fast gedacht.“
Ich reichte den beiden meine Feldflasche. Sie sahen nicht so aus, als hätten sie in den letzten vierundzwanzig Stunden etwas getrunken oder gegessen.
„Was ist mit meinem Pferd, mit meinem Gewehr?“
Sie zuckten mit den Schultern.
„Little Friend reitet dein Pferd.“
Ich war beruhigt. Little Friend würde den Braunen gut behandeln. Außerdem war ich ja bald wieder bei den anderen und würde den Braunen wieder reiten. Das hoffte ich. Das glaubte ich. Ich war sogar fest davon überzeugt.
Ich hatte ja jetzt sogar ein Pferd. Von den Tieren der Rurales lebten noch zwei. Der Fußmarsch hatte ein Ende.
„Habt ihr Hunger?“
Sie nickten. Ich gab ihnen den Rest der eisernen Rationen.
„Wie bist du davongekommen?“, fragte Mayos.
„Als die Mexikaner auftauchten, hatten die Langmesser keine Zeit mehr, auf mich aufzupassen. Als es dunkel wurde, bin ich zur Stadt gelaufen. Da wart ihr fort.“
„Mangas Coloradas sollte leben“, sagte Mann-der-siegt. „Ein Kampf wäre nicht gut gewesen in diesem Augenblick. Die Mexikaner waren zu stark.“
„Lebt er noch?“, fragte ich.
„Mangas Coloradas lebt. Aber es geht ihm nicht gut. Der Fiebergeist war in ihm, und Nochalo hat lange getanzt, bis es besser wurde.“
„Was wird nun werden?“
„Keiner weiß es.“
Mann-der-siegt gab mir die Feldflasche zurück. Er sprach mit vollem Mund, denn er stopfte sich gierig die eisernen Rationen hinein. „Vielleicht trennen wir uns wieder. Eine Gruppe geht nach dem Süden, eine nach dem Westen. Der Große Geist wird uns sagen, was wir tun müssen.“
Ich nickte. Ich war nicht mehr so überzeugt davon – wie ich es noch vor dem gescheiterten Feldzug nach Texas gewesen war –, dass der Große Geist immer recht hatte. Vielleicht hatte der Große Geist aber doch recht, und Nochalo, unser Medizinmann, war ein bisschen schwerhörig und verstand ihn nicht richtig,
„Reiten wir.“
Wir gingen zu den Pferden der Mexikaner. Ich suchte mir das Beste aus, einen stämmigen Schecken mit einer Rammsnase. Das andere Tier nahm Mann-der-siegt an den Zügel und zog es mit, als wir davonritten und die toten Mexikaner hinter uns zurückließen.
Die Sonne stand jetzt schräg über uns und hatte bereits einen rötlichen Schimmer. Ich war froh, wieder im Sattel sitzen zu können. Die Welt sah gleich ganz anders aus.
Wir ritten durch das Hügelland und erreichten ein kahles Steppengebiet, als die Sonne unterging.
Noch immer war es heiß. Der Wind war im Laufe der letzten Stunden immer schwächer geworden und brachte keine Kühlung mehr.
Die baumlose Steppe dehnte sich zu den Horizonten. Die Spur der Apachen, die Tage vorher durch das Land gezogen waren, war nun nicht mehr zu sehen. Das Steppengras, das die unbeschlagenen Hufe der gescheckten Ponys geneigt hatte, hatte sich längst wieder aufgerichtet.
Einmal kreuzten wir eine schmale Wagenstraße. Wir ließen sie rasch hinter uns. Es lag uns nichts daran, gesehen zu werden.
Als die Sonne hinter den Tafelfelsen im Westen versank, sahen wir eine Hütte vor uns.
Sie hatte ein flaches Dach und die Form eines Bauklotzes, den ein Riese achtlos in der Steppe liegen gelassen hatte. Sie wirkte wie ein Fremdkörper in dem flachen Land.
Wir ritten näher. Wir hielten unsere Waffen schussbereit in den Fäusten. Um uns war alles still. Auch der Wind schwieg. Über einem Mesquitebusch hatte sich ein Mückenschwarm zu einem dichten, zuckenden Gebilde geballt. Es war schwül. Ein Gewitter lag in der Luft. Über dem rot glühenden Sonnenball, der die Tafelfelsen im Westen in feuervergoldete Statuen verwandelte, zogen sich dunkle Wolken zusammen.
Die Hütte war aus einem Zweiggeflecht gebaut, das man innen und außen mit Lehm beworfen hatte, der im Laufe der Zeit hart wie Stein geworden war. Er hatte eine schmutzige, graue, unansehnliche Farbe. Zwei winzige Fenster gähnten uns entgegen wie die leeren Augenhöhlen in einem Totenschädel. Vor der Tür hing eine zerfledderte, löchrige Decke. Ein solches Bauwerk nannte man Jacal in Mexiko; es war üblicherweise eine Behausung sehr armer Leute.
Hinter der Hütte befand sich ein Brunnen, dessen Einfassung teilweise zerbrochen war.
Die Hütte war leer und unbewohnt. Wir fanden keine Spuren, die darauf hingedeutet hätten, dass hier vor kurzer Zeit noch Menschen gewesen waren.
Wir stiegen von den Pferden und betraten den Bau.
Im Dach waren ein paar Ritzen, durch die der Schein der Abendsonne drang. Die Hütte war einfach eingerichtet. An den Längsseiten standen mehrere einfache Pritschen mit löchrigen Pferdedecken. In der Mitte standen ein Tisch und vier Stühle. Ein fünfter Stuhl lag am Boden. Ihm fehlte ein Bein.
„Ein guter Platz für die Nacht“, sagte Mayos.
„Wir können vor Sonnenaufgang wieder aufbrechen“, sagte ich. Ich hatte Schmerzen am ganzen Körper. Die Strapazen der letzten Tage hatten mir ziemlich zugesetzt. Ich sehnte mich geradezu danach, auf einer der wackligen Pritschen zu schlafen.
Ich ging wieder hinaus und hobbelte die Pferde an. Mann-der-siegt holte Wasser vom Brunnen und tränkte die Tiere.
Ich hatte noch ein wenig von den eisernen Rationen bei mir. Wir aßen alles auf. Am nächsten Tag würden wir ein Stück Wild schießen müssen, um unseren Hunger zu stillen.
Die Sonne war untergegangen, als wir uns hinlegten. Zur selben Zeit ertönte in der Ferne der erste Donner.
Ich lauschte in die Nacht hinaus. Mann-der-siegt, der auf der Pritsche hinter mir lag, hörte nichts mehr. Er war sofort eingeschlafen. Ich hörte sein schweres Atmen.
Es donnerte wieder. Ich wälzte mich herum, schloss die Augen und versuchte, einzuschlafen. Mochte es doch donnern. Wir hatten ein Dach über dem Kopf.
Draußen kam plötzlich wieder Wind auf. Er strich mit leisem Singen um die Ecken der Hütte. Mir fiel erst jetzt auf, wie schwül es auch im Innern des Raumes war. Ich schwitzte stark und konnte nicht still liegen bleiben, weil ich dann das Gefühl hatte, noch mehr zu schwitzen. Ich rollte mich wieder auf den Rücken und starrte in die Finsternis der Hütte.