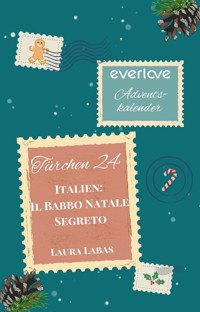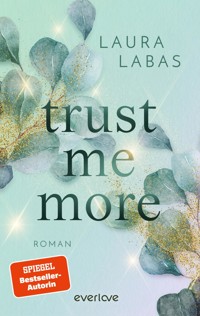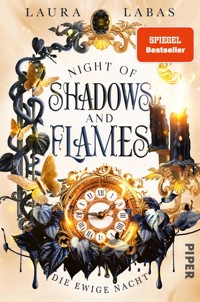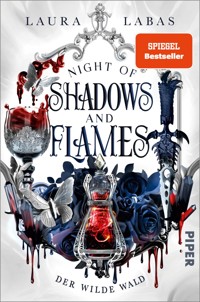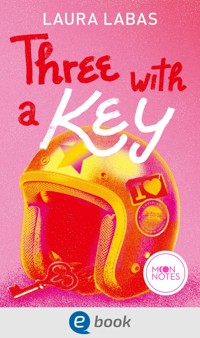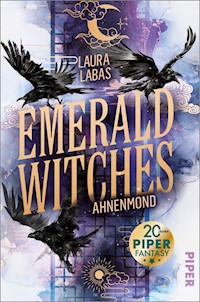9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
One Night in the City – eine New Yorker Rom-Com. Alles nimmt seinen Anfang, als die 20-jährige New Yorker Mathematik-Studentin Shiloh auf dem Weg zur Uni einem gestürzten Fahrradfahrer hilft. Zum Dank lädt Miles sie in das schicke Hotel in Brooklyn ein, wo er um die Hand seiner Freundin anhalten will. Das edle Büfett kann sich die chronisch unterfinanzierte Shiloh nicht entgehen lassen. Doch Überraschung: Miles wird von seiner Verlobten eiskalt abserviert, und so lässt er den Abend mit Shiloh ausklingen. Wieso die Honeymoon-Suite ungenutzt lassen? Die Wege der zwei – die es bei allen Unterschieden beide nicht gerade leicht haben mit ihren Eltern – trennen sich wieder. Aber zum Glück sind da ja noch der Zufall und die Stadt New York ... Zufällige Begegnung oder Schicksal? - Eine freche romantische Komödie: "Sex in the City" mit jungen Studierenden. - Authentisch unperfekte Protagonisten, die du lieben wirst. - New Girl meets Rich Boy in New York City. - Rasante und witzige Lovestory – ein Mix aus New Adult und Coming of Age.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
SIE KÖNNTEN UNTERSCHIEDLICHER NICHT SEIN. DOCH AUF DEN STRASSEN NEW YORKS STÖSST ZUSAMMEN, WAS ZUSAMMENGEHÖRT.
Ich rannte bereits, noch bevor ich realisierte, was ich tat. Der Instinkt, zu helfen, setzte augenblicklich ein, und ich fand mich neben dem Radfahrer auf dem Boden wieder. Die Hitze des Asphalts brannte auf meinen Knien, als ich die Hände nach dem Gesicht des jungen Mannes ausstreckte. Der Schatten seines Helms verdeckte seine Züge, und so erkannte ich erst nach einigen Sekunden, dass seine Augen geöffnet waren und er … lachte.
»Wie … geht es Ihnen?«, stotterte ich fassungslos.
»Prächtig«, sagte er und legte lachend seinen Kopf in den Nacken. »Absolut prächtig.«
Für Kathy
• KAPITEL1 •
from east flatbush to midwood
Lustlos blätterte ich in meinem Exemplar Einführung in die Mengenlehre herum und blickte auf die Wanduhr. Der rote Sekundenzeiger tickte und tickte, aber er bewegte sich nicht. Vielleicht war er kaputt. Es konnte unmöglich immer noch zehn nach acht sein.
Professor Wahlberg zeichnete den axiomatischen Beweis, den wir bereits in der letzten Stunde kennengelernt hatten, an die Tafel, und alle zwölf Studierende der Abendschule lauschten aufmerksam seinen Worten. Nun, alle außer mir. Ich unterdrückte ein Gähnen und wandte mich wieder der verzauberten Wanduhr zu.
Die Arbeit in der Privatdetektei Goldbloom&Son hatte mich geschafft. Dabei musste ich nicht viel mehr machen, als Akten zu sortieren und unsere Klientel mit Kaffee zu versorgen. Vermutlich war es die Eintönigkeit, die mir meine Energie raubte.
Oder der Gedanke, am Montag wieder dort aufzutauchen, nachdem ich heute ein ganzes Tablett mit Kaffee und Plätzchen auf einen Auftraggeber geworfen hatte. Das war nicht absichtlich geschehen. Wieder einmal hatte ich mir selbst mit meinen zwei linken Füßen im Weg gestanden.
Eigentlich gab ich mir Mühe, Mr Goldbloom keine Probleme zu bereiten und ihn in allem zu unterstützen, aber als Sekretärin eignete ich mich einfach nicht. Ich hasste es, Menschen zu empfangen und so lange Nettigkeiten mit ihnen auszutauschen, bis sie an der Reihe waren, dem Privatdetektiv ihr Leid zu klagen und ihr Anliegen zu unterbreiten. Trotzdem bemühte ich mich, da ich den Job behalten wollte, um die Miete zahlen zu können. Deshalb fühlte ich mich miserabel, dass mir ein Missgeschick wie dieses passiert war.
Viertel nach acht.
Wahrscheinlich sollte ich erleichtert sein, dass ich nicht rundheraus gefeuert worden war. Dafür wäre allerdings am Montag auch noch Zeit, nachdem Mr Goldbloom reichlich Gelegenheit gehabt hätte, sich die Situation während des Wochenendes wieder und wieder vor Augen zu führen.
Ich raufte mir die Haare.
Zwanzig nach acht.
Am besten, ich dachte nicht mehr darüber nach. Letztlich würde ich nichts an seiner Entscheidung ändern können. Ich hatte mich mehrmals entschuldigt und konnte nur hoffen, dass er zumindest mein Talent beim Verschriftlichen der Briefe zu schätzen wusste.
Seufzend versuchte ich, mich wieder auf den Unterricht zu konzentrieren. Vergeblich.
Ich studierte gern Mathematik, aber es ermüdete mich. Vor allem die Tatsache, den anderen dabei zuzuhören, wie sie nacheinander den gleichen Beweis erklärten, den ich am Nachmittag vorher bearbeitet hatte. Es brachte mich nicht weiter, die Lösung aus ihren Mündern zu hören, wenn ich doch selbst längst darauf gekommen war. Gott sei Dank hatte ich bei Wahlberg nur einen Kurs am Freitagabend und musste mich nicht öfter durch seine langweilige Lehrstunde quälen. Für die anderen Fächer konnte ich mehr Begeisterung aufbringen …
Fünf vor halb neun.
Leise packte ich Buch und Heft in meinen Rucksack und schlich mich geduckt aus dem müffelnden Raum. Wie auch im restlichen Betonklotz gab es hier Schimmel und Nester aus längst vergessenem Müll hinter quietschenden Türen. Dreckverkrustete Fenster und flackernde Neonröhren gehörten genauso zum alten Gebäude wie farbverschmierte Wände und Konzertposter aus dem vorletzten Jahrzehnt. Für ein mittelmäßiges College in New York mit Gebühren, die einen nicht in den Ruin trieben, ganz normal.
Ich nahm mir vor, auf dem Weg nach Hause ein paar Einkäufe zu erledigen. Glücklicherweise befand sich das College ebenso wie meine Wohnung in Brooklyn, sodass ich nur wenige Stationen mit der Metro fahren musste. Von East Flatbush bis nach Midwood brauchte man um diese Uhrzeit nur eine halbe Stunde, und schräg gegenüber von meinem Apartment, das ich mir mit einer Mitbewohnerin und einem Mitbewohner teilte, hatte freitags bis spätabends noch ein Glatt Mart auf. Ich müsste mir nur überlegen, auf was ich Appetit hatte. Fertignudeln wahrscheinlich. Wie jeden Abend.
Ich war eine Niete im Kochen und würde mich nur im alleräußersten Notfall daran wagen, etwas anderes als Nudeln mit Tomatensoße zu kochen.
Kurz dachte ich nach. Vielleicht würde ich auch noch einen Wein mitnehmen, falls Bitsy an der Kasse stand. Sie fragte nicht nach meinem Ausweis. Nur noch fünf Wochen, bis ich einundzwanzig werden würde.
Mit diesem Plan im Hinterkopf besserte sich meine Laune. Lächelnd schlenderte ich zur nächsten Metrostation. Dabei achtete ich kaum auf den Verkehr, da ich auf meine Hände hinabsehen musste. Ich frickelte das Kabel meiner Kopfhörer auseinander und steckte den Anschluss in mein Smartphone der vorvorletzten Generation. Nach einem kurzen, aber durchdringenden Knirschen hüllte mich die Stimme von Lewis Capaldi ein.
Obwohl mir seine Songs manchmal zu traurig waren, regten sie mich zum Nachdenken an. Dann führte ich Selbstgespräche über seine Songtexte, für die normalerweise Mitmenschen nötig gewesen wären. Mitmenschen waren mir jedoch viel zu anstrengend. Meistens logen sie, und überhaupt war es einfacher, allein zu sein. Allein kam ich sehr gut zurecht. Ich brauchte weder Freunde noch Familie, die etwas von mir erwarteten. Ob nun Geld, Aufmerksamkeit oder Zeit. All dies gehörte mir. Niemand sonst hatte Anspruch darauf. Niemand sonst besaß die Macht, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, weil ich nicht genug für meine Karriere tat. Weil ich keine glatten Einsen nach Hause brachte oder mich nicht um ein besseres Praktikum bemühte.
Ich wollte einfach ich sein. Die einzige Person, der ich Rechenschaft ablegen musste, war ich selbst. Jahrelang hatte ich einstecken müssen. Während meiner Kindheit hatte ich jeder Forderung meiner Eltern nachgegeben.
Ich sollte montagabends zum Geigespielen? In Ordnung. Donnerstag direkt nach der Doppelstunde in Latein zum Volleyball? Sicher. Sonntag Bibelstunde und anschließendes Ehrenamt im Seniorenkomplex? Das konnte ich ja nicht ablehnen, weil es mich als trotzige Göre hätte dastehen lassen. Doch genauso wenig konnte ich Nein sagen zum Tennisspielen, zum Italienischlernen oder zum Chor.
Jede Stunde, jede Minute meines Lebens hatten meine Eltern für mich geplant. Ich musste lediglich am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt sein und tun, was sie mir auftrugen. Mehr erwarteten sie nicht.
Das und eine Karriere als Juristin in der freien Wirtschaft, die uns reich machen sollte. Mein Zwillingsbruder Troye hatte damals genauso gelebt wie ich. Im Gegensatz zu mir sollte er jedoch als Chirurg die Familienschulden zurückbezahlen.
Familienschulden …
Unwillkürlich stieß ich ein abfälliges Lachen aus und wurde mit argwöhnischen Blicken der anderen Fahrgäste bedacht. Nein. Ein selbstbestimmtes Leben hatten wir beide nicht geführt, doch offensichtlich hatte es mir mehr ausgemacht als Troye.
»Für jeden von uns gibt es bloß ein einziges Leben, Shiloh. Was spricht dagegen, das Beste daraus zu machen?«, war Moms Standardargument. Und dann: »Im Gegensatz zu euch wurden uns keine Chancen gegeben. Niemand hat sich um unsere Bildung oder um unsere Zukunft gekümmert. Sei dankbar, dass wir euch derart unterstützen.«
Sei dankbar.
Sei dankbar.
Sei.
Dankbar.
Ich kniff die Augen fest zusammen, stand am Gleis und hoffte, die bösen Gedanken wie Geister vertreiben zu können. Hatte ich nicht mit der Vergangenheit abgeschlossen? Meine Eltern hatte ich seit meinem Abschluss vor einem Jahr nicht mehr gesehen. Sie bestimmten nicht mehr über mich. Nur so konnte ich die Bitterkeit über meine freudlose Kindheit von mir abstreifen wie einen zu klein gewordenen Mantel.
Jemand rempelte mich an.
»Hey!«, rief ich ihm nach, aber er war schon in die Metro gestiegen. Resigniert ging ich durch eine andere Tür und suchte mir einen Stehplatz, wo die Menschenmenge eine kleine Lücke ließ. Mein Blick schweifte über die Passagiere. Ich registrierte ihre traurigen, freudigen und gelangweilten Mienen, nahm ihre Kleidung wahr sowie ihre Körperhaltung. Selbstbewusst und stark, eingeschüchtert und ängstlich. Hoffnung und Träume waren in ihre Gesichter gezeichnet. Der Wunsch auf einen besseren Tag. Der Wunsch auf ein Ende ihrer Sorgen.
Im Glatt Mart schlenderte ich mit rotem Einkaufskörbchen durch die Gänge, da ich nicht unter Zeitdruck stand. Wie immer steuerte ich irgendwann das Regal mit den Instantnudeln an und nahm einmal jede Sorte. Kulinarisch nicht sonderlich ausgefeilt, aber am Ende des Monats bedankte sich mein Bankkonto. Und meine Küche, weil ich sie nicht versehentlich in Brand setzte.
Es war nur eine Kasse geöffnet, hinter der leider nicht Bitsy saß, und deshalb gab es auch keinen Wein für mich. Ich stellte mich hinten an die Schlange, die an der Zeitschriftenauslage entlangführte. Auf mehreren Magazinen war das Gesicht eines jungen Mannes abgebildet.
Der zweite Totalschaden. Dieses Mal als Beifahrer. Miles …
Ich verdrehte die Augen. Meistens ging es um diese Sorte Mensch: Die Erben reicher New Yorker Familien, die nicht wussten, was sie mit ihrem Geld oder Leben anfangen sollten. Ihre Losgelöstheit von den Regeln Normalsterblicher führte zu Verantwortungslosigkeit und Zerstörungswut.
Genervt wandte ich mich ab. Sicher. Ich hatte kein Problem, das zuzugeben: Ich war auch neidisch. Darauf, dass diese reichen Erben von klein auf all das hatten, was meine Eltern so gern haben wollten, doch ohne dafür etwas tun zu müssen.
Nachdem ich genau neunzehn Dollar bezahlen musste, überquerte ich die Kreuzung, an der es schon öfter Unfälle gegeben hatte. Autofahrer sahen den Übergang viel zu spät, und die Ampelschaltung war so knapp gestellt, dass die langsam gehenden Anwohnerinnen und Anwohner im schlimmsten Fall angefahren wurden. Heute gab es bloß ein lautes Hupkonzert, als würde die alte Dame absichtlich lange brauchen, um die Geduld der im Auto Sitzenden zu testen.
Kopfschüttelnd schloss ich die Tür zum Treppenhaus auf, das von grellem Licht geflutet war. Kurz vorher musste anscheinend schon jemand angekommen oder gegangen sein, denn das Licht brannte, bis ich das Apartment im obersten Stockwerk erreichte. Erst als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, brach die Dunkelheit über mich herein. Lewis Capaldi verabschiedete sich dabei mit einer hohen Note.
Früher hatte eine andere Person mit meinen beiden Roomies hier gewohnt. Als sie gegangen war, war mein jetziges Zimmer frei geworden, und ich hatte es mir geschnappt. Ich hatte nicht nachgefragt, aber aus den Gesprächen von Nick und Bronwyn wurde ersichtlich, dass vor mir ein Mädchen namens Claire hier gewohnt hatte. Anscheinend waren sie zu dritt von Louisiana nach New York gezogen, doch Claire war nur ein Jahr später zurückgegangen. Auch wenn ich neugierig war, hatte ich nie dem Impuls nachgegeben, mich nach ihr oder der Vergangenheit von Bronwyn und Nick zu erkundigen. Wir lebten in einer Zweckgemeinschaft.
Zumindest was meine Rolle betraf. Soweit ich wusste, waren Bronwyn und Nick Besties, auch wenn sie sich gelegentlich in die Haare kriegten.
An diesem Abend saßen sie im Wohnzimmer beisammen und sahen sich einen Horrorfilm an, den ich an der Musik und dem Gekreische erkannte. Ich warf einen kurzen Blick in den rechteckigen Raum mit der kahlen Backsteinwand und der zusammengewürfelten Einrichtung. Obwohl ich nur für eine Sekunde reinschaute, entdeckte mich Bronwyn und sah von ihrer Position am Ende des Ledersofas auf.
»Hey, Shiloh! Willst du nicht mitgucken?«, lud sie mich ein. Bronwyn war sehr hartnäckig. Sie ließ sich nie von meinen abweisenden Antworten entmutigen und versuchte immer wieder, mich in ihre Aktivitäten einzubinden. Schon öfter hatte ich mich gefragt, was sie davon abhielt, mich rauszuwerfen, wenn sie doch jemanden haben wollte, der sozialer war als ich.
Bei der günstigen Miete würde man sehr schnell eine Nachfolgerin finden.
»Nein, danke«, sagte ich mit einem Blick auf Nick, der kurz vorm Einschlafen war. Auf seiner Wange blühte ein neuer Bluterguss auf. Bei seiner Arbeit als Stuntman bekam er hin und wieder was ab.
Fast tat er mir leid, weil er von Bronwyn dazu gezwungen wurde, wach zu bleiben und sich diesen Schund anzugucken. Das Blut sah nicht mal realistisch aus, wie es da aus dem Opfer herausspritzte.
Bronwyn zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder dem Flachbildfernseher zu, den ich für sie in die Wohnung hatte tragen müssen. Das erste und einzige Mal, dass ich ihr geholfen hatte. Ich war von ihr eines Abends überrumpelt worden, und bevor ich mir meine eigenen Prinzipien in Erinnerung hatte rufen können, war ich bereits als Tragehilfe eingespannt worden.
In der engen Küche mit dem geblümten Linoleum, in der vergilbte Schränke, ein Herd und ein Kühlschank Platz fanden, stellte ich den Wasserkocher an und verstaute meine Einkäufe. Durch das schmale Oberlicht gelangte genug Licht der Straßenlaterne in den Raum, sodass ich die Deckenlampe nicht benötigte. Sie funktionierte ohnehin nicht, da vor ein paar Tagen die Glühbirne durchgebrannt war. Niemand von uns dreien war gut darin, die Wohnung instand zu halten.
Mit den dampfenden Nudeln in einer Schale stieg ich wenig später durch das Fenster in meinem Zimmer auf die Feuertreppe, auf die ich diverse Grünpflanzen gestellt hatte. Eigentlich war das verboten, aber weder der Vermieter noch der Verwalter verausgabten sich damit, jemanden im Haus zu maßregeln. Im Notfall würde ich die Pflanzen einfach runterwerfen, und schon war der Fluchtweg wiederhergestellt. Bevor es so weit käme, würden wir aber ohnehin an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein, da es keine Rauchmelder gab, die uns vor einem Feuer warnen würden.
Während meine Nudeln noch einweichten, nahm ich mein quietschgelbes Tagebuch zur Hand und schrieb im Schein der Straßenlaternen auf, wofür ich an diesem Tag dankbar war.
Ich hatte meine Arbeit bei Goldbloom&Son erledigt, auch wenn ich wieder mal einen Fehler gemacht hatte. Meine Hausarbeit für Funktionstheorie war mit einer Eins benotet worden.
Nein. Ich strich den letzten Satz wieder. Gute Noten sollten für mich kein Grund mehr sein, dankbar zu sein. Davon hing mein Glück nicht ab.
Es gab jedoch noch etwas Positives. Meine Eltern hatten mich nicht gefunden … Dafür war ich wahrscheinlich am dankbarsten. Denn ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass ich unfähig gewesen wäre, sie zu ignorieren. Ich hasste und liebte sie. Wollte ihre Anerkennung, und gleichzeitig sollten sie vergessen, dass ich je existiert hatte.
Was Troye anging … Mit ihm schrieb ich hin und wieder Nachrichten, doch ich hatte ihm nicht gesagt, wo ich wohnte. Aus Angst, er würde hier eines Tages auftauchen, um mich zurückzuholen.
Lautes Hupen drang bis zu mir nach oben, und mein Blick fiel automatisch auf die Kreuzung, die ich aus der Ferne kaum erkennen konnte, ohne mir den Nacken halb zu verrenken. Meine Gedanken wanderten zu den Zeitschriftenartikeln und dem darin beschriebenen Autounfall. Im Gegensatz zu den reichen Arschlöchern wusste ich wenigstens, was für ein Glück sie hatten. Dass sie mit einem Silberlöffel im Mund geboren worden waren. Sie ahnten nicht mal, wie hart das Leben hier unten war.
Das Hupen verebbte, und ich aß meine Nudeln. Da ich an diesem Abend nichts mehr vorhatte, ging ich früh zu Bett. Nicht dass ich glaubte, mit meinen Sorgen sonderlich viel Schlaf zu bekommen, aber je länger ich im Bett lag, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass es doch klappen könnte.
Mein kleines Nachtlicht in der Form eines Blauwals erleuchtete mein Zimmer, das drei Backsteinwände hatte und eine Wand mit cremefarbener Tapete. Es gab nicht viel, aber in den letzten Monaten hatte ich trotzdem einige Möbel zusammentragen können. Ein breites Bett mit Echtholzrahmen, einen Fernseher auf einer dunklen Konsole und eine Kommode neben der Tür. Außerdem ein alter Schreibtisch, den ich vor dem Sperrmüll gerettet hatte, sowie ein antik anmutender Kronleuchter, der an der Decke unter dem Ventilator hing, und ein bunter Webteppich.
Ich legte mich auf die Seite und beobachtete die Schatten, die meine Möbel an die Wände warfen. Ein weiterer Tag war geschafft. Es war alles gut.
Gib nicht auf, Shiloh.
Noch eine ganze Weile starrte ich so ins Nichts und hoffte, heute von keinem Albtraum heimgesucht zu werden. Es war nicht so, als hätte ich ein Trauma durchlebt, das mich bis in die Gegenwart verfolgte. Doch Nacht für Nacht träumte ich davon, wieder unter dem Dach meiner Eltern zu leben und nicht sprechen zu können. Meine Lippen waren zugenäht. Ich war an einen Stuhl gekettet und musste tun, was sie mir auftrugen. Das erwartete mich jedes Mal, wenn ich die Augen schloss. Es gab kein Entkommen.
»Ein Brief für dich«, sagte Bronwyn mit vollem Mund am nächsten Morgen und hielt mir einen weißen Umschlag hin. Sie saß am kleinen Tisch in der Küche, an den genau drei Stühle passten. Zögerlich nahm ich den Brief an. Meine Hand zitterte. »Wieder von deinem Dad?«
Ich machte ein unbestimmtes Geräusch.
Meine Eltern hatten zwar nicht meine richtige Adresse, aber ich hatte ihnen auf Troyes Nachfrage ein Postfach genannt. Bronwyn war so freundlich gewesen, ihres mit mir zu teilen, weil ich dafür ehrlicherweise kein Geld aufbringen konnte.
Gerade hielt sie die Müslischüssel an ihre Lippen, um die letzten Reste auszuschlürfen. Sie ließ mich dabei nicht aus ihren grüngelben Augen, die mich immer an die einer Katze erinnerten. Ihr honigblondes Haar hatte sie zu einem unordentlichen Knoten auf dem Kopf zusammengebunden, aus dem ihr ein paar Strähnen ins hübsche runde Gesicht fielen.
In Momenten wie diesen, wenn sie so in ihren alten Joggingklamotten dasaß, erinnerte sie mich an eine nicht ganz perfekte und doch wunderschöne Puppe. Etwas kleiner als der Durchschnitt, mehr Rundungen, als ihr lieb waren, um die ich sie jedoch beneidete, und mit einem Charisma, von dem man vielleicht erst nach einer Weile gefangen genommen wurde. Dann aber würde man sich ihm nicht mehr entziehen können. So ging es mir. Es wurde immer schwerer, den Abstand zwischen uns nicht zu überbrücken.
»Ganz schön altmodisch von ihm, Briefe zu schreiben«, meldete sich Nick zu Wort. Er hatte die Küche betreten und knallte seinen Armeerucksack auf den Tisch. Es hätte nicht viel gefehlt, und die Schüssel, die Bronwyn gerade erst abgestellt hatte, wäre zu Boden gescheppert.
»Pass doch auf!«, rief sie.
»Räum deine Sachen anständig weg«, entgegnete er. Jedes Mal, wenn er und Bronwyn sich unterhielten, troff es nur so vor Südstaatenakzent. Die Vokale wurde in die Länge gezogen und gleichzeitig miteinander verbunden. »Jedes Mal, wenn ich von einem Dreh zurückkomme, ist die Wohnung noch gammeliger.«
»Such dir doch eine neue WG.« Sie schmollte für ein paar Sekunden und verschränkte die Arme, ehe ihre Gesichtszüge weicher wurden. »Gosh, sieh zu, dass du zurückkommst.«
»Du kannst dich auch nicht entscheiden, hm, Darlin’?«
Anscheinend brach Nick heute wieder zu einem Dreh auf. Sein Job führte ihn an die verschiedensten Orte, und manchmal war er wochenlang unterwegs. Gern würde ich ihn fragen, wohin es als Nächstes ging, aber das würde er als freundschaftliches Interesse auffassen, und ich wollte keine Freundschaft.
Deshalb schwieg ich und beobachtete ihn lediglich dabei, wie er seine Turnschuhe anzog und Bronwyn lächelnd durch die Haare wuschelte. Sie schlug ihm gegen die Schulter, ehe sie die Kapuze seines Shirts über sein zimtbraunes Haar zog. Auf sein gebräuntes Gesicht legte sich ein Schatten.
Zwischen ihnen herrschte eine so beneidenswerte Leichtigkeit. Sie dachten nicht über ihr Handeln nach, wirkten befreit in ihrer Freundschaft.
Und doch … wusste ich es besser. Ich hatte zufällig Nicks Gesicht gesehen, als er die auf der Couch schlafende Bronwyn beobachtet hatte. Bemerkte Bronwyns tränennasse Wangen, wenn Nick zu spät nach Hause kam.
Sie erlaubten sich gegenseitig, ihre Gefühle zu bestimmen. Trafen Entscheidungen füreinander.
Ich könnte das nicht. Ich würde mein Leben nie mehr von einer anderen Person bestimmen lassen.
Wortlos wandte ich mich ab, um den Brief in einer Schublade zu verstauen. Die quoll bereits über mit Briefen von meinem Vater, die ich nie geöffnet hatte. Ich wollte seine Worte nicht lesen, die meine Zeit in Anspruch nehmen würden. Zeit und Angst und Wut und Traurigkeit.
Lieber wollte ich gar nichts fühlen, als ihm all das zu geben.
Nick und Bronwyn verließen die Wohnung, und auch mir fiel die Decke auf den Kopf. Das Wetter war einladend. Sonne und Wärme. Warum sollte ich mich hier verkriechen, wenn ich freihatte und alles tun könnte? Ein Spaziergang durch die Straßen von Brooklyn wäre genau das, was ich brauchte.
Eilig zog ich mir ein luftiges, dunkelgrün kariertes Kleid an, das dem Dunkelgrau meiner Augen etwas Farbe verlieh.
Meine karamellfarbenen Haare band ich zu einem Dutt zusammen, machte mir die Mühe, Mascara und Rouge aufzutragen und mir goldene Kreolen anzuziehen, bevor ich ein Buch aus meinem kleinen Regal auswählte. Heute hatte ich Lust auf einen humorvollen Liebesroman und entschied mich für einen von Susan Elizabeth Phillips. Von ihren Büchern konnte ich nie genug bekommen.
Gut gelaunt schloss ich die Tür hinter mir ab und spazierte nach draußen in den warmen Spätfrühlingstag.
Oft war die Luft in New York so von Abgasen verpestet, dass man das sanfte Blau des Himmels nicht sehen konnte, doch heute war ein guter Tag. Es fiel mir schwer, mich davon abzuwenden, doch ich wollte nicht Gefahr laufen, an der schlimmen Kreuzung überfahren zu werden.
Kurz bevor ich sie erreichte, schaltete sich die Fußgängerampel auf Rot. Ich blieb stehen und beobachtete die vorbeifahrenden Autos und Lastwagen, die an den unzähligen Fahrradfahrern vorbeischossen. Ein Taxi, das sich zu schnell der Kreuzung näherte, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es blinkte rechts, während hinter ihm ein Fahrradfahrer heranraste, und ich glaubte nicht, dass der Taxifahrer diesen in seinem Rückspiegel wahrnahm. Ein mulmiges Gefühl ergriff mich, während ich dabei zusah, wie sich das Geschehen vor mir entfaltete. Ein Kinofilm, den ich nicht aufhalten konnte, ganz gleich, wie sehr ich mich vor dem Ende fürchtete.
Ich schrie auf. Das Taxi preschte um die Kurve. Der Fahrradfahrer bremste quietschend und riss das Lenkrad herum. Lautes Gehupe aus einem vorbeifahrenden Auto, dessen Fahrerin die Situation mitbekommen hatte.
Das Taxi machte eine Vollbremsung. Viel zu spät, als es fast an dem Fahrradfahrer vorbei war, der dadurch das Heck streifte und zur Seite stürzte. Er schlitterte ein, zwei Meter über den Asphalt. Der Verkehr kam zum Stillstand, als hätte jeder den Atem angehalten.
Ich rannte bereits, noch bevor ich realisierte, was ich tat. Der Instinkt, zu helfen, setzte augenblicklich ein, und ich fand mich neben dem Radfahrer auf dem Boden wieder. Die Hitze des Asphalts brannte auf meinen Knien, als ich die Hände nach dem Gesicht des jungen Mannes ausstreckte. Der Schatten seines Helms verdeckte seine Züge, und so erkannte ich erst nach einigen Sekunden, dass seine Augen geöffnet waren und er … lachte.
»Wie … geht es Ihnen?«, stotterte ich fassungslos.
»Prächtig«, sagte er und legte lachend seinen Kopf in den Nacken. »Absolut prächtig.«
• KAPITEL2 •
i’ll catch you
Er hatte den Verstand verloren. Der harte Aufprall musste in ihm etwas durcheinandergebracht haben. Anders konnte ich mir nicht erklären, dass er ausgelassen lachte, während ein dünnes Rinnsal Blut von seinem Kinn in den Kragen seines weißen Hemds lief.
Der Taxifahrer rannte auf uns zu. Er hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und betrachtete abwechselnd den Typen und dann das zerkratzte Heck seines Autos. Seine gestotterten Worte drangen nicht bis zu mir durch, stattdessen sah ich nur verwirrt das Opfer an. Immerhin hatte es aufgehört zu lachen, als es sich an dem Riemen seines Helmes zu schaffen machte und ihn von seinem Kopf zog. Platt gedrücktes schwarzes Haar kam zum Vorschein, das ihm gemeinsam mit der bronzenen Haut einen Surferboy-Touch verlieh. Nur das Grau seiner großen Augen passte nicht dazu. Sie waren heller als meine. Fast wie Nebel.
»War klar, dass das ausgerechnet heute passiert«, sagte der Typ, der nicht viel älter als ich sein konnte. Höchstens Mitte zwanzig. Er griff neben sich. Sein Handy musste ihm aus der Tasche gefallen sein. Das Display sah zersplittert aus. Seufzend steckte er es sich zurück in die Hosentasche, was im Liegen umständlich war. »Hilfst du mir?«
Ohne zu zögern, schob ich das Fahrrad zur Seite, damit er aufstehen konnte. Mittlerweile hatte sich eine Menschentraube um uns gebildet, und ich fühlte schon den aufsteigenden Drang, mich zurückzuziehen und mich um meine vom Asphalt aufgeschürften Knie zu kümmern, als sich eine Hand auf meinen Unterarm legte.
Der Radfahrer hielt sich an mir fest, sein Blick aber galt dem aufgeregten Unfallverursacher. Offensichtlich wollte er die Polizei rufen, hatte das Handy bereits in der Hand.
»Legen Sie bitte auf«, bat der Typ. »Mir geht’s prima.«
»Aber … mein Auto«, entgegnete der Mann ungläubig. »Und wenn Sie eine Gehirnerschütterung haben?«
Das Lächeln des Radfahrers gefror, und er wurde von einer Sekunde auf die nächste ernst.
»Meinem Kopf geht es ganz hervorragend, und für das Auto müssen Sie ohnehin blechen. So kommen Sie wenigstens drumherum, mir die Krankenhausrechnung und ein neues Fahrrad zu bezahlen.« Er wartete keine Antwort ab, sondern beugte sich herab, um mit seiner freien Hand das blaue Fahrrad aufzuheben. Mit der anderen umklammerte er immer noch meinen Arm.
Ich war so überrumpelt, dass ich völlig neben mir stand, während er mich von der Straße auf den Bordstein führte. Das Vorderrad war verbogen, sodass sich das Gefährt nur umständlich schieben ließ. Schnaubend trat der Typ einmal dagegen und lehnte das Rad dann an die Hauswand.
»Wohnst du hier in der Nähe?«, fragte er schief lächelnd und offenbarte dadurch ein Grübchen auf seiner rechten Wange. Mein Herz machte unwillkürlich einen Satz. »Kannst du mich mitnehmen?«
»W-was?« Wie konnte jemand gerade einen Unfall gehabt haben und nun so reden, als wäre nichts geschehen? Er hätte sich viel eher nach dem nächstgelegenen Arzt erkundigen sollen. Ich war scheinbar traumatisierter als er, der unmittelbar beteiligt gewesen war.
Er verdrehte die Augen, ehe er einen Blick auf seine Smartwatch warf. »Ich muss zu meiner Verlobung. Aber so …« Er machte eine ausladende Geste, um auf sein zerrissenes und mit Blut besudeltes Hemd aufmerksam zu machen. »… kann ich da schlecht auftauchen. Könntest du mir helfen? Ich schenk dir auch das Fahrrad.«
»Du …« Hatte ich die Fähigkeit zu reden verloren?
»Okay, ich gebe zu, die Aussicht auf mein Fahrrad ist kein guter Grund. Man wird es kaum noch retten können.« Er trat noch einmal dagegen und ließ mich endlich los, wodurch der Bann brach, den seine Berührung zwischen uns ausgelöst hatte.
Blinzelnd blickte ich ihn an. »Dir geht es gut?«, wiederholte ich meine Gedanken laut.
»Ein paar Kratzer hier und da …« Er besah sich seinen Ellbogen und schob dazu den Ärmel nach oben, wodurch sich die Wunde erneut öffnete. Das Blut sickerte weiter in den weißen Stoff. »Bitte, ich muss mich nur sauber machen. Gut, dass ich schon früher los bin. Als hätte ich damit gerechnet. Wenn ich doch nur mein Auto gehabt hätte …«
Er seufzte tief.
»Und du musst … zu deiner Verlobung?« Unwillkürlich hatte ich mich in Richtung meines Apartments gedreht, und der Fremde folgte mir. Alles in mir rief, davonzulaufen, doch ich konnte mich nicht wehren. Ich hatte meinen Instinkten freien Lauf gelassen. Aber das war nicht alles …
Als ich seinen Blick auffing, begann mein Herz unwillkürlich zu flattern.
»Hm, ja. Im Williamsburg Hotel. Hab alles vorbereitet, und meine Freunde und Familie werden da sein.« Er blickte erneut auf seine Uhr und runzelte die Stirn. Die Anzeige flackerte. »Also, kannst du mir helfen?«
»Helfen«, echote ich. »Ich kann deine Wunden versorgen.«
Was denkst du dir dabei?
»Cool!« Er machte das passende Handzeichen und folgte mir grinsend ins kühle Haus.
Ich versuchte nicht zu sehr über das, was ich tat, nachzudenken. Ich würde nur panisch werden. Aber dieser Typ hatte etwas an sich, das mich dazu zwang, weiter zu atmen. Normal zu sein. Ihm nicht zu zeigen, wie erbärmlich ich eigentlich war. Dass ich ohne Regeln und Struktur nicht leben konnte.
»Der Fahrstuhl ist kaputt. Wir wohnen im vierten Stock«, murmelte ich. »Die Treppen sind ziemlich steil.«
»Mir geht’s gut. Das krieg ich hin«, versicherte er mir erneut. »Wir?«
»Ich habe zwei Roomies. Aber die sind gerade nicht da.«
Er ging so dicht hinter mir, dass ich die Wärme, die von ihm ausging, spüren konnte. Warum hatte ich mich dazu überreden lassen, ihn mitzunehmen? Was tat ich, wenn er doch plötzlich das Bewusstsein verlieren würde? Oder schlimmer noch – er war ein Massenmörder, der es bloß auf Mathematikstudentinnen abgesehen hatte!
Panisch drehte ich mich zu ihm um und verlor dabei das Gleichgewicht. Geistesgegenwärtig packte mich der Fremde am Arm und zog mich mit einer Hand an meinem Rücken an seinen trainierten Oberkörper. Mit den Handflächen stützte ich mich an seiner breiten Brust ab und sah erschrocken zu ihm auf.
»Alles okay?«, fragte er.
»Äh … Ich habe mich nur plötzlich gefragt, was ich mache, wenn du doch ernsthaft verletzt bist und umfällst oder so.« Dass mit dem Massenmörder verschwieg ich besser.
»So wie das gerade aussah, bist du hier eher diejenige, die das Gleichgewicht verliert.« Wieder dieses schelmische Grinsen. »Kannst du stehen?«
»Klar.« Ich löste mich eilig von ihm, damit er meine erhitzten Wangen nicht bemerkte, und nahm die letzten Stufen in Angriff. Atemlos schloss ich die grüne Metalltür auf und führte meinen Besucher in die chaotische Wohnung. »Der Verbandskasten ist im Bad.«
»Ich folge dir einfach. Oh, und mein Name ist übrigens Miles«, ergänzte er.
Auf dem Weg legte ich meine Handtasche ab und rieb mir über die nackten Oberarme. Draußen war es so warm, aber hier drin fror ich ohne Jacke.
Wir hatten im Badezimmer eine Wanne und Miles wollte sich bereits auf den Rand setzen, aber ich deutete mit einem Kopfnicken auf den Klodeckel. Ohne zu zögern, ließ er sich darauf sinken. Nur hier hätte ich genug Platz, um mich bequem vor ihm hinzuknien, ohne die Wand im Rücken zu haben. Neugierig sah er sich um. Ich zog den Verbandskasten aus dem Schrank unter dem Waschbecken und stellte ihn ins Becken.
»Ich kenne mich nicht so damit aus«, gestand ich und nahm als Erstes das Desinfektionsspray zur Hand.
»Damit kann man nichts falsch machen.« Er zwinkerte mir zu, ehe er sein Kinn vorstreckte, damit ich besser an die Wunde kam.
»Könnte jetzt brennen.«
»Bin ein tapferer Junge.«
Ich widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen. Dass er direkt danach unter dem Spray zusammenzuckte, war als Genugtuung ausreichend. Mit einem Wattestäbchen tupfte ich die Wunde sauber und klebte anschließend ein Pflaster darauf. Auch seine Kratzer am Ellbogen und an seinen Handballen versorgte ich schweigend. Allmählich schaltete sich mein Verstand wieder ein. Ich überlegte fieberhaft, wie ich diesen Fremden wieder loswurde. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, ihn mit in meine Wohnung zu nehmen?
»Das war’s«, verkündete ich etwas zu laut und machte einen Schritt zurück.
Der Radfahrer erhob sich überraschend schnell, fasste mich an den Oberarmen und drehte mich in einer fließenden Bewegung so, dass wir die Plätze getauscht hatten und ich auf dem Klodeckel saß. Er hockte sich vor mich hin und nahm nun selbst das Spray zur Hand.
»Was machst du?«, wollte ich wissen.
»Du glaubst doch nicht, dass ich deine Verletzung nicht bemerkt hätte.« Ich presste die Lippen zusammen, als das Wundspray auf meine aufgeschürften Knie traf. »So, noch ein bisschen sauber wischen, Pflaster … Und du bist so gut wie neu.«
»Danke«, murmelte ich verlegen.
»Ich habe zu danken.« Er sah mich von unten herauf an, wodurch ich seine langen dunklen Wimpern bewundern konnte. Die Tatsache, dass er dies bewusst einzusetzen schien, half mir dabei, nicht zu erröten. Er wusste ganz genau, welche Wirkung er auf das weibliche Geschlecht hatte.
»Musst du nicht los?«
»Oh, stimmt.« Er verschloss den Verbandskasten. »Du hast nicht zufällig ein Hemd, das ich mir leihen könnte?«
Nick war nicht der Typ für Hemden, aber ein T-Shirt würde er sicherlich nicht vermissen.
»Warte einen Moment.« Ich drängte mich an ihm vorbei, wobei ich seinen starken Körper für einen Wimpernschlag überall an meinem spürte, bis ich es auf die andere Seite geschafft hatte. Eilig lief ich in Nicks Zimmer und durchsuchte seinen Schrank nach einem Oberteil, das der Typ auf seine Verlobung anziehen konnte. Plötzlich hielt ich inne.
Warum widerstrebte es mir, ihn für eine andere hübsch zu machen?
Unentschlossen biss ich mir auf die Unterlippe. In der Linken hielt ich ein einfaches schwarzes Shirt, in der Rechten ein knallrotes mit einer unleserlichen Graffitischrift. Ich warf das schwarze zurück und ging mit dem roten nach draußen.
»Mein Mitbewohner muss wohl noch mal zum Waschsalon. Mehr ist nicht sauber«, sagte ich entschuldigend, aber der Fremde wirkte gar nicht übellaunig angesichts der Auswahl.
Stattdessen bedankte er sich grinsend und knöpfte ohne Umschweife sein Hemd auf. Ein gebräunter Oberkörper mit beachtlichem Sixpack kam zum Vorschein. Abrupt wandte ich mich ab und starrte in den Flur hinaus. Mein Mund war plötzlich zu einer trockenen Wüste geworden. Shit.
»Begleitest du mich?«
»Was? Wohin?«
»Zu meiner Verlobung. Mein Handy ist kaputt, und ich kenne den Weg nicht.«
»Du könntest dir ein Taxi nehmen.«
»Ich will mich bei dir bedanken. Es gibt ein kostenloses Büfett. Hummerkrabben, geräucherter Lachs, Melonenspalten, Schweinefilet und Papaya. Alles, was das Herz begehrt. Getränke inklusive.«
Mir lief bereits bei der Vorstellung das Wasser im Mund zusammen. Aber konnte ich mir den Anblick der Verlobung wirklich antun? Zu beobachten, wie er eine Frau fragte, den Rest ihres Lebens mit ihm zu teilen? Und er war noch so jung. Wusste er überhaupt, was er da tat?
»Wann musst du da sein?«
»In genau … fünfzehn Minuten.«
Er entwaffnete mich mit einem Grinsen, bei dem sein Grübchen wieder sichtbar wurde.
Zusammen verließen wir die Wohnung, und ich führte ihn zur nächsten Metrostation. Mit der Metro käme man am schnellsten zum Hotel, das ich ohne ihn vermutlich niemals von innen sehen würde.
Was meine Eltern wohl dazu sagen würden? Wahrscheinlich würden sie mir in Erinnerung rufen, dass ich all dies auch ohne ihn haben könnte: Wenn ich nur wieder meine Studien aufnähme und die Karriere einschlug, die sie für mich vorgesehen hatten. Die sie von langer Hand geplant hatten.
»Wie ist sie so?«, fragte ich, als mir das Schweigen zu drückend wurde. Wir standen dicht gedrängt in der Metro, und er sah mich direkt an, scheinbar ohne die Menschen um uns herum wahrzunehmen. Ich würde diesen Blick vermissen.
Ein gefährlicher Gedanke und doch … Niemand zuvor hatte mich jemals so angesehen. Als wäre ich die wichtigste Person auf der Welt.
»Meine Freundin?« Er seufzte verträumt. »Absolut umwerfend. Wunderschön. Perfekt.«
Die Worte waren wie eine kalte Dusche. Natürlich würde er mich niemals so beschreiben. Er stellte sich seine Verlobte vor, während er hier neben mir stand und seine Hand an der Metro-Stange meine berührte, da nicht genug Platz zum Ausweichen war.
»Sicher ist sie das«, murmelte ich. »Groß, blaue Augen, blond?«
»Woher weißt du das?« Erstaunt sah er mich an, als er angerempelt wurde und einen Arm um meine Taille legte, damit ich nicht zurückstolperte. Seine Hand lag warm an meinem Rücken. Nur der dünne Stoff meines Sommerkleides trennte sie von meiner Haut.
Ich konnte kaum atmen.
Er merkte nichts.
»Dein Ernst?«
»Klar.« Sein schiefes Lächeln erschien. »Dazu ist sie aber noch unheimlich klug und ehrgeizig.«
»Was macht sie denn?«
»Was meinst du?«
»Beruflich«, erklärte ich und bedauerte es, als er seine Hand von meiner Taille löste. Noch eine Station.
»Das Gleiche wie ich, schätze ich.«
Die Wortwahl irritierte mich. Als würde er sie kaum kennen. »Und das wäre?«
»Das Geld unserer Eltern ausgeben und auf diverse Wohltätigkeitsveranstaltungen gehen.«
Seine Antwort rüttelte mich wach.
»Natürlich! Du bist das! Aus den Zeitschriften! Miles …«
»Allerton.« Sein Grinsen wurde breiter. »Schande über mein Haupt. Hatte mich gar nicht vorgestellt. Schön, dich kennenzulernen. Und du musst … Shiloh, Bronwyn oder Nick sein. Die Namen standen zumindest auf dem Türschild.«
»Shiloh«, antwortete ich automatisch, ehe ich ihn weiter mit offenem Mund anstarrte.
Miles Allerton. Das vierte Kind von zwei renommierten Ärzten, die zudem mit einem unverschämt hohen Erbe ihrer jeweiligen Eltern gesegnet waren. Sie waren dafür bekannt, hohe Summen zu spenden und – wichtiger noch – im Forschungsbereich der Onkologie einen beeindruckenden Durchbruch geleistet zu haben. Wie hatte ich ihn nicht erkennen können?
»Hier müssen wir raus, oder?«, fragte er.
Ich konnte nur nicken, als er mich an seiner warmen Hand aus der Metro führte. Miles Allerton.
Während er instinktiv den richtigen Ausgang wählte, blickte ich ihm fassungslos auf den Hinterkopf. Ich hätte ihm nicht zu Hilfe eilen sollen, und ich sollte ihn ganz sicher nicht bis zum Hotel begleiten. So jemand wie er, der keine Ahnung vom Ernst des Lebens hatte, würde nur Probleme machen.
Oder?
Er hatte vor, um die Hand seiner Freundin anzuhalten, und wollte mir mit dem Büfett lediglich was Gutes tun. Danach müsste ich ihn nie wiedersehen. Der heutige Tag würde als Anekdote für mein Tagebuch dienen. Mehr nicht. Ich sollte mich beruhigen.
Als wir die Metrostation verlassen hatten, entzog ich Miles meine Hand. Er schien das nicht mal zu bemerken, da er sich suchend nach dem Hotel umschaute.
»Hier lang«, krächzte ich. »Hast du den Ring?«
»Mein Bruder bewahrt ihn für mich auf.« Miles kratzte sich am Ohr. »Ich bin nicht so der zuverlässige Typ, was die kleinen Dinge angeht. Hätte ihn vermutlich beim Unfall vorhin verloren, so wie ich mein Glück kenne.«
Kopfschüttelnd bog ich in die nächste Straße ein und blickte auf das imposante Backsteingebäude mit den schwarzen überdimensionalen Lettern, in die mehrere Glühbirnen eingelassen waren. Zusammen formten sie den Namen des Hotels. Der Anblick verursachte mir eine Gänsehaut. Ich verspürte den Drang, mich umzudrehen und wegzulaufen.
»Cool. Danke!« Miles stieß mich leicht an und wartete, bis ich ihn ansah. »Du hast mir echt den Arsch gerettet.«
»Sollen wir?«, zwang ich mich, zu sagen.
»Melissa ist bestimmt noch nicht da. Lass uns den Vordereingang nehmen.«
Willenlos ließ ich mich von ihm in das Luxushotel ziehen.
Melissa. Melissa. Melissa.
• KAPITEL3 •
the williamsburg hotel
Die Lobby war genauso edel und stylish, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Wir schritten über das glänzend polierte Parkett zur Theke mit den goldenen Akzenten, schauten uns kurz in der Spiegelwand dahinter in die Augen und ließen unsere Blicke dann leicht verlegen weiterwandern. Miles musste den Reichtum gewohnt sein, da er sich problemlos auf die Angestellte vor uns konzentrieren konnte, während ich weiter die industrielle Einrichtung bewunderte. Einladende Sitzgelegenheiten aus petrolfarbenem Plüsch und blumenbestückte Kaffeetische, wuchernde Grünpflanzen in riesigen Goldtöpfen, Messingleuchter, stuckverzierte Wände, die sich mit rauem Backstein abwechselten. Ein pinkes Neonschild mit dem Namen des Hotels vor einem Meer aus falschem Efeu hinter der Theke an der Wand.
»Ihre Gäste sind bereits da«, hörte ich die Dame im blauen Kostüm sagen, als sie einen anderen Angestellten mit Uniform und passender Kopfbedeckung heranwinkte. »Finn wird Sie begleiten.«
»Danke Ihnen.« Miles lächelte wie immer, und ich konnte der Frau ansehen, dass sie genauso dahinschmolz wie ich.
Dieses Lächeln sollte verboten werden. Und das Grübchen gleich mit.
»Bist du aufgeregt?«, fragte ich, während wir die gut besuchte Lobby durchquerten, um den Fahrstuhl in den Ballsaal zu nehmen.
»Merkt man mir das an?«
»Gar nicht«, versicherte ich ihm. Ich wollte ihm nicht sagen, dass seine Nervosität ansteckend war – selbst ich war mittlerweile aufgeregt, obwohl ich nicht mal einen Grund hatte. Ich war in sein Leben hineingeworfen worden, obwohl darin kein Platz für mich war.
Er rieb sich die Hände und sog dann zischend die Luft ein. Wahrscheinlich war er an seine Schürfwunden gekommen, die er sich an den Handballen zugezogen hatte. Unwillkürlich hob ich einen Finger an sein Kinn, um die Haftung des Pflasters zu überprüfen. Miles rührte sich nicht, fing meinen Blick auf, und für eine Sekunde existierten nur wir beide, schwebten im Raum, ehe in der nächsten ein lautes Klingeln ertönte.
Ich zog meine Hand zurück.
»Es ist direkt hier«, verkündete der Angestellte, der vor uns gestanden hatte und nun als Erster aus dem Lift in einen langen Flur stieg.
War ich schon von der Lobby begeistert gewesen, riss mich der Anblick des Ballsaals vollends von den Socken. Der Raum war riesig, heller Marmorboden, industrielle Kronleuchter an hohen Decken, weiß verputzte Wände und gegenüber von uns eine mit Efeu behangene Bar. Auch hier dominierten die Farben Gold und Blau, wurden jedoch von riesigen Blumenarrangements aus roten Rosen und gleichfarbiger Dekoration erstickt. Nicht mein Geschmack, aber vielleicht war Melissa ja ein Fan von Rosen. Der schwere Duft war jedenfalls … gewöhnungsbedürftig.
Ballons waren zu Bündeln zusammengefasst und an den Säulen befestigt worden, sodass sie den Weg direkt zur Bar säumten. Dort standen rund dreißig Leute beisammen, die Miles’ Ankunft kaum bemerkten. Die meisten hingen an ihren Smartphones, schossen Selfies oder schrieben Instagram-Posts. Gucci, Louis Vuitton und Louboutin erkannte ich auf Anhieb, der Rest ihrer Kleidung sah einfach nur geschmacklos teuer aus.
Befangen strich ich mein Sommerkleid glatt und presste die Handtasche fest an meine Seite. Dann hatte ich meine Sachen eben aus dem Secondhandshop in meiner Nachbarschaft. Nicht jeder war reich. Es achtete ohnehin niemand auf mich. Nur Miles erinnerte sich, dass ich ihn begleitet hatte, und berührte mich leicht am Ellbogen, um mich seinem Bruder vorzustellen.
Er war eine ältere Version von Miles, ein bisschen größer, das Haar kürzer und heller.
Sein Name war Sam, und er begrüßte uns ohne Lächeln und ohne Aufregung. Er reichte Miles die Ringschatulle und nahm sofort einen Schluck aus seinem Champagnerglas. Gelangweilt sah er sich um, blickte dann auf die Uhr.
Fassungslos beobachtete ich dieses Verhalten, das auch die anderen Gäste an den Tag legten. Niemand schien hier sein zu wollen. Sich auf das Kommende zu freuen.
Wie konnte Miles das nicht bemerken?
»Wie findest du ihn?« Er hielt mir das geöffnete Kästchen hin, und ich wurde beinahe von dem rechteckigen Stein geblendet.
»Äh, riesig?«
Das erregte Sams Aufmerksamkeit. Er sah von seinem Smartphone auf und fixierte mich aus klaren blauen Augen, die nicht mit Miles’ grauen zu vergleichen waren.
»Riesig?«, echote er.
»Ist er nicht?«, fragte ich verunsichert. Ich hatte doch keine Ahnung, welche Diamanten groß oder klein waren.
Er machte nun eine Kunst daraus, mich von oben bis unten zu mustern, und schien endlich zu erkennen, dass ich nicht zu den üblichen Kreisen gehörte. Dass ich überhaupt nicht hierher passte.
Ich wollte mich nicht einschüchtern lassen.
»Wenn du ein Foto haben willst, sag Bescheid, andernfalls hör auf, mich anzustarren«, fauchte ich und verschränkte die Arme.
»Sie hat recht, Sammy. Sei nicht unhöflich.« Miles lächelte, dann wurden wir von einem Bediensteten unterbrochen, der Melissa ankündigte.
Immerhin das weckte die Gruppe auf, und Handys wurden vom Selfie- auf den Front-Modus gestellt, um den Antrag fotografieren oder filmen zu können.
Melissa war eine Schönheit.
Wer anderes behauptete, der log.
Sie könnte problemlos vom Hotel auf den Laufsteg wandern, und alle würden sie für ihre Haltung und Selbstsicherheit feiern, die sie mit jedem Schritt ausstrahlte. Ihre Augen waren vor Überraschung weit aufgerissen, wodurch ich das klare, fast durchscheinende Blau bewundern konnte. Kein Wunder, dass sich Miles von ihr angezogen fühlte.
Sie war perfekt, wie er es gesagt hatte.
Ihre Haut schimmerte golden unter dem Licht der Kerzenleuchter, und ihr gelbes Kleid schmiegte sich an ihren schlanken, durchtrainierten Körper. Ich bewunderte sie für die Hingabe, die sie dafür aufbringen musste, so auszusehen. Aber nicht nur ihr Körper war beeindruckend, auch ihre wallenden blonden Locken und das Make-up waren makellos.
Gerade weil ich sie so genau musterte, fiel mir sofort ihr Blick auf, der nicht Miles fokussierte, sondern jemanden neben mir. Einen Mann mit schulterlangem braunem Haar und einem verschmitzten Grinsen, als würden er und sie ein Geheimnis teilen.
Mein Magen drehte sich um.
Das konnte nicht sein, oder?
Miles sah nur Melissa, achtete auf sonst niemanden, während er auf seinen großen Moment wartete. Er ahnte nichts. Rannte mit dem Kopf voran in sein Unglück, wenn ich mit meiner Vermutung richtiglag.
Was sollte ich tun?
Gar nichts. Halte dich da raus. Du bist nur hier für das Essen.
Ich ballte die Hände zu Fäusten und biss die Zähne zusammen. Meine innere Stimme hatte recht, dennoch …
Melissa war nun vor Miles zum Stehen gekommen, der ihre perfekt manikürten Hände in seine nahm und sich so mit ihr drehte, dass die beiden mit dem Profil zu uns standen. Seine freudige Erwartung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Es brach mir das Herz.
Aus unsichtbaren Boxen ertönte plötzlich Streichmusik, ließ die gesamte Situation surreal wirken. Als wäre diese Szene einem alten Filmstreifen entsprungen und in die Wirklichkeit geklebt.
Miles ging auf ein Knie. Das Pflaster an seinem Kinn wirkte genauso lächerlich wie das rote Graffiti-T-Shirt, das ich ihm gegeben hatte. Ich wünschte mir, ich hätte mich doch für das schwarze entschieden. Dann würde ich ihn vielleicht weniger bemitleiden.
»Ich weiß, du musst überrascht sein, uns hier alle zu sehen. Aber ich hoffe, du bist glücklich.« Miles grinste so breit, dass ich ihm am liebsten eine Ohrfeige verpasst hätte. Sah er denn nicht, dass Melissa keine Augen für ihn hatte? Wütend trat ich dem Mann neben mir versehentlich auf seinen teuren Schuh und genoss seinen kurzen Aufschrei. Durch die Ablenkung hatte ich den Part mit dem Liebesgeständnis verpasst.
Jetzt kam Miles zur Sache. Er öffnete die Samtschatulle und blendete uns mit dem Riesenteil von Diamanten. Melissa zog skeptisch ihre Brauen zusammen. »Willst du meine Frau werden und den Rest deines Lebens mit mir verbringen?«
Sie kicherte hinter vorgehaltener Hand.
Sie kicherte!
Hätte ich Ärmel gehabt, hätte ich sie mir in diesem Moment hochgeschoben, um mich auf einen Faustkampf mit ihr vorzubereiten.
Die Frage, warum ich Miles so dringend beschützen wollte, ignorierte ich kurzzeitig.
»Melissa?«
Die Hoffnung in Miles’ Augen tötete mich, dabei kannte ich ihn nicht mal. Mir war es unbegreiflich, wie Melissa ihm mit dieser Kälte begegnen konnte.
»Sorry, Honey, aber ich dachte, wir wollten uns hier zum Essen treffen«, sagte sie schließlich, machte dabei aber keine Anstalten, ihn in eine stehende Position zu ziehen. Sie genoss es zu sehr, über ihm aufzuragen. »Bei der Gelegenheit wollte ich dir sagen, dass ich einen neuen Freund habe.«
Der Typ neben mir hustete, als hätte er sich verschluckt. Melissa entzog sich Miles und schritt auf uns zu, während ihr die Handykameras folgten. Sie verschränkte ihre Hand mit der des langhaarigen Männermodels.
»Colin und ich sind jetzt zusammen.«
Fotos wurden geschossen und Überraschungslaute ausgestoßen, die sich mit Geräuschen des Entsetzens sowie der Schadenfreude mischten. Mir wurde schlecht inmitten dieser oberflächlichen Gruppe, die sich nicht hier eingefunden hatte, um Miles’ glücklicher Stunde beizuwohnen, sondern um einen Skandal mitzuerleben. Ob sie nun vorher davon gewusst hatten oder nicht. Es erfreute sie, jemanden leiden zu sehen.
Miles hielt noch immer den Ring, aber er war inzwischen aufgestanden und blickte von Colin zu Melissa.
»Du … hast eine Affäre mit meinem besten Freund?«
Ich runzelte die Stirn. Bester Freund? Auf einen Blick konnte ich sehen, dass Colin nicht gut genug war, um Miles’ bester Freund zu sein, und das lag nicht nur an dem Arm, den er um Melissas schlanke Taille legte.
Miles fing an zu lachen, stoppte und lachte erneut los. »Filmreifer geht’s nicht mehr, oder?«, stieß er zwischen seinen Lachanfällen hervor.
Sein Gelächter wurde so heftig, dass er sich den Bauch halten musste und sich vornüberbeugte. Der Ring fiel aus der Schatulle und schlitterte unbeachtet über den polierten Marmorboden. Die Smartphones der Gäste richteten sich von Colin und Melissa wieder auf den Erben. Ein weiterer Skandal, der sich an gut zahlende Boulevardmagazine verkaufen ließ.
Ratlos sah ich Sam an, der genervt die Stirn runzelte. Wie konnte er seinem Bruder nicht zu Hilfe eilen?
Ich löste mich aus der Reihe der Starrenden und schmetterte das erstbeste Handy zu Boden. Der dazugehörige Mann mit blonden Locken beschwerte sich lautstark.
»Wenn ich auch nur ein Video online sehe, werden wir euch auf Diffamierung verklagen.« Für einen kurzen Moment wünschte ich, doch mein Jurastudium begonnen zu haben. »Raus mit euch!«
Protestierendes Gemurmel mischte sich mit Miles’ Gelächter.
Ich streckte einen Arm in Richtung Ausgang und wiederholte meinen Befehl. Sam war überraschenderweise der Erste, der sich bewegte. Wahrscheinlich konnte er die Verlegenheit nicht mehr ertragen, was vielleicht auch an dem riesigen Stock in seinem Arsch lag. Wer so eine Familie hatte, brauchte keine Feinde mehr.
Melissa und Colin folgten ihm, und ich zeigte ihnen beide Mittelfinger, was sie mit angewiderten Blicken quittierten. Sollten sie doch glücklich werden.
Schließlich hatten sich alle aus dem Saal entfernt. Die Musik verklang, und Finn, der Angestellte von vorhin, trat herein.
»Sollen wir abdecken?«, wollte er wissen.
Miles sah ihn mit leerem Blick an.
»Es wurde bereits alles bezahlt, oder nicht?«, fragte ich.
Finn nickte zögerlich.
»Also werden wir den ganzen Kram auch essen und trinken. Lass uns bitte allein.« Ich scheuchte ihn nach draußen und verriegelte die Tür hinter ihm, falls er vorhatte, mit Verstärkung zurückzukehren.
Seufzend drehte ich mich zu Miles, der sich nicht von der Stelle bewegt hatte. Wahrscheinlich prasselte erst jetzt das Geschehene auf ihn ein, und er wusste nicht mit der Blamage umzugehen. Oder war es Enttäuschung? Hatte er Melissa so sehr geliebt? Ganz offensichtlich, sonst wäre er nicht so blind gewesen.
Ich warf meine Handtasche auf die Theke und suchte nach dem teuersten Alkohol, den ich finden konnte. Zwar war ich noch keine einundzwanzig, aber da der Saal verschlossen war, würde mich auch niemand erwischen.
»Whiskey, Brandy, Scotch, Gin …«, murmelte ich und tippte nachdenklich mit einem Finger gegen meine Lippen. »Ich nehme alles.«
Ich stellte die unterschiedlich geformten Flaschen nacheinander auf die Theke, suchte Gläser dazu raus und schüttete von allem etwas ein, um mich durchzuprobieren. Wahrscheinlich sollte ich mich vorher noch am köstlichen Büfett bedienen, um mir nicht den Magen zu verderben.
»Du hältst mich bestimmt für einen Oberloser.« Miles sah mich an. Er hielt die Schultern gesenkt und wirkte niedergeschmettert.
»Nicht mehr als vorher auch schon«, antwortete ich schulterzuckend und schritt zum Büfett. Es roch köstlich. Wie Miles versprochen hatte, gab es Krabben und Lachs, frisches Obst und gedünstetes Gemüse. Ich häufte mir einen Teller voll davon. Das Brot war sogar noch warm.
»Ich habe mit einer Abfuhr gerechnet, aber nicht mit dieser Begründung.« Wieder dieses Lachen, das mich zusammenzucken ließ, weil es so hohl klang. Ich wollte es nicht mehr hören.
»Warum hast du dir dann überhaupt die Mühe gemacht, sie zu fragen?«
Mit dem Teller in der Hand setzte ich mich auf einen Hocker. Miles machte es mir nach.
»Es war aufregend.« Er zog ein Glas Scotch mit Eis zu sich heran und schwenkte es, bis die Eiswürfel gegeneinander klirrten.
»Und jetzt?«
»Jetzt tut es nur weh.«
Ich stieß ihn leicht mit der Schulter an, wartete, bis er meinen Blick erwiderte, und lächelte aufmunternd. »Tut mir leid.«
»Nicht deine Schuld.« Sein schiefes Lächeln samt Grübchen kehrte zurück und machte mir Hoffnung, dass er sich von dem Schlag erholen würde. »Ich muss mich eher bei dir entschuldigen.«
»Wieso?« Ich spießte ein Melonenstück auf und verschlang es mit einem Bissen. »Ich habe das Büfett und den Alkohol für mich ganz allein.«
»Was ist mit mir?«
»Kannst du bei Liebeskummer essen?«
»Ich werd’s überleben.« Er stahl mir das zweite Melonenstück direkt vom Teller.
»Hey! Hol dir selbst was.« Ich legte einen Arm schützend über mein Essen. Nach ein paar Sekunden des Schweigens erlaubte ich ihm dann doch, sich zu bedienen. »Wie lange wart ihr ein Paar?«
»Drei Monate oder so«, antwortete er zwischen zwei Bissen.
Ich ließ die Gabel fallen. »Drei Monate?«
»Ja, und?«
»Du hast nach nur drei Monaten entschieden, dass du sie heiraten willst?« Ich griff nach der Sambucaflasche und nahm einen tiefen Zug, hustete sofort und nahm einen zweiten Schluck.
»Mach mal langsam.« Miles nahm mir die Flasche aus der Hand. »Ich dachte nicht, dass das eine so große Sache wird. Und wie gesagt, ich habe eh nicht mit einem Ja gerechnet.«
Fassungslos sah ich ihn an. »Ich versteh dich nicht.«
»Du verstehst meine Welt nicht.«
»Immerhin hast du erkannt, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen«, nuschelte ich und aß ein paar Krabben.
Miles suchte sich am Büfett etwas vom Nachtisch aus und kehrte mit zwei kleinen Gläschen gefüllt mit Schokolade und Nüssen zurück. Er wirkte fast wieder normal, was mir mehr Sorgen bereitete als sein voriges Verhalten. Wie wenig musste er fühlen, um sich so geben zu können?
»Ich war auf der Suche und nahm an, Melissa auch.«
»Nach was?«
»Aufregung. Dem Sinn des Lebens …« Er seufzte. »Hab ihre Liebesschwüre wohl falsch interpretiert. Sie und Colin … Fuck. Man kann echt niemandem vertrauen.«
»Und doch scheinst du mir nicht am Boden zerstört zu sein«, gab ich zu bedenken.
»Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis so etwas geschieht.« Ein trauriges Lächeln, das mich berührte, breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Colin und ich kennen uns aus der Schulzeit, und er war ein guter Freund. Aber ich konnte mit ihm nie über was Ernstes reden. Er war da, wenn ich feiern und mich amüsieren wollte. Jetzt hat Melissa ihn für sich beansprucht.«
»Hast du keine … engen Freundschaften?«
Miles leckte seinen Löffel ab, ehe er mir einen neugierigen Seitenblick zuwarf. »Du klingst nicht, als würdest du mich dafür verurteilen. Warum nicht?«
Weil auch ich keine Freunde hatte? Das konnte ich schlecht sagen, ohne zu viel von mir selbst preiszugeben. Deshalb zuckte ich nur mit den Schultern, was ihm als Antwort genügte.
»Es ist schwer, in meiner Welt bedeutungsvolle Kontakte zu knüpfen. Jedes Mal gibt es Strippenzieher und fremde Motivationen im Hintergrund von Verbindungen. Ob nun freundschaftlicher Natur oder tiefergehend.« Er spielte nachdenklich mit dem Löffel. »Als viertes Kind nimmt mich niemand sonderlich ernst, und ich kann auch keinem einen sozialen Vorteil verschaffen, weil ich weder Einfluss habe noch einen anständigen Beruf. Das sollte es mir eigentlich einfacher machen, echte Freundschaften zu schließen. Aber es war niemand Echtes da.«
Perplex sah ich ihn an, dann schnaubte ich und schlug ihm gegen den Hinterkopf.
»Autsch! Was sollte das?« Er hob schützend die Arme vor seinen Körper.
Ich sprang vom Hocker. »Du hast Geld und ein sorgenfreies Leben. Geh auf die Straße und such dir Freunde.«