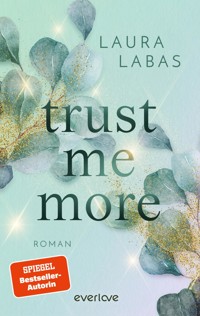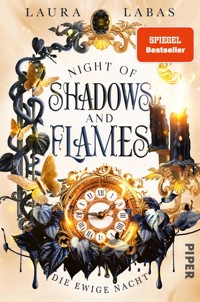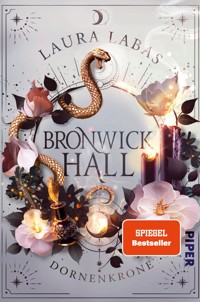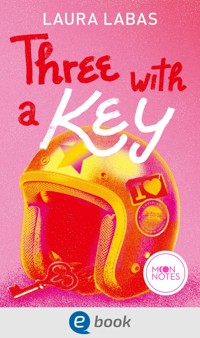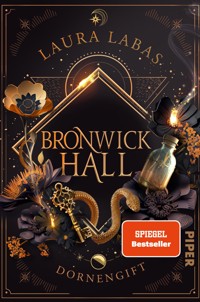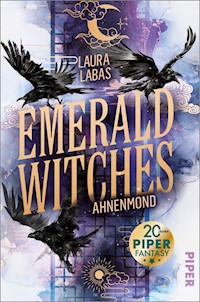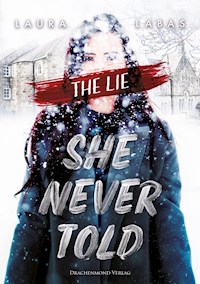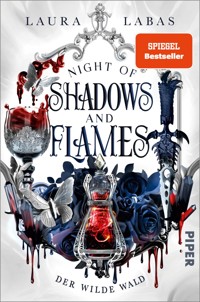
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als junge Hexe hat es Billie im Reich Wimborne nicht leicht. Ihre Art wird von Vampiren unterdrückt, und ein magischer Wald droht, das Land zu verschlingen. Um ihre Familie zu schützen, muss Billie für einen geheimnisvollen Fremden Vampire jagen. Als sie sich unfreiwillig im Haus des so attraktiven wie mächtigen Vampirs Tian wiederfindet, will sie nichts lieber, als ihn zu töten und zu fliehen. Er verhält sich jedoch unerwartet zuvorkommend und bringt dadurch ihre Gefühle durcheinander. Doch um sich selbst zu retten, muss sie Tian verraten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Night of Shadows and Flames – Der Wilde Wald« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Wiebke Bach
Karten: Stephanie Gauger | Guter Punkt, München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Stephanie Gauger, Guter Punkt München unter Verwendung von Motiven von iStock / Getty Images Plus und AdobeStock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Karte 1
Karte 2
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
Vor einem Jahr
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Dieses Buch widme ich all jenen, die über die Jahre immer wieder zu meinen fantastischen Geschichten gegriffen und sie gelesen haben.
Prolog
Eine meiner ersten Erinnerungen war blutgetränkt. Da gab es ein anderes Mädchen, zu einer anderen Zeit, das versehentlich bei einer Brautschau leer gesaugt worden war.
Nun. Nicht gänzlich leer.
Irgendwann hatte der Vampir von ihr abgelassen, und sie war zu Boden gefallen. Blutend und dem Tode nahe. Eine Lache hatte sich von ihrem Hals aus um ihren Kopf ausgebreitet, als würde es ein makabres Bild für die Ewigkeit schaffen. Bis sie ihren letzten Atemzug getan hatte.
Nicht leise und sanft.
Laut und röchelnd.
Erst dann war es vorbei gewesen.
Mit anklagendem Blick hatte sie mich angestarrt, obwohl ich nichts für ihr Schicksal konnte. Ein Schicksal, das auch mich hätte treffen können. Noch immer treffen könnte.
Vampirinnen und Vampire herrschten mit eiserner Hand über das Hexenvolk. Seit jüngster Vergangenheit galten wir als ihr Eigentum. Freiheit wurde uns nicht gestattet. Aber das war mir erst später klar geworden.
Damals … vorher hatte ich das nicht verstanden. Ich war bei meinen Eltern in einer Kommune aufgewachsen, in der mir eine falsche Art von Freiheit vorgespielt wurde. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass alle so lebten wie wir. In einem kleinen, ummauerten Dorf, das nie jemand verließ, aber das von einem vampirischen Baron besucht wurde. Wir gehörten ihm allein.
Weil meine Eltern und alle, die dort lebten, dies gestatteten. Sie hatten sich damit abgefunden, für ihn zu bluten. Sie hatten ihm erlaubt, ihre Kinder zu verkaufen. Weil Hexenblut das begehrteste Blut war. Und weil manche von uns besonders waren.
Heute war erst meine zweite Schau. Zusammen mit anderen jungen Hexen und Hexern, die sich dem Vampir darboten, der dem Baron genug Geld bezahlt hatte, um uns zu testen. Er wollte wissen, ob einer oder eine von uns mit ihm kompatibel war und ihm durch ein Ritual zu größerer Macht verhelfen könnte.
Seit dem unglückseligen Vorfall vor vier Jahren, als ich gerade sechs Sommer gezählt hatte, war es den Besucherinnen und Besuchern verboten worden, uns zu beißen. Ein kleiner Trost. Stattdessen wurde uns mit einem Dolch ein Schnitt am Unterarm zugefügt, damit unser Blut gekostet werden konnte.
Ich betrachtete meinen eigenen roten Lebenssaft, der träge auf den sandigen Boden tropfte. Der Schmerz ein Echo in meinem Inneren. Auch wenn ich die Erkenntnis nicht gänzlich greifen konnte, wusste ich, dass das nicht richtig war. So sollte das Leben von Kindern nicht sein. Aber ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Der mich verstand, anstatt mir den Mund zu verbieten.
Meine Eltern waren nicht dabei. Niemand außer uns Kindern, die auf dem kleinen Platz standen, war hier. Hexen und Hexer hielten sich in ihren Lehmbauten versteckt, weil der Baron sie nicht dabei haben wollte.
Neben mir standen drei Jungs und zwei Mädchen. Ich war die letzte in der Reihe, die der Baron mit dem Dolch verletzt hatte. Mein Hass auf ihn war ins Unermessliche gewachsen. Sollte ich diese Gefühle spüren? Die anderen wirkten ängstlich und scheu, aber nicht wütend. Nicht diesen flammenden Zorn haltend, der mich Nacht für Nacht wachhielt und den meine Eltern mit Essensentzug bestraften.
Ich sollte nicht aufsässig sein. Nicht kühn und nicht trotzig. Dem Baron und auch keinem anderen widersprechen. Ich sollte mich eingliedern und mein Schicksal akzeptieren.
Doch wie?
Wie?, klang es in meinem Inneren tausendfach nach, während ein schneidender Wind aufkam.
Nicht mehr lange und der Baron würde uns mit seinem Besuch erreicht haben. Unser Blut kosten lassen, ob wir wollten oder nicht. Uns verkaufen, ob wir wollten oder nicht.
Ich konnte nicht.
Es war nicht so, als würde ich diesen Ort nicht verlassen wollen. Im Gegenteil. Ich wollte jedoch nicht einem weiteren Vampir gehorchen. Ich wollte diesem hier und allen anderen das Herz aus der Brust reißen.
Panisch blickte ich mich um, als ich die sich nähernden Schritte hörte. Knirsch, knirsch.
Mein Blick glitt über die anderen zitternden Kinder. Der Junge neben mir wimmerte. Der Geruch von Pisse mischte sich zu dem des Blutes. Jemand hatte sich in die Hose gemacht.
Angst. Sie hatten solche Angst.
Doch ich?
Ich spürte den Drang in mir, alles zu vernichten.
Aber selbst mit zehn Jahren wusste ich, dass ich nicht die Kraft dazu besaß, gegen Vampire zu bestehen. Noch nicht. Stattdessen konnte ich etwas anderes tun.
Ohne einen weiteren Moment zu zögern, machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte davon.
Mein dunkelrotes Haar schwebte wie ein Schleier hinter mir her, während meine Füße kaum den Boden berührten. So schnell war ich. So schnell trugen mich meine Beine. Am besten bis zur Mauer und dann darüber hinaus.
Ich hatte die letzten Wochen damit verbracht, mir einen Fluchtweg zurechtzulegen. Auch wenn mir bis zu diesem Zeitpunkt die Überzeugung gefehlt hatte, war mir ganz tief in meinem Inneren klar gewesen, dass ich den Weg brauchen würde. Früher oder später.
Dann verhedderte sich mein Fuß in dem viel zu langen braunen Kleid, und ich fiel der Länge nach in den Staub. Meine Handballen und Knie wurden aufgeschürft. Mit dem Kinn traf ich hart auf, und der Aufprall schoss wie eine Kraftwelle durch meinen gesamten Körper.
Der Schmerz blendete mich für ein paar Sekunden, ehe ich wieder zu mir fand. Tränen schossen mir in die Augen, aber ich hielt nicht inne. Sofort rappelte ich mich auf, weil ich das Rufen über das Rauschen des Windes gehört hatte.
Der Baron hatte mein Verschwinden bemerkt. Mir blieb nicht viel Zeit.
»Du schaffst das, Billie«, knurrte ich wie ein wild gewordenes Tier, das sich nicht mehr einsperren ließ. Entweder ich würde sterben oder ich würde diesem verfluchten Ort entkommen.
Und dann fiel mir meine Magie ein. Etwas, das kaum jemand in der Kommune nutzte, weil es der Baron nicht gern sah. Nur für die Arbeit war es in Ordnung. Für die Herstellung von Talismanen und verpackten Zaubern, die er dann verkaufen konnte.
Ich bewegte meine kleinen Finger ein paarmal, ehe mir der stürmische Wind gehorchte. Meine Spuren verwischte und meinen Geruch forttrug, damit ich schwieriger zu finden war.
All das kostete mich bereits so viel Kraft, dass mir schwindelte. Trotzdem gab ich nicht auf.
Ich taumelte weiter. Fast blind, weil die Schatten der Erschöpfung mein Sichtfeld verkleinerten. Kein Wunder, dass ich die Person zu spät sah, als ich direkt in sie hineinrannte.
Hände schlossen sich um meine Oberarme. Ich setzte mich zur Wehr und schrie auf, als sich die Hand von meinem Arm löste und stattdessen auf meinen Mund legte.
»Pst, Billie, es ist alles in Ordnung. Ich bin es, Tante Frinn.« Irgendwie drangen ihre Worte durch den tosenden Sturm in meinem Kopf. Nach und nach sickerten sie in meinen Verstand, und ich ließ davon ab, zu versuchen, ihr die Fingernägel in die Haut zu graben.
Sie ließ mich los.
»Tante Frinn?« Blinzelnd sah ich zu ihr auf. Ich hatte meine beiden Tanten vor langer Zeit das letzte Mal gesehen und hätte mich bis zu diesem Moment nicht an ihre Gesichter erinnern können. Doch ja, Frinn kam mir bekannt vor.
»Mein armes Kleines, wir kommen gerade rechtzeitig, hm? Tante Elma und Hugh warten auf uns. Komm, wir müssen uns beeilen.« Ich stand da wie angewurzelt. Sie schien meinen Unglauben zu erkennen und strich mir sanft über die Wange. Sie war von Kopf bis Fuß in Leder gekleidet, und an ihrem Gürtel glänzte neben mehreren kleinen Beuteln ein scharfes Messer. »Es ist vorbei. Du musst hier nicht mehr sein. Wie hört sich das an?«
Unsere Zeit war knapp. Das wussten wir beide. Trotzdem drängte sie mich nicht. Sie überließ mir die Entscheidung.
Es war das erste Mal, dass ich die Macht besaß, über mein eigenes Schicksal zu entscheiden.
Ich betrachtete sie eingehend. Nahm die kleinen Fältchen um ihre glänzenden braunen Augen wahr und das warme Lächeln. Mutter hatte mich einst auch so angesehen. Bevor ich es gewagt hatte, Fragen zu stellen. Frinn ähnelte ihr sehr, auch wenn sie härter und kampferprobter wirkte, als es Mutter je sein könnte. Für mich war Frinn die kraftvollste und beeindruckendste Person, der ich je begegnet war. Sie strahlte eiserne Stärke aus, die auf mich überschwappte und mich entschlossener machte.
»Sehr gut«, krächzte ich schließlich und ergriff Frinns Hand. Sie war so groß, dass meine eigene darin zu verschwinden schien. Voller dicker Schwielen.
Meine Tante lächelte. »Jetzt müssen wir nur noch rennen. Schaffst du das?«
Ich nickte. Es gab nichts, dessen ich mir sicherer gewesen wäre. Zusammen liefen wir meiner Freiheit entgegen.
1. Kapitel
Die Wintersonne neigte sich dem Horizont entgegen und färbte die Wipfel der weiß gesprenkelten Tannen flammend orange. Ich saß auf den Stufen des Wohnwagens und zog die Kordeln meiner Stiefel mit geübten Bewegungen fest.
»Hast du es bald, Billie?«, rief Elma aus dem Wagen, ohne sich die Mühe zu machen, rauszuschauen. Dafür war es ihr zu kalt. Sie war nicht für den Winter geschaffen. Nicht so wie ich.
Ich konnte mir kaum etwas Schöneres vorstellen, als den weißen Boden mit vampirischem Blut zu besprenkeln.
Kleiner Scherz.
Weiße Wolken bildeten sich beim Ausatmen vor meinem Mund.
»Kannst du mir zwei Sekunden geben, mir die Schuhe anzuziehen?«, schrie ich zurück.
»Das waren bereits mehr als zwei Sekunden. Das Feuer geht gleich aus.«
Ich verdrehte die Augen. »Du bist eine Hexe. Ein bisschen Magie kannst du schon einsetzen.«
Stille.
Kopfschüttelnd stand ich auf. Die zwei alten grauen Gäule, die unseren Wagen normalerweise mit der Unterstützung unserer Magie zogen, wieherten leise. Wir hatten sie nirgendwo angebunden. Sie wussten, wie gut sie es bei uns hatten, selbst wenn sie in der Kälte stehen mussten.
Im Vorbeigehen klopfte ich ihnen liebevoll auf die Flanken. Sie trugen mit Schaffell gefütterte Decken, in die Tante Frinn einen Zauber gewebt hatte, der sie warmhielt. Selbst bei eisigen Temperaturen wie heute.
Ich stapfte weiter durch den Schnee und verließ die Lichtung auf der Suche nach Brennholz.
Im Schutz der schlanken Tannen lag zwar weniger Schnee, doch die Temperaturen sanken augenblicklich. Ich erzitterte und rieb mir über die dunkelblaue Wolljacke. Das nächste Mal konnte Tante Elma selbst gehen. Ich hatte keine Zeit. Musste mich gleich schon auf den Weg nach Westwend machen, um eine »Verabredung« einzuhalten.
Nicht dass ich ihr entgegenfiebern würde. Sie führte mir wieder vor Augen, wie katastrophal unsere Lage sich momentan darstellte. Doch da sich daran nichts ändern ließ, musste ich die Zähne zusammenzubeißen.
Ich sammelte im schwindenden Licht einen Armvoll Holz zusammen. Dabei war es nicht wichtig, ob es nass oder trocken war. Mit einem kleinen Zauber würde die Feuchtigkeit verfliegen.
Als ich fast nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte, kehrte ich zum Wohnwagen zurück. Eine Buntglas-Laterne lockte mich zur Tür, die genauso beeindruckend wirkte wie alles andere an dem Wohnwagen.
Dabei handelte es sich nicht um einen gewöhnlichen umfunktionierten Planwagen. Damit hätten sich meine Tanten nicht zufriedengegeben.
Sie würden es niemals zugeben, doch sie besaßen einen extravaganten Geschmack, der sich in allem, was sie taten oder besaßen, widerspiegelte.
Der hintere Teil des Wagens war zweistöckig, der vordere Teil einstöckig, aber mit einer hohen Decke. Die Form erinnerte an ein kleines Schiff mit mehreren eingelassenen Rundfenstern und einem blassgrünen Dach, aus dem zwei gebogene Kaminrohre ragten. Der hintere Teil besaß zwei Erker jeweils auf der gegenüberliegenden Seite und ein kleines Rundtürmchen.
Jeder, der den Wohnwagen mit der gelblich-braunen Fassade sah, hätte eigentlich auf den Gedanken kommen müssen, dass bloß Hexen darin hausen konnten. Unserer Erfahrung nach sahen die meisten Menschen aber nur das, was sie sehen wollten. In diesem Fall war dies ein normaler Wagen, der von zwei widerspenstigen Gäulen gezogen wurde.
»Bin wieder da«, rief ich vor der schwarz lackierten Holztür, da ich keine freie Hand zum Anklopfen hatte.
Wenige Augenblicke später öffnete mir Frinn die Tür und ließ mich ins kuschelig warme Innere. Zumindest bis zur gewebten Fußmatte.
»Schuhe aus«, sagte sie streng und nahm mir den Holzstapel ab.
»Ich muss gleich eh wieder …«, beschwerte ich mich, doch sie wandte sich bereits ab. Ich seufzte. Man konnte keine Diskussion mit ihr führen und erwarten, zu gewinnen.
Ich ergab mich meinem Schicksal und setzte mich auf die gepolsterte Bank gleich neben der Tür.
Hier unten im Eingangsbereich hatten all die Möbel und Gegenstände ihren Platz gefunden, für die der Schlafbereich zu klein gewesen war. Leider konnte sich Elma nur schlecht von Sachen trennen, und Frinn und ich brachten es nicht übers Herz, sie dazu zu bringen. Deshalb glich dieser Teil einem Antiquitätenladen ohne Kundschaft. Ein großer verblasster Teppich lag in der Mitte, und auf ihm stand zurzeit ein Webstuhl mit Arbeitstisch und diversen Stoffresten darauf verteilt. Der dreibeinige Hocker hatte schon bessere Tage gesehen, und ich müsste ihn sicher bald wieder reparieren, weil er drohte, ein Bein zu verlieren.
Eine Topfpflanze mit breiten Blättern und ohne jeglichen Nutzen stand neben der Bank, auf der ich gerade meine Stiefel auszog. Sie sah weder besonders hübsch aus, noch bildete sie schöne Blüten. Immerhin ging sie in der hier herrschenden Hitze nicht ein.
Von der Decke hing einsam und verlassen ein langer gemusterter Teppich. Elma hatte ihn vor ein paar Jahren geknüpft, ohne darüber nachzudenken, dass ihre ältere Schwester die Farbe Orange nicht ausstehen konnte. Deshalb war er hierher verbannt worden.
Abgesehen davon gab es noch einen weiteren an die Wand gerückten Werktisch mit allerlei Krimskrams darauf, eine Garderobe, gestapelte Decken, Bücher und Werkzeug, das Hugh des Öfteren benutzt hatte. Er liebte es, Figuren aus Holz zu schnitzen, und etliche davon fand man an den seltsamsten Stellen verteilt.
Durch einen Raumteiler abgetrennt befand sich an die linke Seite gequetscht eine Kochnische samt Esstisch. Von dem schwarzen Herd reichten zwei Blechrohre zum Dach hinaus, damit wir durch den stinkenden Qualm nicht erstickten. Ein Einzelbett mit durchgelegener Matratze hatten wir erst vor Kurzem links neben die Leiter gestellt.
Ich hängte meine geflickte Wolljacke an einem Metallhaken auf, der wie der Schwanz einer Sirene geformt war, und tapste dann zur festgenagelten Sprossenleiter, die ins obere Stockwerk führte.
Elma saß direkt im ersten sehr kleinen Raum an ihrem Schreibtisch und werkelte an einer Taschenuhr herum, die sie vor einigen Tagen auf der Straße gefunden hatte. Mehr als der Tisch und ihr schmales Bett passten nicht hier rein.
»Kannst du es nicht mal gut sein lassen?«, ärgerte ich sie, bloß um sie abzulenken.
Wann immer sie sich derart zurückzog, dachte sie an Hugh. Und an Hugh zu denken machte sie traurig.
»Wilhelmine Kron«, presste sie hervor, ehe sie ihre Wangen aufblies. Sie drehte sich auf dem quietschenden Stuhl zu mir um. »Deine Erziehung lässt wie immer zu wünschen übrig. Du hast deine älteren Verwandten mit Respekt und Höflichkeit zu behandeln.«
Ich verschränkte die Arme, während ich mich seitlich an die Wand lehnte. Das Lächeln konnte ich nur mit Mühe unterdrücken.
»Zum Glück musst du dir das selbst ankreiden.«
»Billie!«
»Hab dich auch lieb, Tante.« Ich überbrückte den geringen Abstand zu ihr und drückte sie einmal fest. »Ich mache mich jetzt auf den Weg. Gibt es etwas, das ich ihm ausrichten soll?«
Ich bereute es fast, sie gefragt zu haben, weil sich die Schatten sofort wieder auf ihr Gesicht legten.
»Dass wir ihn lieben und auf ihn warten.«
»Natürlich.« Ich zögerte einen Moment, doch es gab nichts, das ich nicht schon hunderte Male zuvor gesagt hätte, um sie zu beruhigen. Nichts davon hatte je Wirkung gezeigt.
Hugh geht es gut.
Mein Vertrag ist fast erfüllt.
Wir bekommen ihn zurück.
Mein Zimmer hatte ich mir mit meinem Cousin Hugh, Elmas Sohn, geteilt, bevor … vor allem. Ich hatte im linken Bett geschlafen und er im rechten. Dazwischen gab es einen zurückgezogenen Vorhang und einen halben Meter Platz. Gerade breit genug, um zu den eingebauten Regalen zu kommen, die meine wenigen Habseligkeiten beherbergten.
Normalerweise ging ich auch hier auf dem Land niemals ohne meinen Dolch raus, doch Elma hatte mich so aufgescheucht, dass ich ihn vergessen hatte. Jetzt nahm ich die Waffe mit der Obsidianklinge vom Regal und schob sie zurück in die Lederscheide an meinem Gürtel.
Abgesehen davon wagte ich es nicht, mich mit Kräutern oder Amuletten auszustatten, aus Angst, als Hexe erkannt zu werden. Das würde mich in große Schwierigkeiten bringen. Im besten Fall würde ich in einem Kampf gegen die Häscher sterben, im schlimmsten als Sklavin in irgendeinem Vampirhaushalt landen.
Ich erschauerte allein bei dem Gedanken.
Nein. Das wäre wirklich ein grausames Schicksal. Insbesondere nachdem ich diesem bereits einmal ganz knapp entkommen war.
Das Kribbeln weckte mich aus meinen tiefen Gedanken.
»Ja, ja, ich komme ja schon«, murmelte ich. Als hätte mich das schwarze Tattoo, das sich direkt unter meinem linken Schlüsselbein befand, verstanden, hörte es auf, zu jucken. Drei detailliert gestochene Motten, die meinen Pakt mit Moth besiegelt hatten. Eine war nach oben ausgerichtet, die andere flog nach links auf mein Herz zu und die dritte blieb scheinbar unbewegt dazwischen. Sie alle waren mit Punkten gesprenkelt und besaßen zusätzlich zu den weitgefächerten Flügeln noch lange, geschwungene Fühler.
Ich war diesen Pakt nicht freiwillig eingegangen. Moth hielt Hugh als Geisel, und was sollte ich anderes tun, als zu gehorchen?
»Hast du was gesagt?«, fragte Frinn an der Tür stehend. Sie trug eine blaue Schürze über ihrem dicken Wollkleid. Obwohl sie die fünfzig bereits überschritten hatte, war ihre Haut so rein und strahlend, dass ich sie darum beneidete. Meine Sommersprossen brachten mich eines Tages noch an den Rand der Verzweiflung.
Zudem war ich die einzige in meiner Familie mit widerspenstigem dunkelroten Haar. Elma, Frinn und meine Mutter hatten allesamt schwarzes Haar, auch wenn dieses bei ihnen nun mit vielen grauen Strähnen durchzogen war. Selbst das von Hugh und meinem Vater zeigte nicht den Hauch von Rot.
Vielleicht war ich ja doch ein Kuckuckskind und deshalb hatten mich meine Eltern loswerden wollen …
»Ich muss gehen«, sagte ich. »Bis morgen früh.«
Als ich an Frinn vorbeigehen wollte, drückte sie kurz meinen Unterarm. Ihre blauen Augen strahlten Wärme und Zuversicht aus. Die Sorge in ihrem Gesicht schien in den Hintergrund gerückt.
»Sei vorsichtig.«
Ich grinste schief. »Immer.«
Nachdem ich mich im Eingangsbereich wieder mühselig angezogen hatte, verließ ich das warme Innere und erzitterte sogleich.
Salazar und Paddy schnaubten glücklich. Ich wünschte mir, mit den beiden Gäulen tauschen und mit einer wärmenden Decke hier stehen bleiben zu können, anstatt mich zur Stadt aufzumachen.
Es half nichts. Zu Fuß machte ich mich auf den Weg von unserem Halteplatz am Rand eines Waldes bis zur Straße, die direkt in die Hauptstadt von Wimborne hineinführte.
Da wir keinen festen Wohnsitz hatten, war es einfach, mit dem Wohnwagen vor Städten und Dörfern zu halten. Auch sicherer. Dort wurden wir nicht von neugierigen Nachbarn beäugt, und Häscher verirrten sich selten aufs Land, wenn sie nicht gerade verzweifelt versuchten, Hexen oder Hexer aufzuspüren und festzunehmen.
»Warum muss es auch so kalt sein heute?« Ich zog den schwarzen Schal über meinen Kopf, sodass meine Ohren verdeckt waren. Danach steckte ich bibbernd meine Hände in die gefütterten Taschen meiner Jacke.
Immerhin hielten meine neuen Stiefel dem Schnee stand und sogen sich nicht mit Feuchtigkeit voll. Es waren momentan die kleinen Dinge, die mir Genugtuung verschafften. So etwas wie Glück hatte ich schon lange nicht mehr empfunden.
Wahrscheinlich seit Hugh von Moth entführt worden war. Noch heute machte ich mir Vorwürfe, nicht ausreichend auf meinen Cousin aufgepasst zu haben. Er war nur drei Jahre jünger, doch er hatte immer zu mir aufgesehen. Damals waren wir noch zusammen auf die Jagd nach Vampirinnen und Vampiren gegangen, bis dies eines Tages schiefgelaufen war.
Moth hatte ihn ergriffen und mich dazu gebracht, einen Vertrag mit ihm einzugehen.
Ich knirschte mit den Zähnen. Bald. Nicht mehr lange und ich hätte ein Jahr in seinen Diensten gestanden. Sobald der nächste Monat rum war, würde er Hugh frei und mich in Ruhe lassen.
Als ich die Straße erreicht hatte, konnte ich froh sein, mir während der Wanderung im Dunkeln nicht das Genick gebrochen zu haben. So nahe am Osttor von Westwend gab es immerhin ein paar Öllaternen, die den Weg wiesen. Das war keineswegs selbstverständlich, und es gab sie hier bloß, weil es sich um die Hauptstadt von Wimborne handelte.
Da es schon spät war, fuhren nur ab und zu Wagen an mir vorbei. Alle hatten es eilig. Niemand warf mir einen zweiten Blick zu. Die Wahrscheinlichkeit war zu groß, dass ich eine Vampirin auf Streifzug war und man dadurch meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Vielleicht fiel ich aber auch einfach nicht auf.
Ich wusste nicht, was mir lieber war. Es wäre sicherlich von Vorteil, eine Aura des Respekts auszustrahlen. Insbesondere in den heutigen Zeiten.
Vor fast einem Jahrhundert hatten sich das Vampir- und das Hexenvolk den Menschen zu erkennen gegeben. Man hatte immer über ihre Existenz gemunkelt. Nicht selten war es vorgekommen, dass Menschen von Wesen wie Ghulen oder Sirenen gefressen worden waren, doch so richtig geglaubt hatte man die vermeintlichen Ammenmärchen wahrscheinlich nicht.
Nach der Offenbarung hatte es jedoch kein Zurück mehr in die Leugnung gegeben. Die Menschheit musste sich neu arrangieren.
Während das Hexenvolk allerdings unterdrückt und versklavt wurde, hatten sich Vampirinnen und Vampire aufgeschwungen, um über alle zu herrschen. Den Menschen war nichts anderes übrig geblieben, als ihre Existenz nach erfolglosen Aufständen zu akzeptieren. Was einfacher zu ertragen war, weil sich nicht wirklich viel für sie änderte. Klar, hier und dort gab es einen leer gesaugten Menschen, aber vornehmlich terrorisierten Vampirinnen und Vampire mein eigenes Volk.
Hexen und Hexer hatten es schwer.
Ich atmete aus, und immer noch bildeten sich Wölkchen vor meinem Mund. Es war ein kleiner Trost, dass es nicht zu schneien begonnen und der Wind vor einer Weile nachgelassen hatte. Sosehr ich eine schneeverwehte Landschaft auch bewundern mochte, so wenig Spaß machte es, sich dabei fortbewegen zu müssen.
Westwend ragte wie eine riesige Festung vor mir auf. Jedes Mal war ich beeindruckt von der steinernen Stadt, die alle anderen Siedlungen in den Schatten stellte.
Die graublaue Stadtmauer umschloss die Hafenstadt zu allen Seiten und war in regelmäßigen Abständen mit Geschütztürmen ausgestattet. Dahinter bohrten sich blau und rot gekachelte Spitzdächer in den Himmel sowie einige große Backsteinbauten mit cremefarbenen Rundbögen, die sich überall in der Stadt wiederfanden. Immergrüne Pflanzen rankten sich an Hauswänden hinauf und wurden teilweise zu einem undurchdringlichen Geflecht, das den Zugang zu alten Ruinen versperrte. Rauch stieg aus unzähligen Kaminen und mischte sich mit dem weiß getünchten Nachthimmel.
Die Türen des massiven Osttors waren geöffnet und das schwere Gitter in der Mauer versteckt. Ich hatte es noch nie geschlossen erlebt und wusste nicht, was dafür geschehen müsste. Trotz konstanter Bedrohung durch übernatürliche Wesen, blieb meine Welt überraschend friedlich.
Ein Mann und eine Frau von der Stadtwache standen entspannt vor einer Kohlepfanne und wärmten sich daran die Hände. Bei meinem Eintreten blickten sie kurz auf und nickten mir zu. Ich strahlte für sie wohl keinerlei Gefahr aus.
Von diesem Punkt aus bewegte ich mich auf dem unregelmäßigen grauen Kopfsteinpflaster zwischen den riesigen Stein- und Lehmbauten entlang. Hier wie überall herrschte der Eindruck von geordnetem Chaos.
Westwend war ursprünglich nicht als eine Großstadt geplant worden. Nachdem die riesige Festung auf dem Hügel im Osten erbaut worden war, hatten sich nach und nach Menschen drumherum angesiedelt. Eben dort, wo noch Platz war. Dabei waren sie so kreativ geworden, dass einige Häuser mithilfe von Stelzen über anderen Häusern errichtet worden waren. Und durch ihre Mitte schlängelte sich die Sanil bis zum Cantari Meer.
Trotzdem oder gerade deshalb strahlte Westwend eine unglaubliche Weite und Vielseitigkeit aus. Beengte Gassen gab es zuhauf, genauso wie riesige Einkaufspassagen, in denen die Oberklasse ihr Geld verprasste, wenn sie dies nicht gerade in der beeindruckenden Markthalle in der Nähe des Rathauses tat.
Eine betrunkene Frau stolperte aus einer Bar und rempelte mich an. Ihre Wangen waren rot und ihre Augen glasig.
»Pass doch auf«, grummelte ich, mir über den Arm wischend.
»Pass du doch auf, Hexe«, zischte sie, ehe sie die Straße entlangtorkelte.
Ich erstarrte für eine Sekunde. Woran hatte sie mich erkannt? Waren Häscher in der Nähe, die sie gehört hatten?
Im nächsten Moment kam mir die Erleuchtung, dass sie den Begriff bloß als Beleidigung benutzt hatte. Trotzdem sah ich mich sicherheitshalber um.
Als ich niemanden in unmittelbarer Nähe entdecken konnte und die Fenster bis auf die der Bar allesamt dunkel blieben, setzte ich meinen Weg fort.
Bei den Göttern, wie sehr ich Westwend verabscheute. Überall waren Trunkenbolde, Süchtige nach Rauschgiften, die den Geist vernebelten, oder Häscher, die es auf meinesgleichen abgesehen hatten. Von den Vampirinnen und Vampiren einmal ganz zu schweigen. Die brauchte wirklich niemand. Auch wenn ebenjene mir widersprechen und gleich darauf die Kehle rausbeißen würden.
Während im Rathausviertel die Fassaden gepflegt und die Gassen gekehrt waren, häufte sich in White Bell der Unrat. Wenn einen nicht unbedingt Besorgungen in diesen Stadtteil führten, vermied man dieses heruntergekommene und ärmliche Viertel Westwends. Zum Glück musste ich es nur durchqueren, um zu Moth zu gelangen.
Mit wachem Blick und den Fingern um meinen Dolchschaft machte ich einen Bogen um einen Schneehaufen, den jemand neben seinem Lokal zusammengekehrt hatte. Das Schaufenster eines Barbiers wirkte überraschend edel dafür, dass er hier und nicht im Rathausviertel zu finden war. Goldene und schwarze Lettern, eine Werbetafel im Fenster, die die Preise bezifferte, und verschiedene Grünpflanzen zur Dekoration.
Seufzend setzte ich meinen Weg fort. Ich war schon spät dran, und die Motten unter meinem Schlüsselbein hatten wieder zu jucken begonnen.
Er wurde ungeduldig.
Als hätte es jemals die Möglichkeit gegeben, dass ich meinen Vertrag nicht erfüllte. So einfältig war ich nun auch nicht. Ich wusste, dass er Hugh sofort schaden würde, und das könnte ich meinen Tanten niemals antun. Mir selbst natürlich auch nicht.
Eine der schwarzen Laternen, die in regelmäßigen Abständen die Nacht erhellten, flackerte heftig, ehe sie ganz erlosch. Ich beeilte mich.
Wenige Minuten später läutete die Lunar Uhr bereits zur neunten Stunde. Ich war eindeutig zu spät. Die Glockenschläge waren so laut, dass ich mir einbildete, mein Körper würde vibrieren.
Ich verließ die große Straße zugunsten einer grau gepflasterten Gasse, duckte mich unter einer Wäscheleine hindurch, die zwischen zwei Häusern aufgehängt war und an Spannung eingebüßt hatte. Es war rutschig hier, und nicht nur einmal verlor ich auf den glatt getretenen Steinen beinahe das Gleichgewicht. Unelegant ruderte ich mit den Armen und versuchte, mich zu fangen. Immerhin fiel ich nicht hin und brach mir auf peinliche Weise das Genick.
Dann endlich erreichte ich das kleine gedrungene Stadthaus, das genauso unscheinbar wirkte wie alle in der Straße: eine mit Ritterkreuz-Efeu überwucherte Steinfassade, ein verlassener Balkon und abgedunkelte Fenster. Ein Hauch von Licht drang aus dem unteren Stockwerk nach draußen und verriet, dass es bewohnt war.
Ich stieg die zwei Stufen zur Haustür hinauf und betätigte den Messingklopfer, der die Form einer Katze hatte. Zwei Mal schlug ich ihn ans gebeizte Holz, bevor ich innehielt.
Es dauerte nicht lange, bis die Tür von dem Diener geöffnet wurde, der mich jedes Mal erwartete. Seine Freude, mich zu sehen, hielt sich allerdings in Grenzen. Er war ein Mann, der die achtzig Jahre weit überschritten hatte. Dennoch strahlte er Stärke und Abneigung aus wie niemand sonst, dem ich je begegnet war.
Wahrlich beeindruckend.
»Schön, dich wiederzusehen«, zwitscherte ich zur Begrüßung, weil mir einzig zwei Möglichkeiten blieben.
Die erste war die Naheliegende: Ich gab mich trotzig, wütend und ausfallend und konnte doch nichts an der Situation ändern. Und ja, ich hatte es in der Anfangszeit damit versucht.
Die zweite war die, dass ich mir meinen Humor nicht nehmen ließ, um gerade Moth nicht zeigen zu müssen, wie sehr es mir unter die Haut ging, ihm zu dienen. Damit meinte ich nicht nur die Motten, die er mir eigenhändig gestochen hatte.
Der Diener, der zu seinem Glück kein Sklave war, – denn menschliche Sklavinnen und Sklaven zu halten war verboten –, grunzte etwas Unverständliches und schritt dann wie gewohnt mit schlurfenden Sohlen in den angrenzenden Salon.
Im Gegensatz zum kalt wirkenden Flur, der nicht ein einziges Möbelstück beherbergte, war der Salon eingerichtet – weiche Sofas mit geschwungenen Rosenholzlehnen, dicke Teppiche auf den knarzenden Fußbodendielen und Wandbehänge in gedeckten Farben sowie gerahmte Landschaftsgemälde. Ein gut gefülltes Bücherregal stand direkt neben der Tür und gegenüber des weißen Specksteinkamins, in dem ein Feuer prasselte. Funken sprühten, als hätte gerade erst jemand frisches Holz nachgelegt, und der Geruch von Zedern breitete sich aus. Juckte mir in der Nase.
Ich sah mich um, doch ich war allein. Die drei hohen Spitzbogenfenster hatte vermutlich der Diener mit den schweren Brokatvorhängen verhüllt. Licht spendeten das Kaminfeuer und die vereinzelt platzierten Schirmlampen.
»Wo ist Hugh?«, fragte ich.
Der Diener drehte sich wortlos von mir weg und ließ mich stehen.
»Du bist spät«, kam es prompt aus der dunklen Ecke, die am weitesten von mir entfernt war. Ich hatte Moths Anwesenheit bis dahin nicht bemerkt. Wie üblich kleidete er sich in dunklen Schatten, sodass seine Identität geheim blieb. Wirbelnde Nebelschwaden von Kopf bis Fuß, die mich gerade am Anfang stets abgelenkt hatten.
Ich konnte lediglich seine Silhouette erkennen, abgesehen davon sah ich seinen schwarzen Umhang und die Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Trotz der Schatten. Er wollte nicht das geringste Risiko eingehen, dass ich ihn erkannte.
Schon öfter hatte ich mich gefragt, ob das daran lag, dass wir uns im Schein der Sonne begegnen könnten. In der Stadt als Mann und Frau, wenn ich nicht mit ihm rechnete.
War das der Grund für seine Vorsicht? Weil er jemand Bekanntes war? Oder weil er mir bereits begegnet war? Vorher …
Als er mein Mottentattoo eigenhändig gestochen hatte, hatte er mir die Augen verbunden, weil er mir so nahe hatte kommen müssen. Mit den Fingern hatte er hauchzart über mein Haar gestrichen, damit er es nicht versehentlich mit dem Band verknotete. Es war das erste Mal, dass ich einen Hauch von Wärme von ihm ausgehend gespürt hatte.
Doch ich konnte und wollte meinen Sinnen nicht vertrauen, für den Fall, dass er mich in die Irre führte.
Natürlich hatte ich längst mit meiner Magie überprüfen wollen, ob es sich bei ihm um einen Vampir handelte oder nicht, doch er musste einen Schutzbann um sich gewoben haben. Das bedeutete, entweder er selbst war als Hexer dazu fähig oder er hatte den Zauber eingekauft. Schutzzauber wie diese gab es zuhauf auf dem Markt zu erstehen. Sie waren nichts Besonderes und kein weiterer Hinweis auf seine Identität.
Ein Jahr war mittlerweile vergangen, seit wir uns das erste Mal begegnet waren. Ich konnte mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Es gab so viele Dinge, die ich im Zusammenhang mit ihm und Hugh bereute.
2. Kapitel
Vor einem Jahr
»Wo bei den Höllen kann er bloß sein?«, fragte ich nicht zum ersten Mal, ohne eine Antwort zu erwarten.
Elma, Hughs Mutter, war völlig aufgelöst, seit Hugh in der Nacht ohne uns losgezogen war. Einzig eine beklemmende Nachricht hatte er hinterlassen, die keine von uns beruhigt hatte.
Ich will mir und euch beweisen, dass ich auch dazu fähig bin, Jagd auf Vampire zu machen. Das ist wichtig für mich. Ich möchte nicht immer zurückbleiben. Ich kann auch etwas für das Hexenvolk tun.
Macht euch keine Sorgen. Ich bin gut vorbereitet und bei Morgengrauen wieder zurück.
Hugh
Natürlich war er nicht bei Morgengrauen zurück gewesen. Natürlich machten wir uns trotzdem Sorgen. Er hätte nicht allein losziehen sollen. Niemand von uns zog je allein los. In Ordnung. Abgesehen von mir, doch dabei hielt ich mich an sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, und meine Tanten wussten immer, wo ich war. Wann ich zurückerwartet wurde, und was sie tun mussten, wenn ich nicht wiederkam.
Zu dritt hatten wir stundenlang die Straßen von Westwend durchkämmt und dabei jeden Ort abgeklappert, den Hugh für eine Jagd auf einen fremden Vampir oder eine fremde Vampirin als geeignet empfunden hätte. Doch nichts.
Mittlerweile war die Sonne das zweite Mal seit Hughs Verschwinden untergegangen, und wir standen neben unserem Wohnwagen, während die eisige Kälte in meine Haut biss. Frost hatte sich auf den grauen Pflastersteinen gebildet. Der Geruch von Schnee lag in der Luft.
»Und wenn ihm was passiert ist?«, fragte auch Elma zum wiederholten Mal. Ihre Stimme zitterte genauso wie die schlanken Finger, die aus ihren fingerlosen Handschuhen herauslugten und die sie sich an die Lippen presste. Das Haar war mittlerweile völlig zerzaust, weil sie sich ständig mit den Händen durch die grau-schwarzen Strähnen fuhr.
»Er ist achtzehn. Er kann auf sich aufpassen. Wir haben ihm alles mitgegeben, was er zu wissen braucht«, beschwichtigte Frinn ihre jüngere Schwester und klopfte ihr auf die Schulter. Trotz ihrer Worte strahlte sie wie wir Hoffnungslosigkeit aus. Es war kein gutes Zeichen, dass wir nicht mal die kleinste Spur von Hugh gefunden hatten. Dass wir ihn selbst mit geballter Magie nicht orten konnten. Es gab kein Gerücht über einen schiefgelaufenen Anschlag auf eine Vampirin oder einen Vampir. Keine Nachricht, die im Geheimen weitergereicht wurde und wichtige Informationen zu einem gefangen genommenen Hexer enthielt.
Dass wir ihn nicht finden konnten, bedeutete entweder, dass er sich an einem magisch abgeschirmten Ort befand oder dass er …
Mein Verstand scheute instinktiv davor zurück, den Gedanken zu Ende zu führen. Er durfte nicht tot sein.
Ich ballte die Hände zu Fäusten. Das hier wäre nicht das Ende. Wir hatten nicht zusammen überlebt, um jetzt einen von uns zu verlieren.
»Wir müssen uns aufteilen«, sagte ich schließlich in die Stille der Nacht hinein.« Die Lichter der meisten Häuser ums uns herum waren bereits gelöscht. Dringend benötigter Schlaf hatte sich über die Bewohnerinnen und Bewohner von Westwend gelegt, bevor am folgenden Tag die nächsten harten Arbeitsstunden ihren Tribut forderten. Die Gaslaternen am Ende der Straße flackerten und verloschen dann ganz. Ich spürte eine unheimliche Präsenz. Gänsehaut breitete sich auf meinem gesamten Körper aus. »Was …?«
Da, wo am Ende der gepflasterten Gasse zuvor nur Schatten gewesen waren, stand plötzlich eine in schwarz gekleidete Gestalt. Sie blickte mit ihrem weißen Gesicht genau in unsere Richtung. Abwartend. Wissend auf eine Art, die ich zwar fühlte, aber nicht beschreiben konnte.
»Wer ist das?«, fragte Elma, sofort hatte sie ihren Dolch umfasst. Magie knisterte unsichtbar in der Luft. Trotz allen Schmerzes waren wir immer noch Jägerinnen und keine leichten Opfer.
Ganz gleich, welches Wesen es auf uns abgesehen hatte.
»Wir werden es herausfinden«, sagte Frinn. »Kommt.«
Ich bildete die Nachhut, blickte nach oben und suchte die Dächer nach etwaigen Feinden ab, die vielleicht darauf warteten, uns anzugreifen, während wir abgelenkt waren.
Abgesehen von dunklen Firsten und monsterhaften Wasserspeiern konnte ich jedoch keine Gefahren erkennen.
Wir näherten uns dem alten Mann, dessen Falten ihm tief ins Gesicht gegraben waren. Ein hämisches Lächeln zog an seinen schmalen Lippen und stieß mir sauer auf. Er wusste definitiv etwas, das er als Überlegenheit uns gegenüber empfand.
»Was willst du?«, fragte Frinn mit einem knurrenden Unterton. Wie ich hatte sie vermutlich mit ihrer Magie erfühlt, dass es sich bei ihm um keinen Vampir handelte. Aber ob er ein Mensch war, konnte ich nicht mit Sicherheit bestimmen.
Es war unabdinglich, vorsichtig zu bleiben.
Sein Grinsen wurde breiter, dann – kurz bevor ich die Geduld verlor – deutete er mit einem runzeligen Finger auf mich, die zwischen meinen Tanten stand. Weiter den glänzenden Dolch umfassend.
»Wenn du glaubst, dass ich mit dir irgendwohin gehe, …«, begann ich, bevor er seine Hand drehte und öffnete. Ein zerknittertes Stück Papier kam zum Vorschein.
Ich zögerte einen Moment. Es könnte eine Finte sein, mich zum Näherkommen zu bewegen. Gleichzeitig hatte mich meine Neugier gepackt, und ich war selbstsicher genug, um nicht derart leicht überwältigt zu werden. Mit meinen Tanten rückte ich vor, bis uns nur noch anderthalb Meter trennten.
Der Kerl hatte sich nicht bewegt, und ich streckte meinen Arm aus, ehe ich den knisternden Zettel an mich nahm und auffaltete.
Worte in geschwungener schwarzer Schrift schlugen mir entgegen. Eines unglaublicher als das nächste.
Ich habe Hugh. Wenn dir sein Leben lieb ist, folge meinem Bediensteten. Deine Tanten dürfen dich bis zum Haus begleiten, doch hineingehen musst du allein.
– Moth
»Moth?« Ich hatte die Nachricht laut vorgelesen, sodass ich sie nicht weiterreichen musste. »Ob er ein Vampir ist?«
»Woher weiß er, dass Hugh zu uns gehört?« Frinn wischte sich mit der freien Hand übers Gesicht, als würde sie dadurch das gedankliche Gewitter vertreiben können. Auch ihr Verstand war in den letzten Stunden überanstrengt worden.
Der Bedienstete drehte sich um und begann, von uns davonzulaufen.
»Warte!«, rief ich ihm nach, da wir noch keine Entscheidung getroffen hatten. Das schien ihn jedoch nicht zu beeindrucken. Er setzte seinen Weg unbeirrt fort.
Hilfesuchend blickte ich zu meinen Tanten.
Elma zuckte mit den Schultern. »Es ist die erste Spur, die wir gefunden haben. Oder die eher uns gefunden hat. Auch wenn ich verstehen kann, wenn du das Haus nicht allein betreten willst.«
»Das ist es nicht«, murmelte ich. Ich hatte keine Angst. Nur eine dunkle Vorahnung, die sich wie eine Schlange eng um mein Herz wand.
Wir eilten dem alten Mann nach, bevor er an der nächsten Kreuzung verschwand. Unverwandt fand er seinen Weg durch White Bell und weiter.
Und ich selbst fand mich wenig später meinem Schicksal gegenüber.
»Was soll ich sagen, viel Verkehr«, antwortete ich mit einem Schulterzucken, wieder im Hier und Jetzt angelangt. So unbekümmert wie möglich wirkend bewegte ich mich zum Feuer, um meine gefrorenen Glieder aufzutauen.
Götter, mir war so kalt. Lag das an der Erinnerung, die vehement an mir festhielt wie eine Schneebestie? Sie fühlte sich heute präsenter an als sonst.
»Und immer noch zitterst du nicht vor Angst.« Seine Stimme war dunkel und rau. Wie ein Finger, den er über meine Wirbelsäule gleiten ließ. Als Reaktion darauf erschauerte ich wider Willen.
Ich konnte nicht sagen, ob er die Stimme verstellte oder immer so klang. Sie war der Hauptgrund dafür, dass ich dachte, dass es sich bei Moth um einen Mann handelte.
»Warum sollte ich? Solange ich meinen Teil der Abmachung einhalte, hältst du dich auch an deinen, oder nicht?« Ich legte den Kopf schief, sodass meine Kapuze nach hinten rutschte.
Moth löste sich aus der Ecke und näherte sich mir. Er wirkte nicht direkt bedrohlich, doch es wäre mir lieber gewesen, wenn er auf Abstand blieb. Weit entfernt, sodass ich mich rechtzeitig wehren könnte, was auch immer er versuchte.
Da ich ihm nicht meine tatsächlich vorhandene Angst zeigen wollte – falls er nicht ohnehin mein rasendes Herz hören konnte –, blieb ich stockstill.
Als uns nur noch das eine geblümte Sofa voneinander trennte, hielt er an. Die Schatten quollen weiterhin wie Rauchschwaden aus seinem Körper hervor. Der Zedernduft ging nicht von ihnen aus, und sie verteilten sich auch nicht im Raum. Blieben wie eine Aura in seiner direkten Nähe. Berührten mich dennoch irgendwo tief drin und warfen mich ein weiteres Mal zurück in die Vergangenheit.
Unser erstes Aufeinandertreffen hatte sich damals in meine Knochen gezeichnet. Als hätte jemand mit Hammer und Meißel unsere Geschichte auf ihnen verewigt, damit ich sie niemals vergaß.
In mir.
Nachdem ich dem Griesgram allein ins Haus gefolgt war, hatte er mich in ebenjenen Salon gebracht. Moth hatte bereits auf mich gewartet. Wie heute. Ohne Hugh.
»Wer bist du?« Obwohl ich meinen Obsidiandolch nicht in der Hand hielt, war ich nicht hilflos. Ich hatte meine Magie, die ich jederzeit einsetzen konnte. Selbst wenn ich nicht sonderlich mächtig war, würde sie für eine Ablenkung ausreichen.
»Du darfst mich Moth nennen«, antwortete er heiser. Die Schatten, die um seine Silhouette wirbelten, irritierten mich. Ich konnte weder seine Gesichtszüge erkennen noch irgendein Stück seiner Haut.
»Ich will dich weder Moth nennen noch bei irgendeinem anderen hirnverbrannten Namen. Sag mir, wo Hugh ist!«
Ich bildete mir ein, ein Schmunzeln zu sehen, dabei konnte ich weiterhin bloß Schatten erkennen. Vielleicht lag sein Vergnügen auch wie ein schwerer Geruch in der Luft.
»Du solltest mir dankbar sein, schließlich habe ich deinen Cousin vor einem schmerzhaften Tod bewahrt.«
Ich verengte die Augen. Jetzt kamen wir immerhin zur Sache. Es war eine schwierige Entscheidung gewesen, allein das Haus zu betreten. Genauso gut hätte eine Falle auf mich warten können, und ohne meine Tanten als Unterstützung standen meine Chancen schlecht.
Doch Hughs Name aus seinem Mund beruhigte mich geringfügig.
»Bedeutet was genau? Wo ist er?«
»Hier im Haus. Du wirst ihn gleich sehen können. Vorausgesetzt, wir gelangen zu einer Übereinkunft.« Die Gestalt, Moth, blieb auf der anderen Seite des Zimmers, worüber ich froh war. Sein Blick wog nichtsdestotrotz schwer auf mir.
»Was genau ist passiert?«
»Die Einzelheiten sind nicht wichtig. Er hat sich im Kampf übernommen, und bevor er von der Vampirin ausgesaugt wurde, bin ich dazwischen gegangen.«
Bis hierhin klang seine Geschichte gar nicht so weit hergeholt. Es passte zu dem, was Hugh in seinem Brief an uns geschrieben hatte.
»Aus der Güte deines Herzen?«
»Wohl kaum.« Immerhin war er ehrlich. »Ich brauche ihn als Druckmittel.«
Ich verschränkte abweisend die Arme. Einerseits war es gut, dass er einen Nutzen für Hugh hatte, was für den Moment sein Überleben sicherte, andererseits würde nun etwas sehr Unangenehmes folgen. Moth brauchte sicher keinen Pfand, um mich dazu zu bringen, seine Einkäufe zu erledigen oder bei ihm als Haushälterin anzuheuern.
»Rück schon raus mit der Sprache, oder soll ich dir deinen Wunsch von den Schatten ablesen?« Auch wenn in mir drin die Furcht ihr schreckliches Haupt erhob, würde ich es ihn ganz sicher nicht wissen lassen.
Er neigte den Kopf. »Ein Jahr. Du stehst mir ein Jahr zur Verfügung, in dem Hugh hier bei mir verweilt, unverletzt und versorgt, und dann lasse ich euch ungeschoren gehen.«
»Inwiefern zur Verfügung stehen?« Ein Jahr? Das war eine verdammt lange Zeit.
»Es wird weniger schlimm, als du dir gerade zweifellos ausmalst.« Moth hatte nicht mal den Hauch einer Ahnung, welche verwerflichen und grauenhaften Gedanken in mir erweckt worden waren. »Du tust das, was du bisher auch getan hast.«
Ich schnaubte. »Was? Vampire töten?«
»Ganz genau.« Ich hatte es bloß im Scherz gesagt, weshalb mich seine Bestätigung kurzzeitig irritiert zurückließ. »Die Vampire, die ich dir vorher nenne. Du ziehst allein los, tötest sie und bringst mir einen Beweis.«
»Das klingt …«
»Zu einfach?«
»Normalerweise arbeite ich für niemanden und schon gar nicht für jemanden, der mich erpresst.« Ehrlicherweise war das, was er verlangte, tatsächlich weniger schlimm, als ich gedacht hatte.
»Das ist mir klar, aber du würdest ohne Hugh nicht auf mich hören.«
Wo er recht hatte … Das machte die Sache allerdings nicht angenehmer.
»Ein Jahr lang?« Er nickte. »Woher weiß ich, dass du dich an die Abmachung hältst?«
»Traust du meinem Wort nicht?« Er wirkte gespielt bestürzt, wartete aber keine Antwort ab. »Dir bleibt wohl nichts anderes übrig. Und da ich am längeren Hebel sitze, musst du noch eine andere Sache für mich tun.«
Ich wollte widersprechen, aber er hatte recht. Hugh war in seiner Obhut. Meine Tanten waren draußen. Er gab mir eine Chance, uns alle zu retten, und ich sollte klug genug sein, sie vorerst wahrzunehmen.
»Ich werde keine Menschen töten und nicht deine Dienerin spielen.« Eine Hexensklavin zu werden, war das schlimmste Schicksal, das ich mir ausmalen konnte.
»Ein Tattoo. Du brauchst noch ein Tattoo, damit du meinen Ruf vernehmen kannst, wenn ich deine Dienste benötige.«
»Wenn es sonst nichts ist …«, sagte ich, ohne es zu meinen. »Denkst du, ich bin nicht mehr ganz bei Verstand? Warum sollte ich dir alles geben und vertrauen? Was hält dich davon ab, mir in zwei Monaten in den Rücken zu fallen? Vergiss es.«
Ich attackierte ihn ohne Vorwarnung mit meiner Magie. Dazu bewegte ich meine Hände vor mir in einem Kreis. Ich zog das Feuer aus dem prasselnden Kamin bis zu mir, um es dann in einer brennenden Wand Moth entgegenzuschleudern.
Doch er war schneller als gedacht. Statt ihn zu einem Häufchen Asche zu verbrennen, versengte ich das Sofa, das hinter ihm gestanden hatte.
Wo war er?
Hektisch suchte ich in dem dämmrigen Raum nach den tiefen Schatten, die ihn umgeben hatten. Als ich mich umdrehen wollte, spürte ich kaltes Eisen an meiner Kehle. Ich gab mein Bestes, nicht vor Schreck zusammenzuzucken, versagte dabei jedoch kläglich.
Moth ragte fast einen Kopf über mir auf. Seine Präsenz wirkte zumindest so auf mich in meinem Rücken, selbst wenn ich ihn nicht sehen konnte. Ich spürte seinen Körper nah an meinem. Seine Wärme? Vielleicht.
Mein Herz schlug so heftig, dass mir übel wurde.
»Das sind meine Bedingungen. Akzeptiere sie oder die Konsequenzen, die sich aus deiner Weigerung ergeben«, raunte er.
»Hughs Tod?«
Sein Schweigen war Antwort genug. Und meines auch.
»Kommen wir zum Geschäftlichen«, sagte er prompt und riss mich damit ein weiteres Mal aus meinen Gedanken. Seit damals hatte sich eine Art Routine zwischen uns eingespielt. Etwas, worüber ich nicht zu genau nachdenken wollte, weil sie implizierte, dass ich mich längst nicht mehr vor ihm fürchtete. Dass er zu einer bekannten Konstante in meinem Leben geworden war.
Ein großer Fehler.
Ich verdrehte die Augen, bemüht, ihm meinen inneren Konflikt zu verheimlichen. »Als wäre ich diejenige, die uns aufgehalten hat.«
Er schwieg einen Moment.
»Baron Temerin.«
Baron. Diesen und andere Adelstitel hatten sich Vampirinnen und Vampire nach der Offenbarung gegeben. Unabhängig von der menschlichen Gesellschaft regierten die wichtigsten und einflussreichsten von ihnen zusammen mit dem vampirischen Bürgermeister Crosspin von Westwend in einem Stadtrat. Oder eher Vampirrat.
»Betrachte es als erledigt.« Baron Temerin. Mein nächstes Opfer.
Es war zwar ungewöhnlich, dass mir Moth auftrug, einen so mächtigen Vampir, wie besagter Baron einer war, zu erledigen, aber nicht unerhört. Es gab zwei Kategorien von Vampirinnen und Vampiren, die das einzige waren, was bei meiner Jagd einen Unterschied machte.
»Er ist ein Kronvampir«, fügte Moth an, als hätte er meinen Gedankengang verfolgen können.
»Und ich bin Billie Kron«, erwiderte ich grinsend, obwohl ich gerade heute Nacht keine Lust auf einen Kronvampir hatte. Irgendetwas fühlte sich anders an.
Prinzipiell waren Kronvampirinnen und -vampire wie alle anderen auch, nur dass sie das eben nicht mehr waren. Ein neuer Vampir beispielsweise konnte nur von einem Kronvampir kreiert werden. Zu einem Kronvampir wurde man dann, wenn man eine magische Verbindung mit einer Blutbraut oder einem Blutbräutigam eingegangen war. Jede Hexe und jeder Hexer konnte eine Vampirin oder einen Vampir haben, zu dem sie passte. Manchmal passten wir auch zu mehreren und andersherum. Während Hexen und Hexer jedoch nur eine Konvergenz eingehen konnten, konnten sich Vampirinnen und Vampire mehrere Blutbräute und Blutbräutigame zulegen. Eine Bezeichnung, die mir zunehmend sauer aufstieß.
Es war keine Heirat. Es war Zwang.
Und nur deshalb wurden wir gejagt. Deshalb konnten wir nicht mehr in Freiheit leben.
Vampirinnen und Vampire brauchten Hexen und Hexer, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihre Rasse vor dem Aussterben zu bewahren.
Ich hasste es.
Möglicherweise spürte ich dadurch neue Motivation in mir aufflackern, Baron Temerin zu erledigen. Er hatte sicherlich eine Hexe oder einen Hexer unfreiwillig zu einer Konvergenz gezwungen. Und damit ihr oder sein Leben für immer an das seine gebunden.
»Dein Cousin kommt gleich.« Moth entfernte sich wieder von mir.
»Warum Temerin?«, fragte ich aus einem Impuls heraus. »Hast du eine persönliche Fehde mit ihm?«
Er blieb auf der Türschwelle stehen. »Würde es dir mehr oder weniger Freude bereiten, ihn auszumerzen, wenn es so wäre?«
»Weniger«, antwortete ich ehrlich.
»Dann ist es wohl besser, nichts zu sagen.«
Er gab mir nicht die Chance, etwas zu erwidern, weil er sogleich in der Dunkelheit des angrenzenden Korridors verschwand.
Nachdenklich knibbelte ich an meinem Daumennagel, während ich ins Feuer starrte. Das Knacken und Knistern beruhigte mich. Fast konnte ich mir einbilden, im Wohnwagen zu sein. In der Heimeligkeit meines Zuhauses.
»Billie!«, rief Hugh aus, als er zu mir eilte.
Wir umarmten uns, als hätten wir uns Monate nicht gesehen. Ich vermisste seine Anwesenheit im Wohnwagen mehr, als ich zu sagen vermochte. Seine Nähe vertrieb jedoch für kostbare Momente all meine Sorgen.
Für seine achtzehn Jahre war er ziemlich schlank und zierlich. Während wir tagtäglich unter Frinns strengem Regiment trainierten, um für die Jagd körperlich fit zu sein, saß Hugh für gewöhnlich am Küchentisch und schrieb eigene Geschichten.
Nicht zum ersten Mal zog ich in Betracht, dass dies der Grund dafür war, dass er sich davongestohlen hatte und dann von Moth überwältigt und entführt worden war. Wir hatten ihn nicht genügend vorbereitet. Hatten geglaubt, wir würden ihn beschützen können.
»Geht es dir gut?« Als wir uns voneinander lösten, kniff ich ihm spielerisch in den Oberarm und er zuckte lachend zurück. Er sah gesund aus. Seine Haut, die wegen seines Vaters ein paar Nuancen dunkler war als die von meinen Tanten und mir, strahlte förmlich im Schein des Feuers. Das widerspenstige blonde Haar stand nach allen Seiten ab, und die Augenbrauen waren buschig und dick.
»Schon. Mir ist bloß langweilig nur in Gesellschaft des Dieners.« Er verdrehte die Augen. »Er hat immer noch kein Wort mit mir gewechselt. Auch nach einem Jahr nicht. Es ist frustrierend und einsam. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Für dich. Für uns alle.«
»Das tut mir leid. Nächstes Mal nehme ich deine Mutter mit, ja?«
»Wie geht es ihr?« Sofort verdüsterte sich sein Blick.
»Sie gibt ihr Bestes, nach vorne zu schauen. Und es ist ja fast geschafft. Das Jahr dauert nicht mehr lang.«
Er zeigte mir ein wackliges Lächeln, und es brach mir das Herz. Auch nach so langer Zeit konnte ich ihn nicht einfach mit mir mitnehmen.
Ich hatte es versucht. Hatte seine Hand genommen und war mit ihm bis zur Haustür gerannt, doch weiter waren wir nie gekommen. Spätestens dort hatte sich Moth uns in den Weg gestellt.
Ich hatte versucht, ihn mit meiner Magie in Schach zu halten. Ihn mit den Flammen aus den Öllampen zu blenden, ihn in einen kleinen Wirbelsturm gefangen zu nehmen und ihn an dem Holz der Böden festzukleben.
Es hatte funktioniert. Für die Dauer eines Wimpernschlags war der Triumph der meine gewesen, ehe die Realität wie ein kalter Regenschauer auf mich niedergeprasselt war.
Die Wahrheit war die, dass Hexen und Hexer zwar Magie wirken konnten, doch solange sie keine Konvergenz mit einer Vampirin oder einem Vampir eingegangen waren, konnten auch sie niemals ihr gesamtes magisches Potenzial ausschöpfen. Unsere Magie reichte aus, um im Alltag zu bestehen. Zu überleben. Doch nicht, um uns gegen das Vampirvolk und andere Geschöpfe – denn, um was es sich bei Moth handelte, wusste ich nicht – zu verteidigen.
Nachdem mir die Erkenntnis gekommen war, hatte ich es mit meiner körperlichen Stärke versucht. Doch ganz gleich, wie ich mich bewegt hatte, welche Finte ich mir ausgedacht und ausgeführt hatte, ich hatte ihn nie zu fassen bekommen.
Er war ein Phantom.
Und so hatten Hugh und ich und meine Tanten … Wir alle hatten uns dem Schicksal ergeben müssen. Der Kontrakt war ungebrochen. Die Konditionen mit gefährlichen Nadeln festgesteckt.
Auch wenn mir Moth nie verraten hatte, warum er mich brauchte, um seine Drecksarbeit zu erledigen, war ich froh, dass er uns überhaupt die Möglichkeit gab, Hughs Freiheit zurückzugewinnen.
»Wir sehen uns später«, versprach ich meinem Cousin. Sollte mein Attentat auf Temerin erfolgreich verlaufen, könnte ich den Beweis für meinen Auftragsmord schon vor dem Morgengrauen abliefern.
Sobald die Sonne aufging, war es mir nicht mehr gestattet, Moth oder Hugh zu besuchen. So lautete eine der Regeln.
Ich drückte ihn noch einmal fest, dann verabschiedeten wir uns.
Der Diener reichte mir wie üblich den Zettel mit der Adresse, öffnete mir dann schweigend die Haustür und knallte sie hinter mir zu.
»Unhöflicher Mistkerl«, grummelte ich, ehe ich mir den Schal wieder über den Kopf zog. »Dann mal los.«
3. Kapitel
Ascolott 4. Rathausviertel. Nachdem ich die Adresse gelesen hatte, ließ ich den Zettel mit dem Funken einer Straßenlaterne zu Asche zerfallen. Kurz zischte es, dann waren die Überreste im rauen Wind verschwunden.
Standesgemäß hauste Baron Temerin im angesehensten Viertel Westwends. Als Kronvampir fühlte er sich vermutlich unter seinesgleichen am wohlsten.
Ich beeilte mich, durch die mitunter menschenleeren Straßen und Gassen zu wandern, um mein Versprechen gegenüber Hugh halten zu können. Es war schwer nachzuvollziehen, wie er nach all dieser Zeit noch Hoffnung in mich oder meine Tanten setzen konnte. An seiner Stelle hätte ich mir große Vorwürfe gemacht. Weil ich nicht dazu in der Lage war, ihn zu befreien, ohne nach Moths Pfeife zu tanzen.
Meine Entschlossenheit steigerte sich. Gleichzeitig wurde mir erneut furchtbar kalt.
Es kribbelte bereits in meinem Nacken. Mein Herz pochte in zweifacher Geschwindigkeit, weil mein Unterbewusstsein etwas wahrgenommen hatte, das ich noch nicht greifen konnte.
Abrupt blieb ich stehen. Drehte mich um und inspizierte mit verengten Augen meine Umgebung.
Fast hatte ich es an White Bell vorbei geschafft. Rechts von mir breitete sich dieses ärmliche Viertel aus. Direkt hinter der halbhohen, mit Unkraut bewachsenen Mauer. Frost zog sich in rasender Geschwindigkeit über die rauen und teilweise gesprungenen Backsteine. Auch die Hausfassade zu meiner Linken war mit einer dünnen Eisschicht überzogen und an ihr …
Ich riss den Mund auf, als ich mit bloßem Auge beobachten konnte, wie dunkelgrüne Pflanzen, braune Äste und Zweige Boden und Wände knisternd und raschelnd überwucherten. Sie schienen mit einer so düsteren Aura ausgefüllt zu sein, dass ich instinktiv zurückwich. Ich befürchtete, dass mich eine einzige Berührung vergiften würde.
Das war unmöglich. So schnell konnte nichts wachsen. Zumindest nicht ohne Magie.
Unwillkürlich ging ich einen weiteren Schritt zurück und noch einen.
»Was zur Hölle?«
Abgesehen von dem Knistern des Eises, das sich weiter ausbreitete, sowie dem Rascheln von Blättern und Geäst des wachsenden Waldes, war es still. Dort, wo ich gerade noch gestanden hatte, schoss unter lautem Getöse und Knirschen ein Baumstamm so breit wie mein Körper in die Höhe. Eine riesige Baumkrone spannte sich über mich, als die ersten dicken Schneeflocken zwischen den Blättern hindurchfielen.