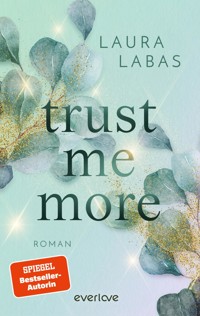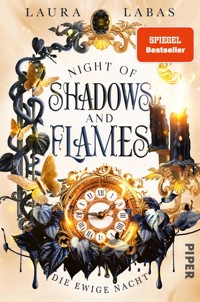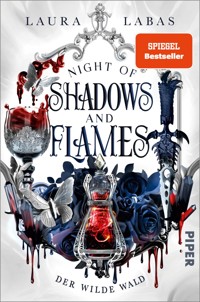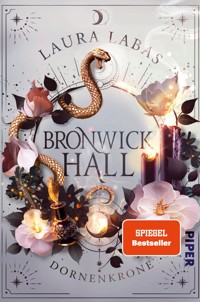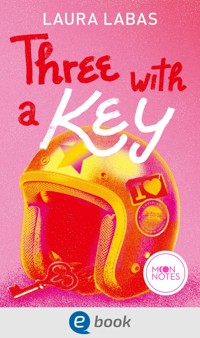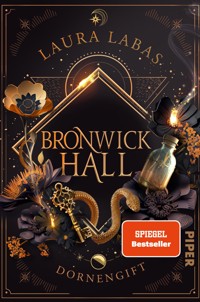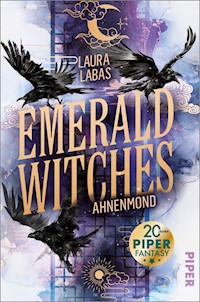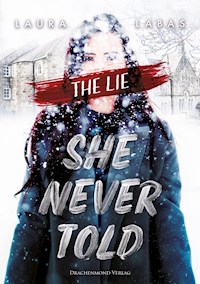9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Darcia Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finstersten Hexenseelen, um mit deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie dreizehn Hexen töten. Während Darcia in den verwinkelten Straßen von New Orleans unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Valens Mariquise in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Darcia könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt – und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Das Herz der Hexe« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Karte: Stephanie Gauger, Guter Punkt München
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt, München, Stephanie Gauger unter Verwendung von Motiven von GettyImages
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Karte
Motto
MYRRHE
Ruhe vor dem Sturm
I
DARCIA
II
VALENS
III
DARCIA
IV
VALENS
V
DARCIA
VI
DARCIA
VII
DARCIA
VIII
VALENS
IX
VALENS
X
DARCIA
XI
VALENS
WEINRAUTE
Auf neuen Pfaden
XII
RUTH
XIII
DARCIA
XIV
DARCIA
XV
RUTH
XVI
VALENS
ROSE
Herz der Leidenden
XVII
RUTH
XVIII
DARCIA
XIX
DARCIA
XX
RUTH
XXI
VALENS
XXII
DARCIA
XXIII
DARCIA
XXIV
RUTH
XXV
VALENS
XXVI
VALENS
XXVII
DARCIA
ROSMARIN
Einmal in ihnen gebannt
XXVIII
RUTH
XXIX
DARCIA
XXX
VALENS
XXXI
DARCIA
XXXII
RUTH
XXXIII
DARCIA
XXXIV
DARCIA
XXXV
RUTH
LAVENDEL
Das Selbst verlassen
XXXVI
DARCIA
XXXVII
DARCIA
XXXVIII
DARCIA
XXXIX
DARCIA
XXXX
DARCIA
Danksagung
Für meine Heldin
Mama
Bis zum Mond und wieder zurück
so sehr liebe ich dich.
Töte dreizehn Hexen,
verbrenn auf einem Scheiterhaufen
und ertränk dich selbst im See der Sterne –
erst dann wirst du über die Wicked herrschen.
MYRRHE
Ruhe vor dem Sturm
I
DARCIA
Das Herz der Hexe pulsierte in meiner Hand.
Ich drückte zu.
Das Gefühl des menschlichen Organs an meiner Haut überwältigte mich. Übelkeit stieg in mir auf.
In dieser Sekunde wäre jedes Zeichen von Schwäche tödlich, deshalb atmete ich tief durch die Nase ein und hielt meinen Blick auf das Gesicht der Hexe gerichtet. Ihr Mund war weit aufgerissen, in ihren Augen spiegelte sich meine dunkle Maske wider, wirkte verzerrt und monsterhaft.
Ich lächelte.
»Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort«, sagte ich, obwohl es gelogen war. Ich hatte sie wochenlang verfolgt, war tagsüber in ihre Wohnung geschlichen und hatte mich nachts auf die Lauer gelegt. Am Ende hatte es keinen Aspekt ihres Lebens gegeben, der mir unbekannt gewesen wäre. Kein Geheimnis, das ich nicht aufgedeckt hätte. Keinen Atemzug, der mir entgangen wäre.
Wochen vorher war mir die Hexe zufällig aufgefallen, als ich aus einem Café getreten war. Ein Blick über meinen Kaffeebecher hinweg in ihre glasigen Augen hatte ausgereicht. Er hatte mir gezeigt, dass sie Magie ausübte. Nachdem ich mich umgesehen hatte, bemerkte ich ein Pärchen, das sich lautstark stritt. Ein Lächeln zierte die dunklen Lippen der Hexe, als sich das Paar gegenseitig wüste Beschimpfungen an den Kopf warf, um dann getrennte Wege zu gehen. Die Hexe war eine Unruhestifterin, die sich in das Leben ahnungsloser Menschen einmischte.
Ich folgte ihr aus dem French Quarter von New Orleans hinaus in die Esplanade Avenue und meine Befürchtung bestätigte sich. Die Hexe gehörte einem der Zirkel an, der sich ausschließlich dunkler Magie bediente. Für sie bedeutete dies grenzenlose Macht – und für mich?
Für mich war sie damit zu meinem nächsten Opfer geworden.
Das Blut wärmte meine Hand.
Mit einem Ruck zog ich das Herz aus der Brust der Hexe. Ein letzter Schlag. Im nächsten Augenblick kippte der leblose Körper zur Seite und ich blickte in das gähnende Maul der mit Hyazinthen bewachsenen Gasse.
Ein weiteres Herz. Ein weiterer Schritt hin zu meinem Ziel.
Das schrille Lachen einer Frau riss mich aus meinen Gedanken und ich erkannte mit Schrecken, dass ich eingenickt war.
Stirnrunzelnd rief ich mir meine Situation in Erinnerung. Ich hockte zwischen einem dunkelblauen SUV und einer Rotzeder eingequetscht, um die dreizehnte und somit letzte Hexe, die ich für meinen Plan benötigte, zu beobachten. Unglückseligerweise war sie vor einer ganzen Weile in ihrem weiß getünchten Haus mit der heruntergekommenen Veranda verschwunden und ich hatte den Kampf gegen meine Müdigkeit verloren. Mit offenen Augen war ich in die Vergangenheit gesunken.
Als ich mich halb aufrichtete, um meine eingeschlafenen Glieder zu schütteln und zu strecken, hörte ich das Lachen erneut und ging sofort wieder in Deckung. Die Hexe, Jemma, war aus ihrem Haus getreten. Mit der einen Hand schloss sie die blaue Eingangstür ab, mit der anderen hielt sie sich ihr Telefon ans Ohr. Ihr Lachen erklang ein weiteres Mal, bevor mich die Gesprächsfetzen, die zu mir herüberwehten, darüber aufklärten, dass sich die Unterhaltung dem Ende zuneigte. Sie wünschte der anderen Person einen schönen Abend und legte auf.
Es kribbelte in meinen Fingern.
Ich folgte Jemma die hell erleuchtete Straße entlang, taumelte von Schatten zu Schatten, da sich meine Knie noch wacklig anfühlten, und suchte fieberhaft nach einem Grund, die Sache nicht jetzt schon zu beenden. Natürlich, ich hatte bei Weitem nicht so viel Zeit darauf verwendet, Jemma zu beobachten, wie bei den zwölf Hexen vor ihr, aber ich kannte mittlerweile ihren Alltag, wusste um ihre schwarze Magie und ahnte, dass sie abgesehen von ihren Zirkelhexen über keinerlei soziale Kontakte verfügte. Es könnte heute geschehen.
Ich könnte die erste Phase des Rituals mit ihrem Herzen abschließen.
Noch eine Nacht.
Mein Herz klopfte heftig, als Jemma in eine dunkle Straße einbog, die auf der einen Seite an fensterlose Hauswände grenzte und auf der anderen an das Ufer des Mississippis. Jemma fühlte sich sicher. Als zweiundvierzigjährige, mäßig talentierte Hexe zu sicher. Sie hatte ihr mausbraunes Haar mit einer rosa Schleife zurückgebunden, der einzige Farbtupfer, den sie sich erlaubte. Graue Stoffhose, grauer Mantel, graue Schuhe bildeten den Rest ihres Outfits. Nichts Auffälliges. Nichts, das sie als böswillige Hexe gebrandmarkt hätte. Trotzdem wusste ich, dass sich auf ihrer Haut mehrere Tattoos verbargen. Zirkelhexen neigten dazu, sich gegenseitig zu markieren, um ihre ewig andauernde Zugehörigkeit erkennbar zu machen.
Als ich mich am Anfang der Straße an die Mauer presste, fiel mein Blick auf meine eigenen tätowierten Hände. Ein großer Hirschkopf prangte auf meinem linken Handrücken und jeder einzelne meiner Finger war mit Runen, Symbolen der Elemente und bestimmten Zaubern übersät. Striche, Augen, Pfeile, Punkte und Kreise. Immerhin besaßen sie eine tiefere magische Bedeutung und schützten mich vor den meisten Flüchen, die Hexen und Waiżen, Hexen mit besonderer Affinität für Flüche, gegen mich verwenden würden.
Jemma stand dem Ufer zugewandt und blickte auf das ruhige Gewässer hinaus. Die Mondsichel schien hell auf uns herab, erleuchtete die nebelverhangene Nacht.
Ich ließ mich hinreißen.
Der Ort war noch weit genug von der St Charles Avenue entfernt, wo sich die meisten Hexen aus den Zirkeln herumtrieben, wenn sie nicht einen der achtzig Friedhöfe aufsuchten. Keine Menschenseele befand sich in unserer unmittelbaren Nähe.
Jetzt.
Ich umfasste einen der Flüche, der fein säuberlich verpackt in einem der handtellergroßen Jutebeutel an meinem Gürtel befestigt war. Flüche setzten sich aus mineralischen und pflanzlichen Bestandteilen zusammen, die in langwierigen Prozessen miteinander verbunden wurden. Diesen Fluch löste ich langsam von der Schlaufe. Als Hexia, Halbhexe, war ich nicht sonderlich begabt, was Flüche und Zauber anging. Meine Spezialität war eher das Brechen von ebenjenen Flüchen und das Heilen von körperlichen Beschwerden. Mit genügend Vorbereitungszeit konnte selbst ich jedoch einen Unbeweglichkeitsfluch herstellen. Das Buch einer dreihundert Jahre alten Voodoohexe hatte mir dabei bisher gute Dienste geleistet.
Ich trat einen Schritt vor und begab mich dadurch in Sichtweite der Hexe.
Nicht mehr Jemma.
Keine eigenständige Person.
Ich musste sie einzig und allein als bösartige Zirkelhexe sehen, um das zu tun, was getan werden musste.
Die Erinnerung der letzten zwölf Male holte mich ein. Blut. So viel Blut. Jedes Mal ein gellender Schrei und das Flehen, das es nie über die Lippen schaffte. Die Wärme der Herzen, das hektische Klopfen, als würde ich einen kleinen Vogel in meiner Hand halten. Grenzenlose Macht gefolgt von dem Geruch nasser Erde, freigesetzt durch alte Magie …
»Wer …?« Als sie meine Bewegung wahrgenommen hatte, drehte sie sich zu mir um. »Darcia? Was machst du hier?«
Überrascht hielt ich inne. Ich hatte nicht damit gerechnet, erkannt zu werden. Ein großer Fehler.
Du hast zu überstürzt gehandelt. Dir war nicht klar, dass sie von dir gehört, dich schon mal gesehen hat.
Es änderte nichts. Ich würde heute, jetzt, handeln müssen, sonst wäre all meine Vorbereitung für die Katz gewesen. Mein Griff um den Beutel wurde fester und ich konnte das Prickeln in seinem Inneren fühlen. Ein so starker Fluch wurde nach einer Weile ungeduldig, flehte darum, endlich freigelassen zu werden. Wie ein Tier, das man eingesperrt hatte.
Ich machte mich bereit, den Fluch auf die Pflastersteine zwischen uns zu werfen und die Sache damit endgültig in Gang zu setzen, als ich laute Schritte vernahm. Auch Jemma wurde von dem Geräusch abgelenkt und ihr Blick fiel auf jemanden, der sich hinter mir näherte.
Eilig steckte ich den sich kläglich windenden Fluch zurück an meinen Gürtel, um in keiner prekären Situation zu landen, in der ich ihn erklären müsste. Sekunden später tauchte Tieno aus der Nebelwand auf. Jeder seiner Schritte ließ den Grund erbeben, obwohl er für einen Waldtroll ziemlich jämmerlich geraten war.
»Tieno? Was machst du hier?«, rief ich entgeistert und das Herz rutschte mir in die Hose. Die Gelegenheit war vertan. Es war kein Hellseher nötig, um die kommenden Minuten vorherzusehen. Jemma hatte mich erkannt und wusste somit auch, dass Tieno mein Waldtroll war, auch wenn er sich unter dem Schleier eines grobschlächtigen, riesigen Mannes verbarg. Seine wahre Gestalt offenbarte er nur in geschlossenen Räumen und unter seinesgleichen. Gleich blieben jedoch seine schwarzen glatten Haare, die breiten Schultern und das zerfurchte Gesicht mit der platten Nase, die ihn aussehen ließ, als hätte er einen heftigen Schlag abbekommen. Seine langen Beine steckten in einer dunklen Hose, unter deren Saum Wildlederschuhe hervorlugten, die ich ihm alle drei Monate neu kaufen musste, weil er die Sohlen so schnell durchlief.
Der sanfte Riese würde nicht zulassen, dass ich in seinem Beisein eine Hexe schlachtete, und diese Hexe würde sich auf den Weg zu ihrem Zirkel machen, um ihren Schwestern von der seltsamen Begegnung mit der Fluchbrecherin und ihrem Troll zu berichten.
Dies wäre das Ende.
Jemma war ihrem sicheren Tod dank meines Freundes von der Schippe gesprungen.
Ich verfluchte ihn innerlich. Natürlich ohne Magie.
»Wila«, sagte Tieno.
Jemma nutzte die Gelegenheit, um die unbeleuchtete Gasse zu verlassen. Sie warf mir einen letzten argwöhnischen Blick über die Schulter hinweg zu.
Die Wut kochte in mir hoch, aber ich hielt sie im Zaum, da ich Tieno mein Leben verdankte. Er war mein Freund und kannte jedes meiner drei Geheimnisse.
Erstens, ich war eine von der Königsfamilie höchstpersönlich Verstoßene aus Babylon.
Zweitens, in meiner Anfangszeit in New Orleans hatte ich für Seda gearbeitet.
Drittens, ich hatte vor, die Herrin der Wicked zu werden.
»Was fällt dir ein, Tieno?«, murmelte ich mit zittriger Stimme. »Jemma wird ihren Hexen jetzt von mir erzählen und wenn sie demnächst verschwindet, wird jeder sofort an mich denken. Denn sie wissen, dass ich normalerweise einen großen Bogen um Zirkelhexen mache. Ich werde mir ein neues Opfer suchen müssen.«
»Wila«, wiederholte Tieno und hielt mir seine Pranken entgegen. Erst jetzt erkannte ich, dass sich etwas darin verbarg.
Es war eine Wila, die auf ein Tuch gebettet lag und deren Haut so weiß strahlte wie mein Bettlaken. Was mich jedoch schockierte, war ihr kurz geschorenes Haar.
Ich wusste nicht viel über das Volk der Wila. Sie waren weibliche Naturgeister, die ausschließlich in Gruppen lebten und mit dem Element Wasser verbunden waren. Sie galten als wunderschöne Mädchen mit durchsichtigen Körpern und langen Haaren. Der Verlust einer einzelnen Strähne bedeutete bereits ihren unmittelbaren Tod. Obwohl diese Wila offenbar mehr als eine Strähne verloren hatte, bewegte sich ihre durchscheinende Brust noch immer in einem gleichmäßigen, wenn auch langsamen Takt. Nicht tot.
»Sie ist so gut wie tot«, sagte ich trotzdem und stemmte die Hände in die Hüften. Ein kühler Wind wehte unter meinen bis zum Boden reichenden Hüftrock und ließ mich erzittern. Ich ließ die Arme sinken und spielte mit meinem Bauchnabelpiercing. Ein Schutzanhänger, den mir Seda geschenkt hatte.
»Wila.« Er klang wie eine kaputte Schallplatte. Selten brachte Tieno mehr als Zwei-Wort-Sätze zustande.
»Ich weiß, dass sie eine Wila ist«, erwiderte ich genervt. In meinem Kopf tobte ein Sturm, den ich eilig einzudämmen versuchte. Es war noch nicht vorbei. Ich würde ein neues Opfer finden und das Ritual beenden.
»Leben«, brummte Tieno und streckte mir die Wila erneut hin, unbeeindruckt von meinem zornigen Gesichtsausdruck.
Ich blickte seufzend gen Himmel und leckte mir ergeben über die Lippen.
»Wo hast du sie gefunden?«, erkundigte ich mich und deutete auf die Straßenmündung hinter ihm. Wir konnten uns genauso gut auf den Weg nach Hause machen.
»Esplanade«, brachte er nach mehreren kläglichen Versuchen hervor. Schützend presste er den zierlichen Körper der Wila in seine Armbeuge.
Es war nichts Neues, dass Tieno verwundete Geschöpfe zu mir brachte. Dies war jedoch das erste Mal, dass er sich um ein Schattenwesen sorgte. So nannte man alle nicht-menschlichen Wesen, die kein Hexenblut in sich trugen.
In der Esplanade Avenue hatten sich neben der kreolischen Oberklasse auch die Schwarzen Zirkel angesiedelt. Sie vollführten ihre Rituale in den riesigen Häusern oder schöpften Energien auf den unzähligen Friedhöfen. Das, was mit dieser Wila geschehen war, schrieb ich dieser Art von Magie zu.
Jemand hatte für ein Ritual das Haar eines Naturgeistes benötigt – und es sich genommen, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. Er oder sie hatte sich nicht mal die Mühe gemacht zu überprüfen, ob das Opfer gestorben war.
»Na komm, ich werde versuchen, sie wieder aufzupäppeln«, verkündete ich. »Ich kann dir nicht versprechen, dass sie es schaffen wird, Tieno.«
»Aufpäppeln«, wiederholte Tieno und sein Gang wurde federnder. Ein deutliches Zeichen dafür, dass er wieder guter Stimmung war.
Ich schüttelte den Kopf. Vermutlich hörte die Wila ohnehin auf, zu atmen, noch bevor wir die Dauphine Street erreichten, an der mein Haus stand. Ein Seitenblick in Richtung Tieno hielt mich davon ab, meine Bedenken erneut zu äußern. Der Waldtroll hatte ein zu weiches Herz.
Einer der Gründe, weshalb ich heute noch lebte.
II
VALENS
Ein Monster begegnete meinem Blick.
Die schwarze Kohlezeichnung war eine Monstrosität, direkt meiner linken Hand entsprungen. Auf Papier gebannt aus der Erinnerung. Aus meinem Spiegelbild. Aus …
Ich klappte das ledergebundene Skizzenbuch entschlossen zu und sah mich auf dem ruhigen Lafayette Cemetery um. Nichts anderes außer grauen Grabsteinen, vergessenen Grüften und Familienkrypten.
Mit einer entschiedenen Geste löschte ich die magische Flamme, die mir bis dahin Licht gespendet hatte, um an meinem Meisterwerk weiterzuarbeiten.
Wohl eher Monsterwerk, dachte ich zynisch. Ich sprang vom Grabstein, der mir als Plattform gedient hatte. Die Statue von St Helen sah mich anklagend an, aber ein schlechtes Gewissen konnte sie mir nicht machen. Das hatte meine eigene Skizze schon.
Denn dieses Monster … das war ich. Verflucht bis in alle Ewigkeit.
Eine Zeit lang war ich in dieser Form Nacht für Nacht durch Babylon gestreift und hatte Menschen verletzt, ohne mich am Tag darauf daran erinnern zu können. Die Schreie meiner Opfer verfolgten mich erst, als ich mein Exil angetreten und Babylon für New Orleans verlassen hatte.
Seit ich erkannt hatte, was ich war, gab es keinen Weg zurück in meine Blindheit, in meine Taubheit.
Du hast wieder Hoffnung, erinnerte mich eine Stimme, leise und mit Bedacht. Wie viele Jahre war ich schon auf der Suche nach der Waiża, die mich verflucht und damit mein Leben genommen hatte? Wie viele Wochen hatte ich damit verbracht, jemanden zu finden, der mir helfen konnte, ohne verraten zu müssen, wer ich war? Woher ich kam.
Seufzend schlug ich den kürzesten Weg ein, um den Friedhof zu verlassen. Ich würde noch das Devil’s Jaw aufsuchen, um mir diese so wichtige Information bestätigen zu lassen. Eine Information, die ich vermutlich auch schon vor ein oder zwei Jahren hätte erlangen können, wenn ich nicht derart in Selbstmitleid versunken gewesen wäre.
Der Bruder der Königin – von seiner besten Freundin in die Verbannung geschickt, damit sie ihn nicht töten musste. Wie erbärmlich!
Als würde das tätowierte Herz wissen, dass es nicht mehr lange auf meiner Brust bliebe, brannte es. Ich rieb mit einer Hand darüber. Das Zeichen meines Fluchs. Wie naiv ich gewesen war! So hatte ich angenommen, dass dieses Zeichen der Fluch wäre und nicht etwas, was mich zusätzlich verhöhnen würde. Nein, mein Fluch war die Bestie unter der Haut.
Ein kühler Wind zog vom Mississippi auf, als ich mich am Ufer entlang bewegte, um das Devil’s Jaw zu erreichen. Eine Spielhölle, die von meinem Freund Adnan Marjuri geführt wurde. Er war der Einzige in New Orleans, der wusste, dass ich verflucht war. Nach meiner wahren Identität hatte er mich nie gefragt, doch ich hegte den Verdacht, dass er wusste, dass Hills nicht mein richtiger Nachname war.
Er gehörte außerdem zu den wenigen, die mehrere Spione in Babylon besaßen, und für ihn wäre es ein Leichtes gewesen, eins und eins zusammenzuzählen, als bekannt geworden war, dass der Bruder der Königin für eine längere Reise verschwunden war. Eine fadenscheinige Ausrede, wenn es denn jemals eine gegeben hatte, die durch meine unmittelbare Erscheinung in New Orleans noch schwammiger geklungen hatte. Natürlich hatte ich mich anfangs bedeckt gehalten, aber mein Selbstmitleid hatte mich auf die Straße und schließlich ins Devil’s Jaw getrieben. Ein Etablissement mit mehr als fünfhundert Kunden pro Nacht, die ihr Geld, ihren Besitz und manchmal auch ihre Familie verspielten. Letzteres hatte ich gewollt. Nichts war mir vergönnt gewesen. Daneben fanden hier die wichtigsten und geheimsten politischen Ereignisse der Schattenwelt von New Orleans statt.
Aus irgendeinem Grund hatte Adnan sich meiner angenommen und zwischen uns war eine Art Freundschaft erwachsen, der ich nie ganz traute. Allem voran, weil Adnan nichts tat, das ihm nicht in irgendeiner Weise diente, und ich war mir sicher, dass er Pläne für mich schmiedete, die ich nicht kennen wollte.
Es reichte mir, dass ich regelmäßig den Schergen meiner Schwester entkommen musste. Sie wusste um meinen Fluch und es war ihre Pflicht, mich auszuschalten. Auch drei Jahre nach meiner überstürzten Flucht suchte sie noch nach mir.
Ich betrat die Straße, an der sowohl das Devil’s Jaw als auch das Bordell Seaheart lagen sowie diverse andere zwielichtige Geschäfte, in denen sich nahezu ausschließlich Mitglieder der Schattenwelt aufhielten. Menschen verirrten sich in den seltensten Fällen hierher und wenn sie von einem Haus ins nächste stolperten, dann weil sie bereits von der Existenz der Hexen und Schattengeschöpfe wussten.
Das ehemalige Rotlichtviertel in Storyville hatte sich zum Mittelpunkt der Schattenwelt gemausert, so war es keine Überraschung, dass sich das Devil’s Jaw nicht in ein kleines Haus quetschen ließ. Die Spielhölle thronte auf zwei Plattformen über dem Mississippi. Ihre beiden Gebäudeteile, die jeweils vier Stockwerke umfassten, wurden durch überdachte Stege miteinander verbunden. Die Fassade wirkte kühl und elegant. Geschwungene Fensterrahmen, weißer Kalkstein, der im unteren Bereich von Algen und Moos angegriffen wurde. Adnan gab monatlich ein Vermögen aus, um diese Art von Instandhaltung zu gewährleisten.
Da ich keine goldene Eintrittskarte mehr benötigte, um das Gebäude zu betreten, ging ich den gaffenden Hexen und übernatürlichen Geschöpfen aus dem Weg und mied den Haupteingang. Im Inneren verlief sich die Masse an Leuten üblicherweise und verteilte sich auf verschiedene Räume.
Als ich von dem hölzernen Steg, der mit schwarzem Teppich ausgelegt war, durch einen offen stehenden Nebeneingang hineinging, wurde ich augenblicklich von einem breitschultrigen Mann begrüßt. Ich tippte auf Wald- oder Bergtroll. Er nickte mir zu.
»Raum der Runen«, antwortete er mir auf die unausgesprochene Frage. Jeder von Adnans Angestellten kannte mich, dafür hatte er gesorgt, da sie nicht alle eine lupenreine Reputation besaßen und das eine oder andere Mal ihre eigenen Kunden übers Ohr hauten. Adnan ließ sie gewähren, da er seinen Spaß daran fand.
»Danke«, murmelte ich, ging mit hoch erhobenem Haupt an ihm vorbei und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie unwohl ich mich fühlte. Natürlich, ich hatte Adnan viel zu verdanken, doch das Devil’s Jaw beherbergte Erinnerungen, die ich am liebsten vergessen würde. Eine Zeit, die so schwarz und klebrig war, dass ich mich ihr unter allen Umständen entziehen wollte.
Außerdem hatte ich seit meiner Verbannung mein Bestes gegeben, mich wie jeder andere zu verhalten, um nicht aufzufallen. Nicht länger der privilegierte Prinz, sondern ein normaler Versager.
Der Korridor, den ich betreten hatte, unterschied sich nicht von den anderen. Es gab schwarze Teppiche, goldene Leuchter an den dunklen, mit Holz verkleideten Wänden und hohe, bemalte Decken. Hin und wieder, wenn ich eine weitere Tür passierte, drangen Stimmen oder andere menschliche, vielleicht auch unmenschliche Geräusche an meine Ohren. Jedes Mal bewegte ich mich schneller, da ich nicht das Bedürfnis verspürte, jemanden auf mich aufmerksam zu machen.
Der Raum der Runen war Adnans kleiner Thronsaal. Er genoss das Gefühl, auf seinem geschnitzten Stuhl mit dem purpurnen Kissen zu sitzen. Dort konnte er genüsslich auf diejenigen herabsehen, die gekommen waren, um ihn um einen Aufschub ihrer Schuldenrückzahlung zu bitten.
Auch jetzt saß er auf seinem Stuhl in dem Zimmer mit dem unechten Marmorboden und den schmalen Fenstern, die den Blick in die dunkle Nacht freigaben. Sein Falke, ein bösartiges Tier mit Federn in hundert verschiedenen Brauntönen, hatte sich wie stets auf seiner gepolsterten Schulter platziert und starrte jeden Gast in Grund und Boden. Eine feingliedrige Kette verband seinen Fuß mit Adnans Handgelenk. Jener trug wie so häufig einen Turban in einer kräftigen Farbe, dieses Mal war es Lila; Gold und Diamanten glänzten an etlichen Stelle seines Körpers, der in ein dunkelblaues Gewand gehüllt war. Seine teuren orientalischen Pantoffeln blitzten unter dem Saum hervor.
Adnan wandte sein Gesicht von dem armen Geschöpf, das vor seinem Thron kniete, zu mir. In seinen Augen glitzerte der Schalk und ich hätte beinahe aufgeseufzt. Er genoss dieses Schauspiel viel zu sehr.
»Ich erlasse dir deine Schulden«, sagte er bloß, weil er keine Lust hatte, sich weiter mit dem Mann zu befassen, der daraufhin in laute Danksagungen und Segnungen verfiel, die Adnan wie lästige Moskitos mit seiner freien Hand wegwischte. Dann rieb er sich über den schwarzen Vollbart, bevor er sich auf den Weg zu mir machte. Die rund zwei Dutzend Gäste wagten nicht, ihn anzusprechen, machten ihm Platz und taten so, als würden sie furchtbar wichtige Gespräche untereinander führen.
»Du wirkst aufgewühlt, alter Freund«, begrüßte mich der gefährlichste Mann in New Orleans. Oder Ghul. Denn ein Mann war er im wörtlichen Sinn nicht. Durch seine Adern floss das Blut einer der ältesten Ghulfamilien. Ich wusste nicht viel über sein Erbe, aber es war des Öfteren Gegenstand von Gerüchten gewesen. Man erzählte sich, dass die Gesellschaft der Ghule seinen Einfluss nur widerwillig akzeptierte. Obwohl sie Leichen verspeisten und sich nicht zu schade waren, in verschiedene Gestalten zu schlüpfen, wenn es die Situation verlangte, galten sie als ausgesprochen stolzes Volk.
Ich beobachtete Adnan einen Moment, besah mir den Falken und den silbernen Sicheldolch an Adnans breitem, schmuckverziertem Gürtel, der locker um seine Mitte lag. Er hatte mir nie erzählt, was es mit dem Dolch auf sich hatte, und trug ihn stets bei sich. Im Gegensatz zu anderen Waffen erlaubte er niemandem, ihn zu berühren.
»Der Körper einer weiteren Zirkelhexe wurde angespült«, erklärte ich, während wir den Ausgang ansteuerten. »Sie muss schon seit einigen Wochen tot sein.«
»Lass mich raten …«, Adnan legte seine freie Hand auf die Brust, »… ohne Herz?«
Ich nickte. »Die Anzahl schwarzmagischer Rituale scheint stetig zuzunehmen. Es kann nichts Gutes für uns in New Orleans bedeuten.«
»Interessiert es dich denn, was es für New Orleans bedeutet?«, erkundigte sich Adnan wachsam und warf mir einen eindeutigen Seitenblick zu. Er wusste, dass ich die Sichelstadt nicht als meine Heimat ansah. Das bedeutete allerdings nicht, dass ihr Schicksal mir gleichgültig war.
Wir schritten durch einen langen Korridor und erreichten schon bald die belebte Spielhölle. Der Saal, in dem sämtliche Kunden von einem Kartentisch und Glücksspiel zum nächsten taumelten. In einem immerwährenden Rausch geschaffen von Alkohol, illegalen Drogen und der unvermeidlichen Gier nach mehr. Nach dem größeren Gewinn. Nach dem ultimativen High.
Auch ich war einer von ihnen gewesen. Nun lenkten mich die schwarz-goldene Inneneinrichtung, die glitzernden Kronleuchter und leicht bekleideten Damen genauso wenig ab wie das Klirren von Münzen und Scharren der Plastikchips. Lediglich ein Kribbeln machte sich in meinen Fingerspitzen bemerkbar, das sich dennoch unterdrücken ließ. Ich durfte mich nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen – Adnan nach dieser einen Information zu fragen, die mir mein Leben zurückgeben würde.
»Adnan«, sagte ich ernst, als wir eine der vielen Bars erreichten und sofort bedient wurden. Der Ghul bestellte für uns beide einen Scotch, den ich nicht anrührte. »Ich bin hier, weil mir ein Gerücht über eine Frau zu Ohren gekommen ist.«
»Du weißt, dass dies Sedas Geschäft ist. Das Seaheart ist bloß auf der anderen Straßenseite«, witzelte Adnan und stürzte seinen Scotch herunter. Der Falke auf seiner Schulter weitete für einen kurzen Moment seine Flügel, als würde er den Alkoholkonsum seines Herrn nicht gutheißen.
Ich überging seinen Kommentar. »Man munkelt, sie wäre die beste Fluchbrecherin der Stadt.«
»Das steht nicht zur Debatte«, bestätigte Adnan sofort und leerte auch meinen Scotch.
»Du weißt also, wen ich meine?« Überraschung ließ mich unvorsichtig werden. Ich beugte mich zu Adnan vor und wurde dafür sofort mit einem lauten Krächzen des Falken bestraft. Eilig zog ich mich zurück, behielt den Vogel aber misstrauisch im Auge.
»Darcia, Hexia und Fluchbrecherin«, antwortete Adnan nachdenklich und blickte sich in der gefüllten Halle um. Verschiedene Gerüche, nicht alle angenehm, drangen in meine Nase und mir wurde bewusst, wie schwül es hier drin war. Ich spürte die ersten Schweißtropfen auf meiner Stirn und wischte sie mit dem Handrücken fort.
»Adnan.« Musste ich ihm denn alles aus der Nase ziehen? Normalerweise machte er sich einen Spaß daraus, mir zu zeigen, wie unwissend ich und wie allwissend er war. Was war dieses Mal anders?
Fast beiläufig legte er eine Hand auf den silbernen Dolch, als sein Blick zu mir zurückkehrte.
»Seda liegt mir schon seit geraumer Zeit in den Ohren. Ihretwegen.« Er presste die Lippen zusammen, als würde er sich selbst davon abhalten, mir etwas mitzuteilen. Eine Sekunde später war der Moment verstrichen und der Gedanke für mich verloren. »Sie und Darcia sind miteinander befreundet und sie möchte, dass ich ihr mehr Kunden schicke. Aber wieso sollte ich wollen, dass meine Kunden frei von Flüchen sind?« Er breitete seinen Arm in einer allumfassenden Geste aus. »Es macht sie um vieles leichtsinniger. Das bedeutet gutes Geld für mich.«
»Ist das der Grund, weshalb du mir in all der Zeit nichts von ihr gesagt hast?«, zischte ich, meine Wut kaum im Zaum haltend. Ich konnte nicht glauben, dass er mir Darcias Existenz vorenthalten hatte, obwohl er wusste …
»Ganz ruhig, alter Freund, ich ging von der Annahme aus, dass du die Waiża finden willst, die dich verflucht hat«, erklärte er sich, nur mäßig von meinem Zorn beeindruckt. Warum auch? Er hatte von mir nichts zu befürchten. Wir waren Freunde und auch wenn ich selbst ein Hexer war, so hatte ich ihm in seinem eigenen Reich nichts entgegenzusetzen. Wenn ich selbst ein Waiża wäre, sähe die Sache anders aus. Diese Art von Hexen konnte Körper- und keine Elementarmagie wirken. Waiżen waren dazu imstande, die grausigsten Flüche zu weben, versagten jedoch bei den einfachsten Zaubern einer vollwertigen Hexe. Trotzdem galten sie im Allgemeinen als mächtiger als Hexia, die umgangssprachlich »Halbhexen« genannt wurden. »Du willst wissen, wo sie wohnt?« Ich nickte. »Marko?«
Jemand trat hinter meinem Rücken hervor und ich wäre zusammengezuckt, wenn dies nicht bereits einige Male geschehen wäre. Adnans Schatten bewegten sich zu leise, zu unsichtbar. Obwohl ich wusste, dass seine Beschützer immer da waren, sah ich sie selten.
Marko war ein stämmiger Mexikaner, ob übernatürlich oder nicht, konnte ich auf einen Blick nicht sagen. Er hielt mir einen gefalteten Zettel hin, den ich zögerlich annahm. Auf ihm stand eine Adresse geschrieben.
»Woher wusstest du …«
»… dass du danach fragen würdest? Keinen blassen Schimmer. Aber meine Schatten sind meinen Feinden nicht von Natur aus immer einen Schritt voraus«, war seine kryptische Antwort. Ich steckte die Notiz ein und wandte mich zum Gehen, als mich Adnan noch einmal zurückhielt. »Valens, eine Warnung. In den vier Jahren, seit sie hier lebt, hat sie nicht ein einziges Wort über ihre Vergangenheit verloren. Ganz gleich, wen ich fragte, niemand hat sie je zuvor gesehen oder von ihr gehört.«
»Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsereins nach einer Verbannung aus der Schattenstadt seine Identität ändert.« Dies war sogar häufig der Fall.
»Bisher ist mir aber niemand gänzlich ohne Vergangenheit begegnet.«
Adnan, der Alleswisser, war bei ihr auf Granit gestoßen. Außergewöhnlich.
»Du interessierst dich also doch für sie.«
»Ich interessiere mich immer für potenzielle Verbündete. Oder Feinde.« Er stieß ein tiefes, theatralisches Seufzen aus. »Sei einfach vorsichtig. Wie ich hörte, ist sie nicht gut auf Vollhexer oder Männer im Allgemeinen zu sprechen.«
»Ich will nicht mit ihr sprechen«, erwiderte ich. »Es reicht, wenn sie den Fluch bricht.«
III
DARCIA
Mein Arbeitsraum befand sich im unteren Stockwerk meines Hauses, das an die Dauphine Street grenzte. Tagtäglich wurde die Straße von Touristen übervölkert, die Tausende Fotos von den bekannten französischen Balkonen schossen. Auch an meinem Haus gab es einen zugewucherten Balkon, dem ich im Gegensatz zur Dachterrasse kaum Beachtung schenkte. Warum sollte ich mich abends dorthin setzen und als Lebendmodell für ebenjene Touristen dienen? Nein, danke.
Manche würden mich vermutlich fragen, warum ich dann nicht wegzog oder mir von Anfang an eine andere Gegend ausgesucht hatte. Die Antwort darauf war einfach – auch ich liebte die Balkone, die verblichenen gelben und grünen Fensterläden und vor allem die Nähe zur Royal Street, an der viele Kunstgalerien, Antiquitätenshops und ausgezeichnete Restaurants lagen.
»Schür das Feuer«, wies ich Tieno an, nachdem ich die einfache Holztür aufgeschlossen hatte, an der der weiße Lack bereits abblätterte.
Wir traten nacheinander in den dunkel gehaltenen Raum ein. Für Fremde war es, als würden sie sich plötzlich wieder in Babylon oder einer der anderen Schattenstädte befinden, aus denen sie verbannt worden waren. Kein elektrisches Licht, keine moderne Einrichtung. Ich hätte es nicht zugegeben, aber auch ich fühlte mich hier heimischer als im restlichen New Orleans. Dies hier war mein eigens geschaffener Rückzugsort und ohne ihn hätte ich längst den Verstand verloren, weil ich Babylon und meine Familie so sehr vermisste.
Siebzehn Jahre hatte ich in meiner Heimat gelebt, bevor ich ins Exil geschickt worden war. Ich war ein einfaches Schulmädchen gewesen. Einfache Hoffnungen. Einfache Gedanken.
Bis ich jäh in diesen Albtraum gerissen worden war.
Ich trat an den massiven Holztisch. Er war an die linke Wand gerückt und mit einem fleckigen Segeltuch bedeckt sowie mit Utensilien aus Glas und Metall und verschiedensten Zutaten beladen. Von den Deckenbalken hingen ältere und frische Kräuterbündel, aus Wachs gezogene Kerzen, die ich für meine Stammkunden anfertigte, um sie vor weiteren Flüchen zu schützen, und getrocknete Blumen, die schon einige unangenehme Gerüche vertrieben hatten. Gerüche, die stets von meinen Patienten verursacht wurden. Ein Fluchbruch war nie angenehm und manchmal rundheraus abscheulich.
Während Tieno die Wila auf ein von mir eilig kreiertes Nest aus bunten Tüchern auf einem hohen Beistelltisch legte, suchte ich meine dunklen Medizinschränke nach Zutaten ab, die ich für die Tinktur benötigte. Gleich drei dieser massiven Möbelstücke standen an den weiß gekalkten, von Querbalken durchbrochenen Wänden und beherbergten die wertvollsten, grausamsten und hilfreichsten Kräuter, Tränke und Amulette sowie Phiolen mit farbenfrohen Flüssigkeiten, spitze Nadeln, Fäden, Zangen und anderes Werkzeug, das ich schon oft für kleinere Operationen benutzt hatte. In meinem Berufsfeld war es wichtig, auf alles vorbereitet zu sein.
Ich ging an einem Ochsenschädel vorbei, dessen gemahlene Knochen Schlaftränken die besondere Kraft verlieh, und fasste neben einen Käfig mit ausgestopften Raben, um ein Glas mit grob gehackter Wurzelrinde des Ibogastrauchs hervorzuholen. Ein paar Löffel davon gab ich in einen Granitmörser, der auf meinem langen Arbeitstisch stand. Bevor ich sie zerkleinerte, gab ich noch eine Prise Salmiak hinzu. Es würde der kleinen Wila hoffentlich helfen, wieder zu erwachen und gegen ihren Verlust anzukämpfen. Die Zutaten erhitzte ich mit einem grünlichen Pflanzenöl zusammen über dem Feuer. Nach kurzer Überlegung fügte ich Myrrhe-Essenz hinzu. Sie sollte für die nötige Reinwaschung von jeglichen Fluchüberresten sorgen. Außerdem half sie vielen Anwendern bei der Konzentration aufs Innere.
Im Fall der Wila hoffentlich auf die innere Heilung.
Wenn ich ehrlich war, wusste ich nicht, was ich da tat. Bei Menschen hielt ich mich ans Gleichgewicht der drei Doshas, aber übernatürliche Geschöpfe verhielten sich oft anders.
Der Erweckende Trank konnte genauso gut nichts in der Wila bewirken.
Als die Flüssigkeit zu zischen begann, nahm ich sie von der Feuerstelle und wartete ein paar Minuten, bis sie so weit abgekühlt war, dass ich sie in den Mund der Wila träufeln konnte. Tieno hielt ihn geöffnet, trotzdem rann ein Teil davon ihre Wangen hinab. Ich legte die Phiole beiseite und berührte ihre Stirn mit einem Finger. Eiskalt.
»Tut mir leid, Tieno«, sagte ich leise. Seine Schultern waren niedergeschlagen nach vorne gekrümmt. »Entweder kämpft sie weiter oder sie stirbt.«
»Kämpferin«, erwiderte Tieno sofort und sah mich voller Inbrunst an. »Wie du.«
Mein Herz sank.
Zu gut erinnerte ich mich an die Schmerzen, die gebrochenen Knochen und das Blut. Blut, das nicht nur meines gewesen war. Auch ich war ein gebrochenes Geschöpf gewesen, als mich Tieno gefunden hatte.
Er war derjenige, der mir ein neues Leben geschenkt hatte. Tieno, der Waldtroll, der damals zu meinem treuen Begleiter geworden war. Meinem engsten Vertrauten.
»Glaub ja nicht, ich hätte vergessen, dass du mir den Plan vermasselt hast«, fauchte ich, um den gefühlsduseligen Moment zu vertreiben.
»Hexen … Herz«, presste er hervor und wandte sich wieder der bewusstlosen Wila zu.
»Ganz genau.« Ich hob einen Finger. »Deinetwegen waren die letzten Wochen für nichts und wieder nichts.«
Seufzend trat ich neben einen an die Wand genagelten Hexenbesen, der nichts weiter konnte, als unheimlich auszusehen, und betätigte einen geheimen Mechanismus. Dazu musste ich einen Metallhaken ein Mal nach links und zwei Mal nach rechts drehen, dann klickte das Schloss und ich konnte das alte Porträt einer untersetzten Dame nach vorne ziehen. Dahinter präsentierten sich mir fünf Regalbretter, auf denen dreizehn Einmachgläser standen. In zwölf von den mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllten Gläsern pochten rote Herzen. Die Leere des dreizehnten verhöhnte mich. Wütend schlug ich das Gemälde wieder an seinen Platz. Mir gefiel das Töten nicht, aber es war der einzige Weg, um mein Ziel zu erreichen.
»Wenn du die Wila nicht bei dir gehabt hättest«, begann ich, doch das Läuten der Türglocke unterbrach mich in meiner Schimpftirade. Ich drehte mich um und beobachtete das Eintreten eines jungen Mannes.
Obwohl ich ihn das erste Mal sah, wusste ich sofort, dass ihm Schwierigkeiten wie Gewitterwolken folgten. So jemand wie er verirrte sich normalerweise nicht in meinen Arbeitsraum. Er war vergleichsweise groß, hatte breite Schultern und schmale Hüften und wirkte sehr athletisch. Der grimmige Zug um seine Lippen ließ mich auf Kampfsportarten statt stupides Gewichtestemmen tippen. Seine Haut war bronzefarben und durch sie stachen seine meerblauen Augen deutlich aus seinem Gesicht hervor. Ein dunkler Bartschatten lag auf seiner unteren, kantigen Gesichtshälfte, während sein Haupthaar von einer verkehrt herum sitzenden Baseballcap verdeckt wurde. Er war leger gekleidet, nicht besonders teuer, aber auch nicht so, als würde ihn nicht interessieren, was er trug.
»Wir haben geschlossen«, sagte ich prompt, bevor er den Mund öffnen konnte.
Ich lehnte lieber einen zahlenden Kunden ab, als mich in dessen Schwierigkeiten wiederzufinden. Sein Blick war zu geschärft, während er über meine Einrichtung schweifte und sich schließlich auf mich fokussierte.
Ich kam mir in meinem schäbigen Rock und dem löchrigen Oberteil plötzlich armselig vor.
»Darf ich dich nicht mal um Hilfe bitten?« Seine Stimme war dunkel, rau, als würde er sie nicht oft benutzen. Sie verursachte mir einen nicht unangenehmen Schauder.
Ich hob eine Hand und deutete auf die sich schließende Tür. »Raus.«
»Ich …«, begann er, doch ich ließ ihn nicht ausreden, sondern sah Tieno an, der den Wink verstand.
Der Waldtroll löste sich von der Wila und baute sich zwischen dem Neuankömmling und mir auf. Selbst wenn dieser Fremde ein Hexer war, er würde nichts gegen den Troll ausrichten können. Sie waren immun gegen Zauber und Flüche jedweder Art.
»Sofort!«, setzte ich nach und Tieno drängte den Fremden mit seinen Pranken weiter zurück. Nach einem letzten düsteren Blick auf mich stolperte er endlich aus meinem Arbeitsraum.
Die Glocke läutete und Tieno verriegelte die Tür.
»Wütend?«, fragte Tieno.
Ich seufzte und rieb mir übers Gesicht. Aus irgendeinem Grund hatte der potenzielle Kunde sofort meine Alarmglocken ausgelöst. Ich hatte gelernt, auf mein Gefühl zu hören.
Was hatte er hier zu suchen gehabt? Mitten in der Nacht? Kannte er keinen Anstand?
»Bleib hier«, wies ich den Waldtroll an, ohne auf seine Frage einzugehen. Ich nahm meinen Blecheimer zur Hand, in dem ich eine Schaufel und eine Harke aufbewahrte, bevor ich meine Dachterrasse aufsuchte. Die Treppe war eng und heruntergekommen, da ich keine Zeit darauf verwandte, sie zu renovieren. Die Stufen knarzten unter meinem Gewicht und oben angekommen, trat ich durch eine Holztür, in die zwei schmale Fenster eingelassen waren.
Meine Dachterrasse wurde bloß vom schwachen Mondlicht erhellt, bis ich den Blecheimer neben die Tür gestellt und nacheinander die von dem hölzernen Gerüst hängenden Lampen entzündet hatte. Auch hier verzichtete ich auf Elektrizität.
Als ich einen tiefen Atemzug nahm und dadurch die Gerüche der angebauten Kräuter und Pflanzen aufsog, fühlte ich sofort, wie die Wut verpuffte und die Nervosität sank. Ich kehrte wieder zu mir selbst zurück.
Zu dem Selbst, das ich in New Orleans kreiert hatte, um zu überleben.
In der Mitte der kleinen, rechteckig angelegten Terrasse lagen mehrere Kissen und Tücher auf dem Betonboden. Um diesen Platz herum war alles mit Keramiktöpfen vollgestellt, sodass mir der Blick auf die Welt außerhalb meiner kleinen Oase versperrt wurde.
Fast konnte ich mir vorstellen, wieder zu Hause zu sein. In Babylon. Die Schattenstadt, die mit New Orleans verbunden war, aber in einer anderen Dimension existierte. Es gab insgesamt fünfundzwanzig Schattenstädte, die allesamt eine Stadt in der Menschenwelt als Bezugspunkt besaßen. Diese änderten sich manchmal mit der Zeit. So war Babylon einst tatsächlich mit dem antiken, menschlichen Babylon verbunden gewesen, bis jene Stadt zerstört worden war. Die Sphären verschoben sich und Babylon senkte seine Anker erst in andere Städte und dann schließlich in New Orleans. Der Schleier zwischen den Städten war hier so dünn, dass es kaum Magie brauchte, um von der einen in die andere zu springen. Vorausgesetzt, man war nicht aus einer von ihnen verbannt worden. Sobald ich Babylon betrat, würde man mich finden und einsperren. Verbannung wäre dann keine Möglichkeit mehr, nur noch lebenslange Gefangenschaft.
Das wollte ich unter allen Umständen vermeiden. Ich war zu Unrecht verbannt worden. Ich wollte es alle wissen lassen.
Ich setzte mich in den Schneidersitz, mit dem Gesicht gen Osten, und legte meine Hände auf den Knien ab. Ganz langsam atmete ich durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, bis sich die Ruhe wie ein Leichentuch über mich senkte. Ich musste nicht meine Augen schließen, um die Anderwelt zu sehen. Das Jenseits unserer Sippe. Mein Zufluchtsort.
»Es tut mir leid, Schwester«, wisperte ich, als ich ihren Schatten am Rande meines Sichtfeldes bemerkte. An diesem Ort besaß ich nicht genügend Macht, um sie vollständig erkennen zu können. Fixierte ich meinen Blick auf sie, verschwamm ihre Gestalt. Deshalb sah ich weiter eine Alraune an. »Ich war zu ungeduldig und ich verlor die Hexe. Verlor ihr Herz.«
»Es wird ein nächstes Mal geben«, hauchte meine Schwester Rienne wie der Wind in dieser unruhigen Nacht. »Ich werde warten.«
Ihre Stimme zu hören, ihre Nähe zu spüren, füllte meine Kraftreserven auf. Sie war der Anker, der mich am Leben hielt. Nicht im wörtlichen Sinn. Sie zu sehen, und sei es auch nur als Hauch, erinnerte mich an mein altes Leben. An die Normalität und unser Lachen, das durch das Haus schallte. An Mom und Dad, die uns mit Liebe überschütteten.
Wir alle waren unschuldig gewesen.
Wir alle litten unter der Last einer falschen Königin.
»Trotzdem, ich wünschte, ich hätte die erste Phase damit abschließen können.« Ich schüttelte den Kopf und unterdrückte die Tränen. Sehnsucht tränkte meine Worte, mein Herz, als ich daran dachte, wie viel Zeit ich verloren hatte. Zeit, die mir davonlief.
»Das wirst du, sobald unsere Götter sehen, dass du bereit bist, die Krone zu tragen«, beschwichtigte mich meine Schwester und ihre Silhouette flimmerte stärker als zuvor. Ich verlor die Verbindung.
»Ich verspreche, es wird bald geschehen«, presste ich noch hervor und ballte meine Hände zu Fäusten. »Ich werde die Herrin der Wicked werden. Koste es, was es wolle.«
IV
VALENS
Ich hielt eine Packung Tiefkühlerbsen an meine geschundene Wange gedrückt und beobachtete durch das einzige nicht getönte Fenster in meinem Loft den Sonnenaufgang. Noch immer fassungslos über das abweisende Verhalten der Hexia und ihres Waldtrolls war ich regelrecht zu mir nach Hause ins French Quarter geflüchtet. Als ich aus dem Arbeitsraum gestolpert war, war ich unelegant gegen den Türrahmen geknallt. Eine Schande als ehemaliger Teil der babylonischen Stadtwache.
»Verflucht«, murmelte ich und legte die Erbsen auf den Beistelltisch mit der Mosaikplatte. Ich saß auf dem Sofa und hielt die Beine angewinkelt. Seit einer halben Stunde hatte ich mich nicht von der Stelle gerührt.
In all den Jahren meiner Anwesenheit in New Orleans war mir noch nie jemand derart Unhöfliches aus der Gesellschaft der Schatten begegnet. Erst recht nicht, wenn es sein oder ihr Tagwerk war, anderen zu helfen.
Die schwere Metalltür wurde aufgezogen. Ich wandte bloß meinen Blick in die Richtung des Neuankömmlings, da es nur eine Person gab, die sich ungefragt Zugang zu meinem Loft verschaffte.
»Deine verfärbte Wange lässt darauf schließen, dass es nicht so gut gelaufen ist?« Adnan brauchte als Ghul kaum Schlaf, was ihn zu meinem beständigen Begleiter machte, wenn er nicht mit dem Devil’s Jaw beschäftigt war.
Er durchquerte mit präzisen Bewegungen meine karg eingerichtete Wohnung, die mit einem breiten Doppelbett, einer Kommode, einem abgewetzten Ledersofa und einigen kleinen Tischen und Stühlen möbliert war. Die Wände bestanden aus kahlem Backstein, der Boden aus Beton. Allerdings hatte ich mir die Mühe gemacht und ihn mit ein paar Flohmarktteppichen verdeckt. Nackte Glühbirnen hingen in unterschiedlichen Höhen von der Decke.
»Du hättest mir ruhig von ihrem Waldtroll erzählen können«, entgegnete ich und deutete mit einem Nicken auf den Stuhl neben mir. Adnan strich mit einer Hand über die verstaubte Sitzfläche, bevor er sich in seinem kostbaren Gewand darauf niederließ. Der Falke begleitete ihn heute nicht. »Verdammt, war der riesig. Ich konnte mich nicht mal wirklich umsehen, geschweige denn ein Wort äußern, bevor sie mich rausgeschmissen hat!«
»Hm, ungewöhnlich«, kommentierte Adnan und schlug die Beine übereinander, sodass mich die Juwelen an seinen purpurnen Pantoffeln regelrecht blendeten. Einmal hatte ich versucht, mit ihm über seine Kleiderwahl zu sprechen, aber er hatte mich lediglich mit einem arroganten Augenbrauenhochziehen bedacht. Offensichtlich fand er meine Kleidung so schrecklich wie ich die seine.
»Was genau?« Ich berührte versuchsweise meine Wange, um die Größe der Schwellung einzuschätzen, und entschied, dass ich die Erbsen besser noch an sie gedrückt hielt.
Adnan schmunzelte. »Dass sie deinem guten Aussehen widerstehen kann natürlich.«
»Haha!« Ich verdrehte die Augen. »So leicht lasse ich mich nicht abwimmeln.«
»Sicher?« Adnan beugte sich vor, als die ersten Sonnenstrahlen mein Loft in goldenes Licht tauchten. Sein Turban saß so fest wie eh und je, sodass sein pechschwarzes Haar vor den Blicken anderer geschützt war. In meiner Gegenwart hatte er ihn schon oft abgenommen, aber er sah ihn als Zeichen des Wohlstands an, weshalb er sich ohne niemals in die Öffentlichkeit begeben würde. »Sie hat ganz klar keine Lust, dir zu helfen.«
»Ich werde ihr keine Wahl lassen«, erwiderte ich bestimmt, legte die Erbsen zur Seite und stapfte in Richtung Bad.
»Weißt du, was?«, rief mir Adnan hinterher. »Ich denke, ich werde dich zu ihr begleiten. Heute Nacht war es im Devil’s Jaw nicht sonderlich aufregend. Ich fühle das Bedürfnis nach einer Ablenkung.«
Wenn Adnan etwas »nicht sonderlich aufregend« fand, bedeutete dies, dass es Prügeleien und Diebstähle, jedoch keine Morde gegeben hatte. Er war eben immer noch ein Ghul, der gerne Leichen fraß.
Nachdem ich mich geduscht hatte, kehrte ich zu Adnan zurück, der von irgendwoher ein Frühstück gezaubert hatte. Wahrscheinlich war ihm sein Bodyguard Marko gefolgt. Ich bediente mich an dem frisch gepressten Orangensaft und nahm mir ein Croissant, bevor ich mit Adnan auf den Fersen die Feuertreppe nach unten stieg. Noch war es zu früh für die übliche Geschäftigkeit im French Quarter, aber es würde nicht mehr lange dauern, bis die Stühle der Cafés und Restaurants über den Asphalt kratzten und Köche mit ihren Chefs die Tagesmenüs durchsprachen.
Da Adnan Busse und öffentliche Verkehrsmittel jedweder Art verabscheute, legten wir die fast zwei Meilen zur Dauphine Street zu Fuß zurück. Die Zeit, die wir dadurch verloren, kam mir vielleicht zugute. Möglicherweise erwachte die Fluchbrecherin erst jetzt und ich müsste sie nicht aus dem Schlaf reißen. Auch wenn ich sie mir kaum schlafend vorstellen konnte. Sie hatte wie eine immer wachsame Furie auf mich gewirkt. Ich lächelte in mich hinein.
Eine Furie durfte sie sein, solange sie mich von meinem Fluch befreien konnte.
Die Chancen, dass sie mir helfen würde, standen jedoch denkbar schlecht. Nicht einmal nach der Art meines Fluchs hatte sie sich erkundigt. Es hätte ja schlimmer sein können und mir wären im Fall einer Katastrophe bloß wenige Stunden zum Leben geblieben. Was für ein Mensch, für eine Hexe, betrieb ein Geschäft, um anderen zu helfen, ohne eine Unze Empathie?
Unglücklicherweise musste ich eine Antwort auf die Frage finden, um weitermachen zu können. Es könnte ja durchaus sein, dass sie lediglich eine Schwindlerin war. Dann wäre es besser, meine Zeit nicht weiter mit ihr zu verschwenden und mich stattdessen auf die Suche nach einer richtigen Fluchbrecherin zu begeben.
Wir erreichten das Gebäude mit der abblätternden Farbe eines feurigen Sonnenuntergangs. Adnan begutachtete den zugewachsenen Vorgarten mit skeptischem Blick und besah sich dann den gusseisernen Zaun genauer, dem ich bei meinem letzten Besuch kaum Beachtung geschenkt hatte.
»Interessant«, murmelte Adnan und rieb sich über den Bart. »Viele Bannflüche hat sie nicht angebracht und keiner von ihnen ist sonderlich stark.«
»Warum sollte sie das überhaupt tun?« Ich sah von ihm zurück zur Fassade und hoch zum Schornstein, aus dem beständiger Rauch in die hereinbrechende Hitze des Tages quoll. Schon jetzt spürte ich die Schwüle, die im Verlauf der nächsten Stunden noch zunehmen würde.
»Schutz, alter Freund, Schutz.« Er hob die Schultern, wandte sich ab und winkte mir im Gehen noch einmal zu. »Viel Erfolg und mach dir nicht gleich in die Hose, wenn sie dich ansieht.«
Ich hielt ihn nicht zurück. Adnan tat immer das Überraschendste und erklärte sich nie. Eigentlich war ich ganz froh, dass ich die bevorstehende Blamage ohne ihn als Zeugen durchleben würde.
Noch einmal atmete ich tief durch, dann bewegte ich mich über den schmalen Kiesweg zur Eingangstür. Es war albern, dass ich mich schon beinahe fürchtete, der Hexia erneut gegenüberzutreten, aber ihre Unfreundlichkeit hatte im wahrsten Sinne des Wortes einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich berührte kurz meine Wange und zuckte zusammen, als mich der Schmerz wieder überkam.
Wäre ich noch der Prinz von Babylon, wäre es Darcia, die sich fürchten müsste.
Wir befanden uns jedoch nicht in Babylon. Deshalb sollte ich wohl besser nach den Regeln spielen.
Um besonders höflich zu sein, benutzte ich den kupfernen Türklopfer. Bereits bei meinem ersten Besuch hatte ich keine Klingel entdeckt und das, was ich von dem Inneren gesehen hatte, sagte mir, dass sie es wie die meisten Verbannten handhabte. Elektrizität war Magie feindlich gesinnt. Oft zerstörte sie heikle Zaubersprüche und veränderte deren Resultat. Dies war einer der Gründe, warum es in den Schattenstädten keine Elektrizität gab. Der andere war der, dass wir dort keinen Strom benötigten. Alles war auf unsere Magie ausgerichtet, sodass selbst die Septi – Nicht-Magische, die in diesen Städten lebten – ohne Elektrizität zurechtkamen und nichts an Komfort vermissen mussten.
Als niemand auf mein Klopfen reagierte, drehte ich den Messingtürknauf und trat in den dämmrigen Arbeitsraum ein. Nur das niedrig brennende Feuer verriet die Anwesenheit mindestens einer Person irgendwo im Haus.
Es gab mehrere Tische, Regale und Stühle, alle Oberflächen waren mit medizinischen Objekten und Zutaten bedeckt. Ich musste mich unter einem Dutzend von der Decke baumelnden Kräuterbündel hindurchducken, um den Raum zu durchqueren.
Alles in allem erinnerte mich dieses Zimmer an zu Hause. Seltsam, dass nach all den Jahren ausgerechnet dieser Ort dieses Gefühl in mir weckte. Ich trat an einen hohen Tisch heran, auf dem mehrere Tücher lagen – und inmitten davon war eine blasse Wila gebettet. Sie stöhnte leise.
»Wer bist du und was machst du in meinem Haus?«
Oh-oh.
Langsam und mit erhobenen Händen drehte ich mich um.
Die Hexia, Darcia, stand mir mit einem Skalpell in der linken Hand gegenüber. In ihrer rechten hielt sie einen gelben Salmiak auf schwarzem Stein, der mir größere Sorgen als das Messer bereitete. Salmiaks wurden sowohl für die Heilung als auch für Flüche benutzt.
»Ich bin ein Kunde«, sagte ich möglichst ruhig. Mein Blick wanderte von ihren tätowierten Händen zu ihrem Bauchnabel, der zwischen dem dunkelgrünen Hüftrock und dem grauen Top hervorblitzte. Er war gepierct und ich war mir ziemlich sicher, dass der Anhänger zu ihrem Schutz diente. Trotz ihrer teilweise offenen, teilweise geflochtenen schwarzen Haare und dem leichten Rouge auf ihren Wangen kam sie mir nicht sonderlich eitel vor. Alles an ihr schien einem Zweck zu dienen. Die Beutel an ihrem Gürtel, die bestimmt Tinkturen und Kräuter enthielten, die magischen Runen auf ihren Händen, die vielen goldenen Ohrringe mit den Hexensymbolen für die Elemente und der Armreif um ihren Oberarm, der aus einfachem Holz geschnitzt zu sein schien. Vermutlich von einem gesegneten Stück. Einzig ihr Nasenring fiel aus der Reihe und besaß meines Wissens nach keine Magie verstärkenden oder schützenden Eigenschaften. »Du bist doch eine Fluchbrecherin, oder nicht?«
Die Wila hinter mir stöhnte erneut und Darcias Blick huschte sofort von mir zu ihr. Ein reizendes Runzeln erschien auf ihrer Stirn. Sie besaß einen dunklen, südländischen Teint, hatte wahrscheinlich Eltern aus dem spanischen Raum. Viele in New Orleans und Babylon hatten Vorfahren, die von dort stammten. »Was hast du getan?«
Sie ließ mir keine Zeit, mich zu erklären, sondern eilte an mir vorbei und legte beide Waffen weg, um sich um die Wila zu kümmern. Mit den Fingerspitzen berührte sie deren Stirn und Wangen, wartete darauf, dass sich der kleine Brustkorb hob und senkte. Währenddessen blieben ihre braunen Augen ausschließlich auf ihre Patientin gerichtet. Mich schien sie vergessen zu haben und ich spielte bereits mit dem Gedanken, sie auf irgendeine Weise auf mich aufmerksam zu machen, als sie erneut ihre Stimme erhob. Immer noch, ohne mich anzusehen.
»Du bist derjenige, den ich gestern rausgeworfen habe, oder?«
Ich wand mich innerlich. »In der Tat.«
Sie hob plötzlich ihren Kopf und ich erstarrte unter ihrem durchdringenden Blick. »Du hättest nicht zurückkommen sollen.«
Innerhalb eines Wimpernschlags hatte sie erneut nach dem Salmiak gegriffen und ihn auf mich geworfen. Sobald er auf meine Schulter traf, zerfiel er zu Staub, legte sich auf meinen Körper und hielt mich an Ort und Stelle gefesselt.
Hervorragend. Sie hatte meine Unachtsamkeit bestraft und mich erneut verflucht. Fabelhafte Fluchbrecherin.
V
DARCIA
Nicht umsonst machte ich einen großen Bogen um männliche Hexer. In der Regel waren sie eitel, selbstverliebt und kontrollsüchtig. Es gab niemanden, der gerne zugab, dass er in irgendeinem Bereich schlechter war als eine Hexia, eine Halbhexe. Dass ich nicht lache! Bisher hatte ich noch niemanden getroffen, der mir das Gegenteil bewiesen hätte, und dieses Exemplar würde nicht damit anfangen. Natürlich sah er unglaublich gut aus mit seinem charmanten Lächeln, der braunen Haut und den kühlen blauen Augen, aber ich las noch viel mehr in ihm als dies.
»Warum hast du das getan?«, fragte er entsetzt. Der Fluch des Salmiaks würde nur wenige Minuten andauern, was er nicht zu wissen brauchte. Außerdem konnte er froh sein, dass ich mich für den Salmiak und nicht für das Skalpell entschieden hatte. »Hast du es nicht zu deiner Arbeit gemacht, Leuten zu helfen?«
Ich verdrehte wegen der deutlichen Rüge die Augen.
»Helfen?«, zischte ich. »Du bist wie ein gemeiner Verbrecher in mein Zuhause eingedrungen. Zwei Mal, wenn ich noch hinzufügen darf. Und du redest von Hilfe?«
»Die Tür war offen!«, entgegnete er sichtlich genervt. Außerdem färbte Wut seine Stimme. Endlich zeigte er sein wahres Gesicht.
»Seit wann ist das eine Einladung?«
»Du betreibst ein Geschäft, Götter noch mal!« Ich konnte ihm ansehen, wie er gegen den Fluch ankämpfte. Auf seiner Stirn erschienen mehrere Falten und Schweiß perlte von seinen Schläfen. »Ich bin nur ein Kunde. Wie jeder andere auch. Du hast nicht mal gefragt, was mir fehlen könnte. Was für eine Heilerin bist du überhaupt?«, redete er sich in Rage und es wäre amüsant gewesen, wenn ich nichts Besseres zu tun gehabt hätte, als mich um einen arroganten Mistkerl zu kümmern.
Ich näherte mich ihm, bis sich unsere Nasenspitzen fast berührt hätten, wenn er nicht einen Kopf größer gewesen wäre als ich. Stattdessen hob ich meinen Blick, während meine Hände über die Vorderseite seiner Jacke wanderten. Mit der Linken griff ich schließlich in die Innentasche.
»Wie jede andere auch? Auf einen Blick habe ich gesehen, dass du weder der Hexen-Unterschicht angehörst noch ein Schattengeschöpf bist«, entgegnete ich und zog mit einem Ruck das kleine Notizbuch heraus, dessen Umrisse sich auf dem Stoff der Jacke abgezeichnet hatten. »Deine Kleidung, wenn auch nicht sonderlich modern, ist zu neu. Du machst dir die Mühe, dich einzuparfümieren, und dein Kinn sieht frisch rasiert aus. Niemand aus meinem üblichen Kundenkreis gibt sich so selbstsicher wie du. Als würde dir die ganze Welt zu Füßen liegen. Wahrscheinlich wurde dir dies als Kind eingeimpft. Jetzt bist du zwar auf dich allein gestellt, doch der Blick auf das niedere Volk ist noch immer derselbe.«
Ich drehte mich um und schlug das Notizbuch auf.
»Tu es nicht«, warnte er mich. Oder war es eine Bitte? Ich wagte einen Blick über meine Schulter. Das, was ich in seinem Gesicht sah, erschütterte mich, denn mit allem hatte ich gerechnet. Wirklich, mit allem, aber nicht mit … Scham. Es traf mich zu unvermittelt, sodass ich das Buch tatsächlich wieder zuklappte.
»Was …«, begann ich, als die Wila erneut stöhnte und ich mich daran erinnerte, was mich eigentlich zurück in den Arbeitsraum gebracht hatte. Ich legte das Buch auf die Ecke eines vollgestellten Tisches und besah mir die Wila, die flatternd ihre Lider öffnete. »Das ist unmöglich.«
Ganz gleich, was ich Tieno gesagt hatte, die Wila hätte den Angriff nicht überleben sollen. Sie zog Leben aus dem Haar, das ihr genommen worden war.
Ich beeilte mich, ihr noch mehr von dem Erweckenden Trank einzuflößen, der ihr schließlich dabei half, wach zu bleiben. Als ob Tieno dies gespürt hätte, betrat er den Arbeitsraum. Er schenkte unserem Kunden einen beiläufigen Blick, bevor er sich neben mich stellte.
»Wo … bin ich?«, wisperte die Wila mit ungewöhnlich tiefer Stimme.
»Bei mir zu Hause«, antwortete ich leise und versuchte mich an einem Lächeln. Tieno schüttelte den Kopf und ich gab auf. Es war besser, mich auf Worte zu beschränken. »Wie geht es dir? Weißt du, wer du bist? Kannst du dich daran erinnern, was geschehen ist?«
Die Wila blickte von mir zu Tieno und wieder zu mir. »M-mein Name ist Arnamentia. Ich bin … ich …« Ihre Unterlippe zitterte, aber sie riss sich sofort wieder zusammen. Gut. Es zeigte ihre Stärke. Sie würde sich nicht unterkriegen lassen. »Meine Schwestern, sie verstießen mich, nachdem ich … ich brach die wichtigste Regel.«
»Du verliebtest dich in einen Menschen?«
Sie nickte. »Eines unserer Opfer. Wir wollten gemeinsam fliehen, doch wir wurden entdeckt. Sie veränderten mit ihrem Lied seine Erinnerungen und verbannten mich aus dem Kreis, sodass ich allein … ich …«
Wenn eine Wila aus dem Kreis der Schwestern ausgestoßen wurde, glich dies einem Todesurteil. Das Haar einer Wila besaß magische Eigenschaften und wurde für viel Geld auf dem Schwarzmarkt verkauft. Eine Schwesternschaft war nahezu unbesiegbar, aber eine einzelne Wila? Leichtes Geld.
»Wenige Tage danach hatte ich das Gefühl, verfolgt zu werden.« Sie schniefte und für einen Moment schimmerte ihr Körper, bevor er wieder normal durchscheinend wurde. Nicht ganz da, nicht ganz fort. »Dann griff mich jemand wie aus dem Nichts an und … er brachte mich an einen dunklen Ort, wo er … mein Haar …« Entsetzen färbte ihre Stimme hell und mit ihren kleinen Händen umfasste sie zum ersten Mal ihren geschorenen Kopf. Danach konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. »Ich lebe noch?«
»Überraschenderweise ja«, bestätigte ich und erntete ein Schnauben seitens des Kunden. Wahrscheinlich war ich ihm zu unsensibel, aber meiner Meinung nach brauchte Arnamentia harte Fakten und keine leeren Worte, die nach Honig schmeckten und letztlich Bauchschmerzen verursachten. »Hat dir dieser … Unbekannte das Haar bloß abgeschnitten oder …«
»Es war während eines Rituals.« Sie presste ihre vollen Lippen aufeinander, ihre violetten Augen schimmerten. »Grausam, dunkel, schmerzhaft.«
»Er wusste also, was er da tat, und wir können davon ausgehen, dass er das Haar für seine eigenen Zwecke nutzt und nicht verkaufen will. Zumindest nicht alles.«
»Das ist schlecht, oder?« Ich bemerkte aus dem Augenwinkel, dass der Kunde mittlerweile seine Schultern wieder bewegen konnte. Nicht mehr lange und der Fluch hätte ihn vollends verlassen.
»Niemand, der Wila-Haar stiehlt, hat Gutes im Sinn«, bestätigte ich.
»Stinkt«, kommentierte Tieno und deutete mit einer Handbewegung auf unseren Kunden.
Erstaunt hob ich die Augenbrauen. »Auf dir lastet ein schwerer Fluch.«
»Das kann er riechen?« Der Kunde blickte Tieno irritiert an.
»Nein, er mag nur dein Parfüm nicht.« Ich streckte den Zeigefinger aus und berührte damit sein Handgelenk, wodurch ihn der Rest des Salmiakfluchs verließ. Das Pentagramm auf dem mittleren Fingerknochen half mir dabei, meine klägliche Magie auf diese Weise zu konzentrieren.
»Danke«, nuschelte er und schüttelte seine Gliedmaßen aus, als hätte er sie seit Stunden nicht mehr bewegt. Dramatisch war er auch noch. Na super! »Wo wir beim Thema wären. Deshalb bin ich hier. Wegen des Fluchs, der auf mir …«
»Dafür hab ich keine Zeit«, unterbrach ich ihn und wandte mich ab, um mich zu bewaffnen.
Ich hatte ein konkretes Ziel vor Augen. Ich musste herausfinden, wer dieser unbekannte schwarze Magier war und was er mit dem Haar der Wila vorhatte. Vielleicht, wenn ich großes Glück hatte, würde ich noch eine Strähne an dem Ort des Verbrechens finden. Sie war nicht unabdinglich für meine Zwecke, zur Herrin der Wicked zu werden, aber sie würde einiges erleichtern.
»Kannst du dich noch an den genauen Ort erinnern, wo du sie gefunden hast, Tieno?« Ich tauschte ein paar Beutel gegen eine kleine Ledertasche aus, in der ich Salmiakflüche und heilende Mittelchen in unterschiedlich großen Phiolen aufbewahrte. Zudem suchte ich in einem weiteren Regal nach meinen Skalpellen und einer Gomorrah-Kerze, die mich – einmal angezündet – für jeden Angreifer unsichtbar machte.
Tieno stampfte zu einer gerahmten alten Karte von New Orleans an der Wand und drückte einen seiner dicken Finger auf die Esplanade Avenue, Ecke N Rocheblave Street.
»Garten«, presste er hervor und wandte sich wieder der Wila zu. »Menti.« Ich brauchte einen Moment, ehe ich verstand, dass er ihr damit einen Kosenamen gab. Herrje!
»Du willst meinen Angreifer finden?«, fragte Arnamentia leise. »Was ist, wenn er dich überwältigt?«
»Wird er nicht«, erwiderte ich sofort.
»Bist du eine Art Rächerin für die Kleinen?«, meldete sich der Fremde zu Wort, dessen Anwesenheit ich ganz vergessen hatte.
Ich warf ihm einen verärgerten Blick zu und verzichtete darauf, ihm eine Antwort zu geben. Es war nicht wichtig, dass er verstand, wie heikel die Lage war.
Ende der Leseprobe