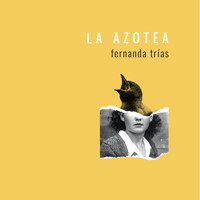18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein berührender Roman darüber, wie Krisen unsere intimsten Bindungen auf die Probe stellen Eine Frau zieht durch eine Hafenstadt, deren Infrastruktur zusammengebrochen ist. Wie fremdgesteuert pendelt sie zwischen ihrer isoliert lebenden Mutter, dem erkrankten Ex-Mann und einem Kind, das nicht ihres ist und für das sie doch Zärtlichkeit hegt. Sie bewegt sich aus schlichter Notwendigkeit, und erst als die Stadt immer leerer wird, ihre Bindungen gekappt sind, steht sie vor der Frage, was sie will. Mit einer verstörenden, zeitweise eigentümlich lyrischen, Prosa schafft Fernanda Trías ein außergewöhnliches Universum, das die Zerbrechlichkeit menschlicher Beziehungen auslotet. Der Roman fragt nach dem Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit und danach, wie freiwillig unsere Beziehungen, wie handlungsfähig wir selbst sind. Rosa Schleim erzählt die Geschichte einer Frau und ihrer Einsamkeit, von einer ökologischen Katastrophe und einer zerstörten Welt, von Mutterschaft, Hunger und Stille. *** »Mit herzzerreißenden Schönheit erzählt.« Jordi Carrión, The New York Times »Ein poetischer und hartnäckiger Wirbelwind, schrecklich und erhaben.« Aura Lucía Mera, El País Colombia
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Rosa Schleim
Die Autorin
Fernanda Trías, geboren 1976 in Montevideo, lebte im Rahmen von Stipendien und Forschungsaufenthalten im Süden Frankreichs, in London, Berlin und Buenos Aires. An der New York University studierte sie Kreatives Schreiben. Für Rosa Schleim wurde sie 2021 mit dem Sor Juana Inés de la Cruz Preis ausgezeichnet. Derzeit lehrt sie Kreatives Schreiben an der Universidad de los Andes in Bogotá, Kolumbien.
Das Buch
Eine Frau zieht durch eine Hafenstadt, deren Infrastruktur zusammengebrochen ist. Wie fremdgesteuert pendelt sie zwischen ihrer isoliert lebenden Mutter, dem erkrankten Ex-Mann und einem Kind, das nicht ihres ist und für das sie doch Zärtlichkeit hegt. Sie bewegt sich aus schlichter Notwendigkeit, und erst als die Stadt immer leerer wird, ihre Bindungen gekappt sind, steht sie vor der Frage, was sie will.
Mit einer verstörenden, zeitweise eigentümlich lyrischen, Prosa schafft Fernanda Trías ein außergewöhnliches Universum, das die Zerbrechlichkeit menschlicher Beziehungen auslotet. Der Roman fragt nach dem Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit und danach, wie freiwillig unsere Beziehungen, wie handlungsfähig wir selbst sind. Rosa Schleim erzählt die Geschichte einer Frau und ihrer Einsamkeit, von einer ökologischen Katastrophe und einer zerstörten Welt, von Mutterschaft, Hunger und Stille.
Fernanda Trías
Rosa Schleim
Roman
Aus dem Spanischen von Petra Strien
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Mugre Rosa im Verlag Literatura Random House, Bogotá, Kolumbien.Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde mit Mitteln des Auswärtigen Amts unterstützt durch Litprom e. V. – Literaturen der Welt© 2020 by Fernanda Trías© der deutschsprachigen Ausgabe2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Brian Barth, BerlinUmschlagabbildung: (Löffel) shutterstock / Anton Starikov, (Roter Fleck) shutterstock / VicWAutorinnenfoto: © Fernanda MontoroE-Book-Erstellung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2951-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Danksagung
Nachweis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Widmung
Für Rita,Santi und Mónicaund Mia Joyce.
Motto
Das ist also der Unterschied zwischen der Linie einer einzigen Dimension und der Oberfläche zweier Dimensionen: Die eine will an einen Ort gelangen, die andere ist schon da, aber kann zeigen, wie sie dorthin gelangt ist. Der Unterschied ist ein zeitlicher und umfasst die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft.WritingsVilém Flusser
Ich bin von mir getrennt durch die Ferne, in der ich mich befinde.Der Tote ist vom Tod getrennt durch eine große Ferne.Ich will diese Ferne durchschreiten und an irgendeinem Ort ausruhen.Auf dem Rücken im Haus des Begehrens, ohne mich von meinem Platz zu rühren – vor der verschlossenen Türmit einem Licht des Winters an meiner Seite.Die Nacht. Die Ferne durchschreitenJaime Sáenz
1
Warum wolltest du ein Heiliger sein?Warum nicht?Warum wolltest du mich beißen?Weil du es zugelassen hast.
An nebligen Tagen verwandelte der Hafen sich in einen einzigen Sumpf. Ein Schatten huschte über den Platz, watete zwischen den Bäumen umher und hinterließ auf allem, was er streifte, die gedehnten Spuren seiner Finger. Unter der intakten Oberfläche bahnte sich der Moder lautlos seinen Weg durchs Holz; der Rost zerfraß die Metalle. Alles verfaulte, auch wir. Wenn Mauro nicht bei mir war, verließ ich an solchen nebelverhangenen Tagen das Haus, um einen Rundgang durchs Viertel zu machen. Ich folgte der in der Ferne flackernden Leuchtschrift des Hotels: HOTE A ACIO. Die Buchstaben fehlten noch immer, dabei war es längst kein Hotel mehr, sondern eines der vielen besetzten Häuser in der Stadt. An welchen Tag ich denke? Noch immer habe ich das Gefühl, das Summen des Neonlichts zu hören – die elektrischen Schwingungen – und den Wackelkontakt eines weiteren Buchstabens kurz vor dem Erlöschen. Die Hotelbesetzer hatten es brennen lassen, nicht etwa aus Schlampigkeit oder Wehmut, sondern als Erinnerung daran, dass sie noch am Leben waren. Noch konnten sie sich eine derartige Laune leisten, etwas rein Ästhetisches, noch konnten sie die Landschaft gestalten.
Wenn ich diese Geschichte erzählen will, sollte ich an irgendeinem Punkt beginnen, einen Anfang finden. Doch welchen? Anfänge waren noch nie meine Stärke. Den Tag mit dem Fisch vielleicht? Diese winzigen Details, die die Zeit markieren und im Gedächtnis haften bleiben. Es war kalt, und der Nebel schlug sich auf den überquellenden Containern nieder. Ich weiß nicht, woher der ganze Müll kam. Es war, als verdaute er sich selbst, um sich anschließend wieder auszuscheiden. Und wer sagt dir, dass nicht wir dieser Abfall sind?, hätte Max wohl erwidert. Ich weiß noch, wie ich an der Ecke des alten Supermarktes abbog, dessen Tür und Fenster zugemauert waren, und wie sich auf dem Weg hinab zur Südpromenade das grünrote Licht seiner Leuchtreklame über mich ergoss.
Tags darauf sollte Mauro zurückkehren, und mit ihm erwartete mich ein weiterer anstrengender Monat in völliger Zurückgezogenheit. Kochen, putzen, alles im Griff haben. Jedes Mal, wenn sie ihn dann wieder abholten, schlief ich einen ganzen Tag lang, um den Schlaf nachzuholen, den er ständig störte oder zu stören drohte. Dieses ewige Wachen. Dafür bezahlten sie mir eine exorbitante Summe, die doch nie hoch genug sein konnte, um mich angemessen zu entschädigen, und das wussten Mauros Eltern. Die aufgestaute Luft am Hafen einatmen, durch die Straßen schlendern, meine Mutter oder Max sehen, das war der einzige Luxus an solchen Tagen, an denen meine Zeit keinen Preis mehr kannte. Aber nur, wenn ich Glück hatte und kein Wind wehte.
Auf der Rambla traf ich lediglich die Fischer an, die Krägen ihrer Anoraks bis zu den Ohren hochgeklappt und mit roten, rissigen Händen. Nach allen Seiten dehnte sich das Wasser aus, eine Mündung, die den Fluss in ein uferloses Meer verwandelte. Der Nebel verschlang den Horizont. Es konnte zehn oder elf oder drei Uhr sein in diesem eintönigen, milchigen Tageslicht. Die Algen trieben in der Nähe wie blutiger Schleim dahin, doch die Fischer wirkten unbesorgt. Sie stellten die Eimer neben ihren Strandstühlen ab, zogen den Köder auf den Haken auf, um ihn mit den vereinten Kräften ihrer dürren Arme so weit auszuwerfen wie möglich. Ich mochte das Surren der Rolle, wenn sich die Angelschnur abspulte. Es erinnerte mich an die Sommer auf dem Fahrrad in San Felipe, ungebremst den Hang hinab, die Knie hochgezogen, damit die Füße sich nicht in den Pedalen verfingen. Meine gesamte Kindheit hatte ich auf diesem Fahrrad an den Stränden verbracht, die inzwischen verboten waren, durch gelbe Bänder abgesperrt, die der Wind abriss, bevor Polizisten mit Masken sie wieder befestigten. »Sperrzone« war darauf zu lesen. Wozu? Wenn doch nur Selbstmörder sich entschieden, so zu sterben, verseucht, Krankheiten ohne Namen ausgesetzt, die aber auch keinen schnellen Tod in Aussicht stellten.
Nur einmal, noch lange vor meiner Hochzeit mit Max, habe ich eine solch zähe Nebelbank wie diese gesehen. Das war in San Felipe, frühmorgens, Anfang Dezember. Ich erinnere mich so gut daran, weil der Badeort noch leer war, mit Ausnahme der wenigen Gäste, die wie wir hier schon ein Leben lang ihre Sommer verbrachten. Max und ich schlenderten gemächlich die Landstraße entlang, ohne auch nur in Richtung des schwarzen Strands zu blicken, gewöhnt an den Rhythmus der sich am Ufer brechenden Brandung. Für uns war dieses Rauschen wie eine Uhr, eine Gewissheit aller Sommer, die noch kommen würden. Anders als die Touristen kamen wir nicht nach San Felipe, um uns zu erholen, sondern zur Bestätigung einer Kontinuität. Max’ Taschenlampe war unsere einzige Lichtquelle, aber wir kannten den Weg. Auf der Höhe des Aussichtspunkts, wohin sich für gewöhnlich die Liebespärchen zurückzogen, legten wir, an die weißen Holzlatten gelehnt, eine Pause ein. Max zielte mit der Taschenlampe in Richtung Strand, und im Nebel konnten wir Horden von Krebsen sehen. Der Sand schien geradezu zu atmen, sich aufzublähen wie ein schlafendes Tier. Die Krebse schimmerten im Lichtkranz, sie quollen massenweise aus den Ritzen der Strandpromenade hervor. Hunderte winzige Krebse. Was Max sagte? Ich weiß es nicht mehr; aber ich meine mich zu erinnern, wie wir beide erschauderten, als wäre uns zum ersten Mal bewusst geworden, dass etwas Unbegreifliches existierte, weit größer als wir.
Doch im Winter sah man an der südlichen Rambla nicht mal eine Meeräsche springen. Die Eimer der Fischer waren leer; die Köder in den Nylonbeuteln überflüssig. Ich ließ mich in der Nähe eines Mannes nieder, der eine russische Fellmütze mit Ohrenschutz trug. Meine Hände zitterten vor Kälte, aber ich tat nichts, um sie zu bändigen. Anders als Max glaubte ich nicht, dass der Wille unabhängig vom Körper sei. Deshalb hatte er die letzten Jahre über alle möglichen bizarren Praktiken ausprobiert: Reinigungen, Fastenkuren, Haken, die an der Haut zogen – die Ekstase des Schmerzes. Nüchtern sei der Organismus eine hervorragende Membran, sagte er, eine dürstende Pflanze, die zu lange in der Dunkelheit zugebracht hat. Mag sein. Aber, wonach Max strebte, war etwas anderes: sich von seinem Körper zu befreien, von dieser unbezähmbaren Maschine des Verlangens, ohne Gewissen oder Grenzen, abscheulich und zugleich unschuldig, rein.
Der Fischer merkte, dass ich ihn beobachtete. Mit meinen überm Wasser baumelnden Füßen, ohne Maske, ohne Gummistiefel, aber mit einem Rucksack, der wirkte, als wäre er mit Steinen gefüllt, wird er gedacht haben, ich sei eine von denen, die alle Hoffnung verloren haben. Dass vielleicht meine Familie gestorben sei, einer nach dem anderen in den Pavillon für akute Fälle eingeliefert, um ihn nie mehr zu verlassen. Das Wasser war kaum zu hören, wie es an die Mauer schwappte. Immer noch herrschte Windstille. Doch Mitleid konnte dieser Mann sich nicht leisten, sein Blick währte nur kurz.
Wie lange konnte die Flaute noch andauern? Jeder Krieg hat seine Waffenruhe, selbst dieser mit einem Feind, der unsichtbar war.
Plötzlich spannte sich die Schnur, und ich sah, wie der Fischer heftig zog und die Rolle aufspulte, bis ein winziger Fisch sich in die Lüfte erhob. Er wand sich kraftlos, doch das kurze Glitzern der silbernen Schuppen entlockte dem Mann ein Lächeln. Dann packte er ihn ohne Handschuhe und löste ihn vom Haken. Wer wusste schon, welchen Tod und welch ein Wunder dieses Tierchen in sich barg. Und so betrachteten wir den Fisch, der Mann und ich. Ich hoffte, er würde ihn in den Eimer legen, und sei es nur vorübergehend, doch er entließ ihn umgehend wieder ins Wasser. Der Fisch war so leicht, dass er lautlos untertauchte. Der letzte Fisch. In einer Minute würde er schon fern sein, gefeit vor dem Dickicht aus Wurzeln, den tödlichen Fallen aus Algen und Müll. Der Mann wandte sich zu mir um und machte ein Zeichen mit der Hand. Das ist der Moment meiner Erzählung, der falsche Einstieg. Hier könnte ich mir ganz einfach eine Prophezeiung oder einen Hinweis auf das ausdenken, was danach kommen wird, aber nein. Das war alles: ein x-beliebiger Tag um eine x-beliebige Uhrzeit, wäre da nicht dieser Fisch gewesen, der sich in die Lüfte erhob und wieder ins Wasser fiel.
2
Es war einmal.Was?Es war einmal ein Einmal.Das, was niemals war?Das, was nie mehr.
Die wenigen Taxis, die auf der Rambla unterwegs waren, fuhren im Schritttempo, mit geschlossenen Fenstern. Sie waren auf der Jagd nach einem Notfall, irgendeinem armen Teufel, der mitten auf der Straße zusammenbrach, um ihn vor den Toren der nahegelegenen Universitätsklinik Clínicas abzuladen. Das Risiko lohnte sich. Das staatliche Gesundheitswesen zahlte die Fahrt nebst einem Infektionsrisikozuschlag. Manche weigerten sich jedoch, Kranke einzusammeln; andere nahmen nur Patienten mit Maske mit. Ich winkte einem, der mich anhupte, ehe er an mir vorbeifuhr. Ich streifte den Rucksack ab und stellte ihn auf den Boden, zwischen meine Füße. Er war vollgepackt mit Büchern. Die Epidemie hatte uns zurückgebracht, was vor einigen Jahren noch verloren schien: ein Land von Lesern, versunken fernab des Meeres, die Reichen auf ihren Landgütern oder in ihren Villen in den Bergen; die Armen, in die Städte im Landesinneren strömend, die wir früher noch als verwaist, karg und stumpfsinnig verspottet hatten. Meine Mutter folgte nicht der editorischen Mode, aber sie tauschte mit der Lehrerin Bücher, und, wenn sie alle gelesen hatte, gab sie sie an mich weiter.
Zwei weitere Taxis fuhren an mir vorbei, bevor ich Glück hatte. Kaum hatte der Fahrer mich begrüßt, erkannte ich schon, was für ein Typ er war. Er gehörte zu denen, die glaubten, eine tiefere Wahrheit, die Wahrheit der Straße zu kennen.
»Mit diesem Rucksack erregst du Aufsehen«, sagte er.
»Die werden nicht viel finden.«
Ich legte den Rucksack neben mich auf den Sitz und nannte ihm die Adresse meiner Mutter. Durchs Fenster erspähte ich, verschwommen hinter einem schmutzigen Dunstschleier, den Palast der Freimaurerloge auf der anderen Seite der Uferstraße.
»Los Pozos? Wohnst du da?«
»Ich besuche nur jemanden.«
Er prahlte damit, das Viertel gut zu kennen. Hier in der Gegend habe er seine Kindheit verbracht, im Haus seiner Großmutter. Ich sagte, ich auch, obwohl das gelogen war. Nach der Evakuierung hatte meine Mutter beschlossen, in eines der verlassenen Häuser von Los Pozos zu ziehen. Die Besitzer vermieteten sie für kleines Geld, Hauptsache, man hielt sie instand, mit diesem Stolz der verarmten Aristokratie. Sie wollten hübsch gepflegte Gärten, keine vermauerten Fenster und keine Landstreicher in ihren Räumen. Diese glorreiche Vergangenheit war es, die meiner Mutter ein Gefühl von Sicherheit gab, nicht etwa der gewonnene Abstand zwischen den Algen und ihr. Meine Mutter hegte ein blindes Vertrauen in hochwertiges Material und vielleicht dachte sie, die Seuche könne eine feste Hauswand, dick und dämmend, und eine gute Dachkonstruktion, ohne Ritzen, durch die der Wind hereinzog, nicht durchdringen. Das Wasser des Riachuelo war weniger kontaminiert als das an der Rambla, aber ein übler Gestank, eine Mischung aus Abfall, Schlamm und Chemie ergoss sich trotzdem über das Viertel.
Direkt an der Ecke, wenige Meter vor der Ankunft, durchwühlte jemand einen Müllcontainer.
»Sehen Sie? Das sind die, die uns später ausrauben«, sagte der Taxifahrer. »Die haben weder Angst vor dem Roten Wind noch vor seiner roten Mutter.«
Der Mann zappelte mit den Beinen wie ein Insekt, um nicht kopfüber in den Müll zu fallen. Der Nebel lichtete sich auch in Los Pozos nicht. Im Gegenteil, vom Wind geschützt, wurde er hier noch zäher. Die Wolken schienen an Ort und Stelle zu entstehen, aus dem Boden ausgedünstet, und die Feuchtigkeit legte sich aufs Gesicht, kalt und kriechend wie der Schleim einer Schnecke.
»Weißt du, wie ich die nenne, die hier wohnen?«, fragte der Taxifahrer.
»Wie denn?«
»Weder Fisch noch Fleisch. Nicht ganz verrückt noch ganz bei Verstand.« Er lachte. »Habe ich nicht recht?«
Ich öffnete das Tor und nahm gleich Kurs auf den Garten. Wozu mich anmelden? Wenn meine Mutter nicht zu Hause war, hielt sie sich sicher bei der Lehrerin auf, die ihr Haus nicht hatte verlassen wollen, weil sie sich nicht von ihrem Flügel trennen konnte. So verbrachten sie ihre Nachmittage, meine Mutter las, und die Lehrerin griff in die Tasten oder tat so, als spielte sie etwas Erhabenes. Mitunter gesellten sich noch ein paar betagte Nachbarn aus Los Pozos hinzu, und dann schlüpften meine Mutter und die Lehrerin in die Rolle zweier Gastgeberinnen in einer verfallenen Stadt. Die Gäste baten meine Mutter, ihnen Bücher zu empfehlen, und sie erzählte ihnen von diversen Romanfiguren, als redete sie von ihren Nachbarn: »Was kann man schon von so jemandem erwarten? Ihr sollte man lieber aus dem Weg gehen, eine vom Schicksal gebeutelte Frau, ein armer Teufel.«
Ich traf meine Mutter im Garten an, wo sie, die Füße im Beet versunken, mit einer Riesenschere die Pflanzen stutzte. Meine knirschenden Schritte schreckten sie auf, und als sie mich erblickte, streifte sie sich einen der mit Erde verschmutzten und für ihre Hände viel zu großen Handschuhe ab.
»Komm, sieh dir das mal an«, sagte sie.
Sie zeigte mir die neuen Triebe der Pflanzen, die sie als ein Wunder betrachtete, als einen Sieg des Lebens über diesen Tod aus Säure und Finsternis. Ich erzählte ihr, in Tschernobyl gebe es mehr Tiere denn je, und selbst die vom Aussterben bedrohten hätten sich dank der Abwesenheit von Menschen wieder vermehrt. Meine Mutter deutete es nicht als Ironie, sondern – erneut – als Triumph über den Tod.
»Der Menschen, Mutter. Über den Tod der Menschen.«
»Details«, sagte sie und zeigte auf die Tür zur Küche. »Hast du Hunger? Ich habe Scones gebacken.«
Auf der Marmorarbeitsfläche fand ich Brot, Käse, Orangenmarmelade und sogar eine Avocado. Wo hatte sie die bloß aufgetrieben? Besser nicht fragen. Die Scones waren mit einem weißen Geschirrtuch zugedeckt. Ein wahres Festmahl für mich, denn vor Mauro konnte ich mein Essen höchstens zwischendurch herunterschlingen. Essen, wenn der Körper es verlangte, war mir als Vorstellung fremd geworden, ein Impuls, den ich ignorierte. Ich musste meine Bedürfnisse vergessen, meinen Hunger dem von Mauro anpassen, mir schnell etwas hineinstopfen, wenn er schlief, um einen weiteren Wutanfall zu vermeiden. Das waren Tricks und Strategien, die ich im Laufe der Monate gelernt hatte.
Ich packte alles auf ein Tablett und ging zurück in den Garten.
»Wir müssen die Waffenruhe ausnutzen!«, sagte ich, während ich das Tablett klirrend auf dem Glastisch mit den leicht angerosteten gusseisernen Beinen abstellte.
Zwei Scones, Butter, Marmelade, eine Tasse Tee, das dazu passende Besteck. Ich musste verbergen, welche Freude mir diese banalen Dinge bereiteten: das Scone mit der Hand zerteilen, spüren, wie es in der Mitte trocken zerbrach; die Butter in feinen Schichten abstreichen mit diesem speziellen Messerchen mit der runden Spitze, das wie ein Spielzeug aussah; den Tee mit einem Silberlöffel umrühren, der schwerer war als mein gesamtes Besteck. Privilegien, die uns nur diese Katastrophe hatte bescheren können. Wir tranken Tee in einem Garten von Los Pozos, wo der Nebel uns wie Mullfetzen umhüllte.
»Du hast die Haare kurz geschnitten«, sagte meine Mutter. »Und jetzt sind sie krauser.«
»Das liegt an der Feuchtigkeit.«
»Lang standen sie dir besser. So wirkst du stumpfer. Lange Haare machen dich lebendiger.«
»Mir gefällt es so.«
»Ich tue nur meine Pflicht, dir das zu sagen«, bemerkte sie achselzuckend. »Wenn deine eigene Mutter dir die Dinge nicht mehr sagt …«
»Wenigstens bist du ehrlich, das muss ich dir lassen.«
»Schlimmer wäre es, zynisch zu sein, Kind. Man sollte dankbar sein, wenn jemand in diesen Zeiten noch aufrichtig ist. Außerdem rede ich ja nur von Haaren. Und Haare wachsen nach, nicht?«
Sie wandte den Blick zur Seite, in die Ferne, dorthin, wo sich der Garten des Nachbarhauses befand, der Villa mit den geschlossenen Läden und den schwarzen Löchern an den Stellen, an denen die Dachziegel fehlten. Hinter der Nebelwand deuteten sich weitere Häuser an, die meisten zugemauert, verwittert vom Leerstand oder von der verseuchten Luft.
»Resignation ist keine Tugend«, sagte sie. »Man muss kämpfen für das, was man in diesem Leben will.«
»Sag mal, Mutter, warum bleibst du eigentlich hier?«
Die Gartenhandschuhe lagen auf dem Tisch und erinnerten mich an die abgetrennten Hände eines Riesen.
»Das gleiche frage ich dich. Was willst du beweisen, Kind? Was hat man dir angetan, dass dir an deinem eigenen Leben nichts mehr liegt?«
»Max hat damit nichts zu tun.«
»Was gibt’s Neues von ihm? Sei ehrlich. «
»Nichts. Ich weiß nichts.«
»Du hast getan, was du konntest«, sagte sie, »aber auf dieser Ehe lag ein Fluch.«
»Was für ein Wort … Und weißt du noch, wer sie vom ersten Tag an verflucht hat?«
Meine Mutter blickte zu Boden, auf einen Fleck zwischen ihren Füßen. Die Ellenbogen auf den gusseisernen Rand des Glastisches gestützt, hielt sie sich den Kopf, während ihre Locken vornüberfielen und ihr Gesicht verhängten. »Ich bin es leid«, hörte ich sie sagen, »ich sag’s dir, ich bin es leid.«
Ich machte mich auf eine bissige Bemerkung gefasst, etwas Persönliches, das mich direkt ins Mark treffen würde, doch diesmal sagte sie nichts. Sie verharrte mit gesenktem Kopf und bot mir ihren Scheitel mit dem grauen Haaransatz dar. Es war, als sprächen wir verschiedene Sprachen, und keine von uns beiden war bereit, die Sprache der anderen zu lernen. Mein ganzes Leben hatte ich mich bemüht, ihre Gebärden zu deuten, zu interpretieren, was ich für geheime Signale hielt. Plötzlich fielen mir die Horden von Krebsen wieder ein. Meine Mutter bereitete mir dasselbe Unbehagen, dieselbe Urangst, und in dem Moment wünschte ich, wir könnten uns wieder so normal hassen, wie wir es früher getan hatten.
»Mutter.« Ich fuhr mit den Fingern zwischen ihre zerzausten Locken und berührte ihre dicken, runzeligen Knöchel. Diese Berührung war mehr als wir uns jahrelang erlaubt hatten. »Lassen wir das.«
Sie blickte auf. Ihr Gesicht war gerötet.
»Ja«, sagte sie. »Ich weiß. Was hat das noch für einen Sinn.«
Sie erhob sich und griff nach dem Teller, auf dem nur noch ein paar gelbe Krümel lagen. Dann verschwand sie in die Küche und kam mit weiteren Scones zurück. Ich verschlang sie so schnell, dass ich unwillkürlich an Mauro denken musste. Dann erzählte ich meiner Mutter, wie ich einmal vergessen hatte, den Müll rauszubringen und mitten in der Nacht von einem Rascheln wach geworden war, das Ratten vermuten ließ. In der Küche brannte Licht, und von der Tür aus sah ich Mauro in Unterhosen inmitten des zerfetzten Müllsacks, wie er alles durchwühlte und sich die Abfälle, egal ob essbar oder nicht, selbst die Alufolienverpackung eines Burgers, in den Mund stopfte. Das Aluminium elektrisierte seine Zähne, sodass er es, zerkaut wie ein Kaugummi, wütend wieder ausspie.
»So ist er immer, wenn er zurückkehrt. Ich weiß nicht, warum sie ihn überhaupt noch abholen.«
Die Feuchtigkeit des Nebels durchdrang allmählich meine Hose, trotz des harten, platten Kissens auf dem gusseisernen Stuhl. Ich umklammerte die Tasse mit beiden Händen und wärmte mir das Gesicht im aufsteigenden Dampf.
»Armes Kerlchen«, sagte meine Mutter, obwohl sie etwas anderes sagen wollte. Ich sah die Furcht in ihren Augen; das Grausen, wenn sie sich vorstellte, wie ich in einem Haus am Hafen dem Roten Wind ausgesetzt war und mit der Krankheit zusammenlebte. Sie glaubte nicht, dass ich all dem gewachsen sein könnte. »Und wie viel fehlt dir noch, bis du das Geld zusammenhast?«
Da war sie. Die Frage. Sie hatte sie sich bis jetzt verkniffen, hatte auf den passenden Moment gewartet, um sie zu stellen.
»Ich weiß nicht, ein paar Monate noch, ein Jahr. Mir geht es gut hier.«
»Du bist ausgeliefert, Kind.«
»Du auch.«
Sie schnalzte mit der Zunge.
»Ich habe mein Leben längst gelebt.«
Die Epidemie hatte es geschafft, dass wir uns versöhnten. Bis vor Kurzem hatten wir es kaum länger als fünf Minuten im selben Raum ausgehalten. Ihre mehrdeutigen Fragen, ihr gut gemeintes Verhalten in der Absicht, über mein Leben zu bestimmen. Niemand kann sich so sehr das Glück einer anderen Person herbeiwünschen; das ist ungeheuerlich, geradezu aggressiv. Vor nicht einmal einem Jahr hätte jede Bemerkung über Max mich mit lautem Türenknallen aus dem Haus vertrieben. Wie der Wind nach und nach lose, ausgedörrte Knochen freilegt, hatte die Epidemie uns einander nähergebracht, wenn auch nur an diesem gottverlassenen Ort.
Und doch log ich sie an. Ich hatte längst das Geld zusammen, um wegzugehen. Ich hatte mehr als irgendwer am Hafen sich hätte träumen lassen. Ich hatte so viel Geld, dass ich mir aus den Geldscheinen Sandwiches hätte machen und Mauro mit Papiersalat hätte füttern können. Aber ich konnte mir genau wie die Fischer einfach nicht vorstellen, anderswo zu sein.
»Ich bin nicht hergekommen, um darüber zu reden«, sagte ich. »Erzähl mir von dir. Wie lebt es sich hier in diesem Loch?«
Sie fing an, mir Klatsch und Tratsch von den Nachbarn zu erzählen. Die Lehrerin hatte eine Affäre mit einem Agrarwissenschaftler. Seit der Rote Wind derartige Verheerungen unter den Tieren anrichtete, war der Mann vom Niemand zu einem Neureichen an vorderster Front aufgestiegen, einem selbst ernannten Experten für Hülsenfrüchte. Obendrein war er einer der Investoren der neuen Nahrungsmittelindustrie und anderer Bauprojekte im Landesinneren. Wenn er in die Stadt reiste, dann nur, um am Hafen oder in anderen Vierteln Horden von billigen Arbeitskräften zu rekrutieren, die er auf Lastwagen auf seine Baustellen verfrachtete.
»Sie ist verrückt nach ihm«, sagte meine Mutter mit einer verächtlichen Handbewegung. Sie selbst fühlte sich gefeit vor derlei Begierden. »Mir gefällt dieser Mann ganz und gar nicht, er hat so eine glitschige, schweißige Haut.«
Wenn meine Mutter lachte, legte sich ihre Gesichtshaut aufs Unbarmherzigste in Falten, ein Auge schloss sich mehr als das andere, und während sich die überschüssige Haut an den Wangen zusammenknautschte, blitzten zwischen ihren Zähnen kleine Metallteile hervor. Das ist es, was die Zeit mit den Gesichtern anstellt, und dabei sind das nur rein äußerliche Spuren, die allenfalls erahnen lassen, was eigentlich mit uns geschieht. Im Moment wirkte sie auf mich gefasst, allem entrückt. Sie hatte steife Finger vom Rheuma, ihre Hände waren von blauen, hervorquellenden Adern überzogen. Wir nahmen beide Kalziumtabletten und Vitamin D, eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums, aber keiner wusste, wie lange uns noch blieb, bis wir zerbröseln würden wie vertrocknete Zweige. Mit den Fingerspitzen las Mutter die verstreuten Krümel der Scones auf und ließ sie zurück auf den Teller fallen. Mir tat es gut, für eine Weile meinen ständig kreisenden Gedanken zu entfliehen, dem, was ich einmal mein Monothema genannt hatte. In den Augen meiner Mutter war Max ein Angsthase, einer, der sich vor dem Leben gedrückt hatte, weil er unfähig war, sich ihm zu stellen. Sie war der Ansicht, ich müsste das Kapitel schließen, ihn in den unerwünschten, der Erinnerung nicht für würdig befundenen Raum der Vergangenheit verbannen. Und er? Was dachte er über sie? Er betrachtete sie wohl als ein notwendiges Übel, als eine Gelegenheit, sich in Mitleid zu üben. Dass dies eine Geste voller Überheblichkeit war, kümmerte ihn wenig. Im Grunde genommen waren Max und Mutter zwei Feinde, die sich ein winziges Terrain streitig machten.
»Und Valdivia hat Husten. Sie haben ihn in die Klinik gebracht und einen ganzen Tag lang dortbehalten, aber dann wieder nach Hause geschickt.«
Ramón Valdivia war der Besitzer des einzigen Lebensmittelladens von Los Pozos, unserer Verbindung zu den robusten, aufstrebenden Städten im Landesinneren, eine Art Bindeglied zwischen dem Leben und uns.
»Das ist sicher eine Grippe«, sagte ich. »Der Mann schläft ja nie.«
»Und er hat zwei neue Enkel. Auf dem Land, von der jüngsten Tochter. Er unterhält sie alle.«
»Die vermehren sich da ganz schön.«