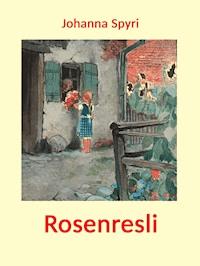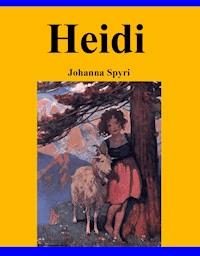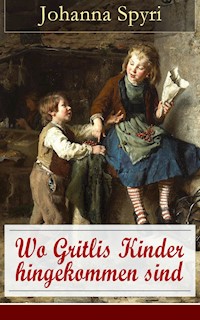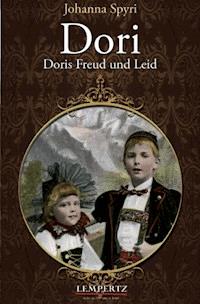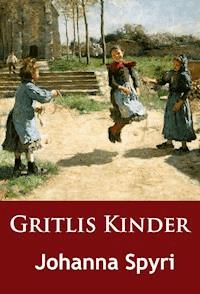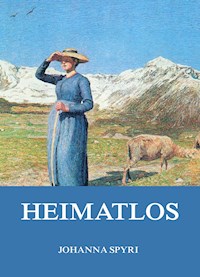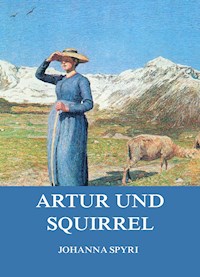0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: nexx – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält fünf wunderschöne Geschichten für Kinder zum Vorlesen, die bekannteste davon ist wohl die des »Rosenresli«, das für seine guten Taten am Ende belohnt wird.
nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Johanna Spyri
Rosenresli
Impressum
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958702318
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
I. Beim Weiden-Joseph
1. Kapitel - Beim Weiden-Joseph
Wo schöne grüne Weidenhügel sich erheben, einer nach dem anderen, und zwischendurch die Taleinschnitte von schimmernden roten und blauen Sommerblumen bedeckt sind, liegt das Dörfchen Altkirch. Das saubere weiße Kirchlein mit dem roten Turm und die hölzernen Häuser ringsherum liegen vor allen Winden geschützt im grünen Grund. Denn hinter dem Dörfchen und von beiden Seiten steigen die Hügel empor, und nur die Vorderseite ist frei und offen.
Diese schaut zu der grünen Höhe des Rechbergs hinüber, auf dessen Gipfel, von Wald umgeben, ein anderes Dorf mit seinen weißen, steinernen Häusern weithin schimmert. Wie die Höhe heißt es Rechberg.
Zwischen den Höhen rauscht der wilde Zillerbach dahin und bringt von seiner Fahrt aus den Bergen herunter viel Holz und Steingeröll in den trüben Wellen mit. Von Altkirch zum Rechberg hinüber führt eine Fahrstraße, die einen weiten Weg zu machen hat. Erst führt sie im Zickzack den Berg hinunter bis zum Zillerbach, dann über die alte, gedeckte Brücke und jenseits wieder im Zickzack hinauf bis zum Dorf Rechberg. Im Ganzen wohl zwei Stunden lang.
Kürzer und viel lieblicher ist der schmale Fußpfad, der mitten über die Höhe hin zum Zillerbach hinunterführt, gerade auf den schmalen, hölzernen Steg zu, der hier über den reißenden Bach geht. Der Steg ist so schmal, dass nur eine Person auf einmal darüber gehen kann. Und es ist gut, dass auf beiden Seiten Seile gespannt sind, an denen man sich festhalten kann. Denn der leicht gebaute Steg zittert und schwankt bei jedem Schritt so sehr, dass den Wanderer ein ganz unsicheres Gefühl befällt.
Weit und breit ist kein Haus auf all den grünen Hügeln zu sehen.
Nur auf dem letzten, von wo der Fußweg steil zum Bach hinuntergeht, steht eine einsame Kapelle. Sie schaut seit uralter Zeit auf das reißende Wasser und den so oft weggeschwemmten und wieder neu errichteten Steg nieder.
In Altkirch leben viele arme Leute, denn es gibt dort wenig Arbeit.
Die meisten Männer gehen als Tagelöhner auf die Bauernhöfe der Nachbarschaft. Einige besitzen selbst ein Fleckchen Erde, das sie bebauen. Nur zwei oder drei Bauern im Dörfchen haben so viel Land, um mehrere Kühe darauf halten zu können,
Eine der ärmsten Familien war die vom Weiden-Joseph in dem abgelegenen alten Häuschen, das am Fußweg zur Kapelle liegt und ganz allein steht. Das Häuschen wird fast ganz von den lang herabhängenden Zweigen eines uralten Weidenbaums zugedeckt. Der hat sich immer mehr ausgebreitet, bis er das Häuschen endlich ganz umschloss. Nach diesem Baum heißt der Besitzer der Weiden-Joseph. Er hatte immer in dem Häuschen gewohnt, denn es war schon seines Vaters Besitz gewesen, der darin uralt geworden war. Jetzt war der Weiden-Joseph selbst ein alter Mann geworden und lebte in dem Häuschen mit seiner alten, seit langer Zeit kranken Frau und seinen zwei Enkelkindern.
Der Weiden-Joseph hatte einen einzigen Sohn, den Sepp, der immer ein gutmütiger, aber ein wenig leichtsinniger und unsteter Mensch gewesen war. Wo er sich jetzt aufhielt, wussten die alten Eltern selbst nicht, schon seit sechs Jahren war er fort von daheim und hatte während der Zeit wenig von sich hören lassen.
Der Sepp hatte sehr früh geheiratet, und die Eltern freuten sich darüber, denn die Frau war die fleißige, brave Konstanze, die von allen Leuten gern gesehen wurde. Sie sah auch gut aus und hielt alles schön in Ordnung im Häuschen ihres Mannes. Der Weiden-Joseph und seine Frau verlebten friedliche Tage, solange die Tochter Konstanze im Haus war. Sie arbeitete von früh bis spät und ließ es den Eltern an nichts fehlen. Sie sagte, Vater und Mutter müssen nun ausruhen, sie haben genug getan. Sie und ihr Sepp seien nun da, um den Alten noch ein paar geruhsame Tage zu machen.
Der Sepp ging täglich auf die Arbeit zu dem großen Hof jenseits der Ziller hinüber und brachte am Samstag ein schönes Stück Geld heim.
Es war alles so zur Zufriedenheit geregelt, dass auch der Sepp ein ausgeglichener Mensch wurde und nichts wünschte, als so weiterzuleben.
Drei Jahre gingen in ungetrübtem Frieden so dahin, und der alte Pater Klemens, der in dem langen, alten Haus hinter Altkirch wohnte und oft ins Häuschen des Weiden-Joseph eintrat, sagte oftmals:
»Joseph, bei Euch ist gut wohnen, da hört man kein böses Wort. Haltet Eure Konstanze in Ehren!« Und seine gutmütigen Augen leuchteten vor Freude, wenn die Konstanze, so sauber und ordentlich wie sie immer war, hereintrat und ihn mit ihrer fröhlichen Stimme willkommen hieß. Auch das kleine Stanzeli auf ihrem Arm streckte schon von weitem dem Pater Klemens das Händchen entgegen.
Dann sagte er noch einmal: »Ja gewiss, bei Euch ist gut wohnen, Joseph.«
Als das Stanzeli fast zwei Jahre alt war, kam der kleine Seppli auf die Welt. Das war eine große Freude für alle. Aber bald danach geschah das Traurigste, das dem Haus des Weiden-Joseph widerfahren konnte. Die Konstanze starb ganz plötzlich und hinterließ eine Lücke, die nicht mehr auszufüllen war. Von der Zeit an lief der Sepp herum wie einer, der keinen Sinn mehr im Leben sieht. Sein unruhiges Wesen kehrte wieder zurück. Er konnte am Sonntag nicht mehr daheim bleiben, wie er es früher so gern getan hatte. Es trieb ihn immer weiter fort, und zuletzt meinte er, wenn er woanders Arbeit suchen könnte, werde es wieder besser mit ihm werden.
Er versprach, den Eltern von Zeit zu Zeit etwas Geld zu schicken für ihren und der Kinder Unterhalt. Dann ging er fort. Eine Zeit lang hielt er sein Versprechen und schickte seine Beiträge. Dann kam kein Geld mehr, und seit sechs Jahren wussten sie weder, wo er sich aufhielt, noch ob er überhaupt noch lebte. Unterdessen waren die beiden Alten immer gebrechlicher und ärmer geworden.
Der einzige, geringe Erwerb, der ihnen geblieben war, bestand darin, dass der Großvater aus den Weidenzweigen Körbchen flocht. Jeden Freitag gab er sie dem Käsehändler mit, der seine Käse auf den Markt in die Stadt trug. Viel nahm der Großvater nicht ein für seine Arbeiten, und die Großmutter musste jedes Stückchen Brot genau einteilen, dass man von einem Tag zum anderen leben konnte.
So war das Stanzeli bald neun, der Seppli sieben Jahre alt geworden, und Stanzeli musste jetzt dem Großvater schon viel bei der Arbeit helfen, denn seit mehr als vier Monaten lag die Großmutter krank darnieder und konnte gar nichts mehr tun. So mussten der Großvater und das Stanzeli zusammen täglich das Kochen besorgen, das zwar nicht sehr viel Zeit beanspruchte, denn es wurde nichts anderes gekocht, als Maisbrei und Kartoffeln. Und dann und wann ein wenig Kaffee. Aber sie mussten gemeinsam das Essen bereiten, denn das Stanzeli war noch zu klein, um die Pfanne hin und her zu heben.
Und der Großvater kannte sich nie bei den Zutaten aus, das wusste dann das Stanzeli genau.
So arbeiteten sie immer miteinander in der Küche, und gewöhnlich stand der Seppli dann auch in dem kleinen Raum, wo die zwei sich kaum bewegen konnten. Er war einmal dem einen und einmal dem anderen im Wege und sperrte ganz weit seine Augen auf in Erwartung der herrlichen Dinge, die da zubereitet wurden. Und weder der Großvater noch das Stanzeli versuchten, den Seppli aus der kleinen Küche zu schicken. Sie wussten genau, dass er zwei Minuten später wieder da war, denn der Seppli hatte in manchen Sachen eine unbeschreibliche Beharrlichkeit.
Eine schöne, warme Septembersonne schimmerte draußen über den grünen Hügeln um Altkirch. Eben fielen einige Strahlen davon durch die trüben Fensterscheiben auf das Bett der Großmutter.
»Ach Gott!« seufzte sie, »scheint auch die Sonne noch? Wenn ich doch auch einmal wieder hinaus könnte. Aber ich wollte ja noch stillhalten, wäre das Bett nur nicht so hart wie Holz, und im Kissen sind fast keine Federn mehr. Und wenn ich erst an den Winter denke, wenn ich so daliegen muss auf dem harten Sack und unter dem dünnen Decklein und ohne ein rechtes Kissen. Ich muss ja erfrieren, es ist mir ja jetzt schon kalt.«
»Du musst dich nicht schon jetzt um den Winter sorgen«, sagte der Großvater beschwichtigend. »Unser Herrgott wird ja dann auch noch am Leben sein. Er hat uns schon manchmal in der Not geholfen, das darfst du nicht vergessen. Was meinst du, wenn wir dir ein wenig Kaffee machten, damit es dir warm würde?«
Die Großmutter wollte gern ein Tässchen Kaffee trinken, und der Großvater machte die Küchentür auf. Sie lag unmittelbar neben der Stube, in der das Bett der Großmutter stand. Ein kleines Treppchen hinter dem Ofen führte in die Schlafkammer hinauf, wo der Großvater mit den Kindern schlief. Er winkte jetzt Stanzeli, dass es mitkomme, und gleich lief ihr auch der Seppli nach, denn er musste zusehen, wenn etwas Essbares bereitet wurde. Draußen nahm der Großvater einen Kessel vom Gestell herunter und goss Wasser hinein. Dann sagte er: »Stanzeli, was kommt jetzt zuerst?«
»Zuerst muss ich jetzt Kaffeebohnen mahlen«, berichtete das Kind und setzte sich gleich mit der alten Kaffeemühle auf den Schemel und drehte mit aller Kraft. Aber irgendetwas stimmte mit der Mühle nicht, es untersuchte sie und zog endlich unten das Schublädchen sorgfältig hervor. Da lagen, anstatt des schönen Pulvers, große Brocken, fast halbe Kaffeebohnen darin. Das Stanzeli hob mit Schrecken das Lädchen zum Großvater empor und zeigte ihm das Unheil. Er besah sich den Schaden und sagte beruhigend: »Musst nur keinen Lärm machen, dass es die Großmutter nicht hört, sonst jammert sie und meint, nun könne sie keinen Kaffee mehr trinken. Aber wart nur ein wenig.«
Damit ging der Großvater hinaus und kam bald wieder zurück mit einem großen Stein in der Hand. Damit zerschlug und zerrieb er die Kaffeebohnen auf einem Papier und dann schüttete das Stanzeli das grobe Pulver in den Kessel hinein. Als aber bald darauf die Großmutter ihr Tässchen in die Hand bekam, rief sie klagend aus:
»Oh weh! Oh weh! Da schwimmen die großen Körner oben auf, die Kaffeemühle ist zerbrochen. Oh, wenn sie nur noch bis zu meinem Tod gehalten hätte, wir können keine neue mehr kaufen.«
Aber der Großvater sagte in besänftigendem Ton: »Du musst dich nicht kränken deswegen, mit Geduld ist manches in Ordnung zu bringen.«
»Ja schon, aber keine Kaffeemühle«, jammerte noch einmal die Großmutter.
Das Stanzeli und der Seppli bekamen auch jedes ein Tässchen voll Kaffee und einige Brocken Kartoffeln dazu. Brot aßen sie nur am Sonntag jedes ein Stückchen. Dann holte der Großvater seine Körbchen herbei, die er fertig geflochten hatte. Er band immer ein paar davon mit einer Schnur zusammen und gab jedem der Kinder ein solches Bündelchen von kleinen Körbchen in die Hand. Dann ließ er sie damit weggehen und ermahnte sie noch, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Sie wussten schon, wohin sie mit den Körben mussten, denn sie hatten alle paar Wochen einmal dem Käsehändler eine solche Sendung zu überbringen. Dieser wohnte weit vom Dörfchen entfernt. Man musste über die Hügel gehen, an der Kapelle vorbei bis zum Wald hinauf, dort stand seine Hütte.
Die Kinder zogen nun miteinander aus. Da das Stanzeli immer ganz gewissenhaft seinen Weg fortsetzte, musste der Seppli auch mit, wenn er auch gern etwas stillgestanden wäre und dies und jenes betrachtet hätte. Erst als sie an die Kapelle kamen, blieb das Stanzeli stehen und sagte: »Leg die Körbe hier auf den Boden, Seppli, wir müssen jetzt in die Kapelle hinein und ein Vaterunser beten, so lange können sie hier liegen bleiben.«
Aber der Seppli war störrisch.
»Ich will nicht hinein, es ist mir zu heiß«, sagte er und setzte sich auf den Boden nieder.
»Nein, Seppli, komm, das muss man tun«, mahnte das Stanzeli.
»Weißt du nicht mehr, dass der Pater Klemens gesagt hat, wenn man an einer Kapelle vorbeikomme, müsse man immer hinein und etwas beten? Steh auf und komm schnell.«
Der Seppli blieb störrisch am Boden sitzen. Aber das Stanzeli ließ ihm keine Ruhe. Ganz ängstlich nahm es ihn bei der Hand und zog ihn auf: »Du musst kommen, Seppli, es geht gewiss nicht gut sonst.
Du solltest auch gern beten.«
In dem Augenblick kam jemand von unten auf die Kapelle zu. Plötzlich stand der Pater Klemens vor den Kindern.
Seppli war schnell auf seine Füße gesprungen. Die Kinder boten schnell dem Pater ihre Hände.
»Seppli, Seppli,« sagte er ganz freundlich, als er diesem die Hand drückte, »was habe ich gehört? Du willst dem Stanzeli nicht folgen, wenn es gern mit dir in die Kapelle hinein möchte? Ich will dir aber etwas sagen. Siehst du, es ist kein Zwang von unserem Herrgott, dass man in die Kapelle hineingehen und beten soll, sondern es ist eine Erlaubnis, dass wir so zu ihm beten dürfen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, schenkt er uns etwas, wir können es dann nur nicht immer gleich sehen.«
Jetzt wanderte der gute Pater wieder seiner Wege, und Seppli trat nun ohne Widerrede mit dem Stanzeli in die Kapelle ein und sagte andächtig sein Gebet. Als die Kinder nach einiger Zeit wieder herauskamen, hörten sie laute Stimmen und ein starkes Keuchen den Fußweg herauf ertönen, der hier sehr steil zum Zillerbach hinunterführt. Jetzt kamen nacheinander drei Köpfe zum Vorschein, erst ein Mädchenkopf und dann zwei Bubenköpfe, und nun standen auf einmal drei Kinder den anderen zweien gegenüber. Mit großem Erstaunen sahen sie sich gegenseitig an.
2. Kapitel - Eine neue Bekanntschaft
Das neu aufgetauchte Mädchen war von allen das größte und mochte wohl elf Jahre alt sein. Der größere der Brüder war wenig über ein Jahr jünger, während der andere bedeutend kleiner, aber sehr stämmig gebaut war. Das Mädchen ging nun noch ein paar Schritte näher auf die Kinder zu und fragte:
»Wie heißt ihr zwei?«
Die Kinder nannten ihre Namen.
»Wo seid ihr daheim?« fragte das Kind weiter.
»In Altkirch, dort, man kann den Kirchturm sehen«, antwortete das Stanzeli und deutete auf den roten Helm zwischen den Hügeln.
»Also habt ihr dort eure Kirche. Eine solche Kirche haben wir auch bei uns, aber sie ist geschlossen, und man geht nur am Sonntag hinein. Aber solche Kapellen haben wir keine bei uns. Dort steht noch eine höher oben, sieh nur, Kurt, ganz oben beim Wald.« Das Mädchen zeigte mit seinem Finger hoch hinauf und der Bruder nickte zum Zeichen, dass er die Kapelle sehe. »Ich möchte nur wissen, warum ihr hier auf so vielen Hügeln solche Kapellen habt.«
»Dass man hineingehen kann und beten, wenn man vorbeikommt«, sagte das Stanzeli schnell.
»Das kann man ja auch sonst tun«, meinte das andere Mädchen.
»Man kann ja überall beten, wo man ist, der liebe Gott hört es überall, das weiß ich.«
»Ja, aber man denkt nicht, dass man auch einmal beten sollte, bis man an die Kapelle kommt, dann weiß man es gleich und tut es auch« entgegnete das Stanzeli ernsthaft.
»Jetzt müssen wir gehen, Lissa«, mahnte der Bruder Kurt, dem das Gespräch zu lang wurde. Aber die Lissa hatte es nicht eilig, sie machte gern ein wenig Bekanntschaft, und das Stanzeli gefiel ihr, weil es so bestimmt antwortete. Und jetzt eben hatte es etwas gesagt, das die Lissa gar nicht widerlegen konnte, wie sehr sie auch nachdachte. Es war ja wirklich so, ihr kam es auch nie in den Sinn, dass man auch einmal beten und dem lieben Gott danken könnte, wenn sie so spazieren ging und Freude hatte. Auch wenn sie schon zu Stanzeli ganz fest gesagt hatte, man könne ja überall beten.
Jetzt machte auch die Kapelle auf einmal einen ganz neuen Eindruck auf Lissa, denn bis jetzt hatte sie so darauf geschaut, wie auf einen Bau, der nur dastehe, weil er einmal vor langer Zeit hingestellt worden war. Sie hätte aber nie gedacht, dass der heute noch jedem etwas Bestimmtes zurufen würde, der da vorübergeht. Nun war es ihr auf einmal, als zeige der liebe Gott vom Himmel herab auf die Kapelle und sage: »Da steht sie, dass du auch einmal an mich denkst.«
Als Lissa gedankenverloren so lange nichts sagte, fuhr das Stanzeli fort: »Und das ist nicht wie ein Befehl, sondern wie eine Erlaubnis, dass wir hier hereinkommen und beten dürfen. Denn wenn wir das tun, schenkt uns der liebe Gott etwas, wenn wir es auch nicht sehen können. Der Pater Klemens hat's gesagt.«
»Ja, aber ich wollte lieber einmal etwas, das man sehen kann«, fügte jetzt der Seppli hinzu, der neben dem Stanzeli stehen geblieben war und aufmerksam zugehört hatte.
»Kennst du auch den Pater Klemens?« fragte Lissa ganz erfreut, denn dieser war auch auf der anderen Seite vom Zillerbach allen Kindern wohlbekannt und ihr guter Freund. Wo immer er von ihnen gesehen wurde, in seinem langen Rock und dem großen Kruzifix an der Seite, da liefen gleich von allen Seiten die Kinder herbei und gaben ihm die Hand. Und dann zog er aus seinem weiten Rock die alte Brieftasche heraus, und jedem der Kinder schenkte er ein schönes, buntes Bildchen.
Lissa hatte davon schon manches erhalten, mit rosigen Engelchen darauf, die Blumen streuten. Andere Bilder zeigten einen Busch Rosen mit einem Vögelchen darauf sitzen. Der Name Pater Klemens rief ihr die liebsten Erinnerungen ins Gedächtnis.
»Er wohnt bei uns in Altkirch, oben im alten Kloster, und er kommt viel zu uns«, berichtete das Stanzeli.
»Ja, und er bringt der Großmutter manchmal ein ganzes Brot«, ergänzte der Seppli, dem diese Tatsache besonders in Erinnerung war.
»Jetzt müssen wir gehen, wir haben noch weit bis zum Käsehändler«, sagte das Stanzeli, indem es sein Bündel Körbchen aufnahm und dem Seppli das seinige gab.
»Willst du einmal zu mir hinüberkommen auf den Rechberg?« fragte Lissa, die gern die neue Bekanntschaft ein wenig fortsetzen wollte.
»Ich weiß den Weg nicht, ich bin noch nie auf der anderen Seite vom Zillerbach gewesen.«
»Oh, der ist ganz leicht zu finden. Komm nur einmal am Sonntag-Nachmittag«, ermunterte Lissa sie, »dann spielen wir bis zum Abend.
Du musst nur über den Steg dort unten gehen und dann immer hinauf bis auf den höchsten Punkt. Dort ist der Rechberg, und das große Haus, das oben ganz allein steht, das ist unser Haus. Also komm dann!«
Jetzt trennten sich die Kinder. Das Stanzeli ging mit dem Seppli den Berg hinauf und Lissa sah sich nach den Brüdern um, die eine Weile nichts von sich hatten hören lassen. Kurt war auf den alten Tannenbaum geklettert, der neben der Kapelle stand, und schaukelte sich auf einem morschen Ast, der bedenklich krachte, hin und her. Lissa schaute mit Interesse zu, ob Kurt bald mitsamt dem Ast herunterkommen werde, was ihr mehr unterhaltsam als gefährlich erschien.
Nicht weit von der Tanne entfernt lag der kleine, dicke Karl ausgestreckt am Boden und schlief so fest, dass er die lauten Rufe von Lissa, er solle sich nun erheben, nicht hören konnte.
Aber jetzt kam etwas den Hügel herabgerollt, das mit einem Mal den Kurt vom Baum und den Karl auf seine Füße brachte. Es war eine große Schafherde, alte und junge, große und kleine. Alles wogte, hüpfte, sprang durcheinander, und nebenher lief der große Schäferhund und bellte in einem fort, damit die Herde zusammenblieb. Er bellte so laut und eindringlich, dass Karl augenblicklich davon erwachte und schnell aufsprang, um die herabrollende Schar zu betrachten.
Der Schäfer trieb seine Herde an den Kindern vorbei nach Altkirch zu. Die drei schauten mit schweigender Bewunderung auf die Vorüberziehenden. Ihre Augen konnten nicht genug aufnehmen von den lustigen Sprüngen, die die jungen, niedlichen Schäfchen neben ihren Müttern machten. Diese beobachteten die Kleinen, dass sie auch nicht mutwillig aus der Reihe hüpften und dann etwa verloren gingen. Als die Herde fast vorüber war und nur noch die letzten alten Schafe nachliefen, da atmete der immer noch in Staunen versunkene Karl tief auf und sagte: »Wenn wir nur ein solches Schäfchen hätten.«
Das war das Gleiche, was Kurt und Lissa in dem Augenblick dachten, und alle drei stimmten auf einmal so ganz überein, wie es selten der Fall war. Lissa schlug gleich vor, nun schnell nach Hause zurückzukehren und Papa und Mama so lange zu bitten, ihnen ein solches Schäfchen zu schenken, bis sie es tun wurden.
Dann schilderte sie den Brüdern noch, wie es sein würde, wenn sie das Schäfchen überall mit sich herumführen könnten. Auf der Weide würden sie seine lustigen Sprünge beobachten und es so sorgfältig bewachen wie die alten Schafe. Und alle drei steigerten sich in eine solche Freude hinein, dass sie übermütig den Berg hinabliefen und schnell über den Steg rannten, die Lissa voran. Hinter ihr folgte Kurt, und beide stürmten in so hohen Sprüngen über den leicht gebauten Steg, dass er unter ihren Füßen schwankte und zitterte.
Die losen Bretter sprangen so auf und nieder, dass der nachfolgende Karl den Halt unter seinen Füßen verlor, mitten auf dem Steg hinfiel und beinahe in den reißenden Zillerbach gestürzt wäre. Kurt kehrte um und zog ihn auf, und da Lissa inzwischen drüben angekommen war, schwankte der Steg nicht mehr auf und nieder, und die Brüder kamen nun auch glücklich auf der anderen Seite an. Der Weg von da zum Rechberg hinauf war ziemlich weit, die Kinder brauchten wohl dreiviertel Stunden, bis sie an der letzten Steigung angekommen waren und ihnen die Lichter aus den Fenstern der Wohnstube entgegenschimmerten. Denn es war unterdessen völlig Nacht geworden.
Schon seit einer Stunde ging die Frau des Oberamtmanns ängstlich hin und her, einmal von der Stube auf die steinerne Treppe am Haus hinaus, dann in den Garten hinunter. Sie schaute sich um, kehrte dann wieder zurück und machte nach einer kleinen Weile aufs Neue denselben Gang.
Schon seit dem Mittagessen hatte sie keines der Kinder mehr erblickt, und um vier Uhr, zur Kaffeezeit, hätten sie wie gewöhnlich daheim sein sollen. Die Mutter hatte ihnen erlaubt, den freien Samstag-Nachmittag oben im Wäldchen zuzubringen. So waren gleich nach Tisch alle drei freudig davongerannt. Aber nun war es dunkel geworden und noch nirgends waren die Kinder zu sehen. Wo konnten sie sich nur so verspätet haben? Oder sollte dem kleinen Karl, der noch gar nicht so fest auf den Füßen stand, etwas zugestoßen sein?
Der Mutter kamen alle möglichen Bedenken, und immer unruhiger lief sie hinaus und wieder hinein und an alle Fenster.
Aber jetzt – das waren die bekannten Stimmen. Sie tönten ganz aufgeregt schon weit von unten herauf. Die Mutter lief hinaus und richtig, da kamen sie heraufgestiegen. Als die Kinder die Mutter sahen, lief eines schneller als das andere, um zuerst erzählen zu können.
Der kleine Karl blieb nun weit zurück. Kurt und Lissa stürzten sich fast gleichzeitig auf die Mutter und wollten beide zusammen alles auf einmal berichten. Aber zu gleicher Zeit ertönte eine laute Stimme von der anderen Seite: »Zum Abendessen! Zum Abendessen!« Es war die Stimme des Oberamtmanns, der eben von seinen Geschäften heimkehrte und seine feste Hausordnung aufrecht hielt.
Als nun alle ruhig bei Tisch saßen, konnte das Erzählen beginnen.
Aber zuerst mussten sie berichten, warum sie nicht zur Kaffeezeit heimgekommen waren.
Endlich kam dann heraus, dass es oben im Wäldchen der Lissa zu langweilig geworden war und sie vorgeschlagen hatte, zur alten Linde hinaufzusteigen. Da man nun von dort auf die Kapelle hinüber- und auf den Zillerbach und den schmalen Steg hinuntersah, hatte Lissa eine unwiderstehliche Lust erfasst, gleich dorthin zu laufen. Sie wollte sich alles aus der Nähe ansehen, denn das Schwanken und Zittern des Stegs war ihr noch von einem früheren Ausflug her in Genussreicher Erinnerung. Sogleich waren die Brüder einverstanden gewesen und in Eile die Reise angetreten worden, sie war aber schließlich viel länger ausgefallen, als sie beabsichtigt hatten.
Als nun das Bekenntnis der unerlaubten Reise abgelegt und die Warnung gefolgt war, ein andermal einen solchen Einfall nicht auszuführen, berichteten sie zuerst von der Kapelle. Dann erzählten sie von den zwei Kindern, dann von der Schafherde und dann noch einmal alles von vorn und noch ausführlicher. Zuletzt kam auch noch die Schilderung von dem lustigen Übergang über den Zillerbach und wie es dabei zugegangen war. Diese Beschreibung hatte dann zur Folge, dass der Vater für die Zukunft jeden Ausflug an den Zillerbach hinunter streng verbot. Der schwankende Steg war überhaupt eine Einrichtung, gegen die der Oberamtmann schon lange protestiert hatte. Dennoch blieb das schadhafte Verbindungsmittel immer noch stehen.
»Karl der Dicke ruht von seinem Tagewerk, und das eure wird wohl auch zu Ende sein«, sagte jetzt der Vater. Er rüttelte ein wenig an dem Stuhl neben ihm, auf dem Karl inzwischen fest eingeschlafen war, denn der Ausflug hatte ihn sehr müde gemacht. Es ging aber nicht so leicht, diesen ersten, guten Schlaf zu unterbrechen. Mit einem Mal nahm der Vater den Stuhl und trug ihn mitsamt dem Schläfer in das Schlafzimmer hinein, und die anderen Kinder folgten nach und jauchzten über den Spaß. Zuletzt kam die Mutter und hatte ihre liebe Not, bis sie den einen aufgeweckt und die anderen zur Ruhe gebracht hatte.
Von dem Tag an verging kein Morgen-, kein Mittag-, kein Abendessen, ohne dass die Kinder eines nach dem anderen und immer wieder und in allen Tonarten die Worte vorbrachten: »Wenn wir nur ein solches Schäfchen hätten.« Endlich hatte der Oberamtmann genug davon.
Eines Abends saß die Mutter mit den Kindern um den Tisch. Der kleine Karl, dem es bei den Schularbeiten der älteren sehr langweilig wurde, wiederholte eben zum sechsten Mal: »Wenn wir nur ein solches Schäfchen ...«, da auf einmal machte der Vater die Tür weit auf und herein sprang ein wirkliches, lebendiges Schäfchen.
Das Tierchen war mit krauser, schneeweißer Wolle bedeckt und so niedlich anzusehen, wie die Kinder noch keines gesehen hatten. Jetzt erhob sich ein solcher Freudenlärm, ein solches Gepolter in der Stube, dass man kein Wort mehr verstehen konnte. Das Schäfchen schoss suchend und blökend von einem Winkel in den anderen, weil es keinen Ausweg fand, und alle drei Kinder rannten mit Freudengeschrei hinter ihm her. Aber mit einem Mal ertönte die laute Stimme des Vaters: »So, nun ist's genug! Nun kommt fürs Erste das kleine Schaf in seinen nagelneuen Stall, und ihr kommt her und hört zu, was ich euch zu sagen habe.« Die Kinder durften erst ihr Schäfchen hinausbegleiten. Es wunderte sie auch sehr, wo der neue Stall für das Tierchen wäre und wie er aussähe.
Richtig, aus ganz neuen Brettern war eine kleine Abteilung weit hinten im Pferdestall errichtet worden, und schönes, weiches Stroh lag darin, worauf das Schäfchen schlafen konnte. Auch eine kleine Krippe war darin, da schüttete man dem Tierlein Gras und Heu und andere gute Sachen hinein, die ihm wohl schmeckten. Als nun das Schäfchen gut auf sein Stroh gebettet war und ganz stilllag, nur noch ein wenig ängstlich atmete, da sagte der Vater, nun müsse es schlafen. Er machte das niedrige Türchen zu und winkte den Kindern, ihm zu folgen.
Drinnen in der Stube setzte er sich, stellte die drei Kinder vor sich hin, hob den Zeigefinger in die Höhe und sagte ernsthaft: »Jetzt hört mir gut zu. Ich habe das kleine Schaf von seiner Mutter weggenommen, um es euch zu schenken. Nun sollt ihr ihm die Mutter ersetzen, es sorgfältig hüten und pflegen, dass es sich bei euch wohlfühlt und es nicht vor Heimweh sterben muss. Ihr dürft es in jeder freien Stunde herausnehmen, mit ihm spielen und spazieren gehen. Ihr könnt es auf die Weide hinauf führen, da kann es sich sein Gras selbst suchen.
Ihr könnt gehen mit ihm, wohin ihr wollt.
Aber niemals dürft ihr das Tierchen allein lassen, keinen Augenblick es ist noch zu klein, um sich zurechtzufinden, es wurde sich gleich verlaufen, fände seinen Stall nicht mehr und könnte elend zugrunde gehen. Wer es aus dem Stall holt, der behütet es, bis er es wieder an seinen Ort zurückgebracht hat. Habt ihr mich gut verstanden und wollt ihr das Schäfchen so sorgfältig pflegen, wie ich es euch gesagt habe. Oder wollt ihr lieber nicht, dann sagt es, dann bringe ich es noch heute zu seiner Mutter zurück.«