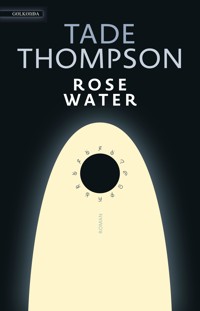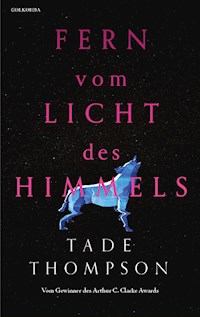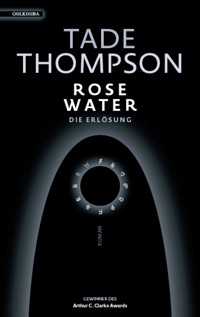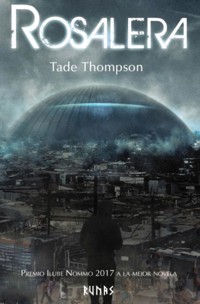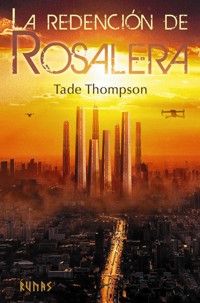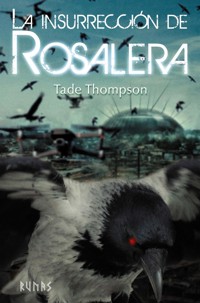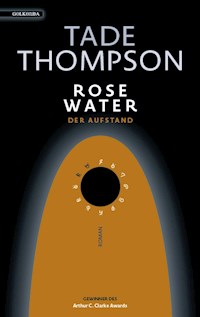
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Golkonda VerlagHörbuch-Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2067 hat sich Rosewater, die Stadt, die ihren Wohlstand dem Alien Wormwood verdankt, von Nigeria losgesagt. Eine Entscheidung, die bei der nigerianischen Regierung nicht auf Gegenliebe stößt. Im Gegenteil: Der Präsident ist nicht bereit, die prosperierende Stadt kampflos in die Freiheit zu entlassen. Jack Jacques, der ebenso ehrgeizige wie charismatische Bürgermeister von Rosewater, hat fest mit Wormwoods Unterstützung gerechnet, denn die Kuppel des Alien hatte die Stadt jahrelang gegen alle Aggressoren von außen verteidigt. Doch Wormwood stirbt … Da erwacht in den Vorstädten Rosewaters eine Frau, die nicht mehr weiß, dass sie eine Ehefrau und Mutter ist, die aber umso deutlicher fühlt, dass dieser Körper nicht zu ihr gehört und etwas wesentlich Älteres, Zerstörerisches, Fremdes in ihr schlummert. Diese Frau wird zur letzten Hoffnung der von den Regierungstruppen bedrängten Stadt. Doch nur wenigen Menschen ist bewusst, welch hohen Preis sie für ihre Rettung zahlen müssen, denn die Invasion der Aliens, dessen Vorhut Wormwood war, hat längst begonnen. Werden S45-Agentin Femi, Ex-Agent Kaaro und seine Lebensgefährtin Aminat die Bedrohung noch abwenden können? Rosewater – der Aufstand ist die hochgelobte Fortsetzung des prämierten Auftakts der Trilogie und schließt inhaltlich fast direkt an den ersten Band Rosewater an. Wurde im ersten Teil noch alles aus Sicht von Agent Kaaro beschrieben, lässt Thompson uns nun aus der Perspektive verschiedener Erzähler mitfiebern. Eine geschickt gewobene und prägnante Mischung aus Science-Fiction, Psychologie, Action und Mystery, die man nicht mehr aus der Hand legen möchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TADE THOMPSON
ROSEWATER
Der Aufstand
Aus dem Englischen von Jakob Schmidt
Die britische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Rosewater Insurrection« bei Orbit, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London, UK.
© 2019 by Tade Thompson
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Auszug aus »Blackfish City« © 2018 by Sam J. Miller
Auszug aus »Afterwar« © 2018 by Lilith Saintcrow
Auszug aus »One Way« © 2018 by S. J. Morden
Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Buch sind fiktiv, und jede Ähnlichkeit mit realen Personen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig.
1. eBook-Ausgabe 2022
Deutsche Erstausgabe
© 2021 der deutschsprachigen Ausgabe Golkonda Verlag in Europa Verlage GmbH, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: s.BENeš (benswerk.com)
Lektorat: Angela Hermann-Heene
Satz: Danai Afrati
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-96509-027-9
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.golkonda-verlag.com
www.facebook.com/Golkonda.Verlag
www.instagram.com/golkonda.verlag
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Cilian, der einfach zur Tür hereingekommen ist.
Inhalt
PROLOG Camp Rosewater: 2055
KAPITEL 1 Rosewater: 2067
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
PROLOG
Camp Rosewater: 2055
ERIC
Ich bin kein Auftragskiller.
Es ist mir wichtig, das klarzustellen, obwohl ich gerade meine Waffe reinige, sie schon auseinandergenommen und geputzt habe, in der Absicht, einen Mann damit zu töten – Befehle …
Für die meisten Afrikaner hatte die plötzliche Entdeckung eines mit einem Meteor eingetroffenen Außerirdischen in London und sein unterirdisches Wachstum keine große Bedeutung. Unser Leben hat sich dadurch kaum verändert. Wir konnten uns über neue, interessantere Verschwörungstheorien austauschen, aber das war es auch schon. Eine Tasse Reis blieb nach wie vor teuer.
Selbst als wir Nordamerika verloren, haben China und Russland sich sofort darum gerissen, das militärische und wirtschaftliche Vakuum zu füllen. Eine Tasse Reis wurde noch teurer.
Aber jetzt ist das Alien hier, in Nigeria, und das bedeutet zumindest für mich, außergerichtliches Töten. Mord.
Ich warte draußen vor dem Kommandozelt und sende geistiges Rauschen aus, wie man es mir beigebracht hat. Meine Stiefel sind vom Schlamm verklebt, den ich durchwaten musste. Selbst jetzt, während ich hier in Habtachtstellung warte, stehe ich fünf Zentimeter tief darin, und wenn ich mich bewege, macht er schmatzende Geräusche. Von drinnen hört man die gedämpften Stimmen eines Mannes und einer Frau, die sich streiten. Die Frauenstimme klingt selbstsicherer, und ich kenne sie. Etwas raschelt, und ein Mann stürmt entweder heraus oder wird herausgeworfen. Stolpernd findet er sein Gleichgewicht wieder. Er rückt sein Hemd zurecht. Der Mann ähnelt mir, er ist schlank, leichtfüßig und lässt sich anscheinend gerade den Rekruten-Bürstenschnitt rauswachsen. Wie ich sendet er ein mentales Rauschen aus, und er entdeckt meinen Geist fast im selben Moment wie ich seinen, was mich ziemlich beeindruckt, weil er noch aufgewühlt von dem Streit ist. Wir sehen uns in die Augen.
Er nickt zum Gruß. »Hat Danladi dich ausgebildet?«, fragt er.
»Dreckskerl Danladi«, sage ich.
»Der Einzige von denen, der auch nur das geringste bisschen was taugt«, sagt er.
Hinter ihm leuchtet die Kuppel auf und knistert, angefangen beim Ganglion. Es ist windig, aber wegen der Regenfälle in letzter Zeit gibt es kaum Staub. Camp Rosewater existiert in zwei möglichen Formen: entweder als Staubsturm oder als Schlammbad. Wir beide bekommen eine Nase voll von der offenen Kanalisation ab. Ich spüre, wie er meinen Geist abtastet, neugierig, knapp an der Grenze zur Unhöflichkeit. Ich merke, dass er stärker ist als ich, und mache alle Verteidigungsschotten dicht.
Sein Gesichtsausdruck ändert sich nicht, aber er streckt mir eine Hand entgegen. »Kaaro«, sagt er.
»Eric«, sage ich.
»Rühren, Eric. Wo kommst du her?«
»Aus Lagos und Jo’burg.« Ich kann mein Haar noch so kurz tragen, die Leute merken, dass ich nur zu einer Hälfte schwarz bin. Manche versuchen, sich das zunutze zu machen, weil sie es als ein Zeichen von Privilegiertheit auffassen.
»Tja, Eric-aus-Lagos-und-Jo’burg, nimm dich in Acht. Sie ist gut in Form.«
Er geht ins Zwielicht davon und verliert sich bald in der Menge jenseits der Absperrung. Ich denke immer noch über ihn nach, als sie mich nach drinnen ruft.
Ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen soll, also sage ich einfach »Ma’am«. Sie stellt sich nicht vor, aber sie ist die Leiterin von Sektion 45. S45 ist eine Regierungsbehörde, die im Geheimen agiert. Sie untersteht direkt dem Präsidenten und kümmert sich mit ihrem Kader von Agenten, die es offiziell gar nicht gibt, um Außergewöhnliches. Leute wie ich werden von ihnen entweder als Raubtiere angestellt oder als Beutetiere zur Strecke gebracht. Angefangen hat die S45, indem sie falsche Hexen vor fundamentalistischen Kirchen gerettet hat, aber jetzt ist sie für allerlei seltsame Phänomene zuständig. Mein Gegenüber ist neu in ihrer Leitungsposition, aber sie verhält sich, als hätte sie sie von Geburt an inne. Ihre Pupillen und die Iris sind kohlrabenschwarz, und weil es schwer ist, ihrem Blick standzuhalten, wende ich ihn ab. Im Innern des Zelts ist es kühl und trocken. Ich bin auf Socken, weil sie darauf besteht, dass man seine Schuhe an der Tür lässt. Ihr Leibwächter ist gedrungen und hält sich zwei Schritte hinter ihr, die Hände vor seiner Jacke gefaltet, den Schlips zwischen ihnen.
»Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragt sie.
»Man hat mir gesagt, dass ich mich hier melden soll.«
Sie lächelt, aber ihr Mund bleibt geschlossen, und auch an ihrem Blick verändert sich nichts. »Sie müssen jemanden für mich neutralisieren.«
Sie trägt ihren Reichtum wie eine Waffe im Halfter, wie die Europäer früher Schwerter trugen, offensichtlich, aufdringlich, damit niemand, der sie sieht, ihre Stellung vergisst. Solche Übertreibung fällt in Camp Rosewater besonders auf und ist auch besonders effektiv in ihrer Wirkung auf weniger vom Schicksal begünstigte Untergebene. Wie zum Beispiel mich.
Ich weiß nicht, was sie meint. »Problem, Ma’am?«
»Kennen Sie Jack Jacques?«
»Nein, Ma’am.«
»Kennen Sie irgendwen in Rosewater?«
»Nein, Ma’am. Ich komme direkt von der Grundausbildung. Davor war ich in Lagos.«
Ich empfange keine Gedanken von ihr. Man hat mich dahingehend vorgewarnt. Die da oben genießen einen besonderen Schutz.
Sie sagt: »Jack Jacques ist ein Unruhestifter. Die meisten halten ihn für eine Lachnummer, aber ich erkenne, worauf er es abgesehen hat. Er muss aufgehalten werden. Der Präsident will, dass er aufgehalten wird.«
Ich denke, dass sie will, dass ich ihn festnehme, und nicke erfreut. Ich kann es nicht erwarten, S45 meinen Wert unter Beweis zu stellen. Ich werde ihre Befehle buchstabengetreu ausführen, schließlich handelt es sich um meine erste Mission. Ihr Leibwächter tritt vor und zeigt mir meine Befehle, komplett mit Präsidentensiegel, ein Dokument, das sowohl meinen Handabdruck als auch die unmittelbare Nähe meines Implantats erfordert, bevor es seinen Inhalt freigibt.
Das Erste, was ich sehe, ist ein glattes, faltenfreies Gesicht, ein Schwarzer, der direkt in die Kamera sieht, mit der Andeutung eines Lächelns um die Augen, wie bei einem Kind, das für das Passfoto ein Lachen unterdrückt. Jack Jacques sieht aus wie Mitte zwanzig und ist schön, beinahe feminin, wäre da nicht sein kantiges Kinn. Seine vollen Lippen gehören für mein Gefühl allerdings in ein Frauengesicht.
»Ich überlasse es Ihnen, sich mit den Einzelheiten vertraut zu machen«, sagt meine Einsatzleiterin. »Enttäuschen Sie mich nicht.«
Sie und ihr Leibwächter verlassen das Zelt auf der anderen Seite, während ich dort hinausgehe, wo ich eingetreten bin.
Wo ist deine Dienstwaffe?
In der Truppenunterkunft.
Gib sie beim Zeughaus ab. Du darfst bei dieser Mission keine offizielle Ausrüstung verwenden. Kannst du dir eine Waffe beschaffen?
Ich glaube nicht, dass ich eine Waffe abfeuern muss …
Eric, was glaubst du, worum es bei diesem Auftrag geht?
Ich kann ihn festnehmen, ohne …
»Festnehmen«?
Sie hat gesagt …
Wenn du unter »Festnehmen« nicht etwas weit Endgültigeres verstehst als ich, dann solltest du deine Befehle vielleicht noch mal sorgfältiger lesen.
Über Jack Jacques ist nicht besonders viel bekannt. Man geht davon aus, dass der Name ein Pseudonym ist. Er tauchte etwa einen Monat nach dem Erscheinen der Alien-Kuppel in Camp Rosewater auf. Der erste Aktenvermerk über ihn betrifft seine Festnahme durch ein paar Jungs von der Armee. Keine Vorwürfe. Anscheinend hat er bloß das Maul aufgerissen. Die ganze Sache ist ziemlich schlecht dokumentiert. An einer Stelle heißt es, dass er sich vierundzwanzig Stunden lang geweigert habe, seinen Namen zu nennen. Wenn ich zwischen den Zeilen lese, würde ich sagen, man hat ihn wohl gefoltert. Nach seiner Freilassung tauchen überall in der Umgebung der Kuppel Flugblätter auf, billig, schwarz-weiß und auf minderwertigem Papier.
Wie lange müssen wir eine Art zu leben erdulden, die der Rest von Nigeria und der Welt seit der Erfindung von Antibiotika hinter sich gelassen hat? Wir rufen die Bundesregierung dazu auf, uns Unterkünfte, öffentliche Transportmittel, Straßen, ein modernes Kanalisationssystem und vor allem Trinkwasser bereitzustellen.
Jack Jacques
Darunter ist die schlechte Kopie eines Fotos von Jacques in einem schlecht sitzenden Anzug zu sehen.
Hier taucht er als Unterzeichner einer Petition gegen das Verbot des Verzehrs außerirdischer Flora und Fauna auf. Hier haben wir die Aussage einer Informantin über eine Zusammenrottung von Unruhestiftern und Linken. Sie sagt, dass Jacques da war, kann aber nichts Genaues über seinen Anteil an der Sache berichten.
Keine Adresse, keine bekannten Kontaktpersonen.
Ich habe noch nie zuvor jemanden getötet, aber meine Arbeitgeber denken, dass ich es getan hätte, weshalb man für diese Mission auf mich zurückgreift. Wenn S45 eine Person rekrutieren will, dann stellen sie in ihrem engeren Freundeskreis Nachforschungen an. Ich weiß, wer mich verpetzt hat. Nur kann man es nicht verpetzen nennen, weil es eigentlich nichts zu petzen gibt. Als ich fünfzehn war, gab es einen Raubüberfall auf meine Familie zu Hause, und die Sache endete mit einem toten Einbrecher mit eingeschlagenem Schädel. Im Polizeibericht steht, dass ich ihm den Kopf mit einem Briefbeschwerer zertrümmert hätte, aber tatsächlich hat meine Schwester ihn versehentlich getötet. Eigentlich hatte sie ihn nur bewusstlos schlagen wollen. Weil meine Schwester eine Vorgeschichte hatte, kamen wir als Familie überein, dass ich die Sache auf meine Kappe nehmen sollte.
Ich rasiere mir den Kopf mit einer an einem Kamm befestigten Klinge. Mein Bürstenschnitt macht mich als Militär kenntlich, deshalb muss ich ihn loswerden. Mein Spiegel hängt an einer Schnur von einer Querstange in meinem Zelt. Er baumelt leicht hin und her, und ich bewege mich wie ein Boxer, um mein Spiegelbild im Blick zu behalten. Als ich fertig bin, wechsele ich die Kleider und trete ins Camp hinaus.
Kaum zu glauben, was da los ist. Es ist etwa vier Uhr nachmittags, und die Aasgeier stürzen sich auf die Marktbereiche und fressen die von den Schlachtern hinterlassenen ausgehöhlten Kadaver. Camp Rosewater besteht mehr oder weniger aus einem engen Ring von Buden rund um die Alien-Kuppel, mit Ausnahme der Stellen, an denen die elektrischen Pylonen, die Ganglien, als Türme aus außerirdischem Nervengewebe emporragen. Es ist ein Gewirr von Zelten, Holzschuppen, verrosteten Blech-Behelfslösungen und Unterständen. Die Wirtschaft basiert auf einer Mischung aus Tauschhandel um den gewöhnlichen nigerianischen Naira. Das Camp wächst mit jedem Tag … von überall treffen Leute ein. Die Neuankömmlinge suchen sich einfach ein Stück Land und bauen darauf. Es gibt ein oder zwei neue Betonbauwerke – Kirchen, Moscheen, Tempel, Waffenlager für die Militärs, die man hergeschickt hat, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Es gibt Mikro-Farmen, weil man in der unmittelbaren Umgebung der Kuppel praktisch alles überall anbauen kann. In meinem Zelt habe ich eine Eisblume, weil das Blumenmädchen, das sie mir verkauft hat, mir hartnäckig versicherte, dass sie mich vor Geistern schützen werde. Innerhalb von zwei Tagen hat sie drei magentafarbene Blüten ausgetrieben. Wenn man hier Saatkörner in den Schlamm wirft, dann wird innerhalb kürzester Zeit gesundes Getreide daraus, und Unkraut jäten ist ein Vollzeitjob.
Es gibt Bordelle, für weibliche Prostituierte ganz öffentlich, während man bei den männlichen Euphemismen wie »Sportcenter« verwendet.
Ich laufe in einem Strom langsam dahinfließender Pisse, in einer Gasse, die von den dicht stehenden Gebäuden verdunkelt wird. Tausend Gespräche erlangen in ihrer Kakofonie Anonymität. Meine Schuhe sind jetzt schon ruiniert, aber das sollen sie auch sein. Die Kleider sind abgetragen, aber in Ordnung, was bedeutet, dass man mich nirgends vor der Tür stehen lassen, aber auch nicht ausrauben wird.
Für den Anfang habe ich erst mal vor, mir eine Bierhalle zu suchen, aber ich finde etwas Besseres, einen Nachtclub.
Ich tanze nicht.
Auf meiner rechten Hand leuchtet noch der Türstempel, und sein durch das Glas dringender Schein lässt meinen Drink wie Lava aussehen. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Musik ist, aber ihre Grundzutat sind schwere Bässe. Die Tanzfläche ist voll. Wenn man reinkommt, trifft man als Erstes auf eine Reihe Kinder, die einem die Schuhe putzen, bevor der Druck der Menge einen auf die Tanzfläche befördert, einen Betonklotz, glatt gescheuert von unzähligen Schuhen. Am Eingang gibt es einen billigen Implantate-Scan, um die Cops auszusortieren, der meine Phantomidentität allerdings nicht enttarnt. In der Westecke steht ein gedrungener Geschützbot als Friedenswahrer.
Niemand hier denkt an Jack Jacques. Das herauszufinden verursacht mir Kopfschmerzen vom vielen Gedankenlesen. Ich ziehe dieselbe Nummer zwei Abende lang ab, bevor ich einen Treffer lande.
Es ist eine Erinnerung an Jacques, an ein Treffen mit ihm. Die Person befindet sich direkt vor dem Club, lehnt an der Wand. Ich stehe auf, um zu gehen, und stoße dabei mit jemandem zusammen. Ich spüre die Absicht, mir eine reinzuhauen, noch bevor ich mich entschuldigt habe. Ich achte darauf, nur ganz knapp auszuweichen, um nicht meine Ausbildung zu verraten. Der Schlag des tollpatschigen Affen verfehlt mich und trifft jemand anders. Ich trete ihm in die Fersen, und er fällt flach hin. In der Verwirrung schlüpfe ich rasch nach draußen.
Sie raucht, ist barfuß, trägt ein Kleid von unbestimmter Farbe und keine Schminke, und ihr geglättetes Haar hängt schlaff herab. Sie hört mich, hört meine Schritte, doch sie sieht mich nicht an. Ich habe Zigaretten dabei, die ich für einen solchen Fall einzeln hier drinnen gekauft habe. Ich rauche nicht, aber ich weiß, wie es geht, also zünde ich mir eine an. Im Schein ihres Zigarettenendes sehe ich, dass sie den Blick zu Boden gerichtet hält, obwohl wir an der gleichen Wand lehnen, das Vibrieren der Musik und die von Dutzenden Leibern abgestrahlte Hitze spüren.
»Ich bin nicht im Dienst«, sagt sie. I no dey duty.
Ich nicke und ziehe an meiner Zigarette.
»Und ich bin bewaffnet.«
Ich betrachte ihr hautenges Kleid und frage mich, wo sie die Waffe versteckt hat. Ich lese die Bedrohung, als die sie mich empfindet, als Spiegelung realer Gewalt in ihrem Leben und dem Leben von Frauen, die sie kennt und von denen sie gehört hat. Ich achte auf eine möglichst wenig bedrohliche Körpersprache. Im Moment denkt sie nicht an Jacques.
»Wahrscheinlich sollte ich weggehen und mir einen runterholen«, sage ich.
Es funktioniert, sie erinnert sich.
Ich erhalte meinen ersten Eindruck davon, wie Jacques im normalen Leben aussieht und klingt. In der Erinnerung, die ich stehle, trägt er einen weißen Anzug. Sein Kopf berührt beinahe die Decke ihrer Liebesbude, was mir verrät, dass er ziemlich groß ist. Er trägt einen schwarzen Schlips und einen Hut – einen eselsohrigen Hut, einen Abeti Aja, wie ihn die Yoruba tragen. Er scheint sich kein bisschen unbehaglich zu fühlen und macht trotz des Schmutzes, der ihn umgibt, einen irgendwie sauberen Eindruck.
»Haste Ziga für mich?«, fragt die Frau. Sie ist mit ihrer fertig und streckt die Hand aus. Ich gebe ihr eine. Durch den Ärmel ihres Kleids sehe ich ein Stück von einer Tätowierung. Es wird sich wohl um den Namen und das Heimatdorf ihrer Mutter handeln. Hier werden Leute vergewaltigt und ermordet, und selbst mit Implantaten ist es nicht immer leicht, die nächsten Angehörigen ausfindig zu machen, deshalb holen die Frauen in Camp Rosewater sich Tätowierungen.
Die Erinnerung an Jacques spult sich erneut ab. Sie findet ihn attraktiv und ist froh, dass er gut riecht. Die Erinnerung springt zurück, und für eine Millisekunde sieht sie mich in dem weißen Anzug und Hut, bevor die Gestalt sich wieder in Jacques verwandelt.
Jacques sagt: Zieh dich aus.
Sie sagt: Wie willst du? Vorne oder hinten?
Jacques sagt: Ich will, dass du auf dem Bett auf und ab wippst und stöhnst, als würde ich dich echt hart ficken. Dann bezahle ich dir das Doppelte. Außerdem erzählst du allen, dass wir gefickt haben, insbesondere den jungen Männern in meiner Begleitung. Kannst du das?
Sie kann es, und sie tut es.
Am nächsten Tag brennt nicht weit von meinem Zelt ein Laster.
Ich schlafe unruhig. Wenn man die Erinnerungen eines anderen Menschen in sich aufnimmt, suchen sie sich einen Platz zwischen den eigenen. Der Verstand weiß, dass sie fremd sind, und will sie abstoßen. Wenn das nicht gelingt, spielt er die Erinnerungen immer wieder ab in dem Versuch, sie einzuordnen. Deshalb lese ich so ungern im Gedächtnis anderer Menschen, und ich bin bin froh, dass ich bei der S45 ein Unterdrückungstraining erhalten habe. Ich sehe jetzt weitere Einzelheiten der Szene, zum Beispiel seine kurzen Fingernägel, seine aufgeschürften Knöchel, den krummen Eckzahn, die Delle in seiner Hose, die vermuten lässt, dass er erregt war, aber sich am Riemen gerissen hat. Bei einem Durchlauf der Erinnerung hört er auf zu reden und sieht mich an.
»Ich sehe dich, Eric«, sagt er. »Ich werde bereit sein, wenn du kommst.«
Dann explodieren seine Augen und er kotzt. Ich erwache.
Mein Zelt ist voller Rauch von dem brennenden Laster. Ein paar junge Männer haben versucht, nachts in den Randgebieten Giftmüll zu verklappen, aber man hat sie geschnappt, kurz nachdem der grüne Schlick im Erdreich versickert ist. Sie sind entkommen, aber ihr Laster nicht. Ich hoffe, dass ich von dieser Mission keinen Krebs kriege.
Ich beginne, nach Rückständen von Imformationen zu suchen. Was ich da mache, ist keine Magie, kein mystischer Blödsinn. Die Aliens haben zu ihren eigenen Zwecken Informationen in der Atmosphäre eingefangen. Das haben sie bewerkstelligt, indem sie ein Netzwerk miteinander verbundener künstlicher Zellen, die Xenoformen, über den Planeten verteilt und so einen Weltgeist namens Xenosphäre erschaffen haben. Ich und ein paar andere Leute können auf diese Daten zugreifen, und deshalb hat S45 mich rekrutiert. Es ist ein nützliches Talent, vor allem, wenn man Menschen sucht. Das Alien-Feld ist mit den Geistern der Menschen vernetzt, und das Datenmaterial kann in beide Richtungen fließen, weil Xenoformen nicht nur untereinander in Verbindung treten. Sie docken auch an menschliche Hautrezeptoren an und erhalten auf diese Art Zugriff auf das Gehirn, aus dem sie behutsam Informationen extrahieren. Ich fange früh an. Ich will herausfinden, wo diese Prostituierte arbeitet. Dort werde ich mich postieren und warten, bis Jacques auftaucht. Ich gehe umher, bis ich jemanden hinter mir höre, der ein Déjà-vu-Erlebnis hat. Menschen in meiner Branche grenzen sich auf einem ganz anderen Niveau innerlich ab. Wie sollten wir sonst merken, was unsere echten Déjà-vus sind und welche von geliehenen Erinnerungen herrühren?
Ich höre ihn, und zwar nicht mit den Ohren. So laut wie er denkt, wird er wohl kaum davon ausgehen, dass ich ein Agent bin. Als ich mich in der Gasse umdrehe, um ihn anzusehen, spüre ich seinen Kameraden hervortreten, der den anderen Weg versperrt.
»Was wollt ihr?«, sage ich. »Ich hab keine Waffe.«
»Neuling, du kannst hier nicht einfach reinspazieren und keine Gebühr zahlen«, sagt der Mann hinter mir.
Klar. Der hiesige Obermotz will mich abkassieren. Das dürfte hier in der Gegend Kehinde sein. Taiwo, sein Zwillingsbruder, hat auf der anderen Seite der Kuppel das Sagen. Laut den Berichten sind beide skrupellos und hassen einander. Man erzählt sich von einem Friedensgipfel zwischen ihren beiden Organisationen, der mit einem Kampf endete, bei dem die beiden sich über Stunden, ohne ein Wort zu sagen, mit den Fäusten traktierten, bis sie völlig erschöpft waren. Laut der urbanen Legende haben sie von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten gekämpft. Der S45-Informant hat gesagt, dass es Stunden waren, ohne Pause. Als der Kampf vorbei war, hatten beide völlig verwüstete Gesichter und aufgerissene Knöchel.
»Sagt mal«, antworte ich, »kennt wer von euch Jack Jacques?«
»Du passt hier nicht her«, sagt Kehinde.
Es ist seltsam. Ich hatte mit einer Art Karikatur eines Paten gerechnet, aber Kehinde sieht ganz normal aus. Er trägt ein Boxershirt und zerschlissene Jeans und die Sorte Stiefel ohne Marke, die die besseren Bewohner Rosewaters tragen. Ein bisschen weich am Bauch, aber ich würde sagen, dass er über fünfundvierzig ist, von daher lasse ich ihm das durchgehen.
Ich weiß, dass ich nicht hierher passe. Das Camp zieht Verzweifelte, Kranke und Kriminelle an. Die Kranken, weil die Kuppel bei ihrer Öffnung Menschen heilt, was sie sofort zu einer Art Mischung aus Mekka und Lourdes gemacht hat. Die Verzweifelten sind diejenigen, die nirgendwohin sonst können. Bettelarme, Verstoßene, religiöse Extremisten, all der Scheiß. Kriminelle brauchen keine besondere Einladung, sie sind überall. Ich bin nicht krank, verzweifelt oder kriminell. Das merken sie mir an.
»Ich bin auf der Suche nach Jack Jacques. Ich habe seine Flugblätter über Gleichheit gesehen. Ich will helfen.«
Sie fangen alle an zu lachen, aber meine Naivität löst eine geteilte Erinnerung aus. Jacques und Kehinde und andere im Hintergrund, in ebendiesem Zimmer.
Wir haben hier eine Gelegenheit. Das hier ist eine neue Gesellschaft, ein neuer Anfang. Ich will etwas daraus machen, dem Chaos Einhalt gebieten, ein Leuchtfeuer für den Rest des Landes sein, Teufel auch, für den Rest der Welt!
Er trägt einen cremefarbenen Anzug. In meinem Kopf flackert etwas auf, und der Anzug wird weiß wie in der Erinnerung der Prostituierten.
Kehinde lacht. Und welchen Platz gibt es für mich in diesem Garten Eden? Welche Rolle haben Männer, die nicht fügsam sind?
Jacques beugt sich vor. Wenn man einen Garten anlegen will, fängt man mit einem Saatkorn an, und das bin ich. Dann braucht man Dünger, das bist du. Mist riecht nicht besonders gut, aber er wird gebraucht.
Ich spüre, wie Kehinde sich innerlich sträubt, aber letztendlich ist er seiner Meinung. Jungs, der Kerl hat mich gerade auf die denkbar freundlichste Art ein Stück Scheiße genannt.
Das Gelächter hallt aus der Vergangenheit wider und mischt sich mit dem in der Gegenwart.
Ich weiß, dass ich meine Befehle nicht infrage stellen soll, aber ich wüsste doch gerne, was falsch daran sein soll, es diesen Kerl, diesen Jacques, mit seinen Ideen versuchen zu lassen. Kriminelle Elemente wird es immer geben, warum sie also nicht für hehre Ziele einspannen? Warum wollen wir – warum will ich – ihn töten?
Man sagt mir, dass ich warten soll, bis Jacques’ Assistentin sich mit mir in Verbindung setzt. In der Zwischenzeit beschäftige ich mich damit, Gräben auszuheben. Dreckskerl Danladi hat mir gesagt, dass es am besten ist, einfache körperliche Arbeiten zu verrichten, wenn man Undercover ist. »Das hält einen fit, und man kann dabei nachdenken.« Damit hat er nur halb recht. Meine Muskeln werden innerhalb von nicht einmal einer Woche härter, aber die Lieder, mit denen wir den Takt halten, haben eine hypnotische Wirkung und lullen mich in einen Zustand des Nichtdenkens, in dem ich die schlüpfrigen Geschichten, die die Männer einander erzählen, passiv in mich aufnehme. Ich werde hier keine davon wiederholen. An den Abenden trinken wir Fusel und Burukutu, alles in den besten Badezimmerdestillen hergestellt.
Ich stütze mich gerade auf eine Spitzhacke und warte, bis das Wasser in dem von uns ausgehobenen Graben abläuft, als eine Frau zu mir kommt. Sie ist eine Leerstelle, im Sinne von: Ich empfange keine Gedanken von ihr. Das kommt manchmal vor. Manche Menschen sind gegen die außerirdischen Sporen resistent, während andere, wie meine Vorgesetzten, über Gegenmaßnahmen verfügen. Immer wieder spielen Kinder im Wasser, die unser nomineller Vorarbeiter wegscheuchen muss.
Sie hält am Rande des Grabens inne und blickt auf mich herunter. »Du bist Eric?«
»Ja.«
»Was erhoffst du dir von Mr. Jacques?«
»Ich will mit ihm zusammenarbeiten.«
»Er hat kein Geld für dich.«
Ich zucke mit den Schultern.
Sie betrachtet mich, als begutachtete sie einen Wels, um festzustellen, ob er frisch ist, und schüttelt dann den Kopf.
»Nein. Ich mag dich nicht. Geh dorthin zurück, wo du hergekommen bist.« Sie wendet sich zum Gehen, aber ich packe sie am Knöchel.
»Warten Sie«, sage ich.
»Nimm deine Hand weg.«
»Ich möchte wirklich seine Vision von …«
»Verpiss dich.«
Sie reißt sich los und geht.
Sie hat gute Instinkte. Ich hätte gieriger auftreten sollen. In Nigeria glaubt niemand an Idealismus, nicht mal in den fundamentalistischen Kirchen. Darum wird Jacques letztendlich getötet werden. Vielleicht.
Ich beobachte Kehindes Zuhause mit den Augen und mit meinen Gedanken, in der Hoffnung, dass Jacques auftaucht. Ich mache nichts, außer Gräben auszuheben, wasche mich und esse noch an der Baustelle, um dann herzukommen und zu warten. Am einundfünfzigsten Tag bin ich so drahtig, als hätte ich mein ganzes Leben lang hier geackert, als Jacques plötzlich mit solcher Intensität in das außerirdische Gedankenfeld einbricht, dass ich denke, er wäre persönlich aufgetaucht. Was er nicht ist.
Es ist Abend. Das verrostete Eisenblech, auf dem ich sitze, wärmt mir mit der Hitze der letzten Sonne den Arsch. Ich sehe, wie Jacques’ Assistentin mit Kehinde in einen Jeep steigt. Sie werden sich mit ihm treffen, und ich habe kein Fahrzeug, mit dem ich ihnen folgen könnte. Instinktiv springe ich von Dach zu Dach, um den Jeep nicht aus den Augen zu verlieren. Ich laufe nicht Parkour, ich stolpere herum und improvisiere, bewege mich vorwärts, indem ich beinahe falle, eine fast schon paralysierende Erfahrung, erhellt vom grünen Schein der Kuppel. Ich ignoriere die Flüche der Verschlagbewohner, an deren Dächern ich mich vergreife, und mindestens einmal breche ich mit dem rechten Fuß durch. Als der Jeep anhält, begreife ich, dass er nicht zu einem Treffen unterwegs ist. Sondern zu einem Kampf. Ein Kämpfer trägt einen als »Laterne« bekannten Alien wie einen Heiligenschein um den Kopf, der andere einen »Homunkulus«. Interessante Wahl. Alien-verstärkte Kämpfer. Gibt’s nur in Rosewater.
Der Homunkulus ist ein von neurotoxischem Schmiermittel überzogenes Schwarmbewusstsein-Säugetier. Er sieht aus wie ein ungewöhnlich kleiner, haarloser Mensch mit glitzernden Augen. Wenn man ihn von seiner Herde trennt, dann hängt er sich an das nächstbeste Säugetier ran. Das Neurotoxin hat keine Wirkung auf das Lebewesen, an den es sich heftet, weshalb dem Kämpfer keine Gefahr von ihm droht. Bei seinem Gegner sieht das anders aus. Die andere Sorte von Aliens, die um den Kopf des Kämpfers, gleicht einer chinesischen Himmelslaterne und stößt psychedelische Wolken aus. Das dürfte entweder ein interessanter, langer Kampf oder ein kurzer, brutaler werden. Ich sehe mich nach Jacques um, aber die Mühe hätte ich mir nicht machen müssen. Er tritt in den Ring, bevor der Kampf losgeht, und hält eine kurze Rede. Ich springe vom Dach und bewege mich auf den Ring zu. Die Waffe in meinem Hosenbund fühlt sich schwer und heiß an. Ich stoße Leute aus dem Weg und besänftige ihre Gedanken – ich will nicht abgelenkt werden. Ich habe eine klare Sichtlinie und bin etwa dreißig Meter weit vom Ziel entfernt. Ich …
Alles erstarrt.
Die Geräusche ersterben, der Wind legt sich, die Menschen verharren bewegungslos, und mehr als das, sie denken auch nicht mehr. Über mir schwebt ein Greif. Ein Greif – Adlerkopf, Adlerschwingen, Löwenkörper –, das Geschöpf aus Legenden. Warum sehe ich einen Greifen? Er senkt sich herab, kratzt sich mit seinem Schnabel und dreht dann den Kopf zur Seite, um mich mit einem Auge zu betrachten. Sein Blick kommt mir vertraut vor.
»Ah, ja. Eric-aus-Lagos-und Jo’burg. Eric, tja, wenn du das hier siehst, dann hast du Jack Jacques gefunden, was leider bedeutet, dass dein Leben in Gefahr ist und dir nur Minuten zum Handeln bleiben.«
»Was machst du …«
»In deinem Kopf? Ich bin nicht in deinem Kopf. Zumindest nicht im Moment. Ich war dort, und das hier ist … eine Art Nachricht, die ich dir hinterlassen habe, damit sie unter genau diesen Umständen aufgerufen wird.«
»Aber ich habe dich bei dem Versuch einzudringen aufgehalten.« Er ist es, der Rekrut mit dem Bürstenschnitt, dem ich begegnet bin, als ich mich zum Dienst gemeldet habe. Kaaro.
»Ach ja. Wie lustig. Nein, das hast du nicht. Ich habe dich nur in dem Glauben gelassen. Wir haben keine Zeit für diesen Kram, Eric. Du bist nicht der Killer.«
»Bin ich nicht?«
»Nein. Du hast nicht das richtige Temperament. Deine Fähigkeiten sind rundum gut, und wenn du dich verteidigen müsstest, könntest du wahrscheinlich töten, aber du wirst nicht ohne Provokation jemanden abknallen.«
»Du hast doch …«
»Deine Akte gelesen, ja. Halt den Mund und hör zu. Deine wahre Aufgabe bestand lediglich darin, Jacques zu orten. Das hast du. Super. Gut gemacht. Oku ise. Die nächste Phase besteht darin, ihn zu töten.«
»Du meintest doch, ich sei nicht der Killer.«
»Die nächste Phase für S45, nicht für dich.«
»Und was mache ich …«
»Was du machst? Tja, du stirbst zusammen mit Jacques. Sie wollen dein Implantat als Zielmarkierung verwenden. Ein Killerkommando steht bereit. Ich wette, dass es bereits unterwegs ist. Ich weiß das, weil ich die Aufgabe hatte, ihnen das Signal zu geben, und das habe ich auch brav gemacht.«
»Dann muss ich …«
»Nein, was auch immer du dir vorstellst, nein. Selbst wenn du dem Team entwischen könntest, Plan B ist eine Drohne, die bereitsteht. Killerkommando versagt, Drohne schießt Rakete mit einem Radius von 100 bis 150 Meter ab. Bumm. Frag mich nicht, wie Plan C aussieht. Sie sind für alle Fälle gerüstet, Eric. Mehr musst du nicht wissen.«
»Warum erzählst du mir das, wenn sowieso alles hoffnungslos ist?«
»Ich habe nicht gesagt, dass alles hoffnungslos ist. Alle Szenarien basieren darauf, dass dein Implantat funktioniert. Schalte das Implantat ab, dann hast du vielleicht eine Chance zu entkommen.«
»Ich weiß nicht, wie man …«
»Dämlicher Scheißkerl. Du sitzt mitten im Bau eines Kriminellen. Meinst du nicht, dass man da die Möglichkeit braucht, Implantate zu hacken? Viel Glück, Bruder. Wenn du es schaffst, schau mal bei mir vorbei. Oder nein, lieber nicht. Ich will keinen Ärger.«
Die Welt setzt sich wieder in Bewegung. Jacques redet sich gerade darüber in Rage, dass die Bundesregierung in ihrem Haushalt nicht einmal Rosewaters Existenz anerkennen will. Ich wechsele die Richtung und entdecke seine Assistentin. Sie reißt die Augen auf, als sie mich bemerkt, und kneift sie dann zusammen.
»Ich habe dir doch gesagt …«
»Sie müssen mich so schnell wie möglich so weit weg von Ihrem Chef bringen wie möglich. Und mein Implantat muss dringend gehackt werden. Sofort.«
»Was …?«
»Leben stehen auf dem Spiel. Ihres eingeschlossen.« Ich bohre ihr meine Waffe in die Seite.
Sie ist nicht besonders beeindruckt, sagt aber: »Na schön, komm mit.«
Wir sind nicht weit vom größten Ganglion entfernt. Der Techniktyp sagt, dass es ein EM-Feld ausstrahlt, das die Zielverfolgung stört. Ich widerspreche nicht – ich sehe es in seinem Vorderhirn. In solcher Nähe empfinde ich eine gewisse Unruhe. Das Nervenende eines riesigen außerirdischen Wesens ist etwas Furchteinflößendes, nicht zuletzt, weil bekannt ist, dass in seiner Nähe immer mal wieder Leute durch zufällige elektrische Entladungen getötet werden. Der Kerl findet meine falsche Identität und die echte, die sich ebenfalls aufspüren lässt, wenn man weiß, wonach man sucht. Er packt Fälschungen von beidem auf ein umgewidmetes Cyborg-Überwachungstier, einen COB-Falken, und lässt ihn frei.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagt er. »Jetzt bist du niemand.«
Ich schüttele den Kopf. »Die Hardware ist immer noch drin. Das bedeutet maximal vierundzwanzig Stunden Freiheit.«
Ich sehe dem davonfliegenden Falken nach, der im Gegensatz zu mir frei ist.
»Ich wusste, dass du es nicht ehrlich meinst«, sagt die Assistentin.
»Hören Sie, er ist außer Gefahr. Darauf kommt es doch an, oder?«
»Was hast du jetzt vor?«
»Ich sitze hier rum und warte, bis man mich festnimmt.«
»Das muss nicht sein. Das Camp ist voller Flüchtlinge, die einen neuen Anfang machen wollen, und Jack könnte jemanden mit einer S45-Ausbildung gebrauchen.«
»Ich habe gerade versucht, ihn zu töten.«
»Nein, hast du nicht. Selbst wenn du die Waffe gezogen hättest, und übrigens hätten Kehindes Jungs dich durchsiebt, bezweifle ich, dass du abgedrückt hättest. Du hast anscheinend ein Gewissen.«
Ich will gerade antworten, da höre ich ein lautes, kurzes Pfeifen. Ich weiß, was es ist, bevor ich den Knall höre und mir die Finger in die Ohren stecke. Drohnenangriff, Kompressionsbombe. Ich sehe die Spur und dass sie zum Kampfplatz führt.
Die Assistentin und ich sind auf den Beinen und rennen dorthin zurück, wo wir hergekommen sind.
Verstümmelte Leichen, überall Körperteile, Blut, das sich mit dem Schlamm zu rosafarbenem Schaum vermischt, bis auf fünfzig Meter in jede Richtung eingeebnete Gebäude, ein Durcheinander von Trümmern und organischer Materie. Der Ring ist ausgelöscht, die Kämpfer verschwunden. Kein Krater, keine Feuer. Kompressionsbomben hinterlassen nichts Derartiges. Im Prinzip sind sie Portale zu einem Vakuum, die Materie einsaugen und dann den Strom umkehren und mit rasender Geschwindigkeit Materie versprühen. Die Knochen der Opfer werden zu Schrapnell.
Das ist meine Schuld. Zweifellos hat man mich per Telemetrie verfolgt und ein paar Berechnungen angestellt. Oder vielleicht hat Kaaro mich auch bezüglich des Killerkommandos angelogen. Wer weiß? Es wird Wochen dauern, all die Leichen zu sortieren.
»Ist er das?«, höre ich hinter mir.
Ich weiß, dass es Jacques ist, noch bevor ich mich umdrehe. Ich weiß sogar, dass er zuschlagen wird, aber ich ducke mich nicht weg. Er hat einen ganz schönen Schlag am Leibe, und ich kann einiges wegstecken. Nach etwa zehn Minuten hat er sich ausgeboxt, ohne mir dabei etwas zu brechen. Ich nehme die Schläge hin, weil ich bestraft werden will. Diese Menschen sind wegen mir tot.
Mit meinem Blut auf dem Anzug steht er über mir, schwer atmend, in den Augen den Zorn Gottes, während seine Assistentin an seinem Ärmel zupft.
Sie lassen mich liegen und gehen.
Ich öffne meine Zeltklappe, und dahinter ist alles voll von Blättern; die Eisblume ist gewachsen und erfüllt nun den gesamten Innenraum. Ich leihe mir eine Machete und schwinge sie hin und her, bis ich an meine Sachen komme. Dann gebe ich das Signal zur Extraktion.
Insgesamt gab es 48 Tote und etwa 100 Verletzte. Ich verbringe Zeit im Arrest, werde vor ein Geheimgericht gestellt und entlassen, nachdem ich meine Strafe abgesessen habe, darf von nun an aber nur noch Schreibtischarbeit machen. Ich halte mich auf dem Laufenden. Jacques lebt noch, er ist jetzt zu präsent in der allgemeinen Wahrnehmung, um ihn umzubringen, auch wenn einen das in Nigeria nicht unbedingt schützt.
Ich arbeite in einer Außenstelle in Lagos, am Arsch, und mache Jagd auf Pastoren, die Hexen umbringen. Ich habe gehört, dass Kaaro noch immer tief in Rosewater drinsteckt.
Ich beneide ihn nicht.
KAPITEL 1
Rosewater: 2067
ALYSSA
Ich bin.
Ich schreibe das hier für euch nieder, damit ihr die Hoffnungslosigkeit eurer Lage versteht.
Ich habe die Zukunft meiner Unternehmung bereits gesehen, und ich vollende meine Mission auf Kosten eures Überlebens. Ich gewinne.
Wenn ihr mich jetzt in diesem Moment sehen könntet, würde ich einer Spinne ähneln, obwohl ich viel, viel mehr Beine habe. Hunderte. Stellt euch eine Spinne mit Hunderten und Aberhunderten von Beinen vor, vielleicht sogar mit Tausenden, vielleicht sogar noch mehr. Die Zahl meiner Beine ist potenziell unbegrenzt. Jedes davon berührt genau eine Zelle. Wenn du lebst und das hier liest, dann berühre ich deine Zellen.
Während ich das hier schreibe, habe ich keinen Namen. In Wahrheit lebe ich nicht im gleichen Sinne wie ihr, aber das wird euch später noch deutlicher werden. Und ich schreibe das hier auch nicht auf die herkömmliche Art, sondern in Form wechselnder Kombinationen neuronaler Übertragungen. In der Zukunft werde ich viele Namen annehmen. Weil meine Visionen von der Zukunft mir verraten, dass Namen Menschen dabei helfen, Dinge zu erfassen, die sie nicht verstehen, nenne ich dir einen Namen, mit dem du mich ansprechen kannst.
Molara.
Ich bin ein Ernteprogramm, und meine Aufgabe besteht darin, zu sammeln. Erst sammle ich meine eigenen Zellen und verbinde sie miteinander. Ich weiß, ich weiß, wenn ich Zellen habe, dann muss ich auch leben. Nein. Meine Zellen wurden von intelligenten Wesenheiten, die euch unbekannt sind, konstruiert. Wenn ich genug Zellen angesammelt habe, baue ich mein Netz, wie eine Spinne. Das tue ich während der Wartezeit. Das, worauf ich warte, lebt wahrhaft, in eurem Sinne, trifft aber vielleicht nie ein. Ich muss darauf warten, bis ich sterbe.
Ich kann für sehr lange Zeit nicht sterben. Es bräuchte Millionen von euren Jahren dazu. Aller Wahrscheinlichkeit nach werdet ihr vor mir sterben. Im Gegensatz zu euch bin ich gut konstruiert.
Ich fange mit einigen wenigen Zellen an, die die Verstreuung überlebt haben. Zwei Zellen, die zusammenkleben, eine dominant, eine passiv, eine zum Kopf erklärt und eine zum Bein. Das Bein streckt sich wie eine Faser, findet mehr Zellen und verbindet sie mit dem Kopf. Wenn ich die kritische Masse von fünf Milliarden Zellen erreiche, entwickle ich ein Bewusstsein.
Ich denke; ich bin.
Ich fange an, das hier für euch zu schreiben.
Ihr seid noch nicht hier. Die Atmosphäre ist voller Schwefel, und obwohl einige Dinge, einige lebendige Dinge, unter den weiten Wassern brodeln, funktionieren meine Zellen in diesem Medium nicht gut. Ich versuche es trotzdem, aber es gibt keine nennenswerte Intelligenz, mit der ich in Verbindung treten könnte.
Ich warte.
Zeit vergeht, ein weiterer geimpfter Meteor mit mehr Zellen trifft ein, aber es sind nicht genug. Was ihr die kambrische Explosion nennt, hält mich beschäftigt. Ihr kriecht aus dem Meer und an Land. Ich stelle euch auf die Probe, aber ihr seid nicht bereit. Als ein Felsbrocken sich durch die Atmosphäre brennt und die Riesengeschöpfe tötet, werde ich verwundet, aber ich bin widerstandsfähig. Ich wachse nach und stelle als Nächstes die pelzigen kleinen Tiere, die die Makrobiosphäre von da an beherrschen, auf die Probe. Sie sind nicht bereit. Sie laufen erst auf vier, dann auf zwei Beinen. Sie verzweigen sich und bilden Gemeinschaften in Bäumen und an Land. Sie verwenden Werkzeuge. Langsam kommen sie der Sache näher. Der Gebrauch von Werkzeugen ändert die Lage, und die spezialisierten Hirnlappen drängen die Natur zu immer größerer Komplexität. Die Hand und der Daumen werden an der Handfläche gegeneinander gestellt. Eine Art Mensch wird geboren. Ich fange mit meiner Arbeit an.
Sich mit den Nervenenden der Haut verbinden, über sie Zugriff auf das zentrale Nervensystem erlangen, Informationen extrahieren, abgleichen und nach Hause in die obere Atmosphäre schicken. Das tue ich, während der Homo sapiens das Sprechen lernt. Nachdem sie Anweisungen von zu Hause erhalten haben, erteilen meine Schöpfer mir Anweisung, die menschlichen Zellen nun nach und nach durch unsere künstlich hergestellten zu ersetzen. Das funktioniert nicht komplikationsfrei. Ein gewisser Prozentsatz von euch erlangt dadurch die Fähigkeit, auf das Informationsnetzwerk zuzugreifen und zu sehen, was ich sehe, in Gedanken hinein und manchmal in die Zukunft. Ihr bezeichnet sie als empfänglich oder als Empfänger. Das darf nicht sein, deshalb töte ich den Anteil von einem Prozent, der diese Fähigkeit entwickelt, immer wieder ab, aber nur nach und nach, damit es niemandem auffällt.
Glaubt bloß nicht, das hier wäre das erste Mal.
In der Geschichte eures Planeten haben immer wieder die einen Organismen die anderen geschluckt. Euer Dasein beweist das. Ihr seid nur hier, weil ein Bakterium ein anderes geschluckt hat. Was ihr als »Menschen« bezeichnet, ist nichts weiter als ein umherlaufendes Nährmedium für Bakterien. Der menschliche Körper enthält mehr Bakterienzellen als Menschenzellen.
Also, leistet keinen Widerstand, geratet nicht in Panik. Es wird nicht wehtun, und wir werden euch sanft hinübergeleiten. Ihr vergeudet eure Menschlichkeit ohnehin, verteilt achtlos euren Samen, schießt eure DNA nach dem Zufallsprinzip heraus, wie Abfall. Im Großen und Ganzen werdet ihr die Gleichen bleiben. Ihr werdet genauso aussehen, und wer weiß? Vielleicht bewahrt ihr euch sogar ein gewisses Maß an Bewusstsein. Ihr werdet nur nicht mehr am Steuer sitzen.
Werdet zu mir.
Und werdet dann zu uns.
Alyssa.
Als Alyssa erwacht, weiß sie ihren Namen, aber nicht viel mehr. Sobald sie die Augen öffnet, macht ihr Herz einen Satz und schlägt schneller, und ihr Atem kommt in raschen, kurzen Stößen. Vollkommen panisch setzt sie sich auf. Ein Traum verblasst in ihrer Erinnerung, nebelhafte Bilder, die sie foppen, Geräusche und Ideen, die sie nicht zu fassen bekommt, bedeutungsvolle Worte, verloren.
Sie zieht die zerknitterte Decke an sich und quiekt, als sie sieht, was darunter zum Vorschein kommt. Ein Mann liegt auf dem Bett, das Gesicht von ihr abgewandt, in Pyjamahosen. Sie weicht so weit zurück, dass sie von ihrer Bettseite rutscht und auf dem Teppich landet. Nichts kommt ihr vertraut vor.
Sie befindet sich in einem Schlafzimmer, mit einem Fenster direkt über dem Bett, durch dessen Vorhänge das Licht der Morgendämmerung hereinfällt. In der Ecke gegenüber der Tür steht ein Lesesessel, auf beiden Seiten befinden sich Nachttische mit Leselampen und einem Stapel Taschenbücher auf ihrer Seite, einem Magazin auf seiner. Da sind gerahmte Fotos an jeder Wand, eine angelehnte Badezimmertür und gegenüber vom Fenster ein Set Einbauschränke mit einer offenen Schranktür, an der ein Kleid hängt. Auf dem Teppich liegen eine blaue Socke und zwei nicht zusammenpassende Hausschuhe. Das Zimmer ist nicht aufgeräumt, aber auch nicht unordentlich. Hier leben Menschen, es wird bewohnt, aber es ist Alyssa unvertraut, und sie kauert sich dicht neben das Bett, an die Wand.
Wo bin ich?
Der Mann atmet und schnauft dann und wann. Die Decke hebt und senkt sich, als wäre auch sie lebendig. Der Rücken des Mannes ist flaumig von blondem Haar. Alyssa weiß, dass sie nicht das Gedächtnis verloren hat, weil sie sich an das Wort »Gedächtnis« erinnert.
»Gedächtnis«, sagt sie, nur um das Wort zu hören, doch selbst ihre eigene Stimme klingt unvertraut.
Sie spürt die harte, kalte Wand in ihrem Rücken, die Teppichfasern, den Menschengeruch im Zimmer, der sich aus Resten von Parfüm, Rasierwasser, verstohlenen Fürzen, sexuellen Körperflüssigkeiten und miefigen Schuhen zusammensetzt. Sie weiß, was all das ist. Sie begutachtet ihre Arme und Beine. Ehering, Verlobungsring. Keine Schnitte oder Blutergüsse. Keine Spuren von Fesseln. Die Nägel könnten mal gemacht werden. Sie zieht ihr Nachthemd hoch, untersucht ihren Bauch, ihre Brust. Keine erkennbaren Probleme. Sie fühlt sich nicht benommen oder als wäre sie betrunken. Genau genommen fühlt sie sich bemerkenswert klar im Kopf, abgesehen davon, dass das Einzige, woran sie sich erinnern kann, ihr Name ist.
Sie steht auf und schiebt sich auf Zehenspitzen um das Bett herum, den Blick auf die schlafende Gestalt darauf geheftet. Er wacht nicht auf. Ein Stück weiter, dann erkennt sie sein Gesicht. Es sieht durchaus angenehm aus, und sie wartet darauf, dass etwas in ihr ihn plötzlich erkennt und alles in Ordnung ist, aber nichts erkennt ihn, und nichts ist in Ordnung. Sie erhascht einen Blick auf den Ehering an seiner linken Hand. Ist er ihr Mann? Sie betrachtet die gerahmten Bilder.
Das, das am nächsten am Fenster hängt, zeigt sie und den schlafenden Mann. Sie sieht, wie ihr Gesicht sich im Glas spiegelt und das Foto überlagert. Das Gesicht mag ihr unvertraut sein, aber das Spiegelbild und das Foto zeigen dieselbe Frau. Sowohl Alyssa als auch der Mann lachen auf dem Bild. Er hat der Kamera das Profil zugewandt und den Mund in ihrem langen, dichten Haar. Als sie sich über den Kopf streicht, stellt sie fest, dass ihr Haar kürzer ist. Die beiden sind irgendwo draußen, es ist sonnig, und im Hintergrund sieht man schneebedeckte Berge. Sie erinnert sich nicht an diese Szene.
Das zweite Bild ist sogar noch beunruhigender. Es zeigt ein – »Ma!« – Kind.
Irgendwie ist es das, was Alyssa am meisten Angst vor ihrer Situation macht. Sie hört draußen etwas poltern, Füße, die sich der Tür nähern. Ein Kind, das sich in seinem Anspruchsdenken absolut sicher ist, dass seine Eltern ihm seine Bedürfnisse erfüllen werden, nur dass Alyssa nicht einmal weiß, wie das Kind heißt oder wie viel es bei der Geburt wog oder welches Geschlecht es hat. Sie fühlt sich nicht wie eine Mutter. Sie reibt sich die Schläfen und versucht, ihr Hirn in Gang zu bekommen.
Was hat das zu bedeuten?
Sie rennt ins Badezimmer und macht die Tür im selben Moment zu, in dem sie hört, wie das Kind hereinplatzt.
»Ma!«
Es ist eindeutig ein Mädchen. Zehn? Elf? Ein Teenager?
»Mir geht es nicht gut«, sagt Alyssa.
Verzweifelt dreht sie das Wasser kalt auf und spritzt es sich ins Gesicht. Sie starrt in den Spiegel. Leuchtende Ziffern zeigen die Temperatur ihrer Haut, des Zimmers und des heißen Wassers im Hahn an sowie die Luftfeuchtigkeit. Im Spiegel sind eindeutig ihr Gesicht und ihr Körper zu sehen, aber das kann Alyssa nur als Tatsache zur Kenntnis nehmen. Sie erkennt beide nicht wirklich wieder.
»Aber du musst mich zu Nicole bringen. Ich komme zu spät.«
»Alyssa.« Eine krächzende Männerstimme erklingt von dem Mann auf dem Bett, ihrem Ehemann.
»Mir geht es nicht gut«, sagt Alyssa erneut.
»Aber …«, sagt das Kind.
»Ich bring dich hin, Pat«, sagt der Mann. »Setz das Wasser auf.«
Alyssa hält die Luft an und hört dann wie ihr Kind, Pat, die Treppe hinunterpoltert. Die Bettdecke raschelt, und er kommt an die Tür.
»Alyssa?«
»Mir geht es nicht gut.« Andere Worte wollen ihr anscheinend nicht einfallen.
»Ja, das meintest du schon. Kann ich reinkommen?«
»Nein!«
»Schon gut, schon gut. Ich bringe Pat zu der Geburtstagsfeier. Soll ich was einkaufen?«
»Nein.«
»Du bist heute ja echt redselig, was?« Er gähnt, und das Geräusch klingt so, als entferne er sich.
Pat. Pat. Meine Tochter heißt Pat. Patricia? Patience? Vielleicht ist das Mädchen ja seine Tochter und nicht ihre. Sie hört Lachen von unten, ein so unendlich normaler Laut, dass sich ihr das Herz zusammenkrampft.
Alyssa schlägt sich gegen den Kopf, und ihr Spiegelbild tut es ihr nach. Hatte sie einen Schlaganfall? Ist sie krank? Sie öffnet das Medizinschränkchen. Schmerzmittel, Tampons, Vitamine, orale Verhütungsmittel, ausgestellt auf Alyssa Sutcliffe. Sutcliffe.
»Sutcliffe«, sagte sie. »Alyssa Sutcliffe.« Nichts klingelt bei ihr.
Ein Asthma-Inhaliergerät, eine Tube Rheuma-Gel, eine Anti-Pilz-Salbe, aber nichts, was auf eine anhaltende Erkrankung schließen ließe. Wie kann es sein, dass sie noch weiß, wofür all dieser Scheiß gut ist, aber sich nicht an ihren eigenen Namen, ihre Familie oder ihr Leben erinnert? Sie wischt die oberste Reihe Tabletten zu Boden und setzt sich auf den Toilettendeckel. In der Ferne hört sie eine Tür knallen und einen Motor anspringen. Das Haus versinkt in Stille.
Alyssa sieht zum Fenster hinaus. Morgensonne und eine Auffahrt. Ein kastanienbraunes Auto entfernt sich auf der Straße, die von Palmen gesäumt ist. Bei den Häusern handelt es sich um nahezu identische zweistöckige Gebäude. Warum geht Pat gleich morgens früh auf eine Geburtstagsparty?
Sie wühlt in den Schubladen herum, unter dem Bett, in einer verschließbaren, aber nicht abgeschlossenen Kiste. Ihr linkes Handgelenk vibriert leicht. Sie erschreckt sich nicht, weil sie weiß, dass es sich um ein Telefon handelt, weiß, dass es nicht wirklich eine Vibration ist, sondern eine elektrische Stimulation von Vibrationsrezeptoren, und dass es bedeutet, dass sie eine E-Mail oder Textnachricht erhalten hat. Warum kann sie sich an all das erinnern, aber an keines der grundlegend wichtigen Dinge? Der Text leuchtet auf dem biegsamen, hypoallergenen Polymer unter der Haut ihres Unterarms auf.
Ruh dich ein bisschen aus. Bin bald zu Hause. X.
Er hätte ruhig mit seinem richtigen Namen zeichnen können, denkt Alyssa. In der Kontaktliste taucht er als Mista Lover-Lover auf.
Sie erforscht das Haus. Sie geht durch das Schlafzimmer ihrer Tochter, sieht an der Wand das Poster von Ryot, einer Girl-Band, die anscheinend schon oben ohne bei Konzerten aufgetreten ist. Man sieht nicht die Brustwarzen, nur die Wölbungen der Brüste. Das Poster fängt an, Musik abzuspielen, sobald seine Sensoren Alyssas RFID-Chip orten, und die Musik ist eine Art Neo-Punk. Alyssa weiß noch, was Punk ist.
»Anhalten«, sagt sie, und das Poster erstarrt wieder beim ursprünglichen Bild.
Als sie das Wohnzimmer betritt, gehen in einem Holofeld über dem Tisch in der Mitte die Nachrichten an. Bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen zwischen Entsalzungs-Flottillen vor der Küste von Lagos finden ein Ende. Ein kurzer Auszug aus einem Interview mit Rosewaters erstem Bestsellerautor Walter Tanmola. Ist das hier ein Interview, oder wollen Sie mich nur auseinandernehmen? Sie können gerne behaupten, dass der Autor tot sei, aber dann frage ich Sie, warum bin ich hier? Warum stellen Sie mir überhaupt Fragen über mein Werk?
Eine Abschwächung des Jetstreams infolge der globalen Erwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit auf regelmäßige Schneefälle in der Sub-Sahara-Region. Neue Insekten-COBs werden in den nächsten Wochen das Werk verlassen. Nollywood-Star Crisp Okoye schießt sich bei einem Selbstmordversuch in den Kopf. All das klingt vertraut und zugleich fremd.
Ihr Unterarm informiert sie über die Temperatur und darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass es im Laufe des Tages regnen wird. Er teilt ihr mit, dass es 09:00 Uhr ist, und spult eine Reihe von Frühstücksoptionen auf Grundlage der im Haus verfügbaren Nahrungsmittel ab. Unter ihrer Haut leuchten das Datum und die Anzahl ungelesener Nachrichten auf.
Die Ansagestimme erinnert die Zuschauer an eine Dokumentation über den Kosmonauten Juri Gagarin, in der es um die Verschwörungstheorien geht, die seinen Tod umgeben. Hannah Jacques, die Frau des Bürgermeisters, bittet in einer gesponserten Mitteilung darum, Reanimierte mit Würde zu behandeln.
Alyssa geht nicht raus. Sie will nicht irgendwelchen Nachbarn begegnen oder sich verlaufen. Sie weiß ohnehin schon nicht, wo sie ist.
Sie setzt sich aufs Sofa und hört, wie die Klimaanlage sich klickend neu einstellt, um die Temperatur für sie angenehm zu halten.
Sie sieht weitere Bilder ihres Mannes und weiß inzwischen von ungeöffneten Briefen, dass er Mark Sutcliffe heißt. Mark, Alyssa und Pat Sutcliffe. Eine glückliche Familie.
Sie sitzt immer noch auf dem Sofa, als Mark zurückkehrt. Er ist wirklich ziemlich groß, was einem eher auffällt, wenn er steht. Mindestens einen Meter neunzig, wenn nicht zwei Meter.
»Wie geht es dir?«, fragt er, die Stirn in Sorgenfalten gelegt.
»Ich muss zum Arzt«, sagt Alyssa.
KAPITEL 2
AMINAT
Aminat ist zwanzig Minuten zu früh da, und genau so soll es auch sein. Sie ist nie genau pünktlich, und sie verabscheut es, zu spät zu kommen. Sie lässt ihre Aktentasche im verschlossenen Kofferraum und ihr Auto auf dem Besucherparkplatz, obwohl sie hier arbeitet. Auf dem Schild steht Landwirtschaftsministerium Ubar. Die meisten halten das für wahr, und tatsächlich gibt es einige wenige offizielle Stockwerke, die sich tatsächlich den landwirtschaftlichen Bedürfnissen der Nigerianer widmen, was in Rosewater bedeutet, die im Überfluss wachsenden Nahrungsmittel in riesigen Silos zu lagern, gekühlt oder auch nicht. Aber die eigentliche Arbeit findet in den Untergeschossen statt, die Sektion 45 beherbergen.
Bevor sie den Haupteingang erreicht, schaltet sie ihr Telefon ab, indem sie zweimal auf ihren Unterarm tippt. Es sitzt niemand am Empfangsschalter. Es ist Samstag, weshalb nur Leute herkommen, die mit S45 zu tun haben. Sie weiß, dass ihr Implantat gescannt worden ist, daher öffnen sich die Türen für sie, aber sie begegnet keiner Menschenseele. Das einzige Geräusch ist das Klick-Klack ihrer Absätze auf dem glänzenden Boden. Sie erreicht einen Fahrstuhl, und die Tür geht auf. Drinnen gibt es keine Knöpfe, nur auf Hochglanz poliertes Metall und ein Licht in der Decke. Die Musik ist irgendwas von Marvin Gaye Abgekupfertes, das Aminat auf dem Weg nach unten mitzusummen beginnt.
Sie zupft ihren Rock zurecht und begutachtet in dem leicht verschwommenen Spiegelbild ihre Schminke.
»Miss Arigbede, der Aufzug wird in Kürze anhalten«, sagt eine körperlose Stimme.
»Danke«, sagt sie.
Als die Aufzugstür sich öffnet, wartet ein Mann direkt davor. Er ist mit einer Maschinenpistole bewaffnet, aber er lächelt und nickt ihr zu und zeigt dann auf die Doppeltür am Ende des kurzen Korridors. Er trägt kein Namensschild, und Aminat fragt sich, ob der Sinn dahinter ist, dass er schießen kann, ohne Folgen befürchten zu müssen.
Die Türen öffnen sich zu einem Forschungslabor. Femi Alaagomeji, Aminats Chefin, ist schon anwesend. Sie hat ein völlig unangemessenes Sommerkleid an, aber Femi gehört zu den außerordentlich schönen Leuten, die in allem gut aussehen. Alle Anwesenden starren Femi an. Immer.
»Du bist früh dran«, sagt Femi. »Gut.«
»Guten Morgen, Ma’am.«
»Wie geht es deinem Freund?«
»Als ich gegangen bin, hat er gerade mit einem Computer Schach gespielt«, antwortet Aminat. Das ist zwar nicht wahr, aber damit lenkt sie das Interesse von ihm ab.
Femi schnaubt und reicht Aminat eine Schutzbrille zum Überziehen.
Sie stehen in einem kleinen Raum mit einer Reihe von Monitoren und ein paar Technikern. Eine Wand wird vollständig von einer transparenten Abschirmung eingenommen. Hinter dem Schirm ist ein Mann an einen Stuhl gefesselt. Es sieht aus, als wäre er beim Zahnarzt oder als sollte er eine Elektroschockbehandlung erhalten, trotzdem wirkt er ruhig. Er trägt einen marineblauen Overall, und überall an ihm kleben Elektroden. Um ihn herum sind zahlreiche Techniker mit Tests, Kalibrierungen und allerlei anderem Kram beschäftigt. Ihm gegenüber steht eine große Maschine, aus der etwas Zylindrisches auf ihn zeigt, wie um eine Röntgenaufnahme von ihm zu machen. Der hintere Teil der Maschine ist an einen größeren Mechanismus angeschlossen, der mit einem horizontalen Metalltorus verbunden ist, dessen Krümmung in weite Ferne reicht. Da keine Leute bei ihm stehen, kann Aminat nicht einschätzen, wie groß er ist.
»Du weißt, warum ich dich hergebeten habe?«, fragt Femi.
»Ein Entkopplungs-Experiment?«, fragt Aminat zurück.
»Ja. Da es mit deiner Arbeit zu tun hat, dachte ich mir, dass du vielleicht gerne zusehen möchtest.«
Das will sie tatsächlich. Seit Jahrzehnten wird die gesamte Biosphäre mehr und mehr von einer außerirdischen Spezies kontaminiert, einem Mikroorganismus mit der Bezeichnung Ascomycetes Xenosphericus. Es gibt zwar Unterarten und Varianten, aber sie alle sind höchst wandelbar und teilen ihre Nichtachtung der Hayflick-Grenze. Mit der Zeit hat S45 herausgefunden, dass all diese Xenoformen menschliche Zellen nachahmen und Stück für Stück menschliche Körper übernehmen. Sie gehen dabei ziemlich langsam vor, und Aminat selbst ist erst zu sieben Prozent außerirdisch. Sie hat jedoch schon Personen mit Xenoform-Anteilen von gut vierzig Prozent gesehen. Ihre Aufgabe ist es, ein chemisches Heilmittel zu finden. Sie weiß, dass es andere gibt, zum Beispiel diese Leute hier, die am selben Problem arbeiten. Die Entkopplung ist die bislang theoretische Trennung von Xenoform- und Menschengewebe. In der Praxis wurde noch keine Methode gefunden, die Alien-Zellen zu entfernen.
Femi bedeutet Aminat, sich zu setzen, weil ihre Chefin aber auch steht, lehnt Aminat ab. Sie stellt fest, dass in dem Zimmer, abgesehen von Aminats fruchtigem Parfüm, nichts zu riechen ist. Nicht einmal Desinfektionsmittel. Eine große Anzeige zählt 45 Sekunden herunter, während die Technikleute die letzten Handgriffe erledigen. Aminat wirft Femi einen Blick zu, bewundert ihre Haut, ihre Haltung, ihre Gelassenheit. Femi ist genauso groß wie Aminat, aber um die Körpermitte breiter und weniger athletisch. Dieser Mangel macht Femi jedoch irgendwie umso attraktiver. Aminat weiß, dass Femi Alaagomeji nur zu zwei Prozent Xenoform ist, einer der niedrigsten aktenkundigen Anteile bei Erwachsenen. Der Anteil bei Neugeborenen liegt unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze, aber am Ende des ersten Lebensjahrs liegen die meisten bei etwa einem Prozent.
Zehn Sekunden. Ein Alarmsignal ertönt, die Technikleute eilen aus dem abgetrennten Bereich und riegeln ihn mit der Testperson darin ab. Der Mann schwitzt, obwohl laut Temperaturanzeige in der Kammer angenehme 22 Grad Celsius herrschen. Er hat die Augen aufgerissen, und Aminat ist sich, auch ohne seine Gedanken lesen zu können, sicher, dass er sich gerade fragt, warum zum Geier er sich für diese Sache freiwillig gemeldet hat.
Das Licht wird schwächer, als die Anzeige bei null ankommt.
»Das sollte eigentlich nicht passieren«, sagt Femi stirnrunzelnd. »Es ist an einen unabhängigen Stromkreis angeschlossen.«
Kein Geräusch erklingt bei der Aktivierung, aber der Mann zuckt zusammen. Die Biometrie fluktuiert wild, so schnell, dass Aminat nicht mehr mitkommt, aber die Technikleute an ihren Monitoren wirken verstört. Der Mund der Testperson ist nun weit aufgerissen, und die Adern an seinem Hals stehen hervor, als wollten sie aus der Haut platzen. Er stemmt sich gegen seine Fesseln. Wahrscheinlich schreit er.
»Soll es denn schmerzhaft sein?«, fragt Aminat.
Femi dreht sich zu einem der Techniker um, der den Kopf schüttelt. »Die Tierversuche haben nicht darauf hingedeutet …«
Die Testperson … zerstäubt zu einem schlammfarbenen Matsch, der, seiner Bande entledigt, zu Boden klatscht und eine sich ausbreitende Pfütze bildet. Spritzer treffen den Sichtschirm und lassen Aminat zurückzucken. Die Techniker schreien auf und wenden sich nahezu synchron ab. Femi zeigt keinerlei Reaktion.
»Ich will bloß hoffen, dass er alle Einwilligungsformulare unterschrieben hat«, sagt sie schließlich. »Krebs können wir von dem Zeug nicht kriegen? Oder halt, ich will keine Antwort. Warum frage ich so etwas jemanden, der gerade meine Testperson durch den Mikrowellengrill gejagt hat?«
»Ma’am, ich weiß nicht, was passiert ist, woran der Versuch gescheitert ist«, sagt einer der Techniker.
»Wer sagt, dass er gescheitert ist?«, fragt Femi.
»Ma’am, der Mann ist tot?«
»Ja, aber darum ging es bei dem Test nicht, oder?«
»Ich kann Ihnen nicht folgen.«
Femi seufzt. »Geh dort rein, Yamskopf, und hol Gewebeproben. Teste sie auf Xenoformen. Wenn du keine findest, wart ihr erfolgreich. Bin ich die Einzige, die hier nicht schläft?«
»Aber die Testperson ist tot, Ma’am.«
»Kleinkram«, sagt Femi. »Hast du eigentlich schon gefrühstückt, Aminat?«
Mittlerweile ist es später Morgen. Nachdem Aminat beobachtet hat, was mit der Testperson geschehen ist, bekommt sie sicher keinen Bissen hinunter, aber Femi ist anscheinend ausgehungert. Sie verlassen die Landwirtschaftsbehörde und nehmen die Bahn vorbei am Nordganglion und nach Süden, in das deutlich weniger wohlhabende Ona-Oko-Viertel, wo Femi ein kleines Buka kennt. Der Besitzer, Barry, hat ein drittes Auge in der Mulde am Halsansatz. Meistens ist es geschlossen, sodass es entlang des Lids eine Kruste bildet. Gelegentlich tränt es, und wenn Barry sich auf etwas konzentriert, öffnet es sich.
»Ich habe ihn nie gefragt, ob er damit sehen kann«, meint Femi zwischen zwei Gabeln Reis mit Dodo. »Ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert.«
Aminat sagt nichts dazu. Aus Höflichkeit schiebt sie das Essen auf ihrem Teller hin und her. Sie hat das Gefühl, dass die Kochbanane, die man für ihr Dodo verwendet hat, ein bisschen überreif war. Wenn Barry in der Nähe ist, dann hat man das Gefühl, dem niemals blinzelnden Auge Gottes ausgesetzt zu sein, und das verursacht ihr Unbehagen. Sie fühlt sich in der Gegenwart von Wiederhergestellten immer unbehaglich, als handelte es sich bei ihnen um die Spielzeuge oder Experimente des Aliens. Natürlich tun sie sich das selbst an, indem sie ihr Fleisch am Abend der Öffnung zerschneiden oder umformen und dann in den von der Kuppel freigesetzten heilenden Xenoformen baden. Aminat fragt sich, ob Wormwood sie wirklich auf diese Weise reparieren muss, wo es doch Genmaterial auslesen und als genauen Bauplan verwenden kann. Aber jeder nach seiner Fasson.
Das Buka befindet sich im zweiten Stock eines dreistöckigen Petesi, und weil Ona-Oko größtenteils flach ist, sieht man von hier aus die Kuppel. Heute Morgen ist sie von einem stumpfen Himmelblau, und ihre Oberfläche weist dunkle Flecken auf. Wenn sie jeden Tag die gleiche Farbe hätte, würden die Leute sie vielleicht irgendwann nicht mehr bemerken. Wenn man bei den Pyramiden von Karnak wohnt, sieht man sie dann überhaupt noch? In diesem Monat hat die Kuppel laut Radionachrichten mehr Auswüchse als im letzten. Die Dornen sind ein relativ neues Merkmal.
Die Stühle sind aus Holz und unbequem, und das Innere des Buka ist sauber, wenn auch wohl kaum so sauber, wie es die Vorschriften erfordern. Die Luft ist erfüllt vom Geruch der Gewürze. Femis Leibwächter haben alle anderen Leute rausgeschickt, für alle Plätze bezahlt und die Gemüter beruhigt. Nun stehen alle vier mit den Gesichtern zu den Fenstern. Aminat weiß, dass sie gemeinsam ein Störfeld abstrahlen, mit dem sie ihr Gespräch vor Zuhörern abschirmen.
»Geht es dir gut, Arigbede? Brauchst du ein Gespräch?«, fragt Femi.
»Nein, brauche ich nicht«, sagt Aminat.
»Macht dir das Experiment zu schaffen?«
»Dir nicht?«, fragt Aminat.
Femi nimmt einen Schluck Wasser und schüttelt den Kopf. »Das Experiment nicht. Das Ergebnis schon. Ein bisschen. Aber ich habe eine ganze Menge Sorgen, und manche davon sind noch schauriger als das, was wir vor einer Stunde gesehen haben.«
»Ja, Ma’am.«
»Ich wünschte, du wärst nicht so förmlich zu mir. Auch nicht zu formlos, aber …«