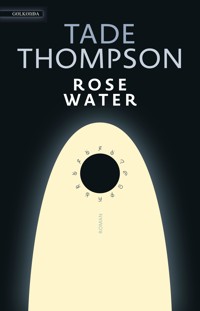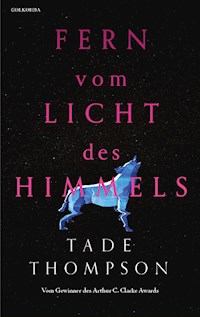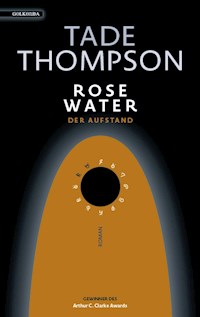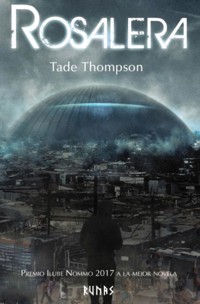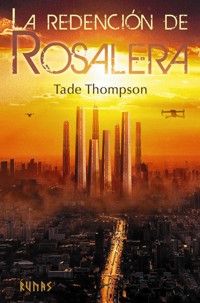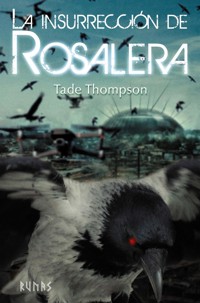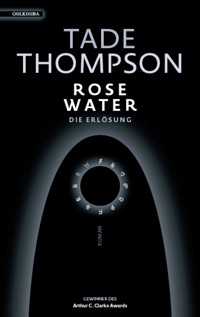
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Tade Thompson beginnt Rosewater – die Erlösung, den abschließenden Band seiner Wormwood-Trilogie, mit einer Art Fuge, einem fast musikalischen Präludium, in dem die Hauptfiguren wieder in die Geschichte eintreten, jede von ihnen verändert durch das, was zuvor geschehen ist. Wir sehen Rosewater durch die Augen der einzelnen Charaktere in seiner ganzen bizarren, chaotischen Vielfalt. Das Leben in dem gerade unabhängig gewordenen Stadtstaat entwickelt sich nämlich absolut nicht so, wie es sich die Bürger vorgestellt hatten. Zwar wurde mithilfe der Außerirdischen der verheerende Krieg gegen Nigerias reaktionäre Regierung gewonnen, doch nicht nur der charismatische Bürgermeister Jack Jacques muss feststellen, dass diese Hilfe allzu teuer erkauft wurde. Denn die Aliens nisten sich in immer mehr Menschen ein und übernehmen ihr Bewusstsein. Allmählich beginnt nicht nur Jacks Beliebtheit, sondern auch seine Autorität zu schwinden. Es liegt nun an einer kleinen Gruppe von Hackern, Kriminellen und schrägen Geheimdienstlern, die über die Raumzeit, die Xenosphäre, und internationale Grenzen hinweg agieren, um den Vormarsch der Außerirdischen zu verhindern. Der ehemalige Kriminelle Kaaro, seine Freundin Aminat, die für den Bürgermeister arbeitet, Femi, die vor allem ihre eigenen Pläne verfolgt und Oyin Da, das geheimnisvolle "Bicycle Girl", das in der Zeit reisen kann, sind vielleicht die letzte Verteidigungslinie der Menschheit … Ein gelungener Abschluss, der die Handlungsstränge aus allen Bänden zu einem intelligenten und überraschenden Ende führt, das noch lange nachwirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TADE THOMPSON
ROSEWATER
DIE ERLÖSUNG
Aus dem Englischen von Jakob Schmidt
Die britische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Rosewater Redemption« bei Orbit, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London, UK.
© 2019 by Tade Thompson
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Auszug aus Red Moon von Kim Stanley Robinson
Copyright © 2018 by Kim Stanley Robinson
Das Urheberrecht des Autors wurde geltend gemacht.
Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Buch sind fiktiv, und jede Ähnlichkeit mit realen Personen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig.
1. eBook-Ausgabe 2025
1. Auflage
© 2025 der deutschen Erstausgabe Golkonda Verlag in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.wordpress.com]
Lektorat: Angela Hermann-Heene
Satz: Margarita Maiseyeva
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-96509-029-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0
E-Mail: [email protected]
www.golkonda-verlag.com
INHALT
VORSPIEL ZUR ERLÖSUNG
LETZTE TAGE
TÖTEN IN ROSEWATER
KORIKO HEISST GRAS
GRENZEN
MAFE
KEIN RICHTIGER SCHLAF
ES IST WAS FAUL
ÜBLE GERÜCHE
HIER HABEN WIR DAS LOCH, IN DEM DU DICH VERKROCHEN HAST
WÄHREND DU SCHLIEFST
LOCKE, DIESER MISTKERL
SCHWESTER SOLEDAD
WENIG BEGEISTERT
SIE WEISS ES
KLEIDUNG
SPACEMAN
DORT, JETZT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
REPRISE
DANKSAGUNG
Für Hunter.
Die mittleren Kinder sind die besten!
Der Mensch hat keinen von der Seele getrennten Leib; denn das, was der Leib genannt wird, ist nur jener Teil der Seele, den die fünf Sinne wahrnehmen.
William Blake, Die Hochzeit von Himmel und Hölle
VORSPIEL ZUR ERLÖSUNG
LETZTE TAGE
Ich bin nicht die Richtige, um diese Geschichte zu erzählen, aber sonst will es eben keiner machen. Die wenigen Menschen, die die Fakten kennen, oder zumindest Konkreteres wissen als ich, haben kein Interesse daran, die Ereignisse noch einmal zu durchleben. Ich habe auch keine Lust, alles noch mal durchzumachen, aber ich will von diesen Ereignissen berichten, also tue ich es. Es heißt, dass Information, genau wie Energie, niemals wirklich zerstört werden kann. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich bin nicht allwissend. Was ich weiß, ist, dass meine Wirklichkeit an den Rändern langsam verschwimmt und ich mich deshalb lieber mit meinem Bericht beeilen sollte.
Ich bin nicht die Richtige, um diese Geschichte zu erzählen, weil ich zu dicht an ihr dran und nicht mal ansatzweise objektiv bin. Vielleicht ändere ich sogar das eine oder andere Detail, um sympathischer zu erscheinen. Du bist also vorgewarnt und kannst selbst entscheiden, ob du mir Gehör schenken willst. Mein Name ist Oyin Da, und ich will dir vom Anfang und vom Ende erzählen.
Man hat mich den größten Teil meiner Kindheit und mein ganzes Erwachsenenleben über gejagt. Die Regierung sagt, ich wäre gefährlich, und das stimmt, wenn man davon ausgeht, dass Ideen gefährlich sind. Eine Pistolenkugel ist eine Idee.
Eine Schrotflinte auch. Manchmal trage ich eine Djellaba, damit die Leute nicht wissen, aus welcher Zeit ich stamme.
Mit meinen Reisen durch die Zeit gibt es ein Problem. Nicht, dass sie nicht funktionieren würden, denn sie funktionieren bestens. Das Problem ist das Wie. Der Typ, von dem die Maschine stammt, Conrad, er war … intelligent, aber nach allem, was ich aus seinen Schriften ersehen konnte, auch zutiefst psychotisch – oder was zum Teufel bedeutet das Wort »Hukferläppchen«? Alle seine Arbeiten sind voll von solchen Nonsens-Wörtern, Neologismen und Metonymien. Ohne irgendwelche Extrapolationen meinerseits konnten mein Vater oder der Professor aus ihnen das Lijad ableiten. Ganz zu schweigen von der Miniaturisierung, die für meine Cyborg-Teile nötig war.
Wir sollten anfangen. Keine Zeit zu verschwenden. Und trotzdem verschwende ich in ebendiesem Moment Zeit. Weil ich nicht weiß, womit ich anfangen soll. So viel ist geschehen; so viel ist im Gange, und so viel steht noch bevor. Rosewater hat die Weltbühne betreten, während die Afrikanische Union darüber debattiert, wie sie mit der Stadt verfahren soll. Kann ja nicht so schwer sein – sie haben gerade erst auf einen Rutsch die Karibikinseln geschluckt. Dagegen wird Rosewater ein Kinderspiel. Nur ist in Wirklichkeit nichts an Rosewater einfach oder vorhersagbar. Ja, der Zuckerguss ist gratis, aber für den Kuchen muss man bezahlen.
Ich bin Oyin Da, die Unwahrscheinliche, das Bicycle Girl. Ich bin eine Künstlerin: Die Geschichte ist meine Modelliermasse. Pass genau auf. Es wird Wendungen geben, plötzliche Perspektivenwechsel, Wirbelstürme aus heiterem Himmel.
Ich bin Oyin Da, die Unwahrscheinliche, und dies sind die letzten Tage Rosewaters.
TÖTEN IN ROSEWATER
Im Jahre 2068 ist es innerhalb der Stadtgrenzen von Rosewater praktisch unmöglich, jemanden zu töten, weil inzwischen ununterbrochen und nicht mehr nur einmal im Jahr Heilungen stattfinden. Mein vierköpfiger Trupp ist seit fünfzehn Minuten damit beschäftigt, einen Mann zu erschießen, nachzuladen, und ihm erneut ins Gehirn zu schießen, in dem Versuch, es so vollständig zu zerstören, dass es seine Persönlichkeit auch nach seiner Wiederherstellung nicht mehr geben wird und die Aliens seine Leiche nicht als Gefäß verwenden können.
»Moment«, sage ich. »Versucht es mit einem chemischen Sprengsatz.«
Sein Schädel ist ein klaffendes Loch, sein Gesicht verschwunden, und trotzdem wächst es nach. Tolu steckt einen Sprengsatz direkt in die Schädelrundung und rennt in Deckung. »Schießt auf die Öffnung.«
Die Detonation klingt gedämpft, aber als chemisches Feuer in alle Richtungen schwappt, weiß ich, dass sein Gehirn das unmöglich überleben kann. Seinen Identitätschip haben wir schon.
»Kommt, bevor die Polizistin hier ist«, sage ich.
Sie fliehen auf ihre Art, und ich verschwimme mit der Xenosphäre.
KORIKO HEISST GRAS
Ihr gefällt das Gefühl, wenn der Morgen anbricht. Sie hört gerne, wie die Regenwürmer sich leise durchs Erdreich winden, wie die Vögel ihre Lieder antesten, und sie mag die taufeuchte Luft. Die Sonne ist gerade über den Horizont gestiegen, und die Helligkeit lässt das Leben aufwallen, in all den Formen, in denen es Alyssa umgibt, einschließlich der Menschen und ihres Volkes, der Heimianer. Sie hat wieder draußen geschlafen, und von den Kristallen auf ihrem Leib sind Fühler ins Erdreich gewachsen und haben sich verzweigt, sodass sie nun von einem feinen, zerbrechlichen Pflanzennetz bedeckt ist. Sie gähnt, zerreißt das Netz, indem sie sich streckt, und steht auf.
Von hier aus sieht sie das Yemaja-Tal, die Stadt, die sich von seiner Mitte her ausbreitet, und ihre ausufernden Randgebiete. Die Grenze zu Nigeria wird von Roboterwachtposten und einer Nachtschicht von Menschen in Techgehäusen gesichert.
Dort, wo früher die Biokuppel war, befindet sich jetzt ein Flughafen. Daneben liegt die Honigwabe, wo man sich um alles kümmert, was mit den Heimianern zu tun hat.
Das ist es, was sie sich immer gewünscht hat – nicht ihr menschlicher Teil; ihr heimianisches Selbst – eine Welt, die nicht von Giftstoffen und ungezügelter Industrie verdorben ist. Es gibt keine feindlichen Drohnen in der Luft. Die Nigerianer haben aufgehört, welche zu schicken, weil sie jedes Mal von den zahlreichen Ganglien abgeschossen werden und es ihnen zu teuer wurde, sie zu ersetzen.
Sie ist die Stadt, und die Stadt ist sie. Wormwoods Nerven ziehen sich durch die Wände aller Bauwerke und bilden in den oberen Erdschichten und im Fluss ein dichtes System aus Wurzeln und Sprossen. Ihr gehört alles, sie ist alles.
Deshalb hört sie den Knall der Explosion, während sie ihn zugleich spürt. Von ihrem Körper ist sie zu weit entfernt dafür, aber ihr Bewusstsein wechselt in den Gedankenraum – in das, was die Menschen als Xenosphäre bezeichnen.
Wie nennen sie mich? Koriko, was Gras bedeutet. Sie müssen mich irgendwie nennen, um mich zu verehren. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ihre Gebete nie beantwortet und widme mich nur den Angelegenheiten der Heimianer, aber trotzdem höre ich sie dauernd. Manche von ihnen stellen sich vor, dass ich die Stadt wäre, und nennen mich Rosewater. Damit haben sie nicht völlig unrecht, obwohl Wormwood der eigentliche Grund dafür ist, dass es die Stadt überhaupt gibt. Während ich das denke, regt Wormwood sich, wärmende Gedanken, eine Bestätigung von Zuneigung, aber nicht an mich gerichtet. Er träumt von meinem Vorgänger, Anthony, von seinem alten, toten Avatar. Ich glaube, er mochte ihn lieber. Für mich gibt es nur Schweigen.
Es ist ein Spielplatz. Oder es war einer. Ein neuer Bombenkrater enthält tote und beschädigte Menschenkinder. Zweifellos handelte es sich um einen Blindgänger, ein Überbleibsel der Bombardierungen während des Aufstands. Das Metall der Schaukeln und Rutschen ist verbogen, heiß, raucht. Sechzehn Kinder sind verletzt, und Alyssa heilt sie innerhalb von Minuten, bevor die besorgten Eltern kommen.
Alyssa hört Gebete, aber sie hält nicht inne, nichts rührt an ihrer Entschlossenheit. Sie gibt die notwendigen Anweisungen, und tief unter der Stadt regt sich Wormwood. Der Boden bebt, und zum zweiten Mal ertönt ein Rumpeln, als Tentakel aus dem Erdreich hervorbrechen. Sie wickeln sich um die fünf toten Kinder und ziehen sie nach unten, an Wormwoods Brust, begleitet vom ebenso eindringlichen wie vergeblichen Flehen ihrer Eltern.
Wissen sie es nicht? Warum betteln sie? Warum hören sie nicht damit auf? Milliarden auf dem heimianischen Mond warten noch immer auf einen irdischen Wirt, und Alyssa-Koriko geleitet ihre Seelen.
»Wendet euch an eure eigenen Götter«, sagt sie zu den Betenden.
Sie verlässt ihren Schlafplatz, um sich um die fünf zu kümmern.
GRENZEN
Oyin Da sieht zu, wie Koriko weggeht. Sie muss sich in Erinnerung rufen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, um nicht von Hoffnungslosigkeit übermannt zu werden. Sie spürt, dass Tolu Eleja, der neben ihr auf der Lauer liegt, das Gleiche empfindet. Seit 2066 widmet Tolu sich mit unermüdlicher Hingabe dem Widerstand. Er lässt sich wirkungsvoll gegen Regierungsagenten einsetzen, hat immer das Hauptziel im Blick, ein guter Soldat. Unglücklicherweise konfrontiert Koriko sie mit einer Situation, die so keiner erwartet hat, und der Aufgabe, die sich ihnen jetzt stellt, ist Tolu mit seinen Fähigkeiten wohl kaum gewachsen.
Er sagt: »Sie ist zu mächtig und zu selbstherrlich.«
»Ich weiß«, sagt Oyin Da.
»Wie sollen wir …«
»Das weiß ich nicht«, unterbricht ihn Oyin Da. »Aber ich möchte mit dir zusammen die Grenzen ihrer Fähigkeiten austesten. Komm mit.«
MAFE
Der Zeuge berichtet Aminat, dass der Tote ohnehin jung gestorben wäre.
»Sein Name war Jackson Mafe, und er war ein Dummkopf. Man konnte noch so geduldig sein, irgendwann hat Jackson einen sauer gemacht. Er war ein bisschen … Sie wissen schon?« Der Zeuge hält sich den Zeigefinger an die Schläfe, macht eine Kreisbewegung damit und hebt die Augenbrauen. Aminat nickt. Jackson war also in irgendeiner Weise lernbehindert. Weiter bitte.
»Sechs Uhr morgens auf der Lumumba Road, ich baue gerade meinen Stand auf, da sehe ich Mafe vorbeikommen. Ich sage Hallo, er sagt nichts. Ich zucke mit den Schultern. Ein paar Minuten später kommt er aus der anderen Richtung zurück, aber diesmal geht er nicht. Er marschiert, aber es ist kein richtiges Marschieren. Wie nennt man das, wenn man den einen Stiefel ganz hochhebt? Wenn man die Knie nicht beugt?«
Stechschritt.
»Ja, genau. Er lief im Stechschritt.«
Wie dem auch sei, jetzt ist Mafe steif und kalt, in der Haltung erstarrt, in der er zu Boden gestürzt ist, und feucht von Rosewaters süßem Morgentau. Er trägt die Kleidung, in der die Leute ihn am vorigen Tag gesehen haben, sein Gesicht wirkt irgendwie friedvoll, falten- und ausdruckslos. Er kann noch nicht lange tot sein. Die Ghule haben ihn noch nicht geholt, und während er zwischen den Stühlen festgesessen hat, ist er zu einem Reanimierten geworden. Von denen sieht man nicht mehr viele. Die Heimianer kolonisieren schnell jede verfügbare Leiche, manchmal nur Augenblicke nach dem Tod. Als Aminat damit fertig ist, die Zeugenaussagen aufzunehmen, hat Mafe sich bereits in ein Bündel unkoordinierter Zuckungen verwandelt, und er hat die Augen geöffnet. Aminat hat das Gefühl, dass er sie anklagend ansieht.
Sie nimmt einen Trupp Ermittler beiseite und befiehlt ihnen, die Verdächtigen festzunehmen.
»Warum?«, fragt einer.
»Weil das eure Arbeit ist«, antwortet Aminat, was für Gelächter sorgt, das allerdings verstummt, als die anderen ihre eisige Miene sehen.
Vier werden festgenommen. Einer war gerade beim Abula-Essen und besteht darauf, sich eine Handvoll mitzunehmen, weil »Gefängnisessen das Letzte ist«. Obwohl er Handschellen trägt, beißt er von seinem Snack ab und lächelt.
Bei ihren Identitätsscans kommt es zu mehreren Fehlermeldungen, aber etwas anderes hat Aminat auch nicht erwartet. Sie haben von der Regierung ausgegebene Zivilistenchips, aber auch Militär-Upgrades aus dem Krieg und Phantomidentitäten wie alle Kriminellen. Aminat besitzt selbst eine Phantomidentität, die sie verwendet hat, als sie während des Aufstands auf der Flucht war.
Bevor Aminat ihr Büro erreicht, ruft der Bürgermeister an.
»Lassen Sie sie gehen«, sagte er.
Wen soll ich gehen lassen? Aminat stellt sich dumm.
»Sie wissen, von wem ich rede. Ich habe heute viel zu tun und Sie auch. Hören Sie auf, Ihre Zeit auf Kriegshelden zu verschwenden.«
Kriegshelden? Sie haben ein leichtes Opfer zu Tode gepiesackt. Sie haben ihn …
»Haben Sie jemanden kaltblütig niedergeschossen? Ihn abgestochen? Mit einem Bajonett durchbohrt? Totgeprügelt?«
Nein.
»Dann lassen Sie sie frei, Aminat. Himmel noch mal.«
Es ging hier nicht um eine … Geschäftsangelegenheit.
»Ich lege jetzt auf, Aminat.«
Aminat gibt die nötigen Befehle, genehmigt aber unter der Hand eine Arthroboter-Drohnenüberwachung und lässt sich die Daten auf ihr Subdermaltelefon streamen. Den ganzen Tag über verfolgt sie die Bewegungen der vier Verdächtigen in unregelmäßigen Abständen mit. Die Pathologen sagen, dass Mafe gegangen ist, dass niemand ihn in Besitz genommen hat und er jetzt ein ganz normaler Reanimierter ist. Anscheinend ist Koriko zu beschäftigt.
Später stiehlt sie sich mit der Phantomidentität, die Bad Fish ihr erstellt hat, aus dem Haus. Sie fühlt sich distanziert von ihrem Liebsten, aber irgendwie glaubt sie daran, dass noch Zeit ist, um ihre Beziehung zu retten, während sie zugleich das Gefühl hat, kurz vor einer heranrollenden Lawine einen Berg hinabzukullern.
KEIN RICHTIGER SCHLAF
Kaaro wacht auf, sobald Aminat das Haus verlässt, herausgerissen aus dem Traum, dass seine Wange über rauen Lehmputz schrammt. Es ist das Abreißen ihrer mentalen Verbindung, das ihn weckt. Er steht nicht auf, regt sich nicht einmal. Er weiß, was kommt. Sie wird ein paar Stunden weg sein und erschöpft und zerschunden heimkehren, aber kein Wort darüber verlieren, und Kaaro wird nicht in ihren Gedanken nach Antworten suchen.
Sein subdermales Telefon leuchtet auf, und er rechnet mit einer Nachricht von Aminat, aber es ist nur ein Software-Update. Er bestätigt das Update und schaltet das Telefon auf Nachtmodus.
Dann wälzt er sich herum und schläft wieder ein.
ES IST WAS FAUL
Ein wichtiger Teil von Bad Fishs Welt verschwindet, und er unterbricht seine Nachforschungen zu nichtkontinuierlichen Netzwerkverbindungen, um sich die Sache näher anzusehen.
Er nimmt den Immersionshelm ab und blinzelt, als seine Augen sich an das Licht seiner Werkstatt anpassen. Drei Yahoo-Yahoos liegen in verschiedenen Haltungen schlafend auf dem Boden, eines davon mit offen stehendem Mund. An der Wand hängt ein Immersionsanzug, an dem Bad Fish gerade arbeitet und mit dem er schon fast fertig ist. Er fährt mit seinem Stuhl zu einem seiner fünf Arbeitsplätze, wobei er nur um Zentimeter ein Bein verfehlt, und ruft ein Hologramm mit detaillierten Informationen auf.
Bad Fish hat eine Karte aller Identitätschips, und Personen, für die er sich interessiert, sind besonders hervorgehoben.
Kaaro gehört zu den wichtigsten fünf; jeden Tag sieht Bad Fish gewissenhaft nach ihm.
Derzeit ist Kaaros Identitätschip verschwunden.
Das kann vieles bedeuten. Ein Softwarefehler oder er hat eine abgeschirmte Anlage betreten, oder er ist sogar tot.
Bad Fish aktualisiert sein System und nimmt Rosewater ins Visier, aber Kaaro taucht nicht wieder auf. Er sucht nach Aminat und findet sie in ihrer Phantomform. Er ruft Überwachungsdaten und anderes Videomaterial in der Umgebung ihres Phantoms auf, was kein Kinderspiel ist, da sie in dieser Form cyber-unsichtbar ist, und um sie herum gibt es noch andere grobschlächtige Phantome. Der am nächsten bei ihm liegende Yahoo-Yahoo furzt, und Bad Fish versetzt ihm einen Tritt.
Er reibt sich das Kinn. Anscheinend ist Aminat gerade mit irgendeiner Operation beschäftigt, und wenn er sich jetzt mit ihr in Verbindung setzen würde, könnte er sie in Gefahr bringen. Er könnte auch Kaaro anrufen, aber das Arschloch ist vielleicht auch mit von der Partie, obwohl er offiziell »im Ruhestand« ist. Stattdessen unterzieht Bad Fish seine Hardware also einer genauen Überprüfung, wobei er die ganze Zeit sein Unbehagen unterdrücken muss.
ÜBLE GERÜCHE
Ich weiß, dass etwas schiefgegangen ist, aber ich bin mir nicht sicher, was. Ich sitze da und starre auf die Pinnwand, an der Informationen über alle Figuren in diesem Spiel hängen. Meine letzte Reise ins Jahr 2067 kam mir komisch vor, vor allem, weil ich schon einmal an genau diesem Zeitpunkt war und meine Erinnerungen daran nicht mit dem übereinstimmten, was ich dieses Mal gesehen habe. Habe ich Gedächtnisprobleme, oder treibt die Maschine langsam in alternative Dimensionen ab?
Mir tun die Augen weh, und ich reibe sie mir und betrachte dann wieder die Pinnwand. Kaaro. Aminat. Jack Jacques. Hannah Jacques. Alyssa, oder Koriko. Taiwo. Femi Alaagomeji. Bad Fish. Wormwood. Rosewater.
Sie alle sind von einem Wirbel umgeben, in dem die Zukunft der Menschheit in der Schwebe hängt. Möglicherweise bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der sich einen Reim darauf machen kann, was zu tun ist und wann. Ich hoffe es.
Ich reiße die ganzen Blätter ab und werfe sie in die Luft, dann schiebe ich sie zu einem ungeordneten Stapel zusammen und hänge sie in einer neuen Reihenfolge auf in der Hoffnung, dass sich dadurch eine Blockade löst, dass mir ein neuer Einfall kommt.
Ich schlage zweimal gegen die Wand. Mein Zimmer ist wie das Innere eines Wassertanks, und wahrscheinlich war es das auch mal. Alle Bildschirme sind dunkel; ihr Leuchten würde mich ablenken. Eine Klappe öffnet sich, und eine Hand hält eine dampfende Kaffeetasse herein, meine fünfte im Laufe einer Stunde. Ich verbrenne mir die Zunge, merke es aber kaum. Etwas Saures rumort in meinem Magen – anscheinend kann man nicht allein vom Kaffee leben.
Ich spiele I. K. Dairo ab, als Erstes »Salome«, singe nickend mit.
Und denke nach.
HIER HABEN WIR DAS LOCH, IN DEM DU DICH VERKROCHEN HAST
Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen ist Dahun zufrieden.
Sein Haus ist in Niger, auf der Sahara-Seite der Großen Grünen Mauer, wo die Luft duftet und die Hitze angenehm ist. Die Nächte dort haben einen besonderen Zauber, und die Stimmen im Hintergrund sprechen verschiedene arabische Dialekte. Diese Nacht ist klar, und er hört die wummernde Musik des nahen Klubs namens Disco Inferno. Er sitzt auf seiner Veranda, prostet dem vollen Mond zu und liest die Nachrichten vom Aktienmarkt. Bisher hat er keine Ahnung von Finanzgeschäften, aber er will Experte werden, seit er bei seinem letzten Auftrag das nötige Kleingeld dafür verdient hat. Er fragt sich, ob das heißt, dass er aus dem Söldnergeschäft ausgestiegen ist, weil er nicht den geringsten Willen dazu verspürt, sich hinter ein Maschinengewehr zu klemmen oder sich für Geld – egal, wie viel – in Gefahr zu begeben.
Er trinkt seinen Gin in einem Zug aus und schenkt sich nach.
Als die Flasche leer ist, fühlt er sich wackelig auf den Beinen und macht sich auf den Weg in sein Schlafzimmer. Dann beschließt er aus einem Impuls heraus, doch lieber einen Spaziergang zu machen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Es ist noch früh; vielleicht geht er ja den ganzen Weg zum Dorf, um sich dort mit echten menschlichen Wesen zu unterhalten, die nicht am anderen Ende eines elektronischen Kommunikationsmediums sitzen. Er setzt seine Kapuze auf – es ist komisch, wie kalt es nachts in der Wüste werden kann. Sobald er einen Meter von seinem Zuhause weg ist, schalten sich die Sicherheitsvorkehrungen ein.
Er geht die Auffahrt hinunter und biegt auf der staubigen, von Sträuchern gesäumten Straße nach links ab. Plötzlich hat er ein komisches Gefühl, zwei Sekunden bevor sich etwas über seinem Mund und um seinen Hals zusammenzieht und ihm die Arme an die Seiten presst. Es ist wie ein Python oder eine Boa Konstriktor, organisch, muskulös, unnachgiebig. Dahun versucht, es zu beißen, was jedoch keine Wirkung zeigt. Während er sich dafür verflucht, weich geworden zu sein, fällt er zu Boden und sieht den Mann, der die Schlange anscheinend kontrolliert.
»Caleb Fadahunsi«, sagt der Mann. »Bleiben Sie ruhig. Ich nehme Sie in Gewahrsam.«
Selbst im Schatten sind die seltsamen Umrisse des Mannes erkennbar. Er trägt eine Art Kapuzenpulli und enge schwarze Hosen, aber das, was Dahun in seinem Griff hält, scheint von dem rechten Arm des Mannes auszugehen, als wäre es ein Teil seines Körpers. Der Mann kennt Dahuns Vornamen, was bedeutet, dass die Leute, für die er arbeitet – um wen auch immer es sich handelt –, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Dahun mag es nicht, Caleb genannt zu werden. Ein Wagen nähert sich, was zu gelegen kommt, um ein Zufall zu sein. Es handelt sich um einen Jeep mit getönten Scheiben, der vage militärisch aussieht und sich schnell auf sie zubewegt. Zwanzig Meter entfernt wird er langsamer, und im selben Moment schießt Dahuns Drohne eine Minirakete auf das Fahrzeug ab. Der Mann zuckt zusammen und Dahun ebenfalls, als ihm klar wird, dass der Wagen unbeschädigt ist. Wahrscheinlich gepanzert.
»Feuer nicht erwidern«, sagt der Mann.
Das ist unklug, weil die Drohne in ein paar Sekunden losballern wird. Sie ist auf Dahuns Identität programmiert und wird auf alles außer ihm zielen. Gerade ist sie über das Dach weg und rast auf sie zu. Der Mann bleibt gelassen.
»Die Geschosse sind panzerbrechend«, sagt Dahun. »Hauen Sie ab, dann hat die Sache hier ein Ende.« Aber wegen der Schlange dringen seine Worte nur gedämpft nach außen.
Die Drohne wird von zwei Schatten verfolgt, und im Licht des Vollmonds sieht Dahun, dass sie flattern. Eulen. COBs, Cyborg-Überwachungstiere. Sie nähern sich der Drohne, die zu spät versucht, die neuen Ziele ins Visier zu nehmen. Zusammen bringen die Eulen die Drohne zu Fall, ohne einen Laut zu verursachen.
Der Tentakel – denn es ist ein Tentakel und keine Schlange – lockert sich. Das Auto kommt mit einem Ruck neben Dahun zum Stehen. »Einsteigen«, sagt der Mann.
Dahun erhebt sich. »Sie haben mich nur erwischt, weil ich einen Spaziergang machen wollte.«
Der Mann legt eine Hand auf Dahuns Kopf, während er ins Auto steigt. »Und was glauben Sie, wer Ihnen diese Idee eingegeben hat?«
Das Auto hat keinen Fahrer, einen Elektromotor und kommt vermutlich von der Regierung. Der Mann legt Dahun Handschellen und den Sicherheitsgurt an. Er ist hellhäutig und irgendwie grotesk, eindeutig aus Rosewater, was verwirrend ist, weil die nigerianische Regierung die COBs, die Cyborg Observation Beasts, kontrolliert. Und dann ist da auch noch das Militärauto. Dahun hat sich am Ende des Kriegs im Guten von Bürgermeister Jack Jacques getrennt. Jacques hat gut und pünktlich gezahlt. Warum sollte …
»Wer sind Sie?«, fragt Dahun.
Das Gesicht des Mannes liegt nach wie vor im Dunkel seiner Kapuze. Der Tentakel windet sich und klatscht auf den Sitz wie Satans Zunge.
»Für wen arbeiten Sie?«
Schweigen.
»Kommen Sie aus Rosewater? Sind Sie ein Wiederhergestellter?«
Der Wagen holpert durch ein Schlagloch, und der Mann wiegt sich in seinem Sicherheitsgurt. »Dumm.«
»Wie bitte?«
Der Mann beugt den Kopf vor, aber Dahun hat den Eindruck, dass hinter der schmalen Öffnung der Kapuze nur ein gähnender Abgrund liegt. »Sie sind dumm. Aber keine Sorge, nicht nur Sie.«
»Ich glaube nicht …«
»Meine Mutter war Anwältin, und sie hat mir immer gesagt, dass jeder, der in einem freien oder zumindest offiziell freien Land festgenommen wird, das Recht hat, zu schweigen. Aber nutzen die Leute dieses Recht? Nein. Jedes Mal müssen die Leute ihr Scheißmaul aufmachen, was? Als wären die Polizisten eure Beichtväter. Ich meine, das wären sie gerne, aber sie sind es nicht. Alle möchten ihre Geschichte erzählen, aber das, was sie erzählen, inkriminiert sie. Caleb, halt einfach deine Scheißklappe. Du hast keine Ahnung, wer ich bin oder warum ich dich eingesackt habe. Alles, was du sagst, kann mir eine Hilfe sein.«
Sein Akzent klingt südafrikanisch, dieses komische, fast-niederländische Englisch.
»Bin ich also festgenommen?«
Aber der Mann aus Südafrika hält sich an seinen eigenen Rat und schweigt.
WÄHREND DU SCHLIEFST
Kaaro wird von seinem Telefon geweckt. Unbekannter Anrufer. Aminats Bettseite ist kalt.
»Sie müssen ins Gefängnis kommen, Mr. Kaaro.« Die Stimme eines Fremden.
»Ich darf keine Regierungsgebäude mehr betreten. Und ich heiße einfach nur Kaaro.«
»Ihre Beschränkungen wurden für diesen einen Fall aufgehoben, und wir werden Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.«
»Ja, aber ich muss nicht machen, was ihr mir sagt. Ich arbeite nicht für die Regierung«, sagt Kaaro. »Ich bin im Ruhestand.«
»Femi Alaagomeji hat um Ihre Anwesenheit gebeten, Sir.«
Kaaro wirft einen Blick dorthin, wo Aminat fehlt, und sagt: »Ich bin in einer Stunde da.«
LOCKE, DIESER MISTKERL
»Dazu hätte ich gerne eine Antwort von Hannah Jacques«, sagt die Moderatorin.
Hannah zögert keine Sekunde. »Um das zu erklären, gebe ich Ihnen ein universelles Beispiel, das gilt, ob Sie nun in Rosewater sind oder in Ojuelegba in Lagos. Nehmen wir eine Person, sagen wir eine vierzig Jahre alte Frau, Shakespeares vierzig Winter. Sie hat einen Autounfall oder stürzt aus großer Höhe. In jedem Fall erleidet sie einen Hirnschaden, einen schweren, aber sie stirbt nicht. Nach einer Phase intensiver medizinischer Versorgung und chirurgischer Intervention lebt sie zwar weiter, aber sie ist nicht mehr sie selbst. Ihre Persönlichkeit hat sich verändert. Nehmen wir dieselbe Frau, doch diesmal erleidet sie keinen Unfall, sondern bekommt vierzig Jahre später Alzheimer. Sie ist nicht mehr die Person, die sie mit vierzig oder gar vierzehn war. Nun nehmen wir dieselbe Person, kein Unfall, keine Demenz, aber sie erleidet einen Schlaganfall und hat Probleme damit, Worte zu verstehen und zu formulieren. Sie ist nicht mehr wie früher. Ich könnte fortfahren. Schizophrenie? Posttraumatische Belastungsstörung? Dissoziative Amnesie?«
»Sie müssen schon die Frage beantworten, Mrs. Jacques«, sagt die Moderatorin.
»Der Personenstatus lässt sich nicht auf die Erinnerungen einer Person beschränken. Wir sollen die Vorstellung akzeptieren, dass die Reanimierten ihr Selbst verlieren, und wenn Wormwood sie wiedererweckt, sind sie nur noch Körper, biologische Gefäße, die darauf warten, von einem fremden Wesen erfüllt zu werden. So einen Albtraum kann sich nur der Geist von John Locke ausgedacht haben. Wir haben also diese dummen, aber technologisch fortgeschrittenen Außerirdischen, die die Erinnerungen ihrer Leute gespeichert und sie dann ermordet haben. Locke würde natürlich sagen, dass Erinnerung und Person identisch sind, dass also jeder einzelne dieser Außerirdischen, der auf einem Milliarden Lichtjahre weit entfernten Speicher liegt, in diesem Sinne noch lebt. Er würde auch behaupten, dass die Reanimierten nicht leben, da sie sich anscheinend nicht an ihre bisherigen Leben erinnern. Die Verwendung reanimierter Körper als Wirte für heimianische Tote erschiene unter diesen Bedingungen ethisch völlig unproblematisch, etwa so, wie wenn man sich Kleider aus einem Wohltätigkeitsladen anzieht. Doch in Wirklichkeit streuen wir den Hinterbliebenen Salz in die Wunden, indem wir dafür Reanimierte verwenden.«
Die Moderatorin hebt die Hand. »Ich fürchte, ich muss Sie unterbrechen und dass Gespräch zurück auf die Frage bringen: Betrachten Sie heimianische Reanimierte als Personen?«
»Ich betrachte die Leiber, in die diese Erinnerungen eingegeben werden, als Personen. Beim Mensch-Sein geht es nicht nur um Erinnerungen. Das Selbst ist verkörpert, und eine reanimierte Hannah Jacques ist nach wie vor Hannah Jacques, genau wie eine Hannah Jacques, die an Demenz leidet, nach wie vor Hannah Jacques ist.«
»Und wer ist dann ein Heimianer?«, fragt die Talkmasterin.
»Die Heimianer sind infolge eines Selbst-Völkermords, der sich als verzweifelter Versuch zu überleben ausgibt, alle tot. Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage: Wenn die Heimianer ihr Selbst in ihre menschlichen Gefäße herunterladen, verbleibt dann eine Kopie auf dem Server? Wenn ja, wer ist der Heimianer, die Kopie auf dem Server oder die in dem menschlichen Körper?«
»Wir sind mit unserer Zeit am Ende. Ladies und Gentlemen, das war Hannah Jacques.«
Als der Applaus erstirbt und die Mikrofone abgekühlt sind, flüstert die Moderatorin Hannah zu: »Das wird Ihrem Mann nicht gefallen.«
»Ihre Augenbrauen sind unsauber ausgezupft«, erwidert sie und geht.
SCHWESTER SOLEDAD
Femi kneift die Augen zusammen, als man sie holen kommt. Normalerweise verbringt sie dreiundzwanzig Stunden am Tag allein in Dunkelheit, bei Wasser und Brot, mit einem Eimer in der Ecke als einzige Hygienevorkehrung, in dem demütigenden Wissen, dass man sie durch die Infrarotkamera in der Decke beobachtet. Sie hat aufgehört, die Tage zu zählen, aber sie weiß, dass sie seit etwa achtzehn Monaten ohne Verfahren in Haft ist. Nach den ersten sechs Monaten hat sie aufgehört, ihre Periode zu bekommen: Unterernährung. Einmal im Monat wird sie von einem gleichgültigen Arzt untersucht. In der täglichen Stunde Sonnenlicht, die man ihr zugesteht, untersucht sie ihre wunden Stellen, ihre Fingernägel und ihre Hautfarbe, um festzustellen, wie weit ihr Vitamin- und Mikronährstoffmangel schon fortgeschritten sind. Das Brot ist oft angeschimmelt, und sie hofft, dass die entsprechende Penicillin-Spezies ein geringes Maß an antibiotischer Wirkung hat und vielleicht auch ein paar brauchbare Mineralstoffe produziert.
Ihr Verstand.
Es gab einen Punkt, an dem Femi sich sicher war, den Verstand verloren zu haben, aber inzwischen hat sie ihre Meinung geändert.
Man hat sie nicht verhört, man hat sie nicht gefoltert und nicht missbraucht. Technisch gesehen betrachten die UN diese Art von Haft als Folter, aber wer hört schon noch auf die? Die UN beschäftigen sich nur noch mit ihren internen Querelen, seit die USA raus sind und England nicht stark genug war, Russland und China in Schach zu halten.
Hast du Angst?
Nein. Klar, sie haben die Kontrolle über meinen Körper, aber mein Verstand ist immer noch stärker als der von denen allen zusammen. Sie werden mich nicht brechen, wenn du das meinst.
Und vor dem Tod?
Wenn ich heute sterbe, dann sterbe ich nicht mehr, wie es in dem Lied heißt.
Ich brauche dich aber lebend.
Meine Liebe, ich unterhalte mich wirklich gerne mit dir, aber im Moment kann ich nicht für mein Überleben garantieren. Vielleicht sehen sie, wie ich mit der leeren Luft rede, und bringen mich in eine Heilanstalt.
Ich habe dir noch eine Menge zu erzählen …
Wenn nötig, kommt Femi mit Isolationshaft klar. Leicht ist es nicht, aber sie schafft das schon. Zu ihrem Vorteil weiß sie genau, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, und das macht anderen Leuten zu schaffen, weil man sie nicht einwickeln kann und sie nur selten unsicher ist oder sich schämt. Die Wahrheit ist, dass es eine unerwartete Besucherin gibt, die regelmäßig ihre Zelle aufsucht, und dass ihr dadurch die Monate hier erträglicher geworden sind. Aber ihre Häscher wissen das nicht, und Femi nimmt an, dass ihre Gelassenheit ihnen Rätsel aufgibt.
Es ist noch nicht an der Zeit für ihre Stunde Frischluft und Bewegung, deshalb wundert sie sich, als man sie holen kommt. Es ist noch Vormittag, weshalb das Licht ihr ungewohnt hell erscheint. Normalerweise gewährt man ihr die eine Stunde abends. Vielleicht hatte Jack Jacques ja endlich genug Arsch in der Hose, um ihre Hinrichtung anzuordnen? Femi ist nicht bereit zu sterben, aber sie hat schon vieles getan, wenn es nötig war, auch ohne dafür bereit gewesen zu sein.
Sie bringen sie vor einen bedeutungslosen Bürokraten, der sich anscheinend für ein großes Tier hält und ihr sagt, dass man sie morgen freilassen wird, ohne ihr einen Grund dafür zu nennen. Das als Freiheit zu bezeichnen, ist allerdings eine Übertreibung, denn sie wird lebenslänglich aus Rosewater verbannt.
»Ich möchte mit Kaaro sprechen«, sagt sie. »Nicht am Telefon; im selben Zimmer. Heute noch.«
WENIG BEGEISTERT
Man fragt sie nach ihrem Namen.
»Lora Asiko.«
Sie wollen wissen, wie alt sie ist. Optionen: wahrheitsgemäß/schnippisch. Schnippisch.
»Das verrät eine Dame nie.«
Gelächter.
Man fragt nach ihrem Beruf.
»Ich bin die ausführende Assistentin von Bürgermeister Jack Jacques.«
Man fragt sie nach ihrer Lieblingsspeise.
»Schokoladeneis ohne Streusel.«
Man fragt sie nach ihrem Geburtsort.
Fehler beim Abrufen der Daten.
»Tut mir leid, das habe ich nicht ganz mitbekommen.«
Frage wiederholt.
Fehler beim Abrufen der Daten.
#Gefahr_einer_Wiederholungsschleife
Raten/Lügen.
»Ich wurde in Lagos geboren, wie der Bürgermeister.«
Man fragt sie, warum sie nervös sei.
»Der Bürgermeister muss schon zu lange auf mich verzichten. Er braucht mich, damit ich mich um seine Geschäfte und sein Leben kümmere. Ich möchte schnell zu ihm zurück.«
Man fragt sie nach der Quadratwurzel von 8936.
»94,53.«
Man fragt sie, was die Worte »Mo beru agba« bedeuten.
»Ein Satz auf Yoruba, der wörtlich übersetzt bedeutet ›Ich fürchte meine Älteren‹, aber in Wirklichkeit die Angst vor übernatürlichen Wesenheiten wie Zauberern und Hexen zum Ausdruck bringt. Durch die Hintertür wird damit auch der Wunsch vermittelt, im Alter Respekt zu genießen oder gefürchtet zu werden, oder es handelt sich um den Appell, sich in jungen Jahren gut zu benehmen, damit man, wenn man älter ist, ein ruhiges Leben führen kann. Glaube ich.«
Man fragt sie –
#Stopp.
#Es_besteht_keine_weitere_Notwendigkeit_zur_Beantwortung_von_Fragen.
#Sie_wissen_dass_du_funktionsfähig_und_einsatzbereit_bist.
»Ich möchte keine Fragen mehr beantworten. Ich möchte gehen.«
Man fragt sie –
#Stopp.
»Ich gehe. Auf Wiedersehen.«
SIE WEISS ES
Ich weiß, was Eric macht. Ich kenne den genauen strategischen Wert des Söldners Dahun als Druckmittel. Ich habe auch gewusst, wie viel Zeit ich mit Femi haben würde, aber es war nicht genug.
»Ich weiß zu viel«, sage ich in die leere Luft hinein. Meine Stimme scheint meinen Mund zu verlassen und ein paar Zentimeter vor meinem Gesicht zu verharren. »Oooooohhh! Aaaahhhhh!«
Kein Echo.
»Die Frau, die zu viel wusste!«
Ich werde wieder ernst und aktualisiere meine Tafel.
KLEIDUNG
Bad Fish findet Kaaro wieder. Ein Software-Update war das Problem. Er überzeugt sich visuell mithilfe der nächstgelegenen Kameras.
Was zum Teufel hat der Kerl an?
SPACEMAN
Anstatt Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um ihn räumlich zu isolieren, fordert man Kaaro im Gefängnis dazu auf, einen Ganzkörperanzug mit einem Visier zu tragen, das der Welt eine blassgrüne Tönung verleiht. Er sieht aus wie ein Astronaut, vermutet aber, dass der Anzug wahrscheinlich nicht nur dazu dient, ihn von den Mikroben abzuschirmen, die die Xenosphäre bilden, sondern auch als Verkleidung. Darin ist es heiß und ungemütlich, insbesondere unter den Achselhöhlen, an den Ellbogen und im Schritt, wo das Material Falten wirft. Er ist sich außerdem sicher, dass der daran befestigte Luftbehälter alt und fast leer ist, weil das Atmen ihn anstrengt und das, was in seinen Lungen ankommt, sich eindeutig nicht frisch anfühlt. Wahrscheinlich hätte er vorher noch mal aufs Klo gehen sollen, denn jetzt will er pissen. Er fragt sich, wo sie den Anzug herhaben.
Zwei bewaffnete Wärter führen ihn tief ins Innere der Anlage und geben ihm dabei mit den Händen an seinen Ellbogen Halt, weil er in dem Anzug so unbeholfen ist. Zumindest riecht er so den ganzen Dreck hier nicht.
Er sieht keine anderen Gefangenen, obwohl gelegentlich der eine oder andere Wärter am Rande seines Blickfelds auftaucht und ihn zusammenzucken lässt. Vielleicht gibt es hier gar keine Häftlinge mehr. Die einen hat man nach ihrem Tod als Gefäße für die Außerirdischen benutzt, andere zum Dank für ihre Dienste im Befreiungskrieg entlassen. Kaaro hat auch in diesem Krieg mitkämpfen müssen und dabei Freunde verloren. Er hat neue Fähigkeiten erlernt und versuchte sich im Töten.
Schließlich liefern sie ihn in einer drei mal drei Meter großen Zelle ab. Eine einzige nackte Glühbirne hängt dunkel von der Decke, in den Ecken sind Spinnweben, Geckos hängen im 45-Grad-Winkel träge an den Wänden. Die Yoruba töten keine Geckos, weil es heißt, dass sie über die Stabilität der Bauwerke wachen und dass ein Haus zusammenstürzen kann, wenn ein Wand-Gecko stirbt. Zwei staubige Holzstühle stehen nebeneinander und sehnen sich nach einem Tisch. Kaaro zieht einen davon herum, sodass die Stühle einander gegenüberstehen, und setzt sich. Der Stuhl knarrt unter seinem Gewicht.
Er muss nicht lange auf Femi warten.
Sie ist ausgemergelt, der blaue Overall hängt schlabbrig an ihr herab. Ihr Haar ist kurz, ihre Augen sind eingefallen, an den Füßen trägt sie Flipflops. Sie ist nicht der Mensch, den er vor achtzehn Monaten noch gekannt hat. Der Wärter steht neben der Tür, während Femi hereinschlurft und sich auf den Stuhl gegenüber setzt. Kein Schmuck, keine Schminke: Die Schönheit dieser Frau ist nach Monaten der Verwahrlosung nur noch zu erahnen. Aber sie ist nicht besiegt. Ihr Blick ist immer noch stählern und kalt, ihre Entschlossenheit unvermindert. Hat man sie gefoltert?
»Was haben sie mit dir … gemacht?«, fragt Kaaro.
»Unwichtig. Kaaro … es ist schön, dich zu sehen, wenn auch nur durch einen Raumanzug. Wie geht es Aminat? Du warst immer mein Lieblingsagent, wusstest du das?«
»Du musst mir nicht schmeicheln, Femi.«
»Das versuche ich auch nicht. Ich habe mir mehr für dich gewünscht, aber du warst mit deinem Penis beschäftigt.«
»Brauchst du einen Anwalt? Ich kann …«
»Nein, brauche ich nicht. Hör zu, du musst diesen Helm abnehmen.«
»Was? Wenn ich das mache, dann werden die Xenoformen auf meiner Haut …«
»Innerhalb von Nanosekunden ein Netzwerk bilden, und dann bist du sowohl in meinem Gehirn als auch in dem von dem Trottel dort an der Tür. Ja.«
»Und das willst du?«
»Früher warst du nicht so schwer von Begriff, soweit ich mich erinnere. Hör jetzt zu, ich weiß nicht, wie lange ich die Freiheit genieße, mit dir zu sprechen. Lies meine Gedanken, und zwar schnell. Lies alles, oder zumindest alles, wofür du Zeit hast. Los.«
Kaaro beginnt, den Helm abzulegen und zählt die Sekunden, bis der Wärter begreifen wird, was hier vorgeht, und entweder Alarm auslöst oder versucht, ihn aufzuhalten. In Kaaros Kopf …
Anfangs hängte man die Leute an Bäumen auf, insbesondere, wenn Jesus vom Kreuz herunterkam und einen der Insubordination bezichtigte, weil das eigene Team die letzten sieben Endspiele verliert. Die Gehenkten entleeren sich manchmal, sodass ihre Beine mit Fäkalien beschmiert sind. Dynamische Rosewater-Sportler, die bei dem Versuch, als Training den Zügen davonzulaufen, auf den Gleisen sterben. Kapiert? Training? Lies den angehängten Text fünf Jahre lang einmal täglich, und du kannst zusehen, wie dein Haar weiß und dein Hirn zu einem flüssigen Brei wird. Die Leute werden kommen, um dein Haar zu sehen. Sie werden bis aus deinem Garten hinaus und bis weit auf die Straße Schlange stehen, wo sie einen Stau verursachen. Eine rechtschaffene Nachbarin, ein Akoluthin und hochrangige Speichelleckerin des Premierministers, wird ausrasten und mit einer Maschinenpistole auf sie draufhalten, bis alle tot sind. Die Nachbarin wird schließlich selbst mit einer Hüpfburg hingerichtet werden, nachdem man ihr den Prozess dafür gemacht hat, dass sie die Nummernschilder von außerhalb eines Zoos abgestellten Autos verschmutzt hat. … was keine Rolle spielt. Als Kaaro langsam mit seinen neuen Gedanken zurechtkommt, liegt er bereits auf dem Boden, trägt Handschellen und wird von herumbrüllenden Leuten festgehalten. Seine Wange wird auf den Beton gepresst, seine Nase in den Staub, und er starrt Femi an, die ebenfalls Handschellen trägt und seinen Blick starr erwidert.
»Mach dir keine Sorgen«, sagt Femi.
Kaaro spürt schwere Tränen in seinen Augen.
»Es ist alles in Ordnung«, sagt Femi.
Das ist es, was sie die ganze Zeit im Kopf hatte? Das trägt sie mit sich herum?
»Ich liebe dich«, sagt er. Es ist keine romantische Gefühlsgeste. Es ist das, was passiert, wenn man ein anderes menschliches Wesen wirklich versteht, wenn man absolute Empathie mit ihm empfindet, wie es bei ihm und Nike Onyemaihe war, der einzigen anderen Person, mit der er jemals so umfassend sein Gehirn geteilt hat. Es ist das Wissen um ihre Geschichte, ihre Fehler, woher ihre Fehler kommen, ihren Schmerz, ihr Leid, ihr verschrumpeltes, verstecktes Herz. Es ist die Liebe, die man als Bruder oder Schwester oder Tante verspürt, die Art Liebe, die durch widrige Umstände vielleicht angekratzt wird, aber weiterbesteht.
»Ich komme schon zurecht, Kaaro«, sagt sie. Sie brüllt es, damit man sie inmitten des panischen Geschreis der Wärter hören kann.
»Ich weiß«, sagt er.
Sie zerren sie aus dem Zimmer. »Ich melde mich.«
Ich weiß.
DORT, JETZT
Nachdem Gebete an Koriko gesandt und die Grenzroboter zurückgepfiffen wurden, treffen sich verfeindete Kontingente aus Nigeria und Rosewater an der Nordgrenze des Stadtstaats. Eric steht oben auf einer sanften Anhöhe und behält alles wachsam im Blick. Es ist Abend, der Himmel färbt sich im schwindenden Licht blutrot. Der Tentakel wickelt sich träge um seinen Hals und löst sich wieder. Sie bilden eine fast vollkommene Einheit, er und dieses Etwas, obwohl Eric sich manchmal daraus löst, um sich wieder wie ein Mensch zu fühlen, wenn auch nur für ein paar Minuten. Der Tentakel macht den Menschen Angst, und sie glauben, er sei etwas Außerirdisches, obwohl er von einem Menschen erschaffen wurde.
Ein Lieferwagen trifft auf der Rosewater-Seite ein und kommt mit verlöschendem Scheinwerferlicht zum Stehen. Die Sicherheitsleute öffnen die Hecktür, und eine dünne Femi Alaagomeji wird herausgeführt. Der Tentakel zuckt, wahrscheinlich wegen Erics aufwallendem Zorn, und er zwingt sich zur Ruhe. Diese Frau, diese tatkräftige, wunderschöne Frau, die ihm das Leben gerettet hat, war eingekerkert, und erst jetzt konnte er sie freibekommen. Was sie ihr angetan haben. Er bedeutet seinen Leuten, Dahun zur Übergabestelle zu bringen. Manche von der Behörde haben Erics Plan mit Sorge betrachtet; immerhin war Dahun ein Söldner, und der Bürgermeister hegt keinerlei Loyalitäten für ihn. Aber Eric hat die Lage anders eingeschätzt und recht behalten. Letztendlich geht es darum, welche Art von Menschen der Bürgermeister schätzt und wie er seine Leute behandelt, ob sie nur Dienstleister sind oder nicht.
So nah bei Rosewater verspürt Eric eine gewisse Unruhe, weil er weiß, dass Kaaro sich dort befindet: Kaaro, der Greif, Kaaro, der ihn gewarnt hat, nicht in die Stadt zurückzukehren, und der, ganz beiläufig und ohne sich dafür anzustrengen, sein Gehirn übernommen hat. Er ist zu mächtig, als dass Eric gegen ihn kämpfen könnte, obwohl sie beide die letzten überlebenden Empfänger sind und ohnehin zusammenarbeiten sollten.
Eric verharrt bei dem Austausch in respektvollem Abstand. Er will nicht versehentlich Femis Gedanken lesen.
Sechs Stunden später, während er immer noch in einem voluminösen, zu großen Kapuzenpulli, mit dem er seinen Tentakel verdeckt, vor ihrer Suite im Hilton steht, wird er hereingerufen. Femi trägt einen lilafarbenen Bademantel, ihr Haar ist jetzt noch kürzer geschnitten und nicht frisiert. Sie ist zwar nach wie vor knochendürr, aber irgendeine Art von Anspannung hat sie verlassen. Das sollte man auch erwarten, bei dem, was die Regierung für das Zimmer hier bezahlt. Ein Kollege von Eric, der im Gefängnis war, sagt, dass man den Gestank nie wieder ganz loswird. Das mag stimmen, nur nicht bei Femi. Er ist sich auch bewusst, dass sie eine Schicht Anti-Pilzmittel überall auf der Haut trägt. Niemand traut einem Empfänger.
»Ich bin bereit, Ihren Bericht entgegenzunehmen und Sie auf den Stand der Dinge zu bringen, Ma’am«, sagt Eric.
»Nicht nötig«, sagt sie. »Nichts ist passiert, außer dass man mich in eine Kiste ohne Kontakt zu anderen Menschen gesperrt hat. Ich brauche keine Unterstützung, und ich habe mich bereits wieder gefangen, während ich im Bad war. Ist meine Bestellung eingetroffen?«
Eric hält sein Handgelenk an ihres. Mit Bestellung meint sie die S45-Autorisierungen und -Beglaubigungen, die bei ihrer Gefangennahme deaktiviert wurden.
»Danke, dass Sie mich holen gekommen sind, Eric«, sagt sie. »Das vergesse ich Ihnen nicht.«
»Ja, Ma’am.« Beinahe fragte er sich, ob er sie in den Arm nehmen sollte. Beinahe. »Wie lauten meine Befehle, Ma’am?«
»Unser Ziel, Eric, besteht darin, die Welt vor Rosewater zu retten. Ab sofort müssen wir die Stadt als Vorposten außerirdischer Invasoren betrachten. Und wir stellen uns ihnen entgegen.«
»Haben wir die nötigen Ressourcen?«
»Der Präsident hat mir versichert, dass ich alle Ressourcen bekomme, die ich brauche, und die Afrikanische Union und der Verbund der Karibikstaaten halten derzeit vertrauliche Beratungen ab, um eine Koalition zu bilden. Aber bisher steht Nigeria allein.«
»Ja, Ma’am.«
»Wir haben allerdings unerwartete Verbündete.«
»Unerwartete Verbündete?«
Eine der Schlafzimmertüren öffnet sich, und eine Frau tritt ein. Im Gegensatz zu Femi ist sie hochgewachsen, aber kräftig, und sie hat Afro-Puffs. Sie hebt die Hand auf Schulterhöhe und winkt Eric halbherzig zu.
»Eric, ich möchte dir Oyin Da vorstellen.«
KAPITEL 1
Meine früheste Erinnerung ist die an die Namensfeier eines Nachbarn im Dorf Arodan. Ich bin mit meinem Vater dort und halte die ganze Zeit über seine Hand.
Ein Yoruba-Kind bekommt nicht einfach irgendeinen Namen, wenn es geboren wird. Namen bedeuten etwas in Bezug auf die Person und sollten im Einklang mit dem Willen ihrer Vorfahren stehen. Mein voller Name ist Oyindamola, allerdings nenne ich mich Oyin Da. Er bedeutet »Süße/Honig gemischt mit Reichtum oder Wohlergehen«; ein guter Name, einer, von dem der Ifa-Priester sagte, dass meine Ahnen ihn guthießen. Ich bin nicht süß und war es auch nie, aber das hat meinen Eltern nichts ausgemacht.
Die Zeremonie findet auf dem Hof der Eltern des Babys statt. Es gibt eine Tribüne, auf der ein verzierter hoher Tisch steht. Die Eltern sitzen mit dem Baby am Tisch, während die Gemeindevorsteherin, eine gedrungene Frau namens Doyin, mit eindringlichem Blick und einem Mikrofon in der Hand eine Rede schwingt. Mein Vater deutet auf einen Fremden links des Podiums, der einen mit Handschellen angeschlossenen Aktenkoffer in der linken Hand hält. Er kommt von der Regierung, ein Standesbeamter, der allen Geburten und Namensfeiern beiwohnen muss. Früher haben die Leute ihre Kinder nach der Geburt selbst registrieren lassen, aber inzwischen ist das anders.
Ich sehe zu. Doyin beginnt ihre Rede mit einem Gebet. Früher hätte sie die Ahnen angerufen, aber mit den Missionaren, dem Kolonialismus und dem Fundamentalismus amerikanischer Machart sind im zwanzigsten und frühen einundzwanzigsten Jahrhundert christliche Gebete vorherrschend geworden. Die Yoruba sind erst vor Kurzem zur Ahnenverehrung zurückgekehrt, als die Rolle der Fundamentalisten bei der Beinahe-Zerstörung der Welt deutlich wurde. Als das Anfachen apokalyptischer Ereignisse weder zum Armageddon noch zur Entrückung führte, geriet es außer Mode, die Eschatologie zu verinnerlichen, und die verbliebenen Christen waren entweder nur noch dem Namen nach Christen oder Randgestalten.
Doyin schenkt den Ahnen ein, und das Kind erhält seine Namen. Es bekommt vier, die, da sind sich alle einig, Glück und Kraft verheißen. Dazu gibt man ihm eine Kostprobe der sieben Geschmäcker des Lebens: Wasser, Salz, Honig, Palmöl, Kolanuss, Bitternuss und Pfeffer. Sie werden dem Kind nur behutsam auf die Lippen gestrichen, jeweils begleitet von einem Gebet für ein langes und erfolgreiches Leben, das immer ein Wortspiel zu dem Geschmack enthält.
Nach dem Pfeffer tritt der Standesbeamte vor und öffnet seine Aktentasche. Er nimmt eine kleine Dose heraus, die ein bisschen aussieht wie ein Schmuckdöschen für einen Verlobungsring, und bricht für alle sichtbar das Siegel. Dann überreicht er das Döschen Doyin, die es in Augenschein nimmt und sich der Menge zuwendet.
»Ich bezeuge, dass dies kein Ariyo-Chip ist.« Damit meint sie die Chip-Marke, die in Nigeria so berüchtigt für ihre Fehlfunktionen ist, dass diese Worte zu einem integralen Teil der Zeremonie geworden sind.
Sie gibt das Döschen dem Standesbeamten zurück, der bereits einen Injektor bereithält. Er nimmt einen Chip aus dem Döschen, lädt den Injektor und drückt ihn gegen den Hals des Babys. Als er abdrückt, ertönt das typische abgehackte Zischen, und die Menge bricht in Singen und Gelächter aus. Der Standesbeamte hält sich nicht weiter auf. Das Baby weint, und die Mutter zieht eine pralle Brust hervor, um es zu stillen.
»Habe ich auch so einen bekommen, Daddy?«, frage ich.
»Ja.«
Die frühesten Bemühungen der nigerianischen Regierung, alle Bürger mit ID-Implantaten auszustatten, waren eine Katastrophe, weil diejenigen, mit denen man den Pilotversuch durchführte, giftige Chips bekamen, die sie erst mit Schwermetallen in den Wahnsinn trieben und sie schließlich umbrachten. Natürlich nicht alle, aber etwa siebzig Prozent, ein PR-Desaster, insbesondere, da man nicht mit Sicherheit sagen konnte, dass die Probanden überhaupt Chips gewollt hatten. Die Sache wurde zu einem Kampfthema für Verfechter der Privatsphäre und hatte ein jahrzehntelanges Stocken des ID-Programms zur Folge. Doch heutzutage läuft es wie eine gut geölte Maschine. Die Leute bekommen bei der Geburt ihre Chips, die dann im Alter von zehn und neunzehn noch einmal versetzt werden.
Während mein Vater dem jungen Paar einen Umschlag gibt, betrachte ich den Hals des Babys und entdecke den roten Punkt dort, wo man den Chip eingesetzt hat.
»Komm«, sagt mein Vater. »Gehen wir in den Wald.«
Mein Vater ist kein typischer Yoruba oder Nigerianer. Er wird jung sterben, aber solange er lebt, ist jeder Tag eine Überraschung. Zum einen hat er keinen Beruf, und das unterscheidet ihn von den anderen Männern im Dorf, aber wenn ich sage, dass er keinen Beruf hat, meine ich damit nicht, dass er nicht arbeitet, ich meine, dass er sich nicht auf eine Sache festgelegt hat. Er verfügt über eine Vielzahl von Fertigkeiten und macht jeden Tag das, wonach ihm ist. Er kann jagen, schlachten, zimmern, mauern, und seine natürliche Neugier treibt ihn dazu, an Maschinen herumzubasteln.
Nachdem wir nachgesehen haben, ob alle Fallen noch in Ordnung sind, gehen wir zum Cashew-Baum und sammeln die herabgefallenen Nüsse in eine Zwei-Liter-Blechdose. Vater gräbt ein Loch und macht darin Feuer, und dann hängen wir die Dose darüber, sodass die Flammen an ihr lecken. Wenige Momente später hören wir das Zischen und Knacken der Cashews, die geröstet werden. Die fleischigen Teile sammeln wir in einem Eimer – in diesen Mengen können sie ätzend sein. Als die Schalen knusprig und schwarz sind, brechen wir sie auf und holen die Nüsse raus, ohne dass ich mich ein einziges Mal verbrenne. Das Gesicht meines Vaters ist wie ein ruhiger Teich. Wenn ich etwas mit besonderer Begeisterung tue, lächelt er, schweigt aber weiter.
Später, als wir einmal mehr die Fallen überprüfen, haben wir zwei Rohrratten und eine Buschratte. Vater hebt mich hoch und setzt mich auf die Bambusbank. Ich kichere, als er mir die Füße wäscht. Er schneidet frischen Bambus und trennt die Stängel der Länge nach auf. Anschließend häutet er die Tiere, schneidet sie in kleine Stücke und legt sie in die Höhlung eines halbierten Bambusstocks. Er presst den Cashew-Saft über das Fleisch und fügt die Nüsse und ganze wilde Chilischoten hinzu, die wir unterwegs gesammelt haben. Dann bedeckt er die Höhlung mit grünen Bambusblättern und wiederholt das Ganze mit einem weiteren Stück Bambus. Er entzündet das Feuer wieder und legt dann die beiden Bambuspfannen hinein.
»Was willst du werden, wenn du groß bist?«, fragt er.
»Die Schlaueste von allen«, sage ich.
Er lächelt und hat vielleicht sogar leise gelacht. »Ich glaube nicht, dass deine Mutter es zwischen zwei Besserwissern aushalten würde.«
Wir essen das gedünstete Fleisch im Bambushain aus Bambusschüsseln, in dem Bambusunterstand, den er gebaut hat. Die Schatten sind länger geworden, und ich sitze im Schatten meines Vaters. Ich rieche seinen Schweiß und höre ihn kauen und ab und zu leise rülpsen. Als er mich hochhebt, döse ich schon vor mich hin, und sein wiegender Gang auf dem Heimweg schaukelt mich endgültig in den Schlaf.
Ich erwache und wälze mich herum, als mir klar wird, dass wir nicht zu Hause sind, sondern in der Werkstatt, wo mein Vater an irgendeiner Monstrosität herumbastelt. Ich schlafe wieder ein, bevor er merkt, dass ich wach bin.
Meine Mutter schreibt einen einzigen Satz mit vierhundert Worten auf Yoruba nieder und erklärt mir, warum er bedeutungslos ist. Sie bringt mir bei, dass das die Essenz von Politik ist: viel zu sagen, aber nichts auszusagen. Meine Mutter ist warmherzig und eine sanfte Erscheinung, sie besteht ganz aus Kurven und Rundheit, die einen scharfen Kontrast zu ihrem Verstand bilden. Sie hat keinen ID-Chip. Ein Volkszähler hat sie deshalb einmal ins Gebet genommen, und sie hat ihn mit verbaler Hypotaxe zu Tode geprügelt. Natürlich nur im metaphorischen Sinne.
Englisch lerne ich erst mit zehn, als mein Vater bereits fort ist.
Ich habe nie gesehen, wie meine Eltern sich geküsst haben, obwohl ich aus irgendeinem Grund viele Jahre lang denke, dass ich das hätte. Aber später, als ich mir diese Zeit noch einmal ansehe, wird mir klar, dass das nicht stimmt. Liegt es an mir? Ist das die Geschichte, die Kinder, die ihre Eltern verlieren, für sich erschaffen? Oder verändert sich die Vergangenheit in kaum merklicher Weise?
Arodan, unser Dorf, ist für genau eine Sache bekannt: Es liegt in der Nähe von zwölf Windkanälen, die man für das missglückte nigerianische Raumfahrtprogramm gebaut hat. Als die Gelder versiegt sind, haben die Arbeiter einfach alles stehen und liegen lassen und sind abgehauen. An einem Tag war der Ort ein geschäftiger Ameisenbau; am nächsten verlassen. Ich habe mir die Windkanäle angesehen, in ihnen herumgeschrien, bis mein eigenes Echo mir Angst gemacht hat. Wie eine Zwergin stand ich vor den riesigen Ventilatoren, jedes einzelne Blatt fünfmal so groß wie ich. Ich stelle mir vor, wie sie sich bewegen, erst langsam, dann schneller, als das Auge folgen kann. Die Tunnel füllen sich mit eingebildeter Luft und pusten mein geistiges Selbst weg wie Laub im Wind. Von innen sehen die Kanäle aus wie der Bauch eines Betonleviathans, gebläht von Fäulnisgasen. Ich bin ein unverdauter Bissen, der allein inmitten von Abfall steht.
»Daddy, erzähl mir was von Aliens«, sage ich.
»Sie haben grüne Haut und kommen vom Mars.«
»Daddy …«
»Sie haben Raumschiffe aus Maiskolben und Sekundenkleber. Sie müssen eine Menge Bohnen essen.«
»Daddy …«
»… weil ihre Raumschiffe von …«
»Ich erzähle Mutter, dass du es mir nicht sagen willst.«
»Aliens … Aliens sind nur in London ein Problem, mein kleiner Liebling.«
»Warst du mal in London?«
»Ich war in Birmingham, aber ich weiß, wie es in London ist.«
»Wie ist es?«
»London ist wie Lagos. Aber es ist auf dem Blut anderer errichtet und das Zuhause von Banditen und Freibeutern.«
»Und Aliens!«
»Und Aliens.«
Mein Vater ist sehr streng in dem Sinne, dass er mich mit nichts davonkommen lässt, aber sofort, nachdem ich meine Strafe bekommen habe, ist er wieder warmherzig und liebevoll zu mir.
Deshalb mache ich manchmal mit Absicht Verbotenes.
Arodan ist ein Dorf, das sich an einen sanft ansteigenden Hügel schmiegt und sich westwärts auf die Ebene erstreckt, bis zum Ufer eines namenlosen Yemaja-Zuflusses. Wenn man es so beschreibt, klingt es groß, aber zwischen den Häusern gibt es eine Menge Platz. Dieser Flecken Land wurde schon zweimal neu besiedelt, zum ersten Mal, nachdem eine britische Strafexpedition das Dorf wegen irgendeines dem Dunkel der Vergangenheit anheimgefallenen Vergehens dem Erdboden gleichgemacht hatte, und dann noch einmal um 1956, als man alle Bewohner tot vorgefunden hatte, zerfleischt von wilden Tieren.
Es gibt hier seit jeher einen gewissen Druck, provinziell zu bleiben. Jedenfalls kennen alle Familien einander. Ja, wir haben alle ID-Chips, aber es gibt nur eine einzige, ungepflasterte Straße, die Arodan ans Verkehrsnetz anschließt, und trotz zahlreicher Fußwege gibt es nur einen befahrbaren Weg den Hügel herab und durch die Dorfmitte. Wir haben ein bisschen Strom, Trinkwasser aus Brunnenschächten, eine Kanalisation, eine Post, aber mehr nicht. Zum nächsten Kino fährt man anderthalb Stunden, und niemand besucht jemals Arodan.
Weshalb es sich immer herumspricht, wenn jemand Fremdes in die Stadt kommt.
Weshalb es zugleich eindrücklich und seltsam ist, dass diese Frau, die unser Dorf besucht, mich ansieht. Mein erster Eindruck von ihr ist der von einer Person, die vollkommen mit sich im Reinen ist. Man spürt es, noch bevor man ihr Äußeres wahrnimmt, ihre dünne Gestalt, ihre helle Haut, ihre hellbraunen Augen, ihr blaues Batik-Wickelkleid, das ihr bis knapp über die Brüste geht, ihre nackten Arme und Füße. Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist. Unreif, wie ich bin, gibt es für mich nur vier Altersklassen: Baby, Kind, erwachsen und alt. Sie ist erwachsen.
»Oh. Du wiederholst gerade«, sagt sie. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Es kommt nicht darauf an, denn im nächsten Moment verschwindet sie. Ohne Drama, ohne funkelnde Lichter, ohne sich aufzulösen, sie ist einfach erst da und dann nicht mehr da.
Manchmal diskutiere ich mit mir selbst über diese Erinnerung und überlege, ob ich mir die Frau nicht doch eingebildet habe. Niemand sonst hat sie an diesem Tag gesehen, und obwohl ich sie nie zuvor gesehen hatte, konnte ich ein Gefühl von Vertrautheit nicht abschütteln.
Das gehört zu den wenigen Dingen, die ich meinem Vater nie erzählt habe.
Priester in Rot streifen durch die rauchenden Trümmer eines Hauses, das bei dem nächtlichen Gewittersturm zerstört worden ist; mein Vater und ich stehen in der Zuschauermenge, die sich versammelt hat. Es ist die stillste Menge, die man je gesehen hat; keine Menschenseele spricht ein Wort. Außer mir. Ich frage, wer die Leute in Rot sind.
»Sango-Priester«, sagt mein Vater. »Der Blitz ist letzte Nacht in das Haus eingeschlagen. Sango ist der Gott des Donners, und jede Wohnstatt, die auf diese Weise zerstört wurde, muss vor ihrem Wiederaufbau gereinigt werden.«
»Ich habe nicht den Eindruck, dass sie etwas reinigen. Eher, dass sie etwas suchen.«
Mein Vater nickt. »Den Donnerstein, den Donnerschlag-Stein. Der Prozess kann erst beginnen, nachdem sie die steinerne Manifestation des Blitzes gefunden haben.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Sie werden einen hübschen Stein finden, den sie als Donnerstein bezeichnen, und dann fangen sie mit der Reinigungszeremonie an.«
Und so geschah es.
Später am selben Abend, während er an der Maschine arbeitet, erzählt er mir, dass sie nicht wirklich einen Donnerstein finden werden. Sie werden irgendeinen interessanten Kiesel finden und beschließen, dass es sich um den Donnerstein handelt. Ich frage ihn, warum sie das dennoch alles machen. Er sagt, dass die alten Traditionen die Gemeinschaft zusammenhalten. Ich solle mir nur einmal einen armen Menschen vorstellen, dem gerade sein Haus abgebrannt ist und der dazu noch eine Verletzung erlitten oder ein Familienmitglied verloren hat. Ein Besuch von einem Gott gibt ihm das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Und wer immer später in dem Haus lebt, wird sich sicherer fühlen. Ich sage, dass diese Sicherheit ein Schwindel ist.
»Unterschätze niemals die Wirkung von Neurotransmittern«, sagt mein Vater.
Einen Monat später überreicht er mir mit einem Zwinkern eine Halskette aus Donnersteinen.
Wir sollten über die Maschine reden.
KAPITEL 2
Obwohl ich die Engländer nur ungern ins Spiel bringe, komme ich wohl nicht darum herum. Um die Zukunft zu verstehen, müssen wir die Vergangenheit verstehen, nicht nur als Kontext, sondern als Saat der Katastrophe.
Während der Hochzeiten des British Empire in Nigeria fand ein Schriftstück, das auf das Gestammel eines an Malaria erkrankten, delirierenden Geistlichen zurückging, seinen Weg nach Whitehall. Es umfasste 256 Seiten.
Als Erstes fiel es den Brüdern John und Richard Lander in die Hände, die gerade den Verlauf des Niger kartografierten, und sie brachten es 1831 nach England. John ging damit in Liverpool zum Zoll, ohne es auch nur gelesen zu haben. Als dann Lord Goderich von der Royal Geographic Society sein Patron wurde, nahm er das Schriftstück mit nach London und las es eines schwermütigen Abends, als er seinen Bruder vermisste. Richard war 1832 nach Nigeria zurückgekehrt, wo er sich die Lungenentzündung zuzog, die ihn letztendlich umbringen sollte. Nachdem er den Text zu einem Drittel gelesen hatte, suchte John sofort Goderich auf, um von seinem Fund zu berichten. Am nächsten Tag nahm Goderich das Schriftstück mit nach Whitehall.
Was genau dann geschah, ist nicht ganz klar. Jedenfalls wurden Kopien angefertigt. Eine davon schickte man versiegelt an das British Museum in Bloomsbury, und bei ihr handelt es sich leider um das einzige erhaltene Exemplar.
Der Name des Geistlichen war Marinementus. Auf ihn kommen wir später noch zurück. Er starb jedenfalls im Regenwald irgendwo westlich von Nigeria. Das war wohl sein erster Tod. Bei dem Dokument handelt es sich um eine recht genaue Sammlung von Prophezeiungen. Es sagt den Untergang des Dampfschiffs Lexington