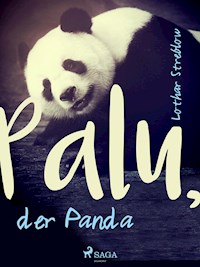Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Tiere in ihrem Lebensraum
- Sprache: Deutsch
Es macht Spaß zu lesen, wie Ruscha und ihr Bruder Slim witzig und unbeholfen in der dunklen Wurfhöhle nach ihrer Geburt herumkrabbeln. Die beiden haben gerade erst laufen gelernt, als sie ihre Höhle verlassen und am Waldrand den nahen Busch entdecken. Ihre nächste große Herausforderung ist es, schwimmen zu lernen. Doch bald haben sie auch diese Fähigkeit gemeistert und tauchen voller Elan in die Tiefen des Sees. Doch auch Gefahren warten auf sie, denn als sie groß genug sind, unternimmt ihre Mutter mit den beiden ihre erste Wanderung in ein Gebiet, das von Menschen besiedelt ist. In dieser spannenden und wundervoll geschriebenen Buchreihe für Kinder von 10-12 Jahren, lernt der junge Leser viele verschiedene Tiere kennen. Direkt durch die Augen des jeweiligen Tieres bekommt man eine faszinierende, erkenntnisreiche und einfühlsame Erzählung von dessen Leben. Dazu erhält man viele wissenschaftliche Informationen über die Umwelt und Lebensweise der Tiere und ihre Gefahren. In vielen Fällen werden unter diese Gefahren auch die Menschen gezählt. Dadurch bringt Streblow den jungen Lesern früh bei, dass bedrohte Tierarten geschützt werden sollten und das Menschen andere Lebewesen respektieren sollten. Diese Reihe macht nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen, beim Lesen Spaß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lothar Streblow
Ruscha, der Fischotter
SAGA Egmont
Ruscha, der Fischotter
Copyright © 1988, 2018 Lothar Streblow und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711807545
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk– a part of Egmont www.egmont.com
„Die Frage nach dem tierlichen Bewußtsein hat die Menschen schon immer gefesselt, weil Haus- und Wildtiere gleichermaßen unsere Bewunderung und Neugier erregen. Sie verlocken uns dazu, in ihre Haut zu schlüpfen und uns vorzustellen, wie ihr Leben sein mag.“
Donald R. Griffin
„Gefühle sind es, die alle Kreatur dazu drängt, etwas zu tun oder, wenn es ängstliche Stimmungen sind, etwas zu unterlassen.“
Vitus B. Dröscher
Am Oberen See
Ein lauer Maiwind kräuselte die weite Wasserfläche, bewegte sacht das Laub der Bäume am Seeufer. Im Schilfdickicht quakte ein Teichfrosch. Ein Bleßhuhn stieg schwerfällig platschend auf. Und ein Graureiher zog mit ruhig schwingendem Flügelschlag am blaßgrauen Himmel seeabwärts. Sonst war es still. Nur der kleine Waldbach, der unweit einer zerzausten Erle in den See mündete, plätscherte murmelnd über herabgeschwemmtes Gestein.
Langsam wich die Nacht dem beginnenden Morgen. Der Horizont bekam einen lichten Schimmer, ließ schon die Sonne ahnen. Aber noch stand der Mond als bleiche Kugel über dem See, warf einen milchigen Schein über das Wellengekräusel, bis die Dämmerung ihn löschte.
Nun verstummte der Teichfrosch. Zwei langgestreckte elegante Schatten umspielten sich unter Wasser, immer wieder, dann trennten sie sich, ein wenig zögernd. Und ein stumpfschnauziger dunkler Kopf mit enganliegendem Haarkleid durchfurchte die Seeoberfläche und tauchte wenige Meter neben der Mündung des Rautenbachs in die Tiefe.
Geschickt wand sich die Otterfähe in den von Unterwasserpflanzen spärlich umsäumten Höhleneingang, spürte Grund unter den Pfoten und glitt schräg aufwärts in den trockenen, weich ausgepolsterten Wohnkessel. Sie war satt, hatte gemeinsam mit ihrem Gefährten ein Teichhuhn und zwei Schermäuse gefangen und später noch einige kleine Fische. Zufrieden leckte sie sich mit der Zunge über die Schnauze. Dann ringelte sie sich sorgsam um ihre beiden schlafenden Jungen.
Dunkel und warm war es in der Höhle. Das winzige Wesen, das neben einem anderen Jungen in der engen Erdkammer lag, sah die Dunkelheit nicht. Seine Lider waren noch geschlossen. Aber es spürte die Wärme, die vertraute Geborgenheit. Und es spürte die Nähe der zurückgekehrten Mutter.
Leise begann Ruscha zu fiepen. Ihr Bettelruf klang wie der Piepslaut eines Hühnerkükens. Die Otterfähe verstand sofort. Aber noch ehe sie bereitwillig ihre Zitzen bieten konnte, spürte sie eine winzige Pfote tastend an ihrem Bauch. Und auch das andere Junge schob ihr drängend seine kleine feuchte Schnauze entgegen.
Plötzlich bekam Ruscha einen tapsigen Schlag auf die Nase. Ihr Bruder Silm war kräftiger als sie. Ungestüm rangelte er an der mütterlichen Milchquelle. Ruscha piepste ängstlich und wehrte Silms Pfote ab. Jetzt war der Weg frei. Endlich konnte sie in Ruhe trinken.
Sie trank lange. Die Milch schmeckte ihr. Sie fühlte sich wohl und wurde müde. Erschöpft ließ sie das Köpfchen sinken. Ihr Bruder trank noch immer, unersättlich und gierig. Und Ruscha schlief ein.
Doch da spürte sie eine feuchte Zunge in ihrem Gesicht. Und eine sanfte, große Pfote wälzte sie herum, während die Zunge über ihren kleinen Körper leckte. Ruscha mochte diese Zunge. Es war ein warmes, zärtliches Gefühl. Und als die Zunge schließlich aufhörte, blieb das Gefühl von Zärtlichkeit.
Ihre Mutter schnurrte leise. Liebevoll umschloß sie die Kleinen ringförmig mit ihrem Körper und dem geschmeidigen Schwanz und legte ihren Kopf und die Vorderpfoten über sie. So waren sie geborgen für den Schlaf.
Gegen Abend hob die Fähe lauschend den Kopf. Oben vor dem Luftschacht ertönte ein leiser Pfiff. Diesen Pfiff kannte sie. Es war ihr Gefährte, der Vater der Kleinen. Er rief sie. Aber sie schätzte es nicht, wenn er der Kinderstube zu nahe kam, auch wenn er die Höhle sicherte und manchmal noch Futter brachte, wie er es kurz nach der Geburt getan hatte, als sie den Bau nur selten verließ. Nur als sie mit Schmerzen angstvoll in den Wehen lag, hatte sein Pfiff sie ein wenig getröstet. Jetzt aber störte sie seine Neugier.
Außerdem knurrte ihr Magen. Es war lange her, seit sie etwas zwischen die Zähne bekommen hatte: Tagsüber ließ sie ihre Kinder jetzt nie allein.
Mit geschmeidigen Bewegungen wand sie sich aus dem Bau. Der Rüde wartete oben neben der Erle, nahe beim Luftschacht. Weiter traute er sich nicht. Wütend fauchte sie ihn an. Und der Rüde zog sich zögernd zurück, glitt langsam ins Wasser. Doch seine Lockrufe verstummten nicht.
Die Fähe beruhigte sich wieder. Sie hatte ihn vom Bau vertrieben, das genügte. Dann folgte sie ihm in den See. Nur ein paar Luftbläschen verrieten ihre Spur.
Ruscha und Silm
Als Ruscha einige Tage später zum erstenmal die Augenlider hob, sah sie zunächst nicht viel mehr als einen fahlen Schimmer, der durch die Öffnung des Luftschachts zwischen den Erlenwurzeln hereinfiel. Das war ein seltsames Erlebnis, denn bisher kannte sie nur das Dunkel. Allmählich aber gewöhnten ihre Augen sich an das schwache Dämmerlicht. Und sie wurde neugierig.
Unbeholfen hob sie ihr Köpfchen. Vor ihr lag ein großes, warmes, pelziges Etwas. Und das duftete sehr angenehm. Diesen Geruch kannte Ruscha: Das war ihre Mutter, wo sie Milch fand, Wärme und Zärtlichkeit. Und daneben lag noch ein kleineres Pelzwesen: das duftete ein wenig anders. Und das war es auch, das sie mitunter stupste, wenn sie bei ihrer Mutter trinken wollte. Ruscha schnupperte aufgeregt. Und ihre kleinen Pfoten tapsten dabei gegen das weiche Fell.
Mit einemmal rührte sich das kleinere Wesen. Ihr Bruder Silm fühlte sich im Schlaf gestört. Unruhig wälzte er sich hin und her. Dann hob auch er den Kopf. Ruscha sah seine kleinen runden Augen, die sie aufmerksam anblickten. Und sie erschrak, als er seine winzige Schnauze aufriß.
Aber Silm gähnte nur. Er hatte schon einen Tag vor Ruscha die Augen geöffnet. Er kannte sich bereits aus. Und jetzt wollte er eigentlich nur schlafen. Mit einem leisen Fieplaut wälzte er sich auf die andere Seite.
In diesem Augenblick erwachte die Fähe. Die Unruhe im Bau hatte sie geweckt. Und sie musterte aufmerksam ihre Jungen. Dabei verdeckte sie mit ihrem großen Körper den Schimmer aus dem Luftschacht. Nun war es wieder fast so dunkel wie zuvor. Und Ruscha verkroch sich am Bauch ihrer Mutter.
Eine Weile lag sie so. Doch sie schlief nicht. Immer wieder hob sie ihr Köpfchen und suchte nach dem hellen Schimmer. Doch der blieb verschwunden. Schließlich bekam sie Hunger und stupste ihre Mutter Milch fordernd gegen den Bauch.
Ruscha schmatzte genießerisch. Das Geräusch machte auch ihren Bruder munter. Noch etwas verschlafen stieß Silm ihr seine Nase ziemlich unsanft in den Magen. Ruscha piepste erschrocken und ließ einen Augenblick die Zitze los. Dabei lief ihr die Milch in den Schnurrbart. Und sie leckte danach.
Inzwischen hatte Silm gemerkt, daß er an der falschen Stelle suchte. Unwirsch wälzte er sich herum. Und Ruscha bekam einen Tritt von seinen Hinterpfoten vor die Schwanzwurzel. Sie fiepte empört. Doch Silm kümmerte sich nicht um sie. Er wollte nur seine Milch. Erst als er eine Zitze gefunden hatte, konnte auch Ruscha weitertrinken.
Endlich hatte sie genug Milch im Bauch. Satt und zufrieden schloß sie die Augen. Ihre Mutter jedoch zog prüfend Luft durch die Nüstern. Im Kessel roch es nicht sehr gut. Da die Kleinen den Bau noch nicht verlassen konnten, mußte sie hier selbst für Sauberkeit sorgen. Und die war jetzt dringend nötig.
Plötzlich fühlte Ruscha sich von zwei großen Pfoten vorsichtig gepackt und von oben bis unten abgeschleckt, immer wieder, von der Nasenspitze bis zum Schwanz und vor allem am Bauch. Das war wie ein Spiel, sehr angenehm und kitzelte ein bißchen und tat sehr gut. Und Ruscha hielt ganz still.
Dann kam ihr Bruder dran. Doch Silm war dagegen. Er war noch immer nicht satt, hatte nur auf das Ende von Ruschas Putzerei gewartet. Ungebärdig versuchte er, sich den Pfoten seiner Mutter zu entwinden und nach einer Zitze zu schnappen.
Die Fähe zuckte zusammen. Die spitzen Milchzähne des Kleinen taten ihr weh. Und als Silm weiter so ungestüm drängelte, stieß sie ihn weg. Das mochte Silm gar nicht. Er strampelte wütend. Aber es half alles nichts. Erst mal wurde geputzt. Und Silm knurrte unwirsch.
Ruscha hatte sich vorsichtshalber in eine Ecke des Wohnkessels verzogen. Hier war sie einigermaßen sicher vor Silms strampelnden Pfoten. Aber sie vermißte die Wärme ihrer Mutter. Sie fiepte leise. Und als ihre Mutter mit Silm fertig war, kam sie zu Ruscha und tröstete sie liebevoll. Doch sie blieb nicht.
Enttäuscht starrte Ruscha in das Dunkel der Höhle. Kein Schimmer mehr fiel durch die Öffnung des Luftschachts. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Von irgendwo oben hörte sie einen leisen Pfiff. Und ihre Mutter wurde unruhig.
Mit einemmal vernahmen die beiden Kleinen ein seltsames Geräusch. Es klang wie das schwache Plätschern von Wasser. Die Fähe hatte den Kessel durch den Ausgang zum See verlassen. Doch das wußten die beiden nicht.
Sie spürten nur, daß sie allein waren. Langsam kroch Ruscha zu Silm hinüber, um sich an seinem kleinen Körper zu wärmen. Jetzt war Silm ganz friedlich. Er mochte die Wärme seiner Schwester und ihre vertraute Nähe. Auch er wollte nicht allein sein. Und so trösteten sie sich beide gegenseitig in ihrer Einsamkeit.
Neugierige Otterkinder
Allmählich gewöhnte Ruscha sich an den Tagesverlauf. Wenn der helle Schimmer verlöschte, verschwand auch ihre Mutter. Und wenn der Schein durch den Luftschacht zu schimmern begann, kehrte ihre Mutter zurück. Erst dann gab es Milch. Und so lange mußte sie eben warten.
Inzwischen waren die beiden Kleinen schon etwas größer und selbständiger geworden. Und auch ihr Schnurrbart war gewachsen. Zwar blieben ihre Bewegungen noch ein wenig unbeholfen, doch ihre Neugier nahm immer mehr zu.
Und Ruscha war sehr neugierig. Aufmerksam untersuchte sie ihren kleinen Körper, knabberte an ihren Pfötchen und spielte mit ihrem Schwanz, wie es auch ihre Mutter oft mit ihr getan hatte. Dabei legte sie sich auf den Rücken, hielt den Schwanz zwischen ihren Vorderpfoten, wedelte damit herum und biß ab und zu ein wenig hinein. Das machte ihr Spaß.
Ihrem Bruder jedoch machte das auch Spaß. Nur begnügte Silm sich nicht mit seinen eigenen Körperteilen. Mit Vorliebe zwickte er seine Schwester in den Schwanz und manchmal auch in die Oberlippe. Dann versuchte Ruscha ihn mit ihren kleinen Pfoten abzuwehren. Und wenn ihr das nicht gelang, biß sie ihn einfach irgendwohin: ins Ohr oder in die Nase oder in die Schwanzspitze, die sie am ehesten erwischte. Und Silms Schwanz gefiel ihr besonders.
Am wohlsten aber fühlte sie sich, wenn sie beide mit ihrer Mutter zusammenlagen. Dann spielte einer mit dem anderen. Manchmal wußte Ruscha gar nicht, wer gerade an etwas von ihr herumknabberte. Und wenn ihre Mutter nicht da war, wartete sie ungeduldig auf ihre Rückkehr.
Eines Abends, als die Fähe wieder einmal den Bau verließ, hatte Silm einen Einfall: Kaum war seine Mutter durch die Röhre zum See verschwunden, krabbelte Silm hinterher. Er wollte herausbekommen, was sich hinter dem Gang befand. Vorsichtig kroch er auf seinen kurzen Beinen hinein, immer weiter. Dabei gelangte er allmählich abwärts. Und hier wurde es feucht.
Silm zögerte. Doch seine Neugier war stärker. Seine kleinen Pfoten patschten vorwärts. Und schnuppernd schob er seine Nase tiefer in den Gang. Hier roch es nach feuchter Erde. Plötzlich zuckte Silm zurück. Seine Schnauze hatte etwas Unbekanntes berührt. Und das war kühl und sehr naß. Und sein kleiner Schnurrbart auch.
Erschrocken versuchte Silm, rückwärts zu kriechen. Doch das ging nicht. Der Gang hinter ihm war verstopft. Silm knurrte und begann aufgeregt mit dem Schwanz zu fuchteln.
In diesem Augenblick ertönte ein ängstliches Fiepen. Ruscha war ohne Zögern hinter Silm in den Gang gekrochen. Und jetzt bekam sie seinen fuchtelnden Schwanz um die Ohren. Sie wollte ausreißen. Aber rückwärts ging das nicht so schnell. Und umdrehen ging auch nicht. Außerdem war es dunkel.
Jetzt begann Silm zu strampeln, immer wilder. Doch nun spürte Ruscha mehr Raum um ihr Hinterteil. Sie hatte das Ende des Ganges erreicht. Aufatmend wandte sie sich um und flüchtete in die Wohnhöhle.
Nach einer Weile kam auch Silm zum Vorschein und schüttelte sich heftig. Wassertropfen spritzten von seinem Schnurrbart. Ruscha duckte sich entsetzt. Und Silm begann, eifrig seine nassen Pfötchen zu lecken.
Er war noch nicht ganz fertig damit, da kam unerwartet seine Mutter zurück. Sie trug eine junge Forelle in der Schnauze, die sie im Bach gefangen hatte. Leise winselnd legte sie den Fisch auf den Boden und zerteilte ihn.
Die beiden Kleinen stutzten. Sie wußten nicht recht, was sie mit dem Fisch anfangen sollten. Schließlich waren sie bisher nur Milch gewöhnt.
Silm streckte vorwitzig seine Nase vor. Die kleine Ruscha aber war mutiger. Erst leckte sie an dem unbekannt riechenden Ding, dann lutschte sie ein bißchen an einer Flosse. Und das schmeckte ihr.
Inzwischen hatte Silm nach dem Fischmaul geschnappt und knabberte neugierig daran herum. Ein Stück abbeißen konnte er noch nicht.
Trotzdem war die Fähe mit ihren Kindern zufrieden. Sie spürte, daß ihre Milch weniger wurde. Die Kleinen sollten sich allmählich schon an feste Nahrung gewöhnen, auch wenn sie noch weiterhin Milch bekamen. Und lange würde es nicht mehr dauern, bis sie richtig zubeißen konnten. Das war heute nur eine erste Kostprobe.
Sie warf noch einen fürsorglichen Blick auf ihre spielenden Kinder, dann verschwand sie wieder in der Röhre, um ihren eigenen Hunger zu stillen. Und zurück blieb ein angenehm duftender Fisch.
Ausflug ins Freie
Von nun ab brachte die Fähe von ihren Jagdzügen immer ein paar appetitliche Happen mit in den Bau. Meist spielten die Kleinen erst ein bißchen damit, bevor sie zu lutschen und vorsichtig zu knabbern begannen. Und manchmal blieb schon ein Stückchen zwischen ihren Zähnen, das sie gierig hinunterschlangen.
Die beiden hatten immer Hunger. Und mitunter wurden sie von der Milch schon nicht mehr richtig satt, obwohl ihre Mutter genau darauf achtete, daß jeder die gleiche Portion bekam. Dann waren sie froh, wenn sie zusätzlich noch etwas zu knabbern erhielten.
Ruscha lutschte besonders gern. Silm aber konnte schon ganz gut knabbern. Immer wieder versuchte er, ihr die besten Brocken wegzuschnappen. Dann balgten sie sich. Doch meist blieb Silm der Sieger.
An diesem Abend jedoch kam die Fähe ohne Beute. Und sie kam nicht durch die Röhre vom See, sondern durch den Luftschacht, den sie sorgfältig erweitert hatte. Dabei bekam Silm einen Erdbrocken auf die Nase.
Verdutzt blickte Ruscha ihrer Mutter entgegen. Und sie wunderte sich noch mehr, als die Fähe sich mit einemmal über sie beugte und sie mit den Zähnen vorsichtig am Nackenfell packte. Aber sie hielt still, hing wie ein lebloses Fellbündel zwischen den scharfen Zähnen. Sie hatte Vertrauen zu ihrer Mutter, die sie nun durch den Luftschacht nach oben trug. Dabei wurde es immer heller. Plötzlich setzten die Zähne sie behutsam ab. Und Ruscha saß zwischen knorrigen Wurzeln im Gras.
Wie gebannt blieb Ruscha sitzen. Sie merkte gar nicht, wie ihre Mutter verschwand und kurz darauf mit Silm wiederkam. Mit weit geöffneten Augen musterte sie die sonderbare Welt außerhalb der Höhle. Das alles sah so ganz anders aus als im Wohnkessel. Und es roch auch anders.
Zwar hatte die Dämmerung schon eingesetzt, aber noch war es hell genug. Der See schimmerte wie ein matter Spiegel durchs Gebüsch. Bäume und Sträucher am Ufer warfen riesige Schatten. Grashalme und Blütenkelche wippten im Abendwind. Und dicht vor Ruschas Nase krabbelte ein großer schwarzer Käfer.
Ruscha fiepte leise. Diese Welt war ihr unheimlich. Ängstlich drückte sie sich an den warmen Leib ihrer Mutter. Die Fähe jedoch richtete sich auf den Hinterbeinen auf und schnupperte sichernd in den Wind. Verblüfft starrte Ruscha zu ihr hoch. So hatte sie ihre Mutter noch nie gesehen.
Silm aber knurrte und zwickte seine Mutter ungeduldig in den Schwanz. Jetzt ließ sich die Fähe wieder auf die Vorderpfoten herab, doch sie legte sich nicht hin. Langsam ging sie weiter. Und die Jungen folgten ihr, zögernd und noch ein bißchen wackelig, denn sie waren das Laufen nicht gewohnt. So machten sie ihre ersten Schritte ins Unbekannte.
Ruscha hielt sich dicht bei ihrer Mutter, krabbelte unbeholfen über Wurzeln und bemooste Steine. Seltsame Gerüche drangen ihr in die Nase. Und die Geräusche fremder Tiere erschreckten sie. Aber sie folgte tapfer ihrer Mutter.
Verwundert blickte sie sich um. Mäuse rannten quietschend in ihre Löcher, als sie die drei Otter kommen hörten. Ein Igel tapste gemächlich durch raschelndes Laub; ihn interessierten die Otter nicht. Und aus der Tiefe des Waldes tönte der unheimlich klingende Ruf eines Waldkauzes.
Ein Geräusch jedoch übertönte alles andere: ein murmelndes Plätschern. Die Fähe hatte waldeinwärts einen kleinen Bogen geschlagen und näherte sich nun dem Bachufer. Von hier führte eine Otterspur zum Waldbach zwischen Sumpfgräsern und Schilf. Nur eine Stelle nahe einem von der Strömung abgeschliffenen großen Stein, hinter dem sich das Wasser in einer flachen Mulde sammelte, lag frei. Doch weiter ging die Fähe nicht.