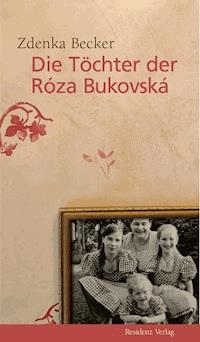Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Samy, der Sohn eines indischen Psychiaters aus Wien, wächst bei seiner slowakischen Mutter in der Nähe von Bratislava auf. Das Schicksal meint es nicht gut mit dem schüchternen Samy - sein Leben ist von Enttäuschungen und Niederlagen geprägt. Weil er dunkelhäutig ist, wird er von frühester Kindheit an mit Ablehnung und Anfeindungen konfrontiert. Vor allem Harry, sein Freund aus Kindertagen, macht ihm das Leben schwer. Als Harry im Erwachsenenalter Leader einer Skinhead-Gruppe wird, spitzt sich die Situation für Samy dramatisch zu ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zdenka Becker
Samy
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ginger./photocase.de
ISBN 978-3-8392-5576-6
Zitat
»I felt like a joke in this world …!
thought nobody deserves this.«
Amanda Todd
1. Kapitel
Etwas Schweres liegt auf seinen Augen. Langsam versucht er, sie zu öffnen, und riecht Blut, scharfes Desinfektionsmittel und süßes Parfum. Er hebt seine Hand, führt sie zum Gesicht, spürt rauen Stoff auf seiner Stirn. »Er ist aufgewacht«, hört er eine Frauenstimme von Weitem sagen. »Wo ist meine Mutter?«, fragt er, ohne die Lippen zu bewegen, und versucht, dorthin zurückzukehren, wo keine Geräusche, keine Gerüche und keine Gefühle waren. Er hört Schritte, dann spürt er auf seiner Schulter eine fremde Hand. »Herr Slovááák, hören Sie mich?«, hallt eine Stimme von irgendwoher. Unfähig zu reagieren, ignoriert er den Eindringling in seinen Ohren und überlegt, wo er sein könnte. Diesmal bewegt er den ganzen Arm, führt ihn zu seiner Brust, ertastet Schläuche und Klammern.
Endlich gelingt es ihm, die Augenlider zu heben, nur einen schmalen Schlitz, aber weit genug, um das gleißende Licht rund um sich wahrzunehmen, und er schließt sie wieder. Gleich danach startet er einen weiteren Versuch und sieht dicht vor sich ein von blonden Locken umrahmtes Gesicht mit einem Erdbeermund. Ein Engel. »Samy, hörst du mich?« Die Stimme, begleitet vom süßen Duft der Maiglöckchen, der ihm sehr bekannt vorkommt, nähert und entfernt sich wie bei schlechtem Radioempfang. »Wo ist meine Mutter?«, fragt er, ohne dass ihn jemand gehört hätte.
Die Dunkelheit umschließt ihn, und er sieht und hört nichts, er schaukelt wie auf Meereswellen, schwebt im luftleeren Raum. Irgendwann geht das Licht in seinem Kopf wieder an, und er sieht eine Reihe Gesichter und hört, ohne den Inhalt zu verstehen, wie jemand über ihn spricht. Langsam begreift er, dass er irgendwo liegt, bewegungslos und steif, versteht aber nicht, warum. Der Vorhang seiner Wahrnehmung schließt sich erneut, und er fällt in die samtene Finsternis, in der er zwar allein ist, sich aber warm und geborgen fühlt. Vorhang auf, Vorhang zu, so geht es einige Male, wobei die hellen und zunehmend schmerzvollen Momente immer öfter kommen. Als er endlich den sterilen Ort, an dem er sich befindet, erkennt, ist ihm klar, dass die Gestalten rund um ihn keine Engel, sondern Ärzte und Krankenschwestern sind.
Der ganze Körper tut ihm weh, vor allem die Hände und Arme, aber auch auf dem Gesicht spürt er dicke Schwellungen, die ihn wahrscheinlich entstellen. In dem Moment durchfährt es ihn wie ein Blitz: Wenn ich nicht im Himmel bin, wo ist dann meine Mutter? Wieso ist sie nicht bei mir?
»Mama! Mama!«, versucht er zu schreien, aber heraus kommt nur ein Krächzen. Die Oberlippe, die sich dick und geschwollen anfühlt und dem verzerrten Mund nicht standhält, platzt dabei, und er spürt warmes Blut über seine linke Wange rinnen. Eine Krankenschwester legt eine Mullbinde darauf, eine andere richtet sein Kopfkissen auf, die dritte, und das ist das Interessanteste, schiebt einen Polizisten, der das Krankenzimmer betreten möchte, aus der Tür. »Der Patient ist noch nicht vernehmungsfähig«, sagt sie streng. »Kommen Sie morgen oder besser übermorgen.«
»Was ist passiert?«, fragt er mit stöhnender Stimme, die kratzig aus der Tiefe seiner Kehle kommt.
»Pscht«, sagt der Engel mit dem Maiglöckchenduft und legt ihm einen Eisbeutel auf den Kopf. »Samy, du musst dich noch schonen.«
»Wer sind Sie?«
»Kennst du mich nicht mehr?«
Er starrt die junge Frau an und schweigt.
»Ich bin Angelika«, stellt sie sich vor und hält dabei seine Hand.
»Angelika?« Er sieht, sie merkt es, dass er keine Ahnung davon hat, wer sie ist und woher sie einander kennen. Sie berührt kurz sein Gesicht, kontrolliert die Geräte und den Flüssigkeitsstand in der Infusionsflasche und geht zur Tür. »Was will der Polizist von mir?«, krächzt er ihr nach, doch bevor ihn die Antwort erreichen kann, fällt er wieder ins graue Nichts.
Wieder Licht.
Und eine andere Stimme und ein anderer Frauenduft. Eine der Schwestern, die ungefragt und leise in seinem Zimmer auftauchen und es genauso geräuschlos wieder verlassen. Die Visite kommt. Die Stimme des Professors klingt hart und fordernd: »Herr Slovák, erinnern Sie sich wirklich an nichts?«
»Was ist passiert?«
»Wissen Sie das nicht?«
»Warum sagen Sie es mir nicht?«
»Später.«
»Wo ist meine Mutter?«
»Herr Slovák, über Ihre Mutter sprechen wir später.«
»Wo ist sie? Sie ist immer weg. Sie ist immer, wenn ich nach ihr suche, weg«, murmelt er leise vor sich hin. Aber keiner hört ihm zu, keiner antwortet. Sie stecken ihre Köpfe zusammen, sprechen über ihn und beugen sich über ihre Unterlagen. Ein paar weiß bemäntelte Rücken. Auf ihren Zetteln Zahlen, Worte, etwas, das wie eine Fieberkurve aussieht. Und dann gehen sie alle, und er bleibt allein im Zimmer und kann sich nicht bewegen. In seinen Venen stecken Nadeln, aus denen Schläuche zu diversen aufgehängten Flaschen führen, sein Körper ist durch Kabel und Saugknöpfe an blinkende Monitore und surrende Geräte angeschlossen. Er schließt die Augen, hört eine Explosion und sieht Feuer. Plötzlich ergreift ihn Panik. Was hat das zu bedeuten? »Mama! Mama! Wo bist du?«, schreit er wieder, aber keiner kommt, um ihm über das Haar zu streichen und tröstende Worte zu spenden. Vor der Tür sitzt ein Polizist und beschützt ihn. Wollten vielleicht die Glatzen hierherkommen und ihn wieder verhauen? »Mama! Mama!«
»Herr Slovák, hören Sie mich?« Mächtige Hände halten ihn an den Schultern und heben seinen Oberkörper leicht an.
»Wo bin ich?«, fragt er.
»Im Krankenhaus. Sie hatten einen … Unfall.«
»Unfall …?«
»Erinnern Sie sich wirklich nicht, was vor einer Woche geschah?«
»Vor einer Woche?«
»Es hat einen Unfall in Ihrer Wohnung gegeben.«
»Unfall?«, schreit er. »Wo ist meine Mutter?« Er beginnt, die Schläuche aus seinen Venen herauszureißen und versucht mit letzter Kraft aufzustehen.
»Beruhige dich«, sagt wieder die Stimme, die er von irgendwoher kennt. »Samy, bitte, beruhige dich«, hallt es noch einmal, bevor er in einen tiefen Traum fällt.
2. Kapitel
»Warum soll ich das alles erzählen? Wen interessiert das? Sagen Sie … Was soll das Aufnahmegerät? Sind wir hier im Fernsehen?«
»Samy, ich bin’s, Hana, Mamas Freundin.«
»Mama?«
»Ich bin’s, Hana. Olgas Freundin.«
»Zuerst Angelika, dann Hana. Was wollen Sie von mir?«
»Ich möchte dir helfen.«
»Ich brauche deine Hilfe nicht. Geh weg.«
»Durch das Erzählen wirst du dich erinnern.«
»Erinnern?« Samy dreht den Kopf zum Fenster und schweigt.
*
Als er klein war, war alles gut. Er lag im Kinderwagen, hob seine Hände hoch, spielte mit den Fingern, steckte den Daumen in den Mund. Der Daumen schmeckte süß, seine Mama lachte ihn an, sie war schön und sie duftete nach Milch, mit der sie ihn nährte. Alle fanden ihn entzückend. »Schau dir nur die süßen Fingerchen und die kleinen Füßchen an«, sagten sie, sie schnitten Grimassen, schepperten mit der Rassel, ließen Kasperl und eine Armee von Stofftieren vor seinen Augen tanzen. Die Welt rund um ihn war in Ordnung. Doch irgendwann war er größer geworden, und keiner brachte ihm mehr Spielsachen und Süßigkeiten. Die Erwachsenen auf der Straße drehten sich nach ihm um und beobachteten ihn, und er erkannte, dass er anders als die anderen aussah, andere Haare, Augen und Gliedmaßen hatte, dass er ein Außenseiter war. Aber das alles war an Mutters Hand noch leicht zu ertragen.
Der wirkliche Stress begann, als er etwa fünf Jahre alt war. Im Kindergarten. Er hatte dichtes, glänzendes Haar und auffallend dunkle Augen, und Harry fragte ihn wie aus heiterem Himmel: »Und wo ist deine Fiedel?« Und auch die anderen Kinder begannen zu schreien: »Ätsch, pätsch, Fiedelmacher, Fiedelspieler! Fiedlimidli! Fiedlimidli!«
»Welche Fiedel?«, fragte Samy verblüfft. »Ich habe keine Fiedel. Was ist das eigentlich?« Doch Harry gab keine Ruhe: »Sicher, alle Zigeuner haben eine Fiedel. Ich hab es im Fernsehen gesehen, und auch mein Papa hat es gesagt. Jeder Zigeuner wird mit einer Fiedel in der Hand geboren.«
»Was für eine Fiedel?«, ärgerte sich der kleine Junge. »Was redest du denn da für einen Mist?« Und da ist auch schon die Faust gegen sein Kinn geflogen.
»Ich rede keinen Mist, du dreckiger Zigeuner«, zischte Harry, der bis dahin sein bester Freund gewesen war.
»Zigeuner? Wie kommst du darauf?«
Samy war das einzige dunkelhäutige Kind im Kindergarten und lernte dort die ersten Regeln des friedlichen Miteinanders kennen – Fäuste. Er war größer als sie, aber sie waren viele. Und er war – ganz allein.
Und auch die Kindergartentante goss andauernd Öl ins Feuer. »Kinder, die Menschen anderer Rassen sind oft größer als wir. Deswegen ist auch Samy so groß, als ob er schon in die Schule ginge.«
Das war natürlich Wasser auf Harrys Mühlen: »Sind die Menschen anderer Rassen so stark wie Pferde?«, säuselte er scheinheilig.
»Sicher nicht«, sagte Timo. »Die dunklen Menschen kann man verhauen, aber die Pferde nicht.«
»Ich habe zu Hause eine schwarze Puppe, sie heißt Schokolina«, sagte eines der Mädchen.
Was für ein dummes Gerede! Samy hatte es damals noch gar nicht richtig mitbekommen, dass er anders als die anderen war, aber sie zeigten mit dem Finger auf ihn. Sie taten es immer und immer wieder, und dann sah er es selbst im Spiegel: ein dunkles, fast schwarzes Kind, ähnlich den Kindern aus Afrika, die er im Fernsehen sah, aber doch ein bisschen anders.
Samy sperrte sich im Badezimmer ein und wusch sich. Er seifte seinen ganzen Körper ein, sah mit dem vielen Schaum wie ein riesiger Schneeball aus, aber als er sich unter die Dusche stellte, war es vorbei mit der weißen Pracht. Er war weiterhin sehr dunkel, fast so dunkel wie die Nacht.
Und die lästigen Fragen im Kindergarten hörten nicht auf. »Tante, warum hat Samy so eine dunkle Haut und nicht eine rosige wie wir?«, fragte Janeta. Und die Kindergärtnerin konnte ihr keine Antwort geben. »Na ja … vielleicht … ich weiß wirklich nicht, warum«, stammelte sie. »Frag mich morgen, heute müssen wir noch singen.« Und sie begann auch gleich: »Hänschen klein, ging allein …« Irgendetwas an Samy war ihr peinlich. Was konnte aber an einer Haut peinlich sein? Haut ist Haut.
Da war ein Mädchen im Kindergarten, Julia hieß sie, sie war sehr schön und hatte lange honigblonde Haare, die in Locken auf ihre Schultern fielen. Und sie hatte blaue Augen, die waren so blau wie der Himmel über der Stadt. Samy war von Anfang an in sie verliebt und wollte nur mit ihr spielen, was auch Julia gefiel. Deshalb war sie auch immer in seiner Nähe. Sie hatten zusammen aus Bauklötzen den größten Turm gebaut. Sie nannten ihn Kreml, und er fiel, weil er viel zu hoch geraten war, irgendwann in sich zusammen. Das machte ihnen aber nichts aus, denn sie bauten ihn am nächsten Tag wieder auf.
Einmal spielten sie, dass sie Pioniere wären. Mit einem roten Tuch, das sie sich um den Hals, wie sie es bei den Schulkindern sahen, gebunden hatten. Und dann salutierten sie vor den Autos, die am Zaun des Kindergartens vorbeifuhren. Es war sehr schön mit Julia.
Harry war der Anführer der Kindergartengang. Er bestimmte, welche Spiele die Kinder spielten, wer Gewinner und wer Verlierer war, wen die Kinder fesseln und quälen sollten, aber vor allem, wer zu der Gang gehörte und wer nicht. Samy gehörte auf einmal nicht mehr dazu.
Eines Tages lauerten sie ihm dann vor dem Haus auf und schlugen ihn alle zusammen, ohne ersichtlichen Grund. Harry, Denis, Juro, Marek … Sie waren damals noch sehr klein, aber die Schläge hatten ihre Wirkung. Als Samy mit zerrissenem Hemd und einer Beule auf dem Kopf nach Hause kam, rief Olga, seine Mama, die Eltern der Jungen an, stritt mit ihnen und drohte mit einer Anzeige, aber ein paar Tage später passierte es wieder. Die Mutter nahm ihn dann in den Arm, streichelte und tröstete ihn: »Weine nicht, mein Kleiner. Sie werden es nicht mehr tun. Sie werden es nicht mehr tun, und weil du ein lieber kleiner Junge bist, werden sie dich irgendwann gern haben. So wie ich dich gern habe.«
»Aber ich bin schwarz, Mama.«
»Du bist nicht schwarz, sondern braun. So wie Milchkaffee. Das ist ein großer Unterschied.«
»Nein, Mama, ich bin fast schwarz.«
»Das stimmt doch gar nicht. Du bist fast weiß, aber du hast einen etwas dunkleren Teint.«
»Ich bin schwarz. Warum bin ich schwarz, Mama?«
»Du bist doch weiß. Schaue dich nur im Spiegel an. Deine Haut ist so schön, so seidig.«
»Mama, ich bin schwarz wie Kohle.«
»Samy, du bist nicht schwarz. Du bist Österreicher.«
»Sind alle Österreicher so dunkel wie ich?«, fragte er in seiner kindlichen Naivität.
»Nein, nicht alle, aber einige schon.«
»Wie viele?« Samy begann auf den Fingern die dunklen Österreicher, die er kannte, abzuzählen, kam aber nur auf einen.
Olga hatte immer konsequent gelogen, wenn es um die Hautfarbe ihres Sohnes ging. Wenn keiner mit ihm spielen wollte, weil er »schmutzig« war, sagte sie, dass nicht er, sondern die anderen anders seien. Und dass er mit Harry spielen solle, der sei auch Österreicher. Aber Harry ist weiß. Sein Vater ist weiß. Und sein Großvater ist auch weiß. Alle in Harrys Familie sind weiß. Ja sicher, auch Samys Großvater, der Vater seiner Mutter, ist weiß, seine Großmutter und seine Urgroßmutter, alle sind oder waren weiß, nur sie schämen sich für ihn … weil sein Vater… ein Österreicher ist. Ein gottverdammter Neuösterreicher, dessen Vorfahren weiß Gott woher stammen. Sie sind bestimmt aus den tropischen Urwäldern gekommen, dachte Samy damals, und waren fast nackt, nur mit einem Lendenschutz bekleidet, und haben sich von dem, was der Wald bot, ernährt.
Auch darüber wusste die Kindergartentante Bescheid: »Kinder, die meisten schwarzen Menschen sind muskulöser als wir.«
»Arnold Schwarzenegger hat noch mehr Muskeln«, rief Timo. »Die schwarzen Menschen sind, verglichen mit ihm, Schwächlinge.«
»Tante, aber ich bin nicht schwarz«, betonte der kleine braune Junge.
»Natürlich bist du schwarz…«, auch die süße Janeta wollte sich wichtig machen, »… auch wenn du ein bisschen hell-schwarz bist.«
»Aber trotzdem bin ich ein Slowake … auch wenn mein Vater …« Aber statt seine Aussage zu bekräftigen, schickte ihn die Tante die Kisten mit den Spielsachen aus dem Nebenzimmer holen. »Weil du so stark bist«, sagte sie. Vielleicht meinte sie es als Kompliment, alle kleinen Jungs wollen irgendwann groß und stark werden, nur Samy wollte so sein wie alle anderen auch.
»Ich bin nicht stark«, rief er. »Ich bin Slowake. Ein ganz normaler, schwacher Slowake.«
Ganz am Anfang, als er noch nicht der »Zigeuner« war, hatte es ihm Spaß gemacht, die Kisten mit dem Spielzeug von einem Raum in den anderen zu tragen und hoch oben im Regal zu verstauen, aber dann bemerkte er, dass nur die Kleinen und Schwachen auf dem Schoß der Tante sitzen durften. Deshalb wollte auch er klein und zerbrechlich sein. Es nützte aber nichts. Samy war einen Kopf größer als die Gleichaltrigen. Im Tauziehen gewann immer die Gruppe, in der er war. Das war die einzige Disziplin, wo sie ihn dabei haben wollten. Und im Fußball.
Und auch Harry erinnerte ihn ständig an seinen Makel: »Mein Papa hat gesagt, dass die Zigeuner Abschaum sind. Und du bist auch einer von ihnen, deshalb bist du auch Abschaum.
»Rede keinen Blödsinn«, mischte sich Julia in die Unterhaltung ein. Sie legte demonstrativ ihren Arm um die Schultern ihres Freundes und lächelte ihn an. »Samy ist genauso wie wir.«
»Seit wann?«
»Seit immer.«
»Ein Zigeuner ist er und basta.«
Dass Harry ein Ekel ist, war Samy von Anfang an klar. Ein widerliches Käsegesicht, das überall den Chef spielen wollte, weil sein leiblicher Vater auch ein Österreicher sein soll. Natürlich ein weißer Österreicher. Angeblich. Keiner hatte den Mann jemals gesehen, aber er sollte aus Wien stammen oder aus Gänserndorf, das sagten jedenfalls die Menschen in der Gasse. Dafür war Harrys Stiefvater ein Slowake. Ein Soldat. Und seine Mutter war ebenfalls Slowakin. Die Frau Direktor und der Herr General. Er trug eine Uniform und sie einen Hosenanzug. Man musste zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer der Mann und wer die Frau war. Der Herr Direktor und die Frau General.
Immer wenn Harry, der in dem gleichen Wohnblock wohnte, zu den Slováks kam, sagte Olga, Samy solle mit seinem Freund hinaus spielen gehen. Nur, er wollte mit »seinem Freund« nichts zu tun haben. Trotzdem kam der wachsblonde, blasse Kindergartenprotzihn sehr oft abholen, damit er ihn mit seinen Kumpels in Spiele verwickeln konnte, die in Raufereien endeten. Aber Samy durchschaute das und versteckte sich. Harry säuselte scheinheilig etwas von Freundschaft und Miteinander und bedrängte dann Olga vor der Tür: »Frau Slováková, ich weiß, dass Samy da ist. Ich habe ihn gesehen. Er ist gerade vor mir ins Haus gegangen. Vielleicht sehen Sie nach.«
»Ich habe ihn nicht gesehen«, log Olga, um ihren Jungen zu schützen.
»Haben Sie unter dem Bett nachgeschaut?« Schon als Fünfjähriger beherrschte Harry den Zynismus perfekt und erzählte überall, dass Samy einmal aus lauter Angst vor ihm in die Hose gemacht und seither einen Riesenrespekt vor ihm hätte. Doch als er da gerade vor Slováks Tür stand, rief seine General-Mutter: »Harry! Komm nach Hause. Ich habe Eis für dich. Vanille … Erdbeer … Zitrone … deine Lieblingssorten.«
»Mama«, lachte dann Samy, »das verfressene weiße Arschloch hat so viel Eis in sich gestopft, dass es davon noch weißer geworden ist.« Samy hat irgendwann auch diese Methode der Bleichung versucht, aber sein Magen hatte bei der Nummer nicht mitgespielt. Ihm war danach so schlecht, dass er zwei Tage lang nur gebrochen und geschi… hatte, Pardon, auf der Toilette gesessen war, aber das durfte er keinem so sagen, weil seine Mutter ihm nicht erlaubte, hässliche Worte auszusprechen. »Samy, du bist ein anständiger Junge, du darfst nicht schimpfen«, sagte sie jedes Mal, wenn er nach einer verbalen Erleichterung suchte.
»Aber …«
»Nichts aber. Das ist egal, was die anderen sagen, du bist gut erzogen und benimmst dich, wie es sich gehört«, beschloss Olga jedes Mal die Diskussion.
3. Kapitel
»Hana, bitte, was hat meine Mutter damit zu tun?«, stöhnt Samy. »Warum ziehst du sie in unser Gespräch hinein? Ich bin derjenige, der ständig Mist baut. Ich. Nur ich allein. Sie hat damit nichts zu tun.«
An dem Tag ist er unruhiger als sonst. Seine Gesprächsbereitschaft gleich null. Er schließt die Augen und tut so, als ob er schliefe. »Na gut, wenn du heute nicht sprechen magst … Soll ich dir etwas von deiner Mama erzählen?«, fragt Hana nicht ohne den Hintergedanken, ihn aus der Reserve zu locken. »Vielleicht etwas von ihrer Jugend und ihren damaligen Freunden?« Samy schweigt. Und je mehr er sich dem Gespräch mit Hana verweigert, umso intensiver drängen sich ihr Bilder auf, in denen Olga und ihre damalige beste Freundin Viera Zemanová die Hauptrolle spielen.
*
Die beiden kannten einander seit ihrer frühesten Kindheit. Und sie waren von Anfang an sehr eng verbunden. So eng, dass die anderen Mädchen in der Schule entweder eifersüchtig auf diese perfekte Freundschaft waren oder sie hinter vorgehaltener Hand belächelten. So oder so, Olga und Viera fielen auf. Es hieß manchmal, sie würden wie eineiige Zwillinge aussehen, und es gefiel ihnen, wenn schon nicht für echte Zwillinge, dann zumindest für Schwestern gehalten zu werden.
Hana ging damals in die Parallelklasse und war mit Eva befreundet, die manchmal zickig und manchmal weinerlich war, was oft zu Streitigkeiten zwischen den beiden geführt hatte. Sie zankten und versöhnten sich fast jeden Tag und blieben trotzdem die ganze Grundschulzeit miteinander befreundet. Wie Hana es nur aushalten konnte, weiß sie bis heute nicht. Ihre Mutter meinte irgendwann, Eva wäre damals ihre »Reibungsfläche« gewesen, dank derer sie zu Hause relativ friedlich gewesen war. Und trotzdem sehnte sie sich schon als Achtjährige nach einer harmonischen Freundschaft mit einem Mädchen, mit dem sie alle Geheimnisse hätte teilen können. Deshalb schielte sie oft neidisch in großen Pausen zu Olga und Viera, die Hand in Hand im Schulhof spazierten und über irgendetwas tuschelten, und beneidete sie um ihr Glück, einander gefunden zu haben.
Viera hatte genau wie Olga blonde schulterlange Haare. Ihre Mütter flochten sie ihnen jeden Morgen zu Zöpfen. Und auch wenn die Mütter verschiedene Flechttechniken verwendeten und die Zöpfe ein bisschen anders aussahen, störte es sie nicht. Jeden Tag am Nachmittag, wenn sie sich nach dem Spielen verabschiedeten, machten sie sich aus, was sie am nächsten Tag für die Schule anziehen wollten. Eine weiße Bluse und einen blauen Rock, ein geblümtes Sommerkleid oder einen roten Strickpullover und eine schwarze Hose, sogar bei den Schleifen im Haar und beim Schlafanzug achteten sie auf Übereinstimmung. Sie besaßen nicht die gleichen Kleidungsstücke, bemühten sich aber stets etwas anzuziehen, das der Kleidung der Freundin möglichst nahekam. Zu Weihnachten und anderen Festtagen wünschten sie sich ähnliche Sachen, die sie von ihren Eltern, je nach Wirtschaftslage und der Möglichkeit, sie tatsächlich auch zu kaufen, manchmal auch bekamen. Vieras Tante, die Leiterin einer Kleiderabteilung für Kinder in einem Kaufhaus war, legte ihnen manchmal das eine oder andere begehrte Kleidungsstück auf die Seite. In den Regalen lagen nur unförmige Teile, die keiner haben wollte. Wenn die Mädchen Glück hatten, und das kam nicht allzu oft vor, kauften ihnen ihre Eltern die gewünschte Bluse oder das ersehnte Kleid.
Mit neun Jahren wurden sie, wie damals alle in dem Alter, Mitglieder der Pionierorganisation. Olga, genauso wie die meisten der Klasse, genoss das Pionierleben sehr und bedauerte nur, dass ihre jüngere Schwester Meli, die in einem Behindertenheim lebte, keine Pionierin werden konnte. Sie war von Geburt an geistig behindert und redete den ganzen Tag wirres Zeug; keiner verstand sie. Jeden Sonntagnachmittag, wenn andere Familien mit dem Propellerschiff in den Vergnügungspark in Petržalka auf dem rechten Donauufer fuhren und ihren Kindern glasierte Äpfel und Zuckerwatte kauften, verbrachten Olga und ihre Eltern bei Meli im Heim. Ihre Mutter brachte dem Sorgenkind jedes Mal einen frischgebackenen Kuchen mit und erzählte, was die Familie die ganze Woche getan hatte. Olga zeigte ihr Pionierabzeichen und das rote Halstuch und blätterte in ihrem Pioniertagebuch. Ihre Schwester griff nach den dicht beschriebenen Seiten, strich mit ihren Fingern über die bunten Zeichnungen und lachte. Wie gern hätte Olga eine »richtige« Schwester zu Hause gehabt, eine, mit der sie reden und spielen hätte können. Aber Meli war keine Schwester zum Herzeigen, denn sie schnitt die ganze Zeit unschöne Grimassen, ließ ihre Augen in verschiedene Richtungen rollen, sabberte, spuckte und streckte die Zunge heraus.
Als Meli, das hässliche Baby mit dem spärlichen rötlichen Haarwuchs, das einem Pavianjungen verdammt ähnlich sah (das erzählten sich die Nachbarn hinter vorgehaltener Hand) ein paar Monate alt und ihr die Behinderung schon deutlich anzusehen war, legte ihr die damals dreijährige Olga ein Kissen auf das Gesicht und drückte, so fest sie nur konnte, zu. Der hilflose Säugling strampelte unter dem Gewicht seiner großen Schwester, schlug wie wild um sich, kämpfte um sein Leben und röchelte laut. Als die Mutter nachschauen kam, was da für ein ungewöhnlicher Lärm aus dem Kinderzimmer kam, verschlug es ihr den Atem. Im Reflex stieß sie Olga grob zur Seite, nahm Meli auf den Arm und schüttelte sie sanft. Die Kleine schnappte nach Luft, lief rot an und begann lauthals zu schreien. Und Olga, die von der Mutter gegen die Wand gestoßen worden war und dabei eine Risswunde auf der Stirn davongetragen hatte, weinte bitterlich.
Zwei Wochen später kam Meli auf die Säuglingsstation des Behindertenheims, das sie nie mehr verlassen sollte. Und Olga, der die Mutter diese Geschichte immer wieder erzählt hatte, litt ihr Leben lang unter schlechtem Gewissen ihrer kleinen Schwester gegenüber. Deshalb murrte sie auch nie, wenn die Familie sonntags Meli besuchen ging. Mit zunehmenden Jahren begriff sie, dass ihre Schwester sich ihr schweres Schicksal nicht selbst ausgesucht hatte und trotzdem ein liebenswertes Mädchen war. Olga brachte ihr ihre Puppen mit und lehrte sie, wie man ihnen Kleider anzieht und mit ihnen spielt.
Der Papa stand meistens abseits, beobachtete seine Töchter mit ernster Miene und verabschiedete sich bald, weil er Zigaretten kaufen gehen musste.
Zusammen mit Viera, die keine Schwester, dafür aber zwei Brüder hatte, verbrachte Olga die ganze Schulzeit in völliger schwesterlicher Harmonie. Erst nach dem Abitur der beiden Mädchen veränderte sich die Situation grundlegend. Während Viera an der juridischen Fakultät an der Komenský Universität in Bratislava aufgenommen wurde, gelang es Olga, einen Soziologie-Studienplatz an der Humboldt-Universität in Ostberlin zu bekommen. Da die beiden Väter verdiente Kommunisten und die Zeugnisse und Resultate der beiden Mädchen bei den Aufnahmeprüfungen mehr als zufriedenstellend waren, gab es keine Probleme. Die anderen Abiturienten, die keine positiven Kaderakten, das heißt, kein Parteibuch oder vielleicht sogar Verwandte im Westen hatten, versuchten es mit Protektion oder dicken Umschlägen, die ihre Eltern den Dekanen und Professoren der jeweiligen Fakultäten zusteckten.
Hana bestand ebenfalls die Aufnahmeprüfungen an der Komenský-Universität, wobei es ihr durchaus bewusst war, dass sie in der sozialistischen Tschechoslowakei ohne die Protektion, die dem politischen Einfluss ihres Vaters zu verdanken war, heute wahrscheinlich keine Psychologin geworden wäre. Aber das war ihr damals egal. Hauptsache, sie konnte studieren.
Hana verlor Olga für ein paar Jahre aus den Augen und wusste von ihr nur aus den Erzählungen ihrer Mutter. Und obwohl Viera auf einmal allein blieb, kam Hana nicht auf den Gedanken, sich mit ihr näher anzufreunden. Im Gegenteil, sie mied sie sogar, was ihr aufgrund ihrer unterschiedlichen Studien leichtfiel. Und als Olga nach fünf Jahren aus Berlin zurückkam und sich wie gewohnt mit Viera traf, fiel allen als Erstes der unterschiedliche Kleidungsstil der beiden auf. Während Viera graue, blaue und schwarze Businesskostüme mit weißen Blusen bevorzugte, trug Olga lange Kleider und Seidenschals in frischen Frühlingsfarben.
Nach ihrer Rückkehr nach Bratislava begann Olga, als wissenschaftliche Assistentin an der Komenský-Universität zu arbeiten. Diese Stelle verdankte sie nicht nur ihrem Studium, das sie mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, sondern auch ihrem Engagement in der Kommunistischen Partei, die für sie zur politischen Heimat geworden war. Sie war wie kaum jemand sonst überzeugt von der Idee des Kommunismus und glaubte an die humanistischen Ideale, wie sie die Genossen Marx und Engels, aber vor allem Wladimir Iljitsch Lenin in ihren Büchern beschrieben hatten. Schon in Ostberlin war sie ein Mitglied des Führungskomitees gewesen und hatte politische Feiern und Besuche bei Spitzenpolitikern, die sie grenzenlos bewunderte, organisiert. Vor allem Erich Honecker, der erste Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem sie als Funktionärin der studentischen politischen Bewegung auf Parteikongressen die Hand schütteln durfte, beeindruckte sie nachhaltig. Vor ihr lag eine glänzende Zukunft.
Als Olga zwei Jahre nach Beendigung ihres Studiums ihren Eltern Ema und Jozef Slovák beichten musste, dass sie in anderen Umständen war und keinen Mann an ihrer Seite hatte, brach für die beiden die Welt zusammen. Die zuerst vor Schreck erstarrte und dann vor Sorge fast wahnsinnig gewordene Ema wollte sofort wissen, welchem ungezogenen und verantwortungslosen Bengel sie das zu verdanken hatte. Als Olga es kategorisch ablehnte, die Identität des »Täters« preiszugeben, redete Ema auf ihre Tochter ein, schrie, tobte und vergoss Tränen, aber vor allem versuchte sie, sie wortreich zu einem Schwangerschaftsabbruch zu überreden, um sie vor dem größten Fehler ihres Lebens zu bewahren. Sie war davon überzeugt, dass ihrer Tochter ein einmaliger Ausrutscher mit einem verheirateten Kollegen von der Universität passiert war, der weder für das Kind zahlen noch sich darum kümmern würde. Ema erwähnte nichts von Meli und ihren schlaflosen Nächten, in denen sie daran dachte, ob es doch nicht besser gewesen wäre, wenn ihre Tochter damals bei der Geburt gestorben wäre. Im Dritten Reich hätten sie das »unwerte Leben« entsorgt und den Eltern gesagt, das Kind wäre tot geboren. Natürlich wäre es ein Schock gewesen, aber jetzt hätten alle ihre Ruhe in der Seele. Ema sagte die ganzen Jahre niemandem etwas von diesen düsteren Gedanken, aber sie schämte sich auch nicht dafür.
Knappe drei Jahre nach Melis Geburt wurde Ema wieder schwanger, ließ aber aus Angst, die Geschichte könnte sich wiederholen, unter Jozefs heftigem Protest den Fötus abtreiben. Aber auch davon erwähnte sie Olga gegenüber nichts, sondern argumentierte mit einer riesengroßen Schande und den verpassten Chancen im Leben, und als das alles nichts nutzte, wandte sie sich schließlich verzweifelt an Jozef, der regungslos neben ihr in der Küche stand: »Papa, warum sagst du nichts? Sag auch etwas.«
Jozef, der in erster Linie Kommunist und erst in zweiter Moralist war, hätte seine Tochter gern im Hafen einer Ehe gesehen, was für ihn aber nicht dieselbe Wichtigkeit hatte wie die Tatsache, dass er bald Großvater werden würde. Dieses Kind, hoffentlich ein gesundes Kind, würde ein wenig Licht in sein Leben bringen und ihn für die behinderte Tochter und den abgetriebenen Sohn (er war davon überzeugt, dass es ein Sohn gewesen wäre), die wie eine nie heilende Wunde in seiner Seele brannten, entschädigen. »Mama, bedränge sie nicht«, sagte er ruhig. »Wenn sie das Kind allein großziehen will, soll sie es bekommen.«
Ema schnappte kurz nach Luft, wankte ein bisschen und setzte sich erschöpft auf den Stuhl hinter ihr. »Du weißt nicht, was du da redest, Papa. Ob wir es wollen oder nicht, der Bankert muss weg«, sagte sie bitter und war zu dem Zeitpunkt noch davon überzeugt, dass es ihr in den nächsten Wochen gelingen würde, Olga von der Dringlichkeit, ihr Leben in Anstand und Moral zu führen, zu überzeugen. Doch Ema irrte sich. Olga dachte vom ersten Moment an keine Sekunde daran, sich vor die Abtreibungskommission zu stellen und angesichts der selbstgerechten Genossen zu begründen, warum sie mit einem Mann, der sie nicht genug liebte, aber vor allem, der sie nicht heiraten wollte, geschlafen hatte. Im Gegenteil, sie freute sich auf das Kind.
Natürlich dachte Olga darüber nach, wie sich diese Schwangerschaft auf ihr zukünftiges Leben auswirken würde, ob sie das Ende ihrer Unabhängigkeit oder einen neuen Anfang bedeuten würde. Sie stand gerade am Beginn ihrer Karriere, hatte kein angespartes Geld und keine eigene Wohnung, und auch um ihre Heimat, die Tschechoslowakische Republik, stand es Ende der 70er-Jahre nicht gerade zum Besten. Das musste sogar sie als begeisterte Kommunistin zugeben, dass die andauernden Engpässe in der Lebensmittel- und Alltagsbedarfsversorgung unzumutbar waren und so bald als möglich verbessert gehörten. Und auch die politische Lage war, trotz des enormen Drucks seitens der Sowjetunion, nicht wirklich stabil. Der mit Panzern niedergewalzte »Prager Frühling« trieb zwar nach außen hin keine Knospen mehr, aber im Untergrund bewegte sich etwas, was nicht zu unterschätzen war. Es hieß, ständig auf der Hut zu sein und den Sozialismus mit allen Mitteln zu verteidigen.
Aber waren nicht gerade politisch und wirtschaftlich schwere Zeiten der geeignete Beginn für eine bessere Zukunft?, fragte sie sich. Eine Neuorientierung zu zweit? Gibt es überhaupt im Leben einer Frau den besten Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen? Ideal wäre, zuerst den richtigen Partner zu finden, finanzielle Sicherheit zu schaffen, ein Nest zu bauen und erst dann den Nachwuchs zu zeugen. Olga fuhr in ihrer Lebensplanung eindeutig gegen eine stark befahrene Einbahn.
Als Wochen und Monate vergingen und Olga keine Anstalten machte, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, der für sie die Absage an ihre große Liebe gewesen wäre, und der Leibesumfang ihrer Tochter sich zu vergrößern begann, nahm Ema ihr Schicksal an. Na gut. Sie wird bald Großmutter und sie würde ihr Enkelkind lieben. Warum eigentlich nicht? Und sie begann sich sogar damit zu trösten, dass Olga nicht allein in Schande leben müssen würde, denn, wie sie beim Einkaufen erfuhr, war auch die beste Freundin ihrer Tochter, die ebenfalls ledig war, schwanger. Was aber noch mehr zählte, war der Skandal um diese Schwangerschaft, der nicht größer hätte sein können. Der Vater von Vieras ungeborenem Kind war angeblich ein österreichischer »Tourist«, der weder von Viera noch von dem werdenden Kind etwas wissen wollte.
»Was für eine Schmach«, kommentierte damals Olgas Mutter Ema die missliche Lage der Familie Zeman, in die diese durch ihre Tochter gebracht worden war. Sie saß auf der Wohnzimmercouch, strickte ein weißes Babyjäckchen, zählte die Maschen und verglich die fertig gestrickten Teile mit dem Pullover, den sie erst vorgestern beendet hatte. Ihre Stricknadeln klapperten dabei leise, die Wollmaschen glitten unter ihren flinken Fingern von links nach rechts. »Von der persönlichen Blamage abzusehen, ist es ein Verrat an unserem sozialistischen Staat«, brummte Jozef, der treue Staatsdiener. »Dass Viera sich mit einem Österreicher, einem imperialistischen Feind, eingelassen hat, zeigt ihren schwachen Charakter und gehört entschieden verurteilt.« Noch am Tag, an dem er es erfuhr, forderte er Olga auf, die Freundschaft mit Viera sofort zu beenden und sie zu meiden, weil der Kontakt zu ihr Olgas Karriere an der Universität schaden könnte. Wenn Jozef damals gewusst hätte, dass auch seine Tochter ein Kind von einem Österreicher, und noch dazu von einem »besonderen« Österreicher, erwartete, hätte er sie – und das lag bei seinem Aggressionspotenzial durchaus im Bereich des Möglichen – geschlagen, vielleicht sogar umgebracht. Aber Olga hatte noch einige Monate Zeit.
Olga und Viera, zwei gefallene Mädchen, trafen einander trotzdem regelmäßig, aber heimlich, in einem Café in der Stadt und sprachen einander Mut zu. Ein lediges Kind zu bekommen, war keine Alltäglichkeit, dazu brauchte man Rückgrat. In Olgas Fall besonders.
Um sich ein bisschen aufzuheitern, erzählten sie sich alte Geschichten aus der Kindheit und kicherten hemmungslos, wie es junge Mädchen oft tun, ohne zu wissen, warum. Sie erinnerten sich an Schneeballschlachten vor der Schule, Zahnpastaangriffe im Pionierlager, abgeschnittene Röcke, die ihre Mütter in Rage gebracht hatten, und ihre ersten Schminkversuche. Sie waren damals auf einer Exkursion in Prag und kauften sich in einer Drogerie Selbstbräuner, Wimperntusche, Kajalstift und blauvioletten Lidschatten und trugen alles in einer öffentlichen Toilette, so gut sie nur konnten, auf ihre verschwitzten Gesichter auf. Schon die schwarz umrandeten Augen mit blauvioletten Monokeln rundherum sahen gespenstisch aus, aber als der Selbstbräuner zu wirken begann und auf ihre Wangen und Nasen dunkelbraune Flecken malte, war ihnen nicht mehr zum Lachen zumute. Aus Angst vor der Bestrafung trieben sie sich lange in der Stadt herum.
Sie fuhren mit der Straßenbahn in entlegene Stadtteile, spazierten durch Grünanlagen, wuschen sich immer wieder in diversen Toiletten, aber die braunen Flecken in ihren Gesichtern blieben hartnäckig. Völlig verzweifelt traten sie den Rückweg in das Schülerheim, in dem sie für ein paar Tage untergebracht waren, an und beratschlagten fieberhaft, welche Ausrede über ihre äußere Veränderung am ehesten glaubhaft klingen würde – zu viel Sonne … oder jemand hatte ihnen Säure ins Gesicht geschüttet –, als zwei dunkelhäutige junge Männer in die Straßenbahn einstiegen. Den beiden Gören verschlug es augenblicklich die Sprache. Noch nie im Leben hatten sie dunkelhäutige Menschen gesehen, und jetzt standen gleich zwei davon keine drei Meter von ihnen entfernt und starrten sie, vermutlich wegen ihrer Kriegsbemalung, ebenfalls an. Olga und Viera waren damals zwölf oder 13, die Männer, wahrscheinlich Studenten, vom Alter her schwer einschätzbar, etwa um die 20.
Viera stieß Olga in die Rippen, deutete auf die beiden und verzog den Mund. »Schau«, flüsterte sie ihr ins Ohr, »die zwei sind furchtbar hässlich.« Im Gegensatz zu ihrer Freundin fand Olga die beiden überhaupt nicht hässlich, vielmehr interessant. Sie fühlte sich von ihnen angezogen und wollte mehr von ihnen wissen, mit ihnen sprechen, sie berühren, testen, ob ihre Hautfarbe echt war. Dann fiel ihr der Selbstbräuner ein und die Unmöglichkeit, ihn abzuwaschen, und so war sie sich ziemlich sicher, dass die beiden beim Händedruck nicht abfärben würden.
Olga und Viera steckten die Köpfe zusammen und kicherten wie immer, wenn sie unsicher waren, und weil ihnen auch angesichts der beiden Jungen nichts Besseres einfiel, wanden sie sich in Lachkrämpfen, bis ihnen die Tränen aus den verschmierten Gesichtern flossen. Die Heiterkeit verging ihnen erst im Schülerheim beim Anblick ihrer Genossin Lehrerin, die sie hysterisch anschrie und mit Hausarrest bis zum Ende der Exkursion bestrafte.
»Weißt du, Olga«, sagte Viera im Kaffeehaus und streichelte dabei ihren runden Bauch, »ich bin sehr stolz darauf, eine Tschechoslowakin zu sein. Wir sind ein besonderes Volk.«
»Wie meinst du das?«
»Wie wir es schon in der Schule gelernt haben – die slawische Rasse hat ihre Qualitäten.«
»Und trotzdem hast du dich in Harald verliebt.«
»Aber erst, als ich erfuhr, dass er tschechische Vorfahren hat.«
4. Kapitel
Hana sitzt an ihrem Schreibtisch, vor ihr Samys Therapieprotokolle, und denkt an den schicksalhaften Sommer in Berlin, wo alles begann. Sie erinnert sich an die vor Hitze glühenden Straßen und den langweiligen Kongress, an dem sie 1979 teilgenommen hatte. Ganz zufällig war auch Olga Teilnehmerin dieses Kongresses, zu dem sie ihr Dekan geschickt hatte. Hana arbeitete damals als Psychologin in einer Kinderambulanz und spezialisierte sich vor allem auf traumatisierte Scheidungskinder.
Für die beiden jungen Frauen war es eine große Überraschung, einander in der Fremde zu treffen, aber noch mehr als das überraschte sie die Nähe und Vertrautheit, die sie abseits der Heimatstadt vom ersten Moment an zueinander empfanden. Es war etwas da, das mehr als die Vergangenheit, die zwischen ihnen lag, wog. Etwas Imaginäres, auf einmal Selbstverständliches. Wahrscheinlich war es Olgas Bereitschaft, Hana in Räume ihrer Persönlichkeit vorzulassen, die für Viera in all den Jahren der Kindheit und Jugend verschlossen blieben.
Hana war zum ersten Mal in Westberlin und genoss die Stadt in vollen Zügen. Es war klar, dass sie nur deswegen zu der internationalen Tagung der Mediziner, Psychologen und Soziologen entsandt wurde, weil sie Kommunistin war. Vorzeigekommunistin. Und sie schämte sich auch nicht dafür. Damals und auch heute nicht. Was ist schon dabei, eine Kommunistin zu sein?, dachte sie. Eine, die für die soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit kämpft und die Humanität nicht nur predigt, sondern lebt. Was soll daran schlecht sein? Die anderen, sie meinte vor allem die Deutschen oder Österreicher, waren Nazis, hatten Menschen getötet, vergast, beraubt, und die alte und ein nicht zu unterschätzender Teil der jungen Generation fand es heute noch in Ordnung. Warum sollte sie sich für ihre Ideale schämen?
Olga war genauso wie Hana 26 und zum ersten Mal im Westen. Und es war aufregend. Die vielen eleganten Geschäfte, wunderschöne Kleider in den Auslagen, die ihnen den Atem raubten, Schmuck, Radios mit Tonbandgeräten, schicke Autos, die an ihnen vorbei fuhren; ihre Augen weideten sich an der Schönheit, die sie bis dahin nicht gekannt hatten. Sie spazierten durch die Straßen, bewunderten die bunten Neonreklamen, netten Bars und Kaffees, tranken zum ersten Mal in ihrem Leben Berliner Weiße mit Schuss. Die grün schimmernde Biermischung behagte ihnen nicht besonders, sie tranken sie aber trotzdem aus, weil sie so herrlich verrückt nach Westen und Freiheit schmeckte.
Um später darüber zu Hause berichten zu können, besuchten sie auch die Gedächtniskirche, den Checkpoint Charlie, den Reichstag und das Brandenburger Tor, das in der Mitte zugemauert war, und studierten die Kritzeleien und Graffiti auf der Westseite der Mauer, von denen sie schon so viel gehört hatten. Es war für sie nachvollziehbar, wenn Kinder, Jugendliche und Künstler in der weißen Mauer eine kilometerlange Leinwand sahen. Obwohl die Mauer, der »Antifaschistische Schutzwall«, Eigentum der DDR war, störte die Ostmächte das Bemalen der Flächen auf der Westseite nicht. Sie sahen tatenlos zu und schritten nicht ein, wenn jemand seiner Wut und seinem Frust mit Farben und Pinsel Ausdruck verlieh. Vor allem Hana gefiel es, die Kunst im öffentlichen Raum zu sehen, sich vorzustellen, dass jeder, der eine Idee hatte, sie auf der Mauer umsetzen konnte. Schicht für Schicht überlagerten sich die Bilder und Botschaften, die alle paar Wochen von anderen Künstlern und solchen, die sich dafür hielten, erneuert und aktualisiert wurden. Was für eine Freiheit!
Dr. Sunjay-Sam Gupta, ein Psychiater und Neurologe aus Wien, war Olga vom ersten Tag an aufgefallen. Er war groß, schlank und durchtrainiert und hatte wunderschöne mandelförmige Augen, Hände wie ein Klavierspieler, lange wohlgeformte Arme und breite Schultern. Mit einem Wort, der Mann war nicht nur klug und gebildet, sondern auch so schön, wie die Bollywood-Schauspieler, die sie im Fernsehen in ihrem Hotelzimmer bewundern konnte. War das ein Zufall, dass sie Sam, wie er von seinen Freunden genannt wurde, und die Bollywood-Filme am gleichen Tag kennenlernte?
Irgendwann fragte er sie, ob sie mit ihm ein Glas Wein trinken wolle, und sie war sofort einverstanden.
»Stört es dich nicht, wenn ich mit ihm ausgehe?«, fragte sie ihre Freundin im Hotel besorgt.
»Nein, überhaupt nicht. Geh nur.« Hana schien es von Anfang an zu merken: Der Mann war ihr Schicksal.
Ab diesem Tag verbrachten sie alle Pausen zusammen und fuhren an einem freien Nachmittag mit der U-Bahn hinaus aus der überhitzten Stadt. Sie spazierten durch einen Stadtwald und kamen zu einem See. Kurz entschlossen zog sich Sam hinter den Büschen um, kam nur mit einer Badehose bekleidet heraus, warf seine Kleidung ins Gras, sprang ins Wasser und kraulte drauf los. Er war ein ausgezeichneter Schwimmer. In der Mitte des Sees drehte er sich um und rief Olga zu sich. Auch sie zog sich ihren Badeanzug an und trat vorsichtig über die Kieselsteine in das kühle Nass. Nach einer kurzen Abkühlphase tauchte sie ein, schwamm und erreichte Sam, der auf sie wartete, mit langsamen Tempi. Er streckte seine Rechte nach ihr und zog sie zu sich. In diesem Augenblick spürten beide, dass etwas Einmaliges begann.
Sie saßen dann im Gras, trockneten in der Sonne und erzählten sich ihre Lebensgeschichten, die völlig unterschiedlich verliefen und deshalb so interessant für den jeweils anderen waren. Sam stammte aus dem Süden Indiens, wurde in Bangalore, der Hauptstadt des Bundesstaates Karnataka geboren, und wuchs mit seinen sechs jüngeren Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf.