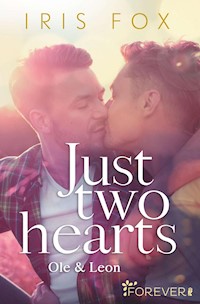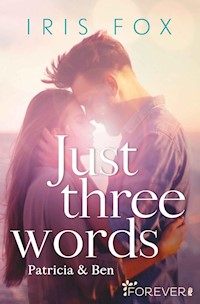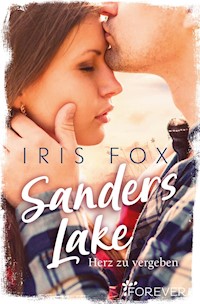
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kleine Stadt, große Liebe Als Nelly ihren Freund mit einer anderen im Bett erwischt, ist damit nicht nur ihre Beziehung passé, sondern leider auch die Wohnung und der Job in Chicago. Da kommt der Anruf aus Sanders Lake gerade richtig: Ihre alte Tante Lucy braucht ihre Hilfe. Und so packt Nelly ihre Sachen in ihren alten Toyota und fährt los. Doch noch vor der Stadtgrenze wird sie von einem Polizisten angehalten, weil sie zu schnell gefahren ist. Kein guter Start in der Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Von da an laufen Nelly und Reed sich auch noch ständig über den Weg. Und was mit einem hitzigen Schlagabtausch begann, wird bald zu einer nicht zu leugnenden Anziehungskraft zwischen den beiden. Doch Nelly hat nicht vor, länger in Sanders Lake zu bleiben als nötig. Sie ist eine Großstadtpflanze und muss zurück. Und Reed ist ein Junge vom Land. Egal, was sie füreinander empfinden, sie kommen aus verschiedenen Welten…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sanders Lake - Herz zu vergeben
Die Autorin
Iris Fox, 1982 in Elmshorn geboren, lebt heute mit ihrer Familie in Syke in der Nähe von Bremen. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Viele Jahre blieb sie dem medizinischen Bereich treu, bis sie nach ihrer Elternzeit in eine Einrichtung für körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen wechselte. Obwohl seit jeher unzählige Geschichten in ihrem Kopf herumschwirren, widmet sie sich erst seit 2014 mit viel Herz und Leidenschaft aktiv dem Schreiben von Romanen.
Das Buch
Als Nelly ihren Freund mit einer anderen im Bett erwischt, ist damit nicht nur ihre Beziehung passé, sondern leider auch die Wohnung und der Job in Chicago. Da kommt der Anruf aus Sanders Lake gerade richtig: Ihre alte Tante Lucy braucht ihre Hilfe. Und so packt Nelly ihre Sachen in ihren alten Toyota und fährt los. Doch noch vor der Stadtgrenze wird sie von einem Polizisten angehalten, weil sie zu schnell gefahren ist. Kein guter Start in der Kleinstadt, wo jeder jeden kennt. Von da an laufen Nelly und Reed sich auch noch ständig über den Weg. Und was mit einem hitzigen Schlagabtausch begann, wird bald zu einer nicht zu leugnenden Anziehungskraft zwischen den beiden. Doch Nelly hat nicht vor, länger in Sanders Lake zu bleiben als nötig. Sie ist eine Großstadtpflanze und muss zurück. Und Reed ist ein Junge vom Land. Egal, was sie füreinander empfinden, sie kommen aus verschiedenen Welten…
Von Iris Fox sind bei Forever erschienen:In der Just-Love-Reihe:Just one danceJust two heartsJust three words
Love Happens - Zwei sind einer zu vielDrei Tage GlückSanders Lake - Herz zu vergeben.
Iris Fox
Sanders Lake - Herz zu vergeben
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinDezember 2020 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-591-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Danksagung
Leseprobe: Just one dance - Lea & Aidan
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 1
Chicago
Nelly
Weit nach Mitternacht geht im Treppenhaus meiner besten Freundin und Arbeitskollegin Catherine das Licht an. Ich hoffe, dass sie es ist, denn seit Stunden hocke ich auf den Stufen vor ihrer Wohnungstür im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses und warte sehnsüchtig darauf, dass sie nach ihrer langen Schicht im Deep purple, einer Music Bar, in der ich bis heute selbst als Barkeeperin gearbeitet habe, endlich heimkommt.
Tapfer halte ich die Tränen zurück, die in regelmäßigen Abständen versuchen emporzusteigen. Doch ich will nicht weinen. Nicht wegen ihm! Neben mir eine Reisetasche, in der Eile gepackt, mit allen Habseligkeiten bestückt, die mir geblieben sind.
Als Catherine die Treppenstufen zum vierten Stock erreicht, sieht sie mich und hält für den Bruchteil einer Sekunde inne. Dann beschleunigt sie ihre Schritte.
»Oh, Süße! Was ist passiert?« Sie setzt sich neben mich. Mir schießen dann sehr zu meinem Leidwesen doch die Tränen in die Augen, als ich zu reden beginne.
»I-ich … ich hab ihn verlassen«, bricht es aus mir heraus. »Es ist aus. Aus und vorbei. Ich hab Schluss gemacht. Endgültig!« Kaum habe ich die Worte über die Lippen gebracht, überkommt mich ein heftiger Heulkrampf, den ich einfach nicht mehr zu kontrollieren vermag. Dummerweise fühle ich mich wie die Versagerin, dabei ist er fremdgegangen. Nicht ich. Liebevoll nimmt Catherine mich in die Arme und wiegt mich ein wenig hin und her.
»Hey, schsch … Alles wird wieder gut. Du wirst schon sehen«, dringt ihre liebevolle leise Stimme an mein Ohr und weiß mich tatsächlich wieder etwas zu beruhigen.
»Vier Jahre für den Arsch!«, bringe ich an ihre Schulter gepresst hervor.
Catherine muss kurz auflachen. »Ja. Das stimmt. Und was für ein Arsch er ist!« Catherine hat Jack nie gemocht. Sie hat immer gewusst, dass er nicht der Richtige für mich ist.
Jetzt muss ich auch lachen, trotz Heulanfall. »Ich wusste, dass du dich über die Nachricht freuen würdest. Deswegen bin ich ja auch als Erstes zu dir gekommen. Damit du es von mir und nicht von jemand anderem erfahren musst«, versuche ich mich an einem schlechten Witz.
»Da bedanke ich mich aber recht herzlich bei dir. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen, dafür, dass du dieses Riesenrindvieh endlich verlassen hast? Eine Tasse Tee vielleicht? Kommt immer gut, bei lebensverändernden Ereignissen. Oder ein provisorischer Schlafplatz, bis du eine neue Bleibe hast?«
Ich werde wieder ernst. »Das ist noch nicht alles«, lasse ich sie wissen.
»Oje, was kommt denn noch?«
»Ich hab den Job geschmissen«, beichte ich. »Dein Angebot bezüglich Tee und Schlafplatz würde ich demnach also gerne für eine Weile in Anspruch nehmen, bis ich mir wieder was Eigenes leisten kann.«
Catherine atmet einmal tief durch. »Oh, Nelly! Der Job ist auch weg? Was genau ist denn passiert?«
»Nun, ja«, grummele ich. »Ich kann ja schlecht für dieses Arschloch weiterarbeiten, während er die neue Kellnerin vögelt, die ich vor ein paar Tagen erst eingestellt habe.« Bei dieser Nachricht fehlen selbst Catherine die Worte.
Ein paar Tage später
Catherine ist bereits zur Arbeit gegangen, während ich mittags noch immer im Pyjama auf ihrem Sofa sitze und darauf warte, dass auch dieser Tag einfach an mir vorbeizieht. Netflix ist zurzeit mein bester Freund, gleich nach Catherine, die zwar jeden Tag aufs Neue versucht, mich aus meinem Schneckenhaus wieder hervorzulocken, bislang aber wenig Erfolg damit hatte.
Mein Handy klingelt. Desinteressiert schaue ich zwar kurz in die Richtung, aus der das Klingeln kommt, doch um aufzustehen und nachzusehen, wer es ist, fehlt mir die Motivation. Irgendwann hört das Klingeln zum Glück auf und ich kann mich wieder auf die aktuelle Serie konzentrieren, die ich mir gerade reinziehe. Keine Folge später beginnt mein Telefon erneut zu klingeln. Genervt hebe ich den Kopf und versuche am anderen Ende des Wohnzimmertisches zu erspähen, wer mich anruft, kann aber aus der Entfernung und aus diesem Winkel nichts erkennen. Also lasse ich mich wieder ins Kissen sinken und warte ungeduldig, dass es verstummt. Die Abstände, in denen mein Telefon einen Anruf ankündigt, werden immer kürzer. Beim fünften oder sechsten Mal gebe ich schließlich auf, reiße die Decke zu Boden, als ich aufstehe und greife nach meinem Handy.
»Was ist?!«, rufe ich in den Hörer, ohne vorher nachgesehen zu haben, wer der Anrufer ist.
»Ähm …«, ertönt es am anderen Ende. Die Stimme ist mir unbekannt. »Guten Tag. Spreche ich mit Miss Moore? Miss Nelly Moore?«
Ich stutze. »Ähm … ja. Die bin ich. Und Sie wünschen?«, werde ich sofort eine Spur höflicher.
»Sehr schön.« Ich höre die fremde Dame am anderen Ende aufseufzen. »Ich bin ja so froh, dass ich Sie endlich erreichen konnte, Miss Moore. Mein Name ist Mrs Norris, ich bin ehrenamtliche Kirchenmitarbeiterin in Sanders Lake und ich rufe wegen Ihrer Tante Lucille an.«
»Lucille?«, überlege ich laut und versuche den Namen erst einmal zuzuordnen. »Sie meinen sicher Lucy, meine Großtante. Was ist mit ihr?« Ehrlich gesagt, interessiert es mich nicht sonderlich, was mit irgendeiner Tante los ist, von der ich seit meiner Kinderzeit nichts mehr gehört habe, doch ich weiß, was sich gehört und frage deshalb.
»Ihrer Tante geht es recht schlecht. Sie … sie wohnt ganz alleine in einem alten kleinen Farmhaus, außerhalb der Stadt. Wie Sie sicher wissen, ist Ihre Tante nicht mehr die Jüngste und es würde ihr sicherlich schon helfen, wenn jemand regelmäßig für sie einkaufen gehen und nach dem Rechten sehen würde, doch sie lässt niemanden an sich heran. Nicht einmal mich. Ich habe wirklich alles versucht.«
»Und was genau erwarten Sie jetzt von mir?«, frage ich.
»Nun …« Mrs Norris räuspert sich. »Vielleicht … vielleicht können Sie einmal mit Lucille reden. Vielleicht hört sie eher auf jemanden, der ihr nahe steht.«
Ich schnaube auf. »Gute Frau«, sage ich, so höflich ich kann. »Ich habe meine Tante seit beinahe zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Von nahe stehend kann hier also wirklich nicht die Rede sein. Tut mir sehr leid, aber ich kann Ihnen da auch nicht weiterhelfen.« Ich will bereits auflegen, als mir Mrs Norris durch den Hörer entgegenruft:
»Miss Moore! Bitte! Legen Sie nicht gleich auf. Sie sind meine letzte Hoffnung.«
»Blödsinn. Warum sollte ich Ihre letzte Hoffnung sein?«
»Weil … weil ich all ihre anderen Verwandten bereits kontaktiert habe und niemand bereit ist, sich Lucilles Problemen anzunehmen.«
Ich schlucke hart. Mrs Norris wirkt verlegen angesichts der Reaktion meiner Familie. Doch sie muss es mir dann nicht weiter erklären. Ich kenne meine Familie und kann mir schon denken, was los ist. Niemand fühlt sich für Tante Lucy verantwortlich, weil sie damals mit einem Mann auf und davon ist. So wird es mir auch einmal ergehen, wenn ich in Nöten bin. Wer der Familie den Rücken kehrt, braucht keine Hilfe mehr von ihr zu erwarten. Nun ja …
Ich weiß nicht warum, aber alleine durch die Tatsache, dass meine Tante Lucy und ich dieses Schicksal teilen, fühle ich mich ihr auf eine gewisse Art verbunden. Und der Zeitpunkt könnte eigentlich nicht besser sein, jetzt, da ich ohne festes Zuhause und ohne Job bin. Und Tag für Tag weiter auf Catherines Sofa zu hocken, macht meine Situation auch nicht besser. Also beschließe ich spontan, nachzugeben.
»Also schön«, lenke ich ein. »Wo finde ich Lucy?«
Kapitel 2
Irgendwo in Indiana
Nelly
Mein alter Toyota besitzt so etwas Luxuriöses wie eine Klimaanlage nicht, deshalb habe ich beide Fenster bis auf Anschlag heruntergekurbelt, bevor ich heute Morgen in Chicago losgefahren bin. Während ich die Mais- und Getreidefelder im Staat Indiana immer weiter Richtung Süden durchfahre, strömt der schwere Geruch des heißen Sommers zu mir herein.
Ich schaue auf die Uhr. Ich brauche länger als geplant. Es ist schon Mittag durch und ich bin noch nicht einmal bei meiner Großtante Lucy angekommen. Meine Tante lebt in einer Kleinstadt namens Sanders Lake, wie ich von Mrs Norris vor ein paar Tagen am Telefon erfahren habe. Einer kleinen Ortschaft in Indiana. Vermutlich mitten im Nirgendwo. Mein innerer Antrieb ist gleich null. Ich interessiere mich im Prinzip für nichts und niemanden mehr nach der Pleite mit Jack! Doch nun habe ich dieser Mrs Norris bereits zugesagt, und meine Versprechen halte ich immer ein. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich selbst bei meiner Tante vermutlich noch weniger ausrichten kann als Mrs Norris selbst.
Zuletzt bin ich Tante Lucy wie gesagt begegnet, als ich noch ein kleines Kind war. Sie hatte wieder geheiratet und ist mit ihrem neuen Mann fortgegangen. Das ist alles, was ich weiß. Seitdem hat niemand aus meiner Familie mehr etwas von ihr gehört. Schließlich hatte sie den Kontakt zu allen abgebrochen. In diesem einen Punkt sind wir uns demnach also ähnlich.
Während der langen Fahrt habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Zwischendurch muss ich mich zusammenreißen und die Tränen zurückdrängen, so aufgewühlt bin ich immer noch, als Jack und die neue Kellnerin vor meinem geistigen Auge aufblitzen. Ich habe die beiden in unserem Schlafzimmer überrascht. Jack dachte, ich hätte die Abendschicht im Deep purple und würde vor zwei Uhr nachts nicht zu Hause sein. Tja, da hatte er falsch gedacht. Ich kam nach Hause, bepackt mit ein paar Einkäufen für ein leckeres Abendessen. Dann hörte ich Stimmen. Als ich die Tür zum Schlafzimmer öffnete, sah ich sie. Nackt. In unserem Bett! Wieder und wieder schiebt sich das Bild von Jacks auf und abschwingendem blanken Arsch in mein Gedächtnis, wie er es ihr besorgt. Und jedes Mal wird mir übel davon.
Ich stehe vollkommen neben mir. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mehr als einmal frage ich mich während der eintönigen Fahrt, warum ich mir diese Reise antue. Ob meine Entscheidung zu meiner Tante zu fahren richtig war. Wäre es nicht besser gewesen, erst einmal selbst wieder auf die Beine zu kommen und sie in ein paar Wochen zu besuchen? Doch ich weiß auch, der Abstand wird mir guttun, um mich neu zu sortieren. Und ist das nicht allemal ein besserer Plan, als weiterhin auf Catherines Sofa in Selbstmitleid zu zerfließen? Außerdem kann ich jetzt nicht einfach stumpf die nächsten Wochen Netflix durchsuchten, jetzt, wo ich weiß, dass es dort draußen jemanden gibt, der meine Hilfe gebrauchen könnte.
Hier bin ich also. Habe den Großteil meines letzten Geldes in Benzin investiert und treibe meinen guten, alten Toyota zu Höchstleistungen an, mitten auf einer öden Landstraße zwischen Mais und Getreide. So im Nachhinein gesehen, wünschte ich, ich hätte etwas Geld für schlechte Zeiten zur Seite gelegt und nicht alles in den letzten Jahren für Klamotten und Konzertkarten ausgegeben. Doch das ist jetzt leider nicht mehr zu ändern. Mein Fuß tritt beherzt das Gaspedal durch, wild entschlossen, das Leben meiner Tante und anschließend mein eigenes wieder auf die Reihe zu bekommen.
Meine Gedanken driften wieder zum Deep purple. Je mehr Meilen ich hinter mir lasse, desto stärker wird mir bewusst, dass ich eigentlich mehr um die Music Bar trauere als um Jack. Laut seufze ich auf, als mir klar wird, wie sehr ich die Arbeit dort vermissen werde. In den letzten vier Jahren ist mir dieser Ort zu so etwas wie einer Heimat geworden.
Im Radio spielen sie gerade 30 Seconds to Mars. Ich erinnere mich an die wundervolle Coverband, die erst vor einigen Wochen bei uns einen Auftritt hatte. Es war nicht ganz leicht, an sie heranzukommen und sie davon zu überzeugen, in unserer kleinen Music Bar aufzutreten, doch letztendlich habe ich es irgendwie geschafft, sie zu überreden. Der Abend war unglaublich. Der ganze Raum mit Menschen gefüllt, die Musik genauso sehr lieben, wie ich es tue.
Um mich von den schmerzenden Erinnerungen abzulenken, klopfe ich den Takt des Liedes auf dem Lenkrad mit und die bereits von der Sonne ausgeblichene Hawaii-Wackelfigur, die auf der Armatur klebt, lässt dazu die Hüften schwingen.
Ein paar Meilen vor meinem Ziel sehe ich plötzlich im Rückspiegel ein Blaulicht aufblitzen. Fast schon denke ich, es ist nur eine Halluzination und nehme mir fest vor, mich wieder in den Griff zu bekommen und ab sofort wieder die Nächte durchzuschlafen. Aber das Aufheulen der Sirene lässt mich schließlich zu dem Entschluss kommen, dass dieses Polizeifahrzeug hinter mir tatsächlich echt ist.
»Scheiße. Was will der denn von mir?« Ich schnaube genervt auf, denn eine Polizeikontrolle in meinem aktuellen Gemütsstand ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Doch der Streifenwagen hinter mir ist unerbittlich, daher bleibt mir schlussendlich nichts anderes übrig, als den Blinker zu setzen, die Geschwindigkeit zu drosseln und rechts ranzufahren.
Der Officer in seinem Wagen überholt mich und hält abrupt vor mir, sodass der Sand am Straßenrand ordentlich aufwirbelt und mein Auto und mich in eine heftige Wolke aus Staub hüllt. Ich muss husten, weil der Dreck durch die geöffneten Seitenfenster zu mir hereinweht und mir in der Lunge kratzt. So etwas kann dir auch wirklich nur auf dem Land passieren!
Nachdem der Staub sich etwas gelegt hat und ich wieder atmen kann, überprüfe ich mit einem schnellen Blick in den Rückspiegel mein Aussehen, noch bevor der Officer an mein Seitenfenster tritt. Dass ich heute schon einen weiteren Heulkrampf hinter mir habe, ist mir zum Glück nicht mehr anzusehen. Gut so. So kommt es, dass ich spontan beschließe, zu handeln und mich dem Officer von meiner besten Seite zu präsentieren, anstatt weiter in Selbstmitleid zu erstarren. Ich überprüfe im Rückspiegel noch einmal den Sitz meiner Haare. Ich sollte eigentlich genügend Sexappeal besitzen, um mit einem einfach gestrickten Dorfpolizisten fertig zu werden und mich aus dieser Verkehrskontrolle herauszureden. Ich habe nicht vor, mehr Zeit als nötig mit dieser leidigen Situation zu verplempern.
Der Polizist kommt auf mich zu. Innerhalb von Sekunden habe ich den Typen abgescannt. Ein stinknormaler Officer vom Land. Schätzungsweise Mitte zwanzig. Wohl ungefähr in meinem Alter. Allerdings gehe ich mal stark davon aus, dass er nicht, so wie ich, bis auf ein paar Mäuse im Portemonnaie und ein paar Klamotten mittellos ist, und sein Wohnsitz mit Sicherheit auch nicht Toyota heißt. Verdammt! Ich kann mir in meiner aktuellen Lage einfach keinen Strafzettel leisten.
»Ich weiß, Officer. Ich war viel zu schnell«, erkläre ich, noch bevor er ein Wort gesagt hat. »Ich war wohl in Gedanken. Bitte verzeihen Sie mir. Es wird nicht wieder vorkommen. Versprochen!« Dann beginne ich vorsichtig mit ihm zu flirten, indem ich meine Lacoste Sonnenbrille bis zur Nasenspitze hinuntergleiten lasse und ihm über den Rand der Brille so charmant wie mir möglich in die Augen schaue. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, während ich auf eine Reaktion von ihm warte.
»Guten Tag«, begrüßt er mich freundlich, aber neutral. Mein Augenaufschlag scheint ihn erst einmal nicht sonderlich zu beeindrucken. Im Gegenteil.
»Guten Tag, Officer«, erwidere ich seinen Gruß brav, ihn weiter lächelnd ansehend. Doch anstatt meinen Blick zu erwidern, schaut er ganz gemütlich über das Getreidefeld am Wegesrand, während er mit stoischer Ruhe und Gelassenheit Notizblock und Bleistift aus der Hemdtasche zieht. Erst nachdem dies vollbracht ist, widmet er mir wieder seine Aufmerksamkeit. Innerlich stöhne ich auf. Na wunderbar. Wenn der in dem Tempo weitermacht, wird das hier vermutlich ewig dauern.
»Ihnen ist also bewusst, dass Sie zu schnell gefahren sind?«
Irritiert sehe ich ihn an. »Äh, ja. Das sagte ich ja bereits. Und ich will das auch ganz bestimmt nicht wieder tun«, schnurre ich noch mal hinterher. Schließlich gilt es hier eine Runde für mich zu gewinnen und ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, heil aus der Nummer herauszukommen.
»Na, davon gehe ich mal aus. Ich hätte gerne Ihren Ausweis, Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere, bitte.« Obwohl ich innerlich angespannt bin, versuche ich mich an einem besonders freundlichen Lächeln, welches ich dem Officer schenke.
»Ist das wirklich notwendig?«, frage ich so lieblich ich kann. »Ich meine, ich habe Ihnen doch gerade schon mein Wort darauf gegeben, dass ich mich ab sofort an die vorgegebene Geschwindigkeit halten werde.« Er stutzt und schaut mir direkt in die Augen. Tapfer lächele ich weiter. Doch dem Officer scheint nicht einmal im Ansatz aufzufallen, dass ich versuche mit ihm zu flirten. Es lässt ihn völlig kalt.
»Das ist die gängige Vorgehensweise«, klärt er mich auf. »Bitte seien Sie jetzt so freundlich und händigen mir Ihre Papiere aus, Ma’am.« Seine Worte lassen keinen Zweifel daran offen, dass er es ernst meint. Mein Lächeln gefriert. Hat der mich gerade wirklich Ma’am genannt?
Okay. Alles klar. Habe verstanden. Der Typ will es also wirklich wissen. Widerwillig, aber dennoch brav, schnalle ich mich ab, lehne mich in den Beifahrerfußraum vor und wühle in meiner Handtasche. Eine Flasche Bourbon, die mir meine Freundin Catherine vor der Abfahrt noch schnell zusteckte, ist mir dabei im Weg. Also nehme ich sie heraus und lege sie auf den Beifahrersitz.
Als ich die Papiere zu fassen bekomme, reiche ich sie auch gleich an den Officer weiter. Er nimmt die Unterlagen entgegen und prüft sie, ohne jede Regung im Gesicht. Währenddessen bleibt mir etwas Zeit mein Gegenüber genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich ihn von oben bis unten mustere. Dabei lasse ich erneut die Sonnenbrille bis zur Nasenspitze heruntergleiten und beäuge ihn ausgiebig, während er die Papiere in Augenschein nimmt. Er bemerkt, wie intensiv ich ihn anschaue. Irritiert huscht sein Blick immer wieder zwischen den Papieren und mir hin und her.
Bei näherem Betrachten sieht mein Gegenüber zwar immer noch wie ein gewöhnlicher Officer aus, doch er ist ein recht ansehnliches Exemplar der männlichen Spezies. Seine Muskeln sind bei Weitem nicht so definiert wie bei Jack, doch ich muss zugeben, der Typ sieht gar nicht mal so schlecht aus in seiner Uniform. Der leichte Sommerwind weht ihm durch die aschblonden Haare. Das Hemd spannt leicht über der Brust und an den Oberarmen. So gesehen, kann das nicht nur Pudding sein, was da in seiner Uniform steckt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, unter dem kleinen Bauchansatz, den mein sexy, süßer Officer mit sich trägt, weiß sich das eine oder andere Muskelpaket gekonnt vor mir zu verstecken.
»Sie sind also Nelly Moore?«, fragt er schließlich und holt mich damit aus meiner Trance wieder heraus.
»Ja, die bin ich«, antworte ich ihm wahrheitsgemäß.
»Und Sie sind nicht von hier, sondern aus Chicago.«
»Genau, Officer. Aus Chicago«, stimme ich ihm zu, nachdem ich mich kurz geräuspert habe. »Ich möchte nur jemanden besuchen, wenn Sie es genau wissen wollen. Oder besser gesagt«, ergänze ich, »ich wurde quasi dazu genötigt, weil sich niemand sonst finden lässt, der sich des Problems annehmen kann. Dabei habe ich zurzeit, weiß Gott, selbst genug Probleme«, grummele ich. »Sobald alles geregelt ist, geht es so schnell wie möglich wieder zurück. Ich habe nicht vor meine Zeit länger als nötig zwischen Rindern und Hühnern zu verplempern. Nein. Ganz sicher nicht«, blubbern mir die Worte über die Lippen, ehe ich begreife, dass ich den Officer hier am Straßenrand mit meiner Lebensgeschichte zutexte. Plötzlich erscheint mir, als wäre Catherines Sofa doch die bessere Wahl gewesen. Doch nun ist es zu spät und mir droht der Strafzettel, daher zwinge ich mich schnell wieder zu einem Lächeln, auch wenn mir in Wahrheit mal wieder eher zum Heulen ist.
Er blickt mir über die Papiere hinweg direkt in die Augen. »Falls es Sie interessiert. Hühner sind sehr intelligente Wesen.«
Ich zucke kurz mit den Schultern. »Wenn Sie meinen.« Ehrlich gesagt interessiert es mich gerade überhaupt nicht, ob Hühner einen ein- oder mehrstelligen IQ aufweisen, und ob ich mich rein theoretisch mit ihnen über das Wetter unterhalten könnte, trotzdem lächele ich honigsüß, noch immer in der Hoffnung, irgendwie um eine Strafe herumzukommen. Doch er scheint gegen meine Avancen einfach immun und meine Hoffnung schwindet so langsam dahin.
»Haben Sie Alkohol konsumiert, Ma’am?«, fragt er stattdessen und bringt seinen Notizblock wieder in Position, vermutlich um sich meine Antwort darauf zu notieren. Vielleicht auch einfach nur, um mich nervös zu machen.
Stille.
»Ähm … nein. Selbstverständlich nicht«, antworte ich schließlich. Seine Augen suchen meine, fixieren mich. »Hören Sie«, versuche ich ganz ruhig zu bleiben, was mir zusehends schwerer fällt. »Ich habe nichts getrunken. Und ich bin auch nicht verwirrt. Ich bin nur etwas nervös. Das ist alles. Ich schwöre, dass ich keinen Tropfen Alkohol im Blut habe.«
»Aber Sie führen auf Ihrem Beifahrersitz eine für alle gut sichtbare Flasche Alkohol mit sich. Ich nehme an, Sie wissen, dass das verboten ist?« Verdutzt huschen meine Augen zu der Flasche Bourbon, die sich bis vor wenigen Augenblicken noch in meiner Tasche befand. Mein Puls beschleunigt.
»Ähm … diese Flasche liegt da seit ungefähr dreißig Sekunden«, rede ich hastig und ärgere mich direkt darüber, dass ich so aus dem Konzept gerate. »Sie haben doch selbst gesehen, wie ich sie ausgepackt habe, als ich nach den Papieren suchte.«
Er ist vollkommen unbeeindruckt und schaut mich ausdruckslos an, ohne ein Wort zu sagen.
»Diese Flasche ist nicht für mich«, haspele ich weiter und ärgere mich zutiefst darüber, dass dieser blöde Officer es geschafft hat, dass ich tatsächlich versuche mich ihm zu erklären. »Ich habe nichts getrunken. Sie ist verschlossen. Sehen Sie«, sage ich und greife nach der Flasche, um sie ihm durch das geöffnete Fenster präsentieren zu können. »Sie ist ein Geschenk. Ich bin komplett nüchtern, Officer.« Er ist die Ruhe selbst, als er sich seinem Notizblock widmet. Ich möchte zu gerne wissen, was er sich darauf notiert:
Geistig verwirrte Frau belästigt Officer mit plumpen Flirtversuchen.Selbige Frau versucht Officer mit einer Flasche Bourbon zu bestechen.
So etwas in der Art wird es vermutlich sein. Und während ich darüber nachdenke, und der Kerl immer noch auf seinem Block herumkritzelt, fühle ich mich wie ein kleines Schulkind, das beim Schummeln erwischt wurde. Mist!
»Steigen Sie bitte aus dem Wagen, Ma’am.« Die Autorität seiner Stimme hallt durch meinen Toyota. Mich schaudert heftig. WTF! Ungläubig blicke ich kurz durch die Windschutzscheibe vor mir, so überrascht bin ich von seinem erhobenen Tonfall. Ich kann meine Armhärchen dabei beobachten, wie sie sich immer weiter aufstellen. Ich brauche zwei Atemzüge lang, um mich einigermaßen wieder zu fassen. »Wenn Sie sich meiner Anweisung widersetzen, sehe ich mich leider gezwungen, Sie …«
»Oh Gott! Nein! Das ist wirklich nicht nötig. Ich mach ja schon«, unterbreche ich ihn schnell und öffne die Tür.
Er geht einen Schritt beiseite und wartet geduldig bis ich ausgestiegen bin. Die lange Autofahrt steckt mir in den Knochen, weshalb ich mich einmal strecke. Er deutet auf die Straße.
»Bitte gehen Sie die Linie entlang. Ein paar Meter vor und wieder zurück«, ist alles, was er mir zu sagen hat. Oh Mann. Ich habe wohl den einzigen Polizisten erwischt, der gegen weibliche Reize immun ist.
»Okay«, bringe ich knirschend hervor. Meine Lungen ziehen die Luft zwischen den Zähnen scharf ein, während ich tue, was er von mir verlangt. So hatte ich mir das jetzt wirklich nicht vorgestellt. Schritt um Schritt setze ich wie gewünscht auf der Linie einen Fuß vor den anderen und komme mir dabei so unglaublich dämlich vor, dass ich von ihm abgewandt heftig mit den Augen rolle. Nach ein paar Metern drehe ich um, und laufe peinlichst genau auf der Linie entlang wieder auf ihn zu. Er scheint zufrieden und lächelt mich zum ersten Mal an. Man könnte beinahe auf den Gedanken kommen, er hätte Spaß daran, mich mit dieser Aktion zu quälen. Mir hingegen ist das Lachen mittlerweile gründlich vergangen. Mehr als einen wütenden Augenaufschlag habe ich für den Kerl nach der Nummer hier nicht mehr übrig. Aber selbst das scheint ihn nicht aus dem Konzept zu bringen. Er macht einfach weiter mit seinem Programm und deutet nun auf meinen Wagen.
»Öffnen Sie bitte den Kofferraum, Ma’am.« Abermals macht er einen Schritt zur Seite, damit ich ungehindert an den Kofferraum treten kann.
»Aber klar doch.« Sichtlich genervt schreite ich an ihm vorbei. So langsam geht mir der Typ auf die Nerven. Mittlerweile ist mir auch der Strafzettel egal. Ich will nur noch, dass es vorbei ist. Da sich meine Reisetasche auf der Rückbank befindet, kommt gähnende Leere zum Vorschein, als ich den Kofferraum öffne.
»Kein weiterer Alkohol«, murmelt er, den leeren Kofferraum in Augenschein nehmend.
»Nein«, antworte ich knapp und hoffe, diese Begegnung mit ihm bald hinter mir zu haben.
»Führen Sie irgendwelche Drogen mit sich?«, will er jetzt von mir wissen. Ich stemme meine Hände in die Hüften und kann förmlich spüren, wie mir sämtliche Sicherungen im Kopf durchknallen.
»Selbstverständlich nicht!«, antworte ich ungehalten. »Für wen halten Sie mich denn? Für irgendeine dahergelaufene Crack-Nutte, die für ihren Zuhälter Stoff von einem Bundesstaat in den anderen schmuggelt? Falls ja, muss ich Sie leider enttäuschen. Ich bin nichts weiter als eine dämliche Pute, die ihren Freund mit einer anderen im Bett erwischt hat. Dass ich daraufhin ausgezogen bin, versteht sich von selbst, nehme ich an, doch nun habe ich leider keine Bleibe mehr. Ich wohne quasi in meinem Toyota. Außerdem habe ich meinen Job hingeschmissen, den ich nebenbei bemerkt wirklich gerne gemacht habe, eben weil ich für diesen Arsch nach der Nummer ja schlecht weiter arbeiten kann. Leuchtet ein, oder? Also bitte entschuldigen Sie, wenn ich gerade etwas neben der Spur bin. Wenn es sein muss, dann verhaften Sie mich eben. Ich habe eh keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Im Moment weiß ich nur, dass eine alte Tante von mir Hilfe braucht, weswegen ich gezwungen bin, Chicago zu verlassen, um aufs Land hinauszufahren. So bin ich ja überhaupt erst in diese Situation geraten, in der wir zwei jetzt so nett miteinander plaudern.«
Mein Brustkorb hebt und senkt sich deutlich nur wenige Zentimeter vor ihm. Erst jetzt bemerke ich, wie dicht ich an ihn herangetreten bin.
»Ich hatte eigentlich gar nicht vor, Sie zu verhaften«, lenkt er ein. Seine Stimme bekommt dabei mit einem Mal einen sanften Ton. Als würde er verstehen, was ich gerade durchmache.
»Oh, okay. D-danke …«, stammele ich. Langsam weiche ich ein paar Schritte zurück, um Abstand zwischen uns zu bringen. Es ist mir peinlich, dass ich gerade so sehr aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Normalerweise bin ich niemand, der sich einfach so mitteilt. Ich suche mir die Menschen, die ich an meinem Leben teilhaben lasse, für gewöhnlich ganz genau aus. Lockere Bekanntschaften vom Straßenrand gehören nun wirklich nicht dazu.
»Falls Sie aber doch länger in unserer schönen Stadt Sanders Lake verweilen sollten, und Sie einen ruhigen Platz zum neu orientieren und sortieren Ihres Lebens brauchen, stelle ich Ihnen gerne eine unserer Ausnüchterungszellen zur Verfügung. Ein Anruf genügt«, bietet er mir an, ohne die Weichheit in seiner Stimme wieder zu verlieren.
Skeptisch betrachte ich ihn. Hat er gerade einen Witz gemacht? Ich habe keine Ahnung, ob er mich verarscht oder es ernst meint. Ich weiß nur, so intensiv wie er mir in diesem Moment in die Augen sieht, erhöht sich mein Puls. Leichter Schwindel lullt mich ein. Allerdings könnte der Schwindel auch einfach nur an der Hitze liegen, stelle ich nüchtern fest. Doch es ändert nichts daran, dass dieser Officer alleine durch seine Stimme und die Art, wie er mich ansieht, eine Wirkung auf mich ausübt, die ich schwer kontrollieren kann und die ich so von mir nicht kenne. Aber vermutlich bin ich einfach nur irritiert und mit den Nerven ziemlich zu Fuß unterwegs. Mehr ist das nicht. Also bleibe ich ihm eine Antwort schuldig und warte einfach mit verschränkten Armen ab, was weiter geschieht.
Er versteht und tritt einen Schritt vom Wagen zurück. Ich hole einmal tief Luft, dann knalle ich die Klappe des Kofferraumes geräuschvoll herunter. Mit einem lauten PENG geht das, was auch immer das gerade zwischen uns war, vorüber. Gut so! Ich brauche nicht noch mehr Drama in meinem Leben.
»Warten Sie bitte hier. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.« Er lässt mich stehen und geht zu seinem Streifenwagen zurück. Mein Smartphone kündigt eine Nachricht an.
Jack: Nelly, mein Schatz. Wo steckst du? Lass uns bitte reden.
Ich schreibe zurück: Lösch meine Nummer, Arschloch!
Nachdem ich die Nachricht abgeschickt habe, pfeffere ich mein Telefon ins Wageninnere, so wütend bin ich mittlerweile. Wütend darüber, weil ich mir eingeredet hatte, Jack wäre der Richtige. Wütend darüber, dass mein Leben nur noch ein einziger Scherbenhaufen ist und ich mit nichts am Straßenrand stehe und einem fremden Officer meine Lebensgeschichte erzählt habe. Unglaublich wütend, weil dieser süße, dämliche, blöde Officer ewig braucht für meinen Strafzettel, und ich wie bestellt und nicht abgeholt am Straßenrand warten muss.
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis mein süßer, dämlicher, blöder Officer endlich wieder auf mich zukommt. Er tut es mit einer Lässigkeit, die schon fast unverschämt ist, den Strafzettel in Händen haltend, als wäre es eine Trophäe.
»Ich muss Sie darüber belehren, dass Sie zukünftig die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten haben und muss Sie auffordern, vor der Weiterfahrt den Alkohol zu verstauen.« Ich nicke nur noch. Mir ist bewusst, dass ich diese Schlacht verloren habe. Er hält mir den Zettel hin und ich nehme ihn entgegen. Er lässt nicht sofort los, sondern schaut mir in die Augen. Ich stutze. Für einen Augenblick wirkt es auf mich so, als würde er noch etwas sagen wollen, doch der Moment vergeht und schließlich lässt er den Zettel los und wendet den Blick ab. »In Ordnung. Ich wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt, Ma’am«, verabschiedet er sich und lässt mich stehen. Verdattert sehe ich ihm nach. Während er zu seinem Dienstwagen zurückschlendert, erhasche ich einen Blick auf seine Kehrseite. »Ach, und übrigens«, ruft er mir zu, während er bereits in seinen Wagen steigt. »Bevor ich Sie angehalten habe, hat Ihr Wagen aus dem Auspuff gequalmt, als würde er jeden Moment verrecken wollen. Das sollte sich besser mal ein Fachmann ansehen.«
Seine Wagentür schlägt zu, der Motor röhrt auf und seine Reifen wirbeln beim Anfahren wieder ordentlich Staub auf, der mich gänzlich einhüllt. Hustend stehe ich da, mutterseelenallein in dieser Einöde am Straßenrand, ohne die Chance bekommen zu haben, irgendetwas darauf zu antworten.
Ich höre mein Handy klingeln und stolpere noch ganz benommen ins Wageninnere. Hektisch hangele ich mein Telefon zwischen den Sitzen hervor. Es ist Catherine.
»Hi, Cathy«, nehme ich das Gespräch an.
»Hi, wie geht es dir? Bist du schon angekommen?«
»Nein, bin noch unterwegs. Hab gerade eine Polizeikontrolle hinter mir«, antworte ich ihr.
»Oh, wie fies! Eine Polizeikontrolle«, wiederholt sie. »War es sehr schlimm?«
»Wie man es nimmt. Hab einen Strafzettel für zu schnelles Fahren aufgedrückt bekommen.«
»Wie ärgerlich«, meint Cathy am anderen Ende der Leitung.
»Egal«, wiegele ich ab und konzentriere mich darauf, nicht wieder mit dem Heulen zu beginnen. »Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und bei dir? Alles klar soweit?«, frage ich, weil ich nicht möchte, dass sich das ganze Gespräch nur um mich dreht. Sie druckst erst noch etwas herum, doch schließlich kommt sie mit der Wahrheit heraus.
»Jack war hier. Hat natürlich vermutet, du wärst noch bei mir. Er wollte wissen, wo du steckst. Ich dachte, es wäre gut, wenn du das weißt, obwohl ich nach wie vor denke, es ist besser, so wie es jetzt ist«, macht sie mir noch schnell ihren Standpunkt klar.
»Keine Angst. Ich gehe nicht wieder zu ihm zurück. Mit dem Typen bin ich fertig«, betone ich und höre Catherine einmal tief durchatmen. »Du hast ihm hoffentlich nicht gesagt, wo ich bin und was ich vorhabe?«
»Selbstverständlich nicht«, tönt es durchs Telefon. »Der Arsch kann mich mal!«
Catherine zaubert mir mit ihren Worten ein Lächeln ins Gesicht. Ich bedanke mich noch herzlich bei ihr und verspreche ihr, mich zu melden, sobald ich bei meiner Tante Lucy angekommen bin. Dann lege ich auf.
Wie in Trance greife ich nach der Flasche Bourbon. Die Landstraße vor mir fest im Blick, öffne ich sie und genehmige mir einen beherzten Schluck, bevor ich sie wieder verschließe und in meiner Handtasche verschwinden lasse. Dann starte ich den Wagen und lenke ihn zurück auf die Straße.
Irrwitziger Weise kann ich aber an nichts anderes mehr denken als an diesen süßen, dämlichen, blöden Officer. Unaufhaltsam schleicht sich der Typ einfach in meine Gedanken hinein. Die Begegnung mit ihm hat mich richtig aufgewühlt.
Als ich Sanders Lake endlich erreiche, beschließe ich, mich vor dem Besuch bei meiner Tante etwas zu stärken und wieder zu beruhigen. Da kommt mir ein Schild, auf dem groß und bunt Stephanie’s Diner geschrieben steht, gerade recht. Spontan setze ich den Blinker und parke meinen Toyota vor dem Diner.
Bevor ich aussteige, greife ich nach meiner Handtasche, dabei bemerke ich den Strafzettel, der auf meinem Beifahrersitz liegt. Ich nehme ihn und lasse ihn durch meine Finger gleiten. Dabei stelle ich nur noch eines fest: das Abenteuer auf dem Land fängt ja gut an!
Kapitel 3
Reed
Dank der unvorhergesehenen Verkehrskontrolle gerade eben, treffe ich später als vereinbart im Diner ein. Mein Kollege Logan sitzt bereits an einem Tisch direkt am Fenster und wartet auf mich.
»Na, endlich!«, tönt er. »Ich bin am Verhungern. Wo warst du denn die ganze Zeit?«
Ich setze mich zu ihm, studiere kurz die Karte, die ich eigentlich auswendig kann, und winke Stephanie, der Besitzerin des Diners und festen Freundin von Logan, zu.
»Ich hatte ein paar Meilen stadtauswärts noch eine Verkehrskontrolle«, gebe ich Logan als Antwort.
Er stutzt, sieht mich an. »Eine Verkehrskontrolle«, echot er. »Hier bei uns?«
Ich kann seine Verwunderung nachvollziehen. Unsere kleine beschauliche Stadt Sanders Lake ist nicht gerade für Verkehrssünder bekannt, sondern gilt eher als still und gesetzestreu. Hier ist halt für gewöhnlich nicht viel los. Bei knapp 1200 Einwohnern, auch nicht anders zu erwarten.
»Ja«, entgegne ich. »Eine junge Frau aus Chicago. Sie ist gefahren, als wäre der Teufel persönlich hinter ihr her. Bin kaum hinterhergekommen mit dem Dienstwagen.«
Logan grinst. »Und deswegen verpasst du beinahe das Mittagessen?«
»Gesetz ist eben Gesetz«, sage ich. Ich will gerade ansetzen und Logan darüber belehren, dass er im Dienstgrad über mir steht und eigentlich er derjenige sein müsste, der mir meine Arbeit erklärt und nicht umgekehrt, als die Schelle der Eingangstür ertönt und die blonde Frau aus Chicago ebenfalls das Restaurant betritt.
Ich verstumme, brauche noch einen Moment, bis ich mich wieder unter Kontrolle habe, und lenke meinen Blick wieder auf Logan.
»Ähm … wo waren wir gerade?«
Logan, überrascht über meine Reaktion, sieht nun ebenfalls zur Eingangstür und bemerkt die Blondine. »Na, sieh mal einer an«, säuselt er und grinst wie ein Honigkuchenpferd, als er sich wieder mir zuwendet. »Ich verwette meinen Dienstwagen darauf, dass das dein City Girl aus Chicago ist.«
»Deinen Dienstwagen will niemand geschenkt«, entgegne ich ihm, denn seine Karre ist noch weitaus altersschwächer als meine. »Und ja, das ist sie«, gebe ich ihm im nächsten Atemzug recht.
Zum Glück kommt Stephanie nun zu uns herüber, sodass wir unsere Bestellung aufgeben können.
Nachdem wir bestellt haben, wendet sich Logan wieder der Frau aus Chicago zu. »Sie sieht verdammt heiß aus. Oder was meinst du?«, fragt er mich unvermittelt, während er sie für meinen Geschmack viel zu intensiv anstarrt.
»Hey«, flüstere ich ihm entgegen, um seine Aufmerksamkeit wiederzuerlangen. »Starr sie gefälligst nicht so an. Sie hat dich nicht zu interessieren. Immerhin hast du Stephanie«, rufe ich ihm seine langjährige Beziehung ins Gedächtnis.
»Und die werde ich auch für keine andere Frau auf dieser Welt wieder hergeben«, sagt er, ohne das Interesse an der Unbekannten zu verlieren. »Wie heißt sie denn? Und was will sie hier? Was genau konntest du in Erfahrung bringen?«, platzt es aus ihm heraus.
»Ey … du bist schlimmer als jedes Waschweib«, sage ich, rücke dann aber doch mit ein paar Informationen raus, während ich im Augenwinkel mitbekomme, wie Stephanie nun die Bestellung der Blondine entgegennimmt. »Es war wie gesagt nur eine Verkehrskontrolle. Außer dem Namen und dem aktuellen Wohnort konnte ich nicht viel mehr in Erfahrung bringen«, flunkere ich, denn es erscheint mir unpassend herumzuposaunen, dass die junge Frau mir beinahe ihre gesamte Lebensgeschichte erzählt hat. »Ihr Name ist Nelly Moore, sie ist fünfundzwanzig Jahre alt und kommt aus Chicago. Sie besucht eine alte Tante und ist quasi in ein paar Tagen schon wieder weg, wenn ich das richtig verstanden habe.«
Logan scheint enttäuscht. »Das ist alles?«
»Ja«, beharre ich. »Und sie hat uns nicht weiter zu interessieren.« Stephanie bringt Getränke und das bestellte Essen an unseren Tisch. »Iss lieber, ehe es kalt wird«, fordere ich ihn auf. Damit ist das Thema Nelly Moore für mich vom Tisch.
Kapitel 4
Nelly
Das Haus meiner Tante Lucy befindet sich etwa eine halbe Meile außerhalb von Sanders Lake. Die Zivilisation habe ich somit fürs Erste hinter mir gelassen. Durch die verdreckte Frontscheibe meines betagten Toyota schaue ich zwar auf ein recht passables kleines Farmhaus, der nächste Nachbar allerdings befindet sich in weiter Ferne. Im Vorgarten blühen ein paar hübsche Blumen, die jemand mit Hingabe regelmäßig pflegt. Der Rasen hingegen wirkt vernachlässigt und trocken. Hinter den schlierigen Fenstern sind luftige, gelblich-weiße Gardinen zu erkennen, zwischen denen es sich gleich mehrere Katzen gemütlich gemacht haben. Unangenehm glotzen sie mich mit ihren runden Augen an und beobachten jede meiner Bewegungen. Mir sind diese Tiere unheimlich. Zu Hause hatten wir einen Kater, bei dem man nie wusste, woran man ist. Im ersten Moment strich er einem verschmust um die Beine, im nächsten attackierte er einen mit seinen scharfen Krallen und zerfetzte einem die Haut.
Trotzdem steige ich aus. Schließlich bin ich nicht stundenlang hierhergefahren, um jetzt wegen ein paar Fellnasen wieder das Weite zu suchen. Meine Handtasche mit der Flasche Bourbon darin geschultert, gehe ich auf die Eingangstür zu. Wenige Stufen führen auf eine Holzveranda, dessen Vordach bereits bessere Zeiten gesehen hat, aber grundsolide gebaut erscheint.
Ich klingele. Die Farbe der verwitterten Holzfassade muss einmal ein helles, freundliches Blau gewesen sein, ist jedoch, witterungsbedingt, einem Graublau gewichen und blättert an einigen Stellen. Auf der anderen Seite der Tür höre ich es mauzen, doch bereits nach kurzer Zeit mischt sich eine murmelnde Frauenstimme dazwischen. Durch die Scheibe in der Haustür kann ich eine ältere, leicht gebückt gehende Frau auf mich zukommen sehen. Das muss Tante Lucy sein.
»Aber jaaaa, ganz ruuuuhig. Wir schauen, wer uns da besuchen will. Aber jaaaaa doch«, höre ich sie säuseln, vermutlich das Wort an die Katzen gerichtet, die ihr um die Beine streichen. Mich schüttelt es bei dem bloßen Gedanken selbst von so vielen Viechern umgarnt zu werden.
Mit einem lauten Knarzen öffnet sich die Tür einen Spalt weit und die alte Dame schaut zu mir heraus. »Ja, Sie wünschen?«, spricht sie mich direkt an.
»Hi, Tante Lucy«, antworte ich schnell, mich mit einem Mal vollkommen nervös und fehl am Platz fühlend. »Ich bin es … Nelly. Vermutlich erkennst du mich nicht direkt. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war ich noch so klein«, sage ich und deute mit der linken Hand an, wie groß ich wohl ungefähr bei unserem letzten Beisammensein gewesen sein muss.
Tante Lucy schürzt skeptisch die Lippen. »Das kann ja jeder behaupten. Gehen Sie!«, ruft die alte Dame mir harsch entgegen und will die Tür bereits wieder verschließen. Von der erhobenen Stimme ihres Frauchens angestachelt, beginnen die Katzen im Kanon zu miauen. Ein unerträgliches Gejaule beginnt. Schnell stelle ich meinen Fuß in die Tür, bevor sie zugeht. Direkt darauf bereue ich es auch schon wieder, denn meine liebreizende Tante knallt mit voller Wucht die Tür dagegen, sodass ich, ohne es zu beabsichtigen, in das Katzenkonzert mit einsteige. Laut aufheulend springe ich auf dem gesunden Fuß auf der Veranda umher und reibe mir dabei den schmerzenden Fuß. Für einen kurzen Augenblick zögert meine Tante. Jedoch beschließt sie nach wenigen Sekunden, wie geplant, die Tür zu verschließen.
Mit pochendem Zeh lasse ich mich auf den Stufen der Veranda nieder und krame wohl oder übel nach der Telefonnummer der Kirchenmitarbeiterin, mit der ich telefoniert habe. Ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter.
Zehn Minuten später höre ich, wie Tante Lucy vorsichtig den Kopf durch den Türspalt nach außen steckt. Als sie mich entdeckt, lächelt sie, wirkt deutlich freundlicher als vorhin noch.
»Na, komm schon rein, Mädchen. Mrs Norris hat gerade angerufen. Sie hat mir erzählt, dass sie dich mir auf den Hals gehetzt hat.« Mühselig bückt sich Tante Lucy nach einer Katze, um sie etwas weiter abseits der Tür wieder auf den Boden zu setzen. Dann öffnet sie die Tür ganz und deutet mit einer Handbewegung, ich solle eintreten. Stumm folge ich ihrer Anweisung. Dabei beobachtet sie mich genauso intensiv wie ihre Katzen es tun. Meine Tasche geschultert, schaue ich mich im Eingangsbereich etwas um.
»Nett hast du es hier, Tante Lucy«, versuche ich einen ersten zaghaften Versuch, mit ihr ins Gespräch zu kommen, obwohl es ehrlich gesagt eher verwohnt als gemütlich ist.
»Das weiß ich. Und deshalb wird es euch auch nicht gelingen, mich von hier zu vertreiben«, murmelt sie biestig.
»Wer hat das denn vor?«, frage ich neugierig.
»Na, wer wohl? Mrs Norris natürlich und der verkappte Pfarrer. Sie meinen, ich käme alleine nicht mehr zurecht. Es wäre ihre Christenpflicht, mir zu helfen. Doch ich will keine Fremden hier im Haus und in eine Einrichtung gehe ich schon zweimal nicht. Mich müsst ihr schon mit den Füßen voran aus diesem Haus tragen. Das sage ich euch«, lässt sie mich wissen, wie sie die ganze Sache sieht. Sie schlurft an mir vorbei und zeigt auf eine offen stehende Tür. »Aber genug davon. Komm erst mal mit in die Küche. Du wirst sicher durstig sein, nach der langen Fahrt. Und deinen Zeh können wir auch kühlen. Der tut sicher weh.«
Umringt von mehreren Katzen, beobachte ich meine betagte Tante, wie sie mir voraus in die Küche tritt. Ich folge in gebührendem Abstand. War der Geruch an der Haustür noch wohlwollend als muffig zu bezeichnen, so ändert sich dieser Zustand mit jedem Schritt, den man weiter in das Haus hineintritt. Hier stinkt es! Aber ganz gewaltig! Was aber eigentlich kein Wunder ist, bei der Anzahl an Katzen, die hier zu hausen scheinen. Und regelmäßig gelüftet wird hier vermutlich auch schon länger nicht mehr.
»Kaffee?«, werde ich gefragt und so bin ich dazu gezwungen einmal tief Luft zu holen und zu antworten.
»Sehr gerne. Wenn du einen dahast.«
»Ich habe immer Kaffee da. Bei mir muss niemand verdursten. Ich komme noch sehr gut alleine zurecht«, setzt sie direkt nach, um ihren Standpunkt nochmals zu verdeutlichen und mir wird klar, dass mein Aufenthalt hier länger dauern könnte, als angenommen. Schnell räumt Tante Lucy ein paar alte Zeitschriften von einem Stuhl. »Kannst dich hier hinsetzen, solange. Zieh schon mal deinen Schuh aus«, fordert sie mich auf. »Ich bringe dir etwas zum Kühlen.« Der Stuhl hat schon bessere Tage gesehen und knarzt unheilvoll, als ich mich draufsetze, doch er hält.
Etwas später lässt der Schmerz im Zeh dank der Packung Tiefkühlerbsen etwas nach und auf dem Tisch vor mir steht eine randvoll gefüllte Tasse Kaffee. Ein prüfender Schluck aus der Tasse bestätigt meinen Verdacht, dass der Kaffee nur mehr lauwarm ist und vermutlich seit den frühen Morgenstunden auf der Kaffeemaschinenplatte warmgehalten wird. Dennoch lächele ich tapfer, während meine Tante es sich mir gegenüber gemütlich macht. Eine weiße Katze landet mit einem eleganten Sprung direkt neben meiner Tasse und schon schwimmt ein weißes Haar in der schwarzen Flüssigkeit.
»Na, naaa«, ermahnt Tante Lucy das Tier und setzt es sogleich wieder auf den Boden zurück. »Wenn wir Gäste haben, dürft ihr nicht auf den Tisch. Das wisst ihr doch«, schnurrt sie dem Tier entgegen und krault es hinter den Ohren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Tiere den Unterschied kennen, denke mir aber einfach meinen Teil, weil ich mich nicht in den ersten fünf Minuten mit meiner Tante anlegen möchte. Unauffällig pule ich das Katzenhaar aus meinem Kaffee und stürze die lauwarme Plörre in einem Zug hinunter, damit ich es hinter mir habe.
Meine Tante schaut mich fordernd an. »Nun sag schon, was du hier willst, Mädchen«, wird sie deutlich. »Du bist sicher nicht hier, weil du ein paar schöne Tage auf dem Land verbringen möchtest.«
Innerlich schnaube ich auf, nach außen hin bleibe ich ruhig. »Kann man nicht unbedingt behaupten. Nein«, gebe ich ihr recht.
»Mrs Norris hat gesagt, ihr hättet miteinander gesprochen. … Über mich.« Tante Lucys Stimme zittert. Es ist ganz deutlich zu erkennen, wie wenig sie davon hält, dass Mrs Norris jemand Außenstehenden hinzugezogen hat.
»Ja«, gebe ich wahrheitsgemäß zu. »Sie meint, du bräuchtest Unterstützung im Alltag, würdest aber jede Hilfe, die man dir anbietet, ablehnen. Sie sagt, du kämst halt nicht mehr so gut alleine zurecht wie früher«, beginne ich von dem Gespräch mit der Kirchenmitarbeiterin zu erzählen. Ich sehe, wie meine Worte Tante Lucy zusetzen. »Ich glaube, sie will dir nichts Böses«, versuche ich sie zu beruhigen. »Sie macht sich einfach Sorgen um dich. Deshalb hat sie mich angerufen. Das ist doch eigentlich sehr nett von ihr, dass du ihr nicht egal bist. Meinst du nicht?«
Tante Lucy kräuselt die Lippen. »Mrs Norris soll sich nicht in Dinge einmischen, die sie nichts angehen. Sie dramatisiert. Man darf ihr nicht alles glauben, was sie so von sich gibt«, wiegelt Tante Lucy ab, und erhebt sich von ihrem Sitz. Dabei will sie nach meiner leeren Tasse greifen, fasst aber etwas daneben, und die Tasse wirbelt schwungvoll einmal herum und landet mit einem lauten Klirren auf dem Küchenboden. »Herrje! So ein Pech. Ich habe meine Brille gar nicht auf«, ruft sie aus und will sich sogleich nach den Scherben bücken. »Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren«, versucht sie sich mir zu erklären. Ich bekomme die leise Befürchtung, dass meine Tante auch mit Brille nicht sonderlich viel mehr sehen kann, doch das behalte ich lieber erst einmal für mich. Vorerst.
»Warte, Tante Lucy. Ich mach das schon«, sage ich und komme ihr zuvor, bevor sie halb blind beginnen kann in den Scherben zu wühlen und sich dabei womöglich noch verletzt.
»Das ist nicht nötig.« Sie versucht mich am Arm wieder hochzuziehen, doch ich wehre sie freundlich, aber bestimmt ab. »Ich komme hier sehr gut alleine zurecht. Das hab ich doch schon gesagt«, setzt sie nach.
»Ja, das hast du«, entgegne ich, während ich die Scherben einsammele. »Und niemand will dich zu etwas zwingen, was du nicht willst. Ich am allerwenigsten«, versuche ich sie zu beruhigen.
»Das wäre ja auch die Höhe! Ich lasse mir gewiss nicht von einem Grünschnabel wie dir vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe. Komm du erst mal selber klar, dann reden wir weiter.«
Mit einem dicken Kloß im Hals versuche ich meiner Tante nicht zu zeigen, wie sehr mich ihre Worte verletzen. Immerhin hat sie keine Ahnung, wie nah sie gerade an der Wahrheit ist, und außerdem bin ich ohne Ankündigung einfach so bei ihr aufgetaucht und meine Anwesenheit verunsichert sie. Vermutlich würde es mir an ihrer Stelle nicht viel anders ergehen. Daher zwinge ich mich dazu ruhig zu bleiben und frage mit Blick auf die Scherben in meiner Hand nur: »Wo kann ich die hier entsorgen, liebe Tante?«
Skeptisch betrachtet sie mich eingehend. Dass ich nervös bin, kann ich nicht vor ihr verbergen, trotzdem versuche ich mich an einem offenen und freundlichen Lächeln. Schließlich gibt Tante Lucy nach und öffnet nun selbst wieder deutlich milder gestimmt die Schranktür unter dem Spülbecken für mich, sodass ich die Scherben im Mülleimer entsorgen kann. Nachdem ich den Boden und den Tisch mit einem Lappen gereinigt habe, lassen wir uns wieder am Küchentisch nieder.
»Du darfst mir bitte meine Art von eben nicht übel neben«, höre ich meine Tante sagen. »Es ist nur so … Ich hab es nicht gerne, wenn man versucht über meinen Kopf hinweg zu entscheiden. Und Fremde im Haus kann ich überhaupt nicht leiden.«
»Das verstehe ich«, gebe ich zu. »Aber wenn man es genau nimmt, bin ich keine Fremde. Ich bin deine Nichte. Trotzdem verspreche ich dir, beim nächsten Mal werde ich anrufen, bevor ich vorbeikomme.«
Sie stutzt. »Beim nächsten Mal?«
»Ja, wieso nicht? Du scheinst ganz okay zu sein. Hast mir Kaffee angeboten«, versuche ich es mit einem auflockernden Scherz. Und es klappt. Sie lacht tatsächlich kurz auf.
»Mädchen, ich kann dir sagen, du bist die Erste seit Jahren, die freiwillig einen Fuß in mein Haus setzt. Die Einzigen, die sich hier bei mir noch blicken lassen, sind der Briefträger, der Pfarrer und die leidige Mrs Norris, die ich einfach nicht mehr loswerde. Besuch, also richtigen Besuch habe ich hier seit Jahren nicht mehr gehabt. Ich bin es gewohnt, alleine zu sein. Du brauchst dich mir gegenüber also wirklich nicht verpflichtet fühlen. Außerdem habe ich ja meine Katzen.«
Mir wird direkt etwas weh ums Herz, wie ich sie so reden höre. »Was ist mit deinem Mann?«, frage ich zaghaft, obwohl ich mir die Antwort eigentlich schon denken kann. »Soweit ich weiß, hast du geheiratet, bevor du damals von zu Hause fort bist.« Mit einem Schmerz behafteten Ausdruck im Gesicht wandert der Blick meiner Tante zum Küchenfenster hinaus in die Ferne.
»Ach, mein lieber George. Er war eine gute Seele. Die beste, die man sich nur denken kann. Leider ist er nun schon lange nicht mehr unter uns.«
»Das tut mir leid«, flüstere ich, und fühle sogleich einen Schmerz, der nicht der meine ist. Obwohl ich meine Tante Lucy so gut wie gar nicht kenne, berührt mich ihre Trauer.
»Es ist lieb von dir, dass du das sagst, aber es muss dir nicht leidtun, liebe Nelly. George und ich hatten ein wunderbares Leben. Wir haben einander sehr geliebt. Und ich habe es nie bereut, dass ich mich damals für ihn entschieden habe.«
»Entschieden?«, hake ich nach.
»Als wir uns ineinander verliebten, war George schon lange mit einer anderen Frau verheiratet. Damals, also ganz früher, in unserer Jugend, war es üblich, dass wir alle sehr jung geheiratet haben, oftmals übereilt. So war es auch bei George. Er und seine erste Frau hatten sich nie wirklich ineinander verliebt, trotzdem geheiratet und in den folgenden Jahrzehnten sechs Kinder großgezogen. Das musst du dir bitte mal vorstellen. Sechs Kinder und das alles ohne Kribbeln im Bauch.« Ich nicke nur stumm, und während ich den Worten meiner Tante lausche, überlege ich, ob es zwischen Jack und mir in den letzten vier Jahren jemals gekribbelt hat. »Dann bin ich in sein Leben getreten und es war um uns beide geschehen. Für ihn war schnell klar, dass nur eine Scheidung infrage kommt, damit wir zusammen sein können. Es lag nur an mir, wie ich mich entscheiden würde. Ich selbst war verwitwet und kinderlos, war demnach ungebunden. Die Tatsache, eine Ehe zu zerstören und eine Frau unglücklich zu machen, nur damit ich glücklich sein kann, hat mich lange zögern lassen, doch letztendlich habe ich ja gesagt und so nahm alles seinen Lauf.« Sie macht eine kurze Pause, bevor sie weiterspricht, mich fest dabei ansehend. »Bis zu seiner Scheidung ist zwischen ihm und mir nicht das Geringste passiert, was man als anstößig bezeichnen könnte. Den Ruf einer Ehebrecherin und eines Ehebrechers hatten wir dennoch weg. Du weißt ja selbst, wie die Familie zu Hause so tickt.« Etwas unsicher, ob ich ihre Haltung teile, wartet sie auf eine Reaktion von mir.
»Oh ja. Das weiß ich nur zu gut«, stimme ich ihr zu und Tante Lucy entspannt sich wieder. »Ich habe selbst kaum noch Kontakt nach Hause. Bin vor Jahren ausgezogen.« Für einen kurzen Moment glaube ich in den Augen meiner Tante so etwas wie Anteilnahme zu erkennen.
»George und ich entschieden uns für einen kompletten Neubeginn und kauften dieses kleine Farmhaus für uns. Es war die beste Entscheidung unseres Lebens.« Mir wird ganz warm ums Herz, weil ich spüre, während Tante Lucy von George spricht, wie sehr sie einander geliebt haben müssen.
»Was ist dann geschehen?«