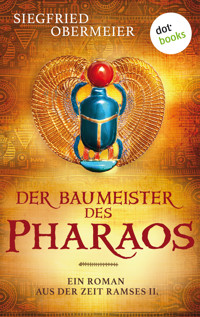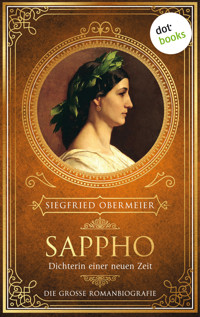
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war die größte Dichterin des Abendlandes: Der historische Roman »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« von Siegfried Obermeier als eBook bei dotbooks. Lesbos, um 600 vor Christus. Als Frau auf die Welt gekommen zu sein, bedeutet für die junge Sappho: keine Rechte, keine Selbstbestimmung, keine Chance auf Bildung. Doch die feinsinnige Griechin ist entschlossen, sich den Regeln ihrer Zeit zu widersetzen – sie ist sicher, dass sie dazu bestimmt ist, all das auszukosten, was bisher ihren Brüdern vorbehalten ist. Mit Geduld und Beharrlichkeit erstreitet sie sich eine Ausbildung an der Seite junger Männer. Ihre eigene Stimme findet Sappho in den Gedichten, die sie bald schon über die Grenzen des Inselreiches hinaus berühmt machen. Endlich sieht sie sich am Ziel, ihren Lebenstraum zu verwirklichen: eine Schule nur für Frauen. Doch wie groß ist der Preis, den sie dafür bezahlen wird? Sie ist die erste Lyrikerin der Menschheitsgeschichte, ihr Werk wurde mit dem Homers gleichgestellt – doch tragischerweise gingen fast alle ihre Texte im Laufe der Jahrhunderte verloren: Siegfried Obermeier nähert sich in diesem besonderen Roman mit viel Feingefühl einer der größten Frauengestalten der Weltgeschichte. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die bewegende Romanbiografie »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« von Siegfried Obermeier über eine besondere Frau, die für sich und ihre Ideale ein Leben lang kämpfen musste – und deren Nachruhm nie verblasst! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Lesbos, um 600 vor Christus. Als Frau auf die Welt gekommen zu sein, bedeutet für die junge Sappho: keine Rechte, keine Selbstbestimmung, keine Chance auf Bildung. Doch die feinsinnige Griechin ist entschlossen, sich den Regeln ihrer Zeit zu widersetzen – sie ist sicher, dass sie dazu bestimmt ist, all das auszukosten, was bisher ihren Brüdern vorbehalten ist. Mit Geduld und Beharrlichkeit erstreitet sie sich eine Ausbildung an der Seite junger Männer. Ihre eigene Stimme findet Sappho in den Gedichten, die sie bald schon über die Grenzen des Inselreiches hinaus berühmt machen. Endlich sieht sie sich am Ziel, ihren Lebenstraum zu verwirklichen: eine Schule nur für Frauen. Doch wie groß ist der Preis, den sie dafür bezahlen wird?
Sie ist die erste Lyrikerin der Menschheitsgeschichte, ihr Werk wurde mit dem Homers gleichgestellt – doch tragischerweise gingen fast alle ihre Texte im Laufe der Jahrhunderte verloren: Siegfried Obermeier nähert sich in diesem besonderen Roman mit viel Feingefühl einer der größten Frauengestalten der Weltgeschichte.
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba« und »Das Spiel der Kurtisanen« sowie die große Romanbiographie »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Dieses Buch erschien bereits 2001 unter dem Titel »Sappho« bei nymphenburger.
Copyright © der Originalausgabe 2001 nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Roberto Castillo und eines Gemäldes von Anselm Feuerbach
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-909-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sappho« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Sappho, Dichterin einer neuen Zeit
Die große Romanbiografie
dotbooks.
Prolog
Ich will dir einen Traum erzählen, liebe Kleis, den ich träumte, seit ich mich erinnern kann. Doch wie weit reicht unsere Erinnerung zurück? Bis ins zweite, ins dritte – oder erst ins vierte Lebensjahr? Vielleicht haben andere Mädchen es anders empfunden, ich jedenfalls fühlte mich benachteiligt, beiseite geschoben, ungerecht behandelt, wenn meine älteren Brüder schon in ganz jungen Jahren nach draußen gingen, um den Vater auf die Jagd, zu Besuchen und zum Hafen zu begleiten. Du, meine Tochter, bist anders erzogen worden, aber damals begegnete man mir mit wenig Verständnis. Für Mädchen gehöre sich das nicht, sagten die Mutter, die Amme, die Tanten, die Dienerinnen. Alle waren sich darin einig, dass es unserem Geschlecht – dem weiblichen – nicht gestattet sei, die gleichen Freiheiten zu genießen, wie es Knaben, Jünglinge und Männer durften.
Mein Traum war, dies zu ändern, zuerst nur für mich, dann für alle Frauen und Mädchen. Man mag ihn einfältig nennen, diesen Traum, unausgegoren, kindisch – ja hoffnungslos und in keinem Fall zu verwirklichen. Zuerst wurde ich belächelt – ein Kleinmädchenwunsch! Später tuschelten sie hinter meinem Rücken, und es fehlte nicht an guten Ratschlägen, auch an Drohungen und Mahnungen.
Habe ich meinen Traum verwirklichen können, habe ich erreicht, was ich so sehnlich wünschte? Vieles konnte ich verwirklichen, einiges nicht. Kluge Leute sagen, die wahre Geburt des Menschen finde nicht bei seinem ersten Atemzug statt, sondern in dem Augenblick, da er sich deutlich erinnere, zu denken und zu sein. Jeder von uns aber hat eine Vorgeschichte – es gibt Eltern und Großeltern, wir stehen nicht allein da, sondern werden in ein Geflecht von Menschen und Umständen hineingeboren, das wir zuerst nicht bewusst erleben, sondern erst später aus dem Munde anderer erfahren.
Ehe ich selbst zu erzählen beginne, gebe ich wieder, was mir Eltern, Verwandte, Diener und Freunde berichtet haben über eine Zeit, da ich noch ungeboren oder nicht zu eigenen Gedanken – nicht zur Erinnerung fähig war. Es soll dein Wissen erweitern, liebe Kleis, über mich und unsere Familie; und so beginne ich meinen Bericht mit deiner Großmutter, deren Namen du trägst und der du im Wesen nicht unähnlich bist.
Buch I
Komm hierher zur heiligen Stätte,
wo von Apfelbäumen ein schöner Hain
sich rings erstreckt und auf Altären
schwelen Wolken von Weihrauch.
Kühles Wasser rauscht an Apfelzweigen
leis vorbei, Rosen beschatten alle
Hänge, traumlos rieselt der Schlaf
von ihren bebenden Blättern.
Überblüht von Frühlingsblumen
prangen die Wiesen – Nahrung der Pferde
und süßen Duft verströmt das Aniskraut.
Komm doch, Kypris, waltend an dieser Stätte,
und vermische im Gold der Schalen den Nektar,
mit dem zarten Duft der Festesfreude!
Gib uns zu trinken …
Kapitel 1
Kleis war jetzt hochschwanger und verließ das Haus nicht mehr. Früher hatten sie ihre Dienerinnen gelegentlich zum Markt begleitet, wo sie mit kundiger Hand und wachsamen Augen den Bedarf an Fleisch und Fisch einkaufte – oder, besser gesagt, einhandelte, denn sie war nur selten gesonnen, den geforderten Preis zu bezahlen. Es hätte dieses Handels nicht bedurft, da ihr Gemahl Skamandronymos einige Dutzend höriger Bauern, Fischer, Schäfer, Winzer, Imker und Jäger beschäftigte, sodass sie mit allem Notwendigen versorgt waren. Aber in den Familien der Oligarchie war es üblich, dass die Frauen sich nicht ganz unsichtbar machten, sondern sich dann und wann in der Öffentlichkeit zeigten, natürlich in schicklicher Begleitung der douloi, die ihre Sänfte umgaben und deren Zahl den Wohlstand der Familie anzeigte. Wurden es weniger, so zog man gleich gewisse Schlüsse daraus.
Kleis gehörte einer alteingesessenen Familie an, die seit Menschengedenken auf Lesbos blühte und sich mehrfach verzweigt hatte. Die Ureinwohner – sie nannten sich Pelasger – unterschieden sich im Äußeren deutlich von den späteren Zuwanderern. Ihr Wuchs war klein, stämmig; Haut, Haare und Augen dunkel, ihre aiolische Sprachform unterschied sich wesentlich von der der anderen hellenischen Stämme.
Auch auf Lesbos war – wie überall, wo sich Menschen in Städten und Siedlungen zusammenfanden – eine Rangordnung entstanden. An der Spitze standen die Familien der Oligarchie, was eine »Herrschaft Weniger« bedeutet, und diese bestimmten auf den Adelsversammlungen in gemeinsamer Beratung das Schicksal ihrer Stadt. Dann gab es die Freien, die kein eigentliches Bürgerrecht besaßen, jedoch Handel und Handwerk trieben und auch Grundbesitz erwerben konnten. Den Unfreien aber, den hörigen Bauern und Handwerkern, den dienenden Knechten und Mägden musste es nicht unbedingt schlechter ergehen als den Freien. Es hing von ihrem Herrn ab, wie er sie behandelte, und wer sein Gesinde schlecht hielt, geriet in schlechten Ruf.
Auch bei der pelasgischen Urbevölkerung hatten sich im Laufe der Jahrhunderte Unterschiede herausgebildet. Bei Familien, die im Laufe der Zeit wohlhabend geworden waren und seit Generationen keine schwere Arbeit verrichten mussten, hatten sich nicht nur Sprache und Sitten verfeinert, sondern auch Gesicht und Gestalt. Nach und nach war alles Grobe und Bäuerische abgefallen. Bei fast allen Männern hatte sich das Derb-Stämmige in anmutige Wohlgestalt verwandelt und das war bei den sportlichen Wettkämpfen der epheboi deutlich zu sehen.
Die Frauen aus den alten Adelsfamilien neigten zu feiner Zierlichkeit und Antlitzen von herbem Liebreiz. Auf fremde Zuwanderer wirkte das häufig so bestrickend, dass sie auf Lesbos einheirateten und sich dort niederließen. Dazu muss gesagt sein, dass die meisten Patrizierfamilien keineswegs abgeneigt waren, ihre Töchter und Söhne mit Einwanderern aus guten Familien zu verbinden. Nicht wenige der Oligarchen betrieben – wenn auch nebenher und durch geeignete Diener – lebhaften Handel mit hellenischen Städten und Inseln und manchmal reichten die Verbindungen bis nach Aigyptos und Parthia.
Kleis kannte diese Zusammenhänge schon, weil es Hera, der Gemahlin des Zeus, gefallen hatte, sie ehelich mit einem dieser Zuwanderer zu verbinden. Aphrodite, die Schaumgeborene, hatte zuvor jedoch bewirkt, dass Kleis’ Liebe zu ihm entbrannte.
Sie lächelte, als sie daran dachte, und gerade in den Zeiten der hohen Schwangerschaft kamen ihr diese Ereignisse oft in den Sinn. Bei ihren Söhnen war das noch anders gewesen. Da hatte sie ihr Sinnen und Trachten ganz nach innen gerichtet, auf das neue Leben, das wundersam in ihr heranwuchs. Jetzt hingegen erlebte sie in Wachträumen oft jene Zeit, da sie zu den großen Jahresfesten mit ihrer Familie ins heraion gezogen war, um dort mit anderen Mädchen aus Adelsfamilien im Chorgesang das Götterpaar Zeus und Hera zu preisen. Auch Dionysos besaß in diesem Tempel einen Altar, doch ihm zu huldigen war den Erwachsenen, vor allem den Frauen vorbehalten. Das im Zentrum der Insel am Golf bei Pyrrha gelegene Heiligtum gehörte allen Bewohnern von Lesbos, gleich aus welchem Gebiet sie kamen.
Skamandronymos war nur bedingt als Fremder anzusehen, denn er kam aus dem Gebiet von Ilion in der Landschaft Troas, wo man aiolisch sprach und sich politisch der Insel Lesbos verbunden fühlte. Kein Fremder und doch fremd auf Eresos und Mytilene – fremd auch, als er im Tempelvorhof unter den Bürgern und Freien von Lesbos stand und dem lieblichen Chorgesang der Mädchen lauschte.
Singe mir, Muse, das Lied von den Werken
der häuslichen Hera …
Skamandronymos ließ seinen Blick über die jugendfrischen Mädchengesichter wandern, von denen ein Teil noch kindliche Züge aufwies, ein anderer aber schon die erwachende Weiblichkeit verriet. Wie es sich bei Hymnen an Götter gehörte, war der Blick der Mädchen nicht – wie sonst anempfohlen – züchtig gesenkt, sondern zum Himmel erhoben, wo die Unsterblichen wohnten und wohin der Rauch der schwelenden Opferfeuer zog.
Da blieb sein Blick an einem der Gesichter haften. Ein schmales Antlitz mit dunkel leuchtenden Augen und dunkel schimmerndem Haar, das – von einem silbernen Stirnband gehalten – zu beiden Seiten auf die schmalen Schultern fiel.
Immer wieder kehrte sein Blick zu diesem einen Gesicht zurück. Ihre Augen sahen ihn nicht, denn sie schaute während des Gesanges nach oben und in den Pausen blieb ihr Blick gesenkt. Einmal jedoch, für die Zeit eines Lidschlags nur, trafen sich ihre Augenpaare. Kleis erschrak etwas, runzelte auf niedliche Art ihre glatte Stirn und dann setzte wieder der Chorgesang ein. Weil die späte klare Morgensonne den Vorhof des Tempels in helles Licht tauchte, genügte dieser kurze Augenblick, um sie das Gesicht ihres Betrachters genau erkennen zu lassen. Sein Haupt überragte die meisten seiner dicht gedrängt stehenden Nachbarn um fünf oder sechs daktyloi, seine schmale Nase ragte kühn hervor, Haar und Bart leuchteten in der Sonne wie das Goldbraun reifer Haselnüsse.
Für Skamandronymos war es dann sehr schwierig, den Namen ihrer Familie herauszufinden. Bei dem auf das Tempelfest folgenden symposion der Handelsherren und ihrer Gäste begegnete er nur nachsichtigem Kopfschütteln.
»Aber mein Lieber, da standen gut dreißig Mädchen in drei Reihen; über die Hälfte davon wird dunkelhaarig gewesen sein und sie alle trugen als Jungfrauen nach Landessitte das Haar offen.«
Der andere lachte. »Da wird es dir wohl nicht erspart bleiben, von Haus zu Haus zu gehen und …«
»Unsinn!« Skamandronymos sagte es mit verhaltenem Zorn, doch dann beschloss er, das Pferd von der richtigen Seite aufzuzäumen. Sollte es nämlich überhaupt zu einer Werbung kommen, dann musste er mit mindestens einem Fuß auf Lesbos stehen. Bisher hatte er seine Handelsgeschäfte drüben am Festland ausgeübt, seine Schiffe lagen im Hafen von Ilion und das war sein euporion, der Platz seiner Geschäfte, gewesen. Hauptsächlich verschiffte er Wein, Getreide und Öl zum Zwischenhandel nach Kypros; einige Male hatte er es gewagt, auf eigene Rechnung nach Aigyptos zu segeln, wo es im Delta – nahe dem Meer – in Naukratis einen Umschlaghafen für Waren aus Hellas gab.
Für das, was er nun plante, musste er niemanden um Erlaubnis fragen, keinem Menschen Rechenschaft ablegen. Sein Vater war vor Jahren ins Schattenreich gewandert, die Mutter ihm vor einigen Monaten nachgefolgt. Die beiden Schwestern waren verheiratet, sein jüngerer Bruder ausbezahlt – er führte als naukleros ein Frachtschiff, war Eigner und Kapitän in einer Person.
Es dauerte nicht lange, dann betrieb Skamandronymos seine Geschäfte von Mytilene aus, erwarb dort ein Haus, doch das Bürgerrecht von Lesbos wurde ihm verweigert, solange er nicht »als Gründer einer Familie Lesbos endgültig zu seiner Heimat erwählt hatte«. Dieser amtliche Bescheid erregte nur seine Heiterkeit.
»Aber deshalb bin ich ja hierher gezogen!«, rief er lachend und sein Diener blieb stehen und blickte ihn fragend an.
»Es ist nichts …«, sagte Skamandronymos.
Natürlich hatten sie ihn auch gefragt, warum er als Achtundzwanzigjähriger nicht längst verheiratet war, doch dafür gab es plausible Gründe. Die Eltern hatten das für ihn – wie es üblich war – längst geregelt und ihren halbwüchsigen Sohn mit der damals erst achtjährigen Tochter einer befreundeten Familie verlobt – ganz ernst gemeint und amtlich mit einer Abschrift des Vertrages im Tempel der Hera. Nur, was die Menschen planen, müssen die Götter nicht gutheißen und so hatte Atropos seiner kindlichen Verlobten schon als Elfjähriger den Lebensfaden durchschnitten. Dann mussten seine Schwestern verheiratet werden, zudem bereitete die zunehmende Seeräuberei den Kauffahrern große Verluste. Damit wurde es erst besser, als die Handelsschiffe schwer bewaffnete Krieger mit an Bord nahmen, darunter geschickte Bogenschützen, die im Stande waren, aus großer Entfernung die Segel der Piraten in Brand zu schießen.
So war es nun gekommen, dass Skamandronymos nach Lesbos umsiedelte, um dort eine Braut zu finden – allerdings keine beliebige, sondern eine ganz bestimmte, nämlich sie, die Schwarzäugige und Dunkelgelockte, die Schöne und Zierliche aus dem Chor der Jungfrauen.
Als im gamelion, dem siebten Jahresmonat, das Fest der Hera stattfand, war Skamandronymos wieder zur Stelle, begleitet von einem Geschäftsfreund, der jede wichtige Familie auf Lesbos kannte. Wieder trat der Chor auf, fast sofort entdeckte er die Gesuchte und flüsterte seinem Begleiter ins Ohr: »In der mittleren Reihe, die Vierte von links …«
Der andere musterte sie lange und nickte dann. »Du hast Glück …«, flüsterte er kaum hörbar.
Skamandronymos stieß ihn leicht an. »Und?«
»Später«, kam es zurück.
Ungeduldig erwartete er das Ende der Feier; sein Freund führte ihn zu dem Maulbeerwäldchen hinter dem Tempel.
»Was wolltest du damit sagen, dass ich Glück habe?«
Der andere lachte gutmütig. »Glück aus mehrerlei Gründen. Zum einen habe ich das Mädchen gleich erkannt, weil sein Vater früher unser Nachbar in Mytilene gewesen war.«
»Früher – warum früher?«
»Sei nicht so ungeduldig. Der Vater des Mädchens heißt Penthilos und verlor zwei seiner Söhne beim Seehandel. Kamon, sein dritter, ist schon verheiratet.«
»Was soll das? Ich möchte etwas über das Mädchen wissen!«
Der Freund nickte. »Gut – Penthilos begann danach das Meer zu hassen, gab den Seehandel auf und kaufte sich in Eresos, im Südwesten der Insel, ein Gut. Er lebt heute nur noch von Wein- und Olivenanbau. Kleis ist seine einzige Tochter – das ist ein weiterer Glücksfall für den, der sie freit.«
Der Freund musste dann die ersten Verbindungen herstellen; dazu nannte ihm Skamandronymos die Höhe seines Vermögens, sein Einkommen, gab auch Auskünfte über Herkunft und Familie.
»Penthilos ist nicht abgeneigt, aber ihn stört dein Beruf. Wer sich mit Poseidon einlasse, der stehe auf unsicherem Boden, und damit meint er die Planken der Schiffe. Er wolle nicht erleben, dass seine Enkel das gleiche Schicksal teilten wie seine Söhne. Und dann schloss er – wie stets – seine Rede mit dem Zitat unseres Homeros aus der Odysseia: Übel gibt es gewiss, doch kein anderes vergleicht sich dem Meere.«
Skamandronymos schluckte. »Das – das ließe sich ändern …«
Der Freund nickte. »Darum geht es. Ehe Penthilos mit dir überhaupt in Verhandlungen tritt, musst du dich bereit erklären, die Handelsschifffahrt aufzugeben.«
»Ich soll also ein besserer Bauer werden, Wein und Getreide ziehen?«
»Das liegt bei dir.«
Dann aber kam ihm das liebliche Bild der Kleis vor Augen und er ließ sein Einverständnis ausrichten.
So kam es zu einem Treffen mit Penthilos, das nicht in dessen Haus, sondern auf der Agora von Eresos stattfand.
Penthilos deutete auf niedrige Lagerhallen, die den Hafenbereich säumten. »Von hier aus werden meine Waren verschifft – hauptsächlich Wein und Öl.«
Sie betraten eine der Hallen und Penthilos winkte den Wächter beiseite. »Stelle dich draußen vor die Tür, wir wollen nicht gestört werden!«
Sie nahmen auf niedrigen Hockern zwischen den hohen Amphoren Platz. Es roch so betäubend nach Wein, dass er davon fast betrunken wurde.
»Wo hast du Kleis gesehen?
»Im heraion beim Chorgesang.«
»Und das genügt dir, um sie zu freien?«
»Ja, verehrter Penthilos, so seltsam es klingen mag.«
»Hat sie dich bemerkt?«
»Ich weiß nicht – ja, ich glaube schon.«
»Nun, das tut ja nichts zur Sache, die Kinder werden von den Eltern verheiratet – sie allein bestimmen, wer sich mit wem verbindet.«
»Unter Anleitung und Zustimmung der Götter, so meine ich.« Penthilos sah ihn seltsam an. »Du bist ein frommer Mann, wie es scheint … Das kann nicht schaden, denn wer die Götter ehrt, begegnet auch den Menschen mit Respekt. Du wirst dich fragen, warum ich überhaupt einen Fremden als Gatten für meine Kleis in Betracht ziehe?«
»Sage es mir.«
»Der Grund ist einfach, wenn vielleicht auch ungewöhnlich. Es hat schon Bewerber für Kleis gegeben, schließlich ist sie vierzehn, recht hübsch und nicht unvermögend.« Penthilos hielt inne, um zu prüfen, wie der andere darauf reagierte.
Skamandronymos gab sich gelassen. »Wie es scheint, hast du bisher abgelehnt.«
»So ist es und ich sage dir auch, warum. Der eine war zu alt, ein Witwer, hätte mein Bruder sein können. Die beiden anderen bestanden darauf – was ihr gutes Recht ist –, dass Kleis in ihr Haus, in ihre Familie komme. Doch ich will meine Tochter nicht verlieren, sie ist mein letztes Kind. Du aber hast hier keine Familie, wirst den Seehandel aufgeben, wirst – darauf bestehe ich – dein Haus neben dem meinen errichten. So sehe ich meine Enkel heranwachsen, bin den Göttern dankbar, dass meine durch den Tod der Söhne geschwächte Familie wieder grünt und blüht. Du sprichst aiolisch wie wir, bist nicht unvermögend, bist niemandem verpflichtet. Wenn meine Frau einverstanden ist, dann sollst du Kleis bekommen und ich habe wieder einen Sohn im Haus.«
Penthilos wischte sich die Tränen aus beiden Augen und er tat es nicht verstohlen, bekannte sich zu seinem Leid und zeigte es. Beim nächsten Mal durfte Skamandronymos schon in das Haus seiner künftigen Familie kommen. Es stand auf einem bewaldeten Hügel, hoch über der Stadt Eresos, und war so angelegt, dass man von hier aus das Meer nicht sehen konnte. Zum Teil verdeckte es die im Südwesten aufragende Akropolis, außerdem hatte Penthilos nach dem Tod seiner Söhne schnell wachsende Büsche und Bäume pflanzen lassen. So schwand bald die Sicht auf Poseidons Reich, in dem die beiden Jünglinge ihr frühes Ende gefunden hatten.
Kapitel 2
Kleis erhob sich schwerfällig von ihrer kline und sogleich eilte eine Dienerin herbei, um sie zu stützen. Doch sie wies die helfende Hand zurück.
»Es muss auch so gehen – ich bin schwanger und nicht krank. Ist es draußen noch warm genug?«
Es war gegen Ende des Monats maimakterion, es hatte mehrmals geregnet, am Morgen und in den frühen Abendstunden war es schon recht kühl.
Kleis ließ sich einen Sessel in den kleinen Innenhof stellen, wo der Schatten der Säulen auf Gesicht und Oberkörper fiel, während die Sonnenstrahlen ihre Beine wohlig erwärmten.
Kleis hatte damals nicht zu hoffen gewagt, dass jener Fremde mit dem nussbraunen Haar und der herrischen Nase jemals um sie freien würde, ihr Wunsch ging nur dahin, dass ihr künftiger Gemahl wie dieser Fremde sein würde: groß, schlank … Natürlich wusste sie genau, dass die Heirat von jungen Menschen zunächst eine Sache der Eltern war; mit der Ehe mussten sie sich dann jedoch selbst zurechtfinden. Es gab nicht eine unter ihren inzwischen verheirateten Freundinnen, die ihren künftigen Mann vorher kennen gelernt hatte. Es war schon viel, wenn die beiden Elternpaare auf der Agora eine kurze Begegnung herbeiführten, um dem jungen Mädchen wenigstens zu zeigen, dass ihr Künftiger nicht hinkte, nicht bucklig und kein Greis war.
Auch Kleis wurde von der Mutter eines Tages mitgeteilt, dass nun der geeignete nymphios für sie gefunden war und ihr in den nächsten Tagen einen Besuch abstatten werde. Dass es eines Tages – eines nicht sehr fernen Tages – dazu kommen musste, hatte sie gewusst, nur jetzt, da diese Zeit gekommen war, erschrak sie doch. Das ist wie mit dem Tod, dachte sie später, man wusste, dass er kam, schob ihn aber dennoch in eine Ferne, die ihn quasi unsichtbar machte. Wenn er dann nahte, war es schrecklich. Es war allerdings kein tödlicher Schrecken, sondern mit Neugier und allerlei Erwartungen vermischt, ein eher wohliger Schrecken.
Diesen Besuch wollte Penthilos damit verbinden, dass sein künftiger Schwiegersohn gleich die ganze Familie kennen lernte. So wurden Tanten und Onkel, Vettern und Basen, dazu auch enge Freunde geladen. Das Haus war dafür groß genug, denn Penthilos hatte es nach der Geburt jedes Sohnes erweitert, in der irrigen Annahme, dass sie für ihre künftigen Familien Platz brauchen würden.
Ihr klopfte das Herz, als sie an der Seite ihrer Mutter das andron betrat, den Hauptraum des Hauses, genutzt für symposioi und Familienfeiern. Hier waren an sich keine Frauen zugelassen, nur bei großen Ereignissen wie Geburt, Heirat, Tod versammelte sich im andron die ganze Familie.
Skamandronymos erhob sich und ging den Frauen einige Schritte entgegen. Er verneigte sich leicht, begrüßte zeremoniell die Herrin des Hauses, dann wandte er sich an Kleis.
»Ich glaube, wir kennen uns schon.«
»Ja – ja, wir haben uns schon gesehen …«
»Zwei Mal.«
Sie nickte. Dann nahmen alle Platz; die jungen Leute auf Hockern, die älteren auf einer kline, die Kinder blieben stehen und reihten sich an den Wänden auf – großäugig, neugierig, schüchtern, die älteren Jungen schnitten, wenn keiner hinsah, freche Gesichter, einer streckte sogar kurz die Zunge heraus.
Kleis nahm nichts davon wahr. Sie sah dem Mann ins Gesicht, der sie und nur sie mit seinem Blick beim Tempelfest gesucht und gefunden hatte. Sollten ihre heimlichen Opfergaben an Aphrodite – eine vertraute Dienerin hatte sie zum Tempel gebracht – dieses Wunder bewirkt haben?
Nachdem die Anwesenden – einige hatten sich länger nicht gesehen – das Notwendigste an Fragen und kaum wahrgenommenen Antworten in einem kakophonischen Lautsturm hinter sich gebracht hatten, gebot der Hausherr mit erhobener Hand Ruhe.
»Meine lieben Gäste, heute hat uns ein Ereignis zusammengeführt, das nicht von Schmerzen begleitet ist wie eine Geburt oder in Trauer und Tränen gehüllt ist wie ein Tod. Zu unser aller Freude habe ich heute meine Tochter Kleis mit Skamandronymos aus dem von Homeros unsterblich gemachten Ilion verlobt und verbunden. Dronymos – wie ich ihn künftig nennen werde – wird mir und meiner Gemahlin unsere zu früh ins Schattenreich entschwundenen Söhne ersetzen, er wird mit Kleis Kinder zeugen und unser vereinsamtes Haus wieder lebendig machen.«
Penthilos redete noch viel, sprach auch davon, dass Dronymos ihm zuliebe den Seehandel aufgegeben habe und von Mytilene nach Eresos übersiedeln werde.
Kleis senkte den Kopf und verbiss sich ein Lachen. Glaubte ihr Vater wirklich, es sei ihm zuliebe geschehen, oder ist das eine dieser dummen Vorstellungen, dass alles im Leben von den Männern ausgeht? Gerade in letzter Zeit hatte sie oft darüber nachgedacht, wie das so war mit Frauen und Männern und ob es wirklich recht und richtig war, dass schon die kleinen Jungen sich nach Herzenslust draußen umtun konnten und sich daran auch nichts änderte, wenn sie heranwuchsen: Immer standen sie mit einem Fuß draußen und später als Ehe- und Handelsmänner oft genug mit beiden, waren nur noch Gast im eigenen Haus. Draußen – das waren Geschäfte, Krieg, Seefahrt, Wettspiele und anderes mehr. Frauen und Mädchen hatten keinen Anteil daran oder doch nur einen sehr geringen.
Als der Vater davon sprach, dass Dronymos mit ihr Kinder zeugen werde, erweckte das in Kleis weder Scham noch Neugier oder Verwirrung, sondern nur Ratlosigkeit. Kinder wurden von Frauen im Bauch ausgetragen und dann geboren, das hatte sie oft genug beim Gesinde gesehen. Nur, was hatte ein Mann damit zu tun? Niemand hatte darüber je mit ihr gesprochen und sogar ihre geliebte trophos, die altvertraute Amme und Kinderfrau, war diesen Fragen ausgewichen.
»Das lernst du schon noch früh genug kennen …«, hatte es da immer geheißen. Es war ihr allerdings anzusehen, dass sie gerne mehr gesagt hätte, und einmal erfuhr Kleis auch, warum dies nicht geschah.
»Die Mutter will es nicht …«, murmelte die Amme mit abgewandtem Gesicht.
Kleis lächelte still in sich hinein, umfasste ihren Leib mit beiden Händen und erhob sich. So trage ich mein Kind schon jetzt, dachte sie und spürte, wie das Kleine sich – von der Berührung aufgestört – sachte bewegte, als wolle es sich bequemer betten.
Die späte Sonne hatte sich in den Ästen der Pinien und Steineichen verfangen, die das Haus im Westen umgaben. Nur manchmal drang ein feiner Strahl durch die Baumkronen und zeichnete einen bald verblassenden Lichtfleck auf die Mauern des Hofes. Schnell war es kühl geworden und Kleis ging ins Haus.
Aus ihrer damaligen Ratlosigkeit bei des Vaters Rede vom Kinderzeugen war bald ein Wissen geworden – ein frohes Erleben, denn Dronymos erwies sich als zärtlicher und rücksichtsvoller Gatte.
Als junger Mann war er durch die Schule von Hafenhuren gegangen; später – als er es sich leisten konnte – kam noch die Erfahrung mit kundigen Hetären hinzu und durch diese Begegnungen lernte er mehr über das Wesen der Frauen kennen, als es anders möglich gewesen wäre.
Wenige Tage nach seiner Hochzeit wurde Dronymos in die Bürgerliste von Eresos aufgenommen, hatte nun Stimme und Sitz bei den Adelsversammlungen. Anfangs waren von manchen seiner Standesgenossen ironische Bemerkungen zu hören.
»Da hast du dich ja fein ins gemachte Nest gesetzt …«, musste er sich sagen lassen und ein anderer sah sich zu der Feststellung veranlasst: »Du bist schon ein Glückskind, Dronymos, hast zwei Männer beerbt, mit denen du nicht einmal verwandt bist.« Damit waren die beiden verstorbenen Söhne des Penthilos gemeint, deren Erbteil über Kleis jetzt an ihn gefallen war.
Doch Dronymos unterdrückte den aufsteigenden Zorn und begegnete der Ironie mit gutmütigem Spott. »Es stimmt schon, die launische Tyche hat immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Ich hoffe nur, dass sie es weiterhin tut.«
»Du sagst ja selbst, dass die Schicksalsgöttin launisch ist«, hielt ihm einer entgegen. »Mache dich lieber darauf gefasst, dass sie dir plötzlich den Rücken kehrt.«
Sie tat es nicht. Kleis gebar ihm nacheinander die beiden Söhne Charaxos und Erigyos, was Penthilos zu Tränen rührte.
»Zwei Söhne hat mir Poseidon genommen, zwei Enkel gaben mir die Götter zurück.«
In seiner tiefen Dankbarkeit bestiftete er das heraion reich und übernahm die Kosten für eines der alljährlichen Götterfeste.
Penthilos erlebte noch die Geburt seines zweiten Enkels, starb jedoch kurz darauf an einem Sturz von der Leiter, als er eigensinnig den Weinstock an der Südseite des Hauses selbst beschneiden wollte. Die alte Rebe war von seinem Großvater gepflanzt worden und trug alljährlich besonders süße Früchte.
»Da lasse ich keinen anderen hin«, hatte er eigensinnig gesagt und hatte sich dann bei dem schweren Sturz das Genick gebrochen.
Seine Gemahlin folgte ihm bald nach und jetzt, da Kleis ihr drittes Kind erwartete, waren sie und Dronymos Frau und Herr des Hauses.
Wenn sich Dronymos im Freundeskreis einen dritten Sohn wünschte, so tat er dies vor allem, weil es für einen Mann von Stand und Ansehen keine andere Möglichkeit gab. Hätte er gesagt, diesmal wünsche er sich eine Tochter, so wäre er nur kopfschüttelndem Unverständnis begegnet. Wie kann sich ein geistig gesunder Mann nur ein Mädchen wünschen? Die gehen später aus dem Haus, brauchen eine Mitgift und gehören dann einer anderen Familie an, tragen den Samen eines Fremden aus. Nur die Söhne sind es, die eine Familie am Leben erhalten, die nach seinem Tod die Namen ihrer Vorväter in ehrenvoller Erinnerung halten. Im Stillen dachte Dronymos anders. Ja, diesmal wäre ihm eine Tochter willkommen, ein zierliches Abbild ihrer Mutter, ein Wesen, das lieblich heranwuchs wie eine Blume und einen verwundern machte, dass ein so grober und haariger Klotz etwas so Schönes und Zartes zeugen konnte.
Nur Kleis gegenüber deutete er es an, kleidete sein »Bekenntnis« allerdings in feine Ironie. »Ein wenig eintönig ist es wohl schon, immer nur Jungen auf die Welt zu bringen? Weißt du, ich habe mir gedacht, wenn da ein Mädchen dazwischen kommt, kann es auch nicht schaden. Danach dürfen es wieder Jungen sein …«
Zu solch törichten Worten hatte Kleis nur nachsichtig gelächelt. »Ja, mein Lieber, Männer reden sich da leicht. Müsste nur einer von euch einmal im Leben ein Kind gebären, so würde er alles tun, damit dies nicht wieder geschieht.«
Bei ihren beiden Jungen konnte Kleis den Zeitpunkt der Zeugung nur ungefähr nennen, denn Dronymos war damals ein eifriger Liebhaber gewesen und schlief in manchen Zeiten fast täglich mit ihr. Ihre jetzige Schwangerschaft hingegen konnte sie genau bestimmen. Dronymos war im vergangenen Winter einmal längere Zeit in Mytilene gewesen, wo ihn politische Ereignisse festgehalten hatten. Bei seiner Rückkehr schien er verärgert.
»Das war wieder einmal Zeit für nichts geopfert! Einige der Adelsfamilien liegen sich schon seit Monaten in den Haaren – jede fühlt sich benachteiligt und bangt um ihren Einfluss. Jetzt ist der Friede vorläufig wiederhergestellt, aber lange wird er nicht dauern. Die Versöhnung sollte mit einem abschließenden symposion gefeiert werden, doch ich hatte einfach genug von diesen ewigen Streitereien und schützte dringende Geschäfte vor und bin in einem Zug hierher geritten – hatte Sehnsucht nach dir …«
Diese Sehnsucht mündete in eine heftig durchliebte Nacht und Kleis fühlte deutlich, dass der reichlich vergossene Samen in ihr aufging, und so konnte sie genau die Zeit berechnen, wann dieses Kind zur Welt kommen sollte. Gerade das machte ihr einige Sorgen, denn die zweihundertsiebzig Tage waren abgelaufen und jetzt noch einige dazu. Und es gab nicht die geringsten Anzeichen einer nahe bevorstehenden Niederkunft. Das Kind in ihrem Leib bewegte sich zuzeiten sehr heftig und bewies damit, dass es lebte, doch es wollte offenbar nicht ans Licht der Welt. Dronymos versuchte, sie zu beruhigen.
»Vielleicht hast du dich doch in dem Zeitpunkt getäuscht? Wir haben uns schließlich nach meiner damaligen Rückkehr nicht nur einmal geliebt. Die Schwangerschaft könnte doch auch ein paar Wochen später entstanden sein.«
»Nein, nein – diesmal weiß ich es genau. Die Zeit meiner Reinigung blieb schon beim nächsten Mal aus, zudem habe ich gefühlt, dass – dass …« Sie streichelte seinen Arm. »Ein Mann versteht das nicht … Ich werde noch einige Tage warten, dann lasse ich Gaia rufen.«
»Was? Nein, das verbiete ich dir! Diese Kassandra kommt mir nicht ins Haus, die hat schon vielen Unglück gebracht.«
Gaia war eine heilkundige Kräuterfrau, und wenn Dronymos sie eine Kassandra nannte, dann einiger düsterer Prophezeiungen wegen, die sich seltsamerweise erfüllt hatten – jedenfalls sagte man das. Schon ihre Mutter und auch deren Mutter hatten Gaia geheißen und dasselbe Gewerbe betrieben. Menschen aller Stände riefen sie ins Haus, wenn eine Krankheit nicht weichen, eine Wunde nicht heilen wollte. Doch sie taten es insgeheim, quasi bei Nacht und Nebel, denn wer wollte sich schon dem Gerede aussetzen, die als Kassandra und Giftmischerin Verrufene um Hilfe gebeten zu haben?
Anders war dies freilich beim Priester des Asklepios, der auch als heilkräftiger Arzt galt und dessen Anwesenheit jede Familie als Ehre betrachtete. Er lebte als Stadtschreiber in Mytilene, wo auf der Akropolis ein kleines Heiligtum des Asklepios stand, das er nebenher versorgte. Ihn lud man bei hellem Tag ins Haus und er trat mit zwei Dienern, die seine ärztlichen Gerätschaften trugen, sehr würdevoll auf.
Auf seine Hilfe setzte Dronymos alle Hoffnung. Doch zunächst stellte der Priesterarzt die strenge Frage, ob der Hausherr in dieser Sache dem Asklepios schon geopfert habe.
»Nein – nein … Daran haben wir noch nicht gedacht, denn alles kam so plötzlich …«
Der iatros runzelte seine Stirn. »So plötzlich? Eine Schwangerschaft dauert neun Monate, wenn ich nicht irre, und da wäre wohl reichlich Zeit gewesen, Asklepios, dem heiligen Sohn des Apollon, ein angemessenes Opfer darzubringen. Das muss jetzt schleunigst geschehen, und zwar noch ehe ich mich mit deiner Gemahlin befasse.«
Der eingeschüchterte Dronymos brach sofort mit dem Arzt nach Mytilene auf, wo er am Altar des Asklepios eine Ziege opferte, reichlich Weihrauch streute und zwei oboloi Silber niederlegte. Kleis nutzte die auf zwei Tage angesetzte Abwesenheit ihres Gemahls, um Gaia ins Haus zu rufen, und zwar gleich am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang.
Ihre Hütte stand etwa eine Wegstunde entfernt, verborgen in einem kleinen Tal, inmitten eines fast unzugänglichen Gefilzes von Sträuchern und Büschen. Wer Gaia rufen wollte, musste in den frühen Morgenstunden ein bestimmtes Gebiet aufsuchen, wo sie ihre heilkräftigen Wurzeln und Kräuter sammelte.
Als sie im oberen Stock die gynaikonitis betrat – nur begleitet von Kleis’ vertrauter Dienerin –, bemerkte sie mit leiser Stimme: »Ein schönes Haus, ein großes Haus – man spürt den Reichtum …«
Kleis lag auf einer kline, den Leib grotesk aufgetrieben. Sie blickte der Besucherin entgegen und bemühte sich um eine willkommen heißende Miene, doch es wollte ihr nicht ganz gelingen.
Schlank und groß stand Gaia da, ihre langen, etwas verfilzten Haare fielen frei auf die Schultern, ihr Gesicht war von feinen Runzeln überzogen, die Haut vom Aufenthalt im Freien tief gebräunt. Ihr Alter war kaum zu schätzen, lag wohl zwischen dreißig und vierzig. In den hellen honigfarbenen Augen stand ein leises Lächeln.
»Brauchst vor mir keine Angst zu haben, kyria. Gaia kommt nur, um Gutes zu bewirken – nach Kräften und mithilfe der Götter.«
Sie kniete nieder und betastete den hochschwangeren Leib.
»Das Kindchen will nicht ans Licht, es fühlt sich wohl im warmen, feuchten Dunkel deines Bauches, und wer sich wohl fühlt, will diesen Zustand nicht verändern. Schicke deine Dienerin hinaus, Kleis.« Die alte Amme blickte Gaia böse an, doch sie gehorchte dem Wort ihrer Herrin.
»Ich muss dich genauer untersuchen, darf ich?« Kleis nickte etwas widerstrebend.
Ohne zu zögern, schlug Gaia die Gewänder der Schwangeren zurück, goss aus einem Tonfläschchen etwas Öl auf die Finger ihrer rechten Hand und drang schnell und geschickt in Kleis’ Schoß ein. »Nur ruhig – ganz ruhig, du darfst dich nicht verkrampfen. Der Muttermund ist so fest geschlossen wie der Pfropf auf einer Flasche, aber Vorwehen hat es schon gegeben, das spüre ich.«
»Davon habe ich nichts bemerkt …«
»Die meisten Frauen nehmen sie nicht wahr, weil sie schnell vergehen und sich anfühlen wie leichtes Bauchgrimmen, wenn man zu viel Obst gegessen hat.«
Sie richtete sich auf und wischte die Hand sorgfältig an ihrem peplos ab. »Weißt du, es ist so: Die Götter sind auf wunderbare Menschen eifersüchtig, neiden ihnen die besonderen Gaben und suchen deshalb ihre Geburt zu verhindern. Ja, Kassandra kann auch Gutes prophezeien und ich sage dir, Kleis, dieses Kind wird ein Mädchen ganz besonderer Art.«
»Ein Mädchen? Woher weißt du das?«
»Ich weiß es eben. Du hast ja schon zwei Jungen geboren und die kamen recht schnell – das stimmt doch? Die werdenden Männer haben es immer besonders eilig, auf die Welt zu kommen, damit sie bald ihre fragwürdigen Heldentaten verrichten können: Wettkämpfe, saufen, Kriege führen, Frauen schwängern, bis ihre Namen glänzen wie funkelnde Schwerter.«
»Und das gefällt dir nicht? Auch deine Mutter und deren Mutter haben Männer gebraucht, um Kinder zu zeugen. Wer waren diese Männer und warum sind es immer nur Mädchen geworden?« Gaia lächelte. »Neugierige Fragen beantworte ich nicht gerne, aber da ich in dir keine Bosheit erkenne, sollst du es wissen.«
Sie nahm auf dem niedrigen Hocker Platz. »Von meiner Großmutter weiß ich es und von meiner Mutter auch. Sie haben sich junge, schöngestaltige Hirten gesucht, die entzückt waren, statt ihrer Schafe und Ziegen einmal eine richtige Frau begatten zu dürfen. So kam bei uns Nachwuchs ins Haus …«
»Und wenn es ein Junge wurde?«
Gaia hob ihre schlanken, langfingrigen Hände. »Der wurde dann ausgesetzt – nachts auf der Agora von Eresos. Da fanden sich immer gleich Männer zur Adoption bereit, denn das Schwänzchen vorn dran macht einen Säugling ungleich wertvoller …«
Sie lachte und strich sich mit einer schroffen Geste eine Haarsträhne aus der Stirn. »Ich habe das auch schon zwei Mal getan, denn mir erging es wie dir: Das Mädchen erschien erst nach zwei Knabengeburten. Ich weiß, wer die Kleinen adoptiert hat – da sind sie ungleich besser versorgt als in meiner armseligen Hütte.«
»Nun hast du eine Nachfolgerin?«
»Ja, die kleine Gaia steht im achten Lebensjahr und erweist sich als recht tüchtig – in jeder Beziehung. Doch jetzt zu dir. Die Frucht in deinem Körper ist reif zur Geburt – schon überreif. Wenn sie nicht kommt, wächst sie in deinem Leib weiter, wird größer und größer und das kann am Ende deinen und den Tod des Kindes bedeuten. Ich werde das nach Kräften verhindern und dir eine Arznei bereiten, welche die Wehen hervorlockt. Da ich schon wusste, um was es bei dir geht, habe ich alles mitgebracht.«
Am Gürtel trug sie ein pralles Leinensäckchen, aus dem sie einen winzigen Mörser hervorholte. Sie legte einige Wacholderbeeren und schwärzliche Stücke des Mutterkornes hinein, zerstampfte und zermahlte sie gründlich, fügte einige Tropfen Öl hinzu und verrührte das Ganze mit dem Zeigefinger. Dabei murmelte sie Unverständliches und es klang wie leiser, beschwörender Singsang. Mit einem zierlichen Holzlöffel schabte sie die Paste heraus und gebot: »Mund auf!«
Gehorsam schluckte Kleis die Arznei und trank ein paar Schluck Wein hinterher.
»In zwei Stunden müssten die ersten Wehen einsetzen und das Kind wird bis spätestens morgen früh zur Welt kommen. Du bist ja eine erfahrene Mutter, und wenn du glaubst, die Wehen seien nicht stark genug, dann schluckst du noch einmal meine Arznei – ich werde sie dir vorbereiten.«
»Ich danke dir, Gaia – fordere deinen Lohn!«
»Den hole ich mir, wenn dein Kind gesund in der Wiege liegt.«
Kapitel 3
Als die Kinderfrau die beiden Söhne vor ihrem Mittagsschlaf hereinbrachte, hatte Kleis noch den bitter-aromatischen Geschmack von Gaias Arznei auf der Zunge.
Die beiden Vier- und Fünfjährigen unterschieden sich in vielen Dingen. Charaxos, der Ältere, zeigte ein aufgeräumtes Wesen, lächelte und lachte oft über sein rundes Kindergesicht mit den freundlichen grauen Augen und dem hübschen, immer leicht geöffneten Mund. Er plapperte die ganze Zeit vor sich hin, erzählte alles durcheinander und hielt dabei den Arm der Mutter fest, um ja nicht ihre Aufmerksamkeit zu verlieren.
Der vierjährige Erigyos hingegen zeigte ein schmales verschlossenes Gesicht, das weit weniger kindlich wirkte als das seines Bruders. Er lachte so gut wie nie und sprach nur, wenn er mit seiner Mutter allein war. Zusammen mit seinem Bruder aber schwieg er verbissen, scheute jede körperliche Berührung und in seinen dunklen, etwas abgründigen Augen war keine Gefühlsregung zu erkennen.
Kleis sorgte sich um diesen Jungen, der so wenig Kindliches an sich hatte und sich vor jeder Zuwendung verschloss.
Wenn sie beide in dem kleinen ummauerten Garten spielten, dann tat Charaxos dies lärmend, geschäftig und in ständiger Bewegung. Er las verschiedenfarbene Steinchen auf, trug sie mit wichtiger Miene da- und dorthin, sammelte sie in einem Korb, wählte die schönsten aus, warf jedoch die ausgeschiedenen nicht weg, sondern stapelte sie an der Gartenmauer.
Erigyos hingegen suchte sich einen dürren abgefallenen Ast und schlug damit auf alles ein, was lebte – auf Blumen, Sträucher, Käfer und Schmetterlinge und sogar auf ein halb zahmes Wiesel, das zur Mäuseverfolgung gehalten wurde. Schließlich musste der Vater von diesem Treiben unterrichtet werden, und als eine Strafpredigt nichts half, wandte Dronymos widerwillig den Stock an, der allerdings nur bewirkte, dass Erigyos besser aufpasste und seine Untaten heimlich verrichtete.
»Das wird sich geben«, versuchte Kleis ihren Gemahl zu beruhigen. »Kinder sind in diesem Alter oft seltsam und unberechenbar, weil sie erst lernen müssen, sich richtig zu verhalten. Einige brauchen dazu eben länger und dies scheint mir bei unserem Erigyos der Fall.«
Dronymos zögerte. »Ich weiß nicht – ja, du magst Recht haben, vielleicht habe ich mich als Kind ähnlich verhalten …«
Kleis hatte es eingeführt, dass die beiden Jungen drei Mal am Tag mit ihr etwa eine Stunde ohne Kinderfrau allein sein sollten: am Morgen nach dem Aufstehen, vor dem Mittagsschlaf und vor dem Zubettgehen. Warum sie so dick geworden war, hatte sie den beiden erklärt.
»Da steckt für euch ein Geschwisterchen drin, und wenn es geboren ist, seid ihr ein dreiblättriges Kleeblatt.«
»Das ist aber schön!«, hatte Charaxos freudig gerufen, »zu dritt spielt es sich noch besser als zu zweit.«
Erigyos hatte zuerst nichts gesagt, dann jedoch leise gefragt: »Es wird doch ein Junge – oder?«
»Das wissen bis jetzt nur die Götter – wir Menschen lassen uns überraschen.«
»Mit einem Mädchen spiele ich nicht!«, Erigyos machte sein verstocktes Gesicht und wandte sich ab.
»Stell dich nicht so an!«, lachte sein Bruder. »Warum soll ein Mädchen nicht mit uns spielen können?«
Erigyos drehte sich um. »Was sie tut, ist mir egal – ich werde nicht mit ihr spielen.«
Daran musste Kleis nun denken, als die beiden vor ihr standen. »Es müsste wohl schon da sein?«, Charaxos sah sie fragend an.
»Wer hat das gesagt?«
»Alle im Haus sprechen davon …«
Kleis mühte sich um ein Lächeln. »Nur Geduld, ihr beiden – ein Tag früher oder später macht doch nichts aus.«
»Es könnte auch sterben, wie Nisas Kind, das nur vier Tage gelebt hat«, sagte Erigyos, ohne eine Miene zu verziehen.
Nisa war eine Hausmagd, die vor einigen Monaten geboren hatte. »Sie wird neue Kinder bekommen«, versuchte Charaxos abzulenken. Kleis betrachtete ihren Jüngsten mit gerunzelter Stirn. »Du wünschst doch nicht, dass unser Neugeborenes stirbt?«
»N-nein, n-nur, es könnte doch sein?«
»Es könnte, aber es wird nicht sein«, sagte Kleis fest. »Jetzt geht in euer Zimmer, ich fühle mich nicht wohl.«
Das war nicht gelogen, denn Kleis spürte ein leises Ziehen im Leib und gegen Abend setzten die Wehen ein.
Die Sonne im Osten sandte gerade ihre ersten gelbgrünen Lichtpfeile in den fahlen Morgenhimmel, da erschien das Köpfchen des Kindes. Als die Hebamme den glänzend feuchten Körper geschickt herauszog und mit einem leichten Klaps das neue Leben entfachte, begrüßte das Kind mit einem quäkenden Wa-wa-wa den erwachenden Tag.
Gegen Mittag kehrte Dronymos zurück, betrachtete erleichtert und entzückt seine Tochter.
»Ein Mädchen! Jetzt bist du nicht mehr ganz allein in dieser Männerwirtschaft, liebe Kleis. Hast du dir schon einen Namen ausgedacht? Die unserer Söhne habe ich gewählt, jetzt bist du an der Reihe.«
Kleis hatte sich schon vor der Geburt Gedanken über einen Mädchennamen gemacht und da war ihr eingefallen, dass manchmal in ihrer Familie von einer fernen Urahnin die Rede war, die als Seherin galt und sehr alt geworden war. Sie hatte den jetzt unüblichen Namen Sappho getragen und nun sollte er in der Neugeborenen weiterleben.
»Ja, sie soll Sappho heißen, wie deine verehrte Vorfahrin.«
Ein leises Unbehagen war aus seinem Gesicht abzulesen, doch Dronymos stand zu seinem Wort und rief das Hausgesinde zusammen. Dann nahm er das Kind aus dem Korb, hob es hoch und sagte vernehmlich:
»Dieses Mädchen wird Sappho heißen! Es ist mein und meiner Gemahlin Kleis geliebtes Kind – habt ihr es gehört?«
Die Frauen und Männer nickten und murmelten ihr »Ja – ja – jawohl …«
Dann trug der Vater sein Kind feierlich um den Herd des Hauses und draußen vor der Tür wurde ein Stück Wollstoff aufgehängt. Bei den Knaben waren es Ölzweige gewesen.
Für Gaia ließ Kleis aus einem viertel obolos Silber einen Ring schmieden und in die Siegelplatte deren Namen eingravieren. Dieses Geschenk übersandte sie ihr mit den Worten: »Sappho grüßt Gaia, ihrer Helferin ans Licht«.
Dass ein Vater besonderen Anteil an der Erziehung einer Tochter nahm, war keineswegs üblich – ja, sogar die Söhne wurden bis zu ihrem sechsten oder siebten Lebensjahr den Frauen überlassen und erst dann unter die Aufsicht eines paidagogos, eines Erziehers und Hauslehrers, gestellt. Mädchen blieben bis zu ihrer Verehelichung in der Obhut ihrer Mutter oder, wenn diese vorzeitig starb, anderer weiblicher Verwandter.
Dronymos hingegen – er tat es nicht einmal verstohlen – nahm regen Anteil an seiner heranwachsenden Tochter, ohne sich allerdings in die Erziehung zu mischen. Dies geschah erst, als sie ins Fragealter kam und recht energisch dagegen protestierte, dass die älteren Brüder ihre regelmäßigen Lehrstunden hatten, sie jedoch davon ausgeschlossen war.
»So ist das von alters her eingerichtet«, erklärte die Mutter. »Aus den Knaben werden Männer und die haben draußen im Leben eine Aufgabe zu erfüllen – als Kaufleute, Krieger, Seefahrer, was auch immer. Dazu braucht es Kenntnisse wie Schreiben, Lesen, Rechnen, auch Geschichte und Geografie und das Wissen von den seligen Göttern. Unbildung ist das Vorrecht von Sklaven und Halbfreien, mit Ausnahme der Hauslehrer, die ihr Wissen weitergeben und davon leben. Wir, die Frauen und Mädchen, bleiben im Haus – wir wirken nach innen, die Männer nach außen. Und glaube mir, die Kenntnis von häuslichen Aufgaben verlangt nicht weniger zu lernen und zu üben als bei deinen Brüdern, nur sind es eben andere Dinge, mit denen wir uns befassen. Wenn du sie später als Ehefrau nicht selbst tun musst, so fordert es deine Rolle als Herrin des Hauses, dass du weben, spinnen und nähen kannst, über Küche und Keller Bescheid weißt, denn das ist unumgänglich, wenn du das Hausgesinde überwachst und deine Befehle erteilst. Wenn die Leute merken, dass sich ihre Herrin dabei nicht genau auskennt, verlieren sie jeden Respekt und tun, was ihnen beliebt. Hast du das alles verstanden?«
Sappho hob ihr feines Köpfchen und ihre klugen dunklen Augen blickten Kleis liebevoll an.
»Natürlich, liebe Mutter, dazu bin ich ja alt genug. Eines will mir jedoch nicht in den Kopf: Warum sollen nicht auch Mädchen schreiben und lesen können, nicht über Religion und Geschichte Bescheid wissen – nur zur eigenen Freude?«
Kleis schüttelte ihren Kopf. »Nutzloses Wissen! Jeder Mensch – ob Frau oder Mann – hat gewisse Pflichten im Leben zu erfüllen und nur dafür muss er gerüstet sein. Was hätte dein Vater davon, wenn er kochen könnte?«
Sappho lachte leise und es klang wie ein zartes Glockengeläut. »Er könnte dann immer seine Lieblingsspeisen zubereiten.«
Da musste nun Kleis lachen und sie versäumte nicht, bei nächster Gelegenheit Dronymos von diesem Gespräch zu berichten. Der lachte allerdings nicht.
»So Unrecht hat sie da nicht, unsere kleine dorkas.«
Er liebte es, für die Tochter Kosenamen zu erfinden – nannte sie abwechselnd Gazelle, Häschen, Nymphchen, Blume oder Pflänzchen.
»Eigentlich sollte ich auf sie eifersüchtig sein, du hegst, pflegst und umwirbst sie wie eine Geliebte.«
»Weil sie dein junges Ebenbild ist, meine Kleis.«
Sie zog ihn spaßhaft am Ohr. »Jetzt muss ich mich auch noch verspotten lassen – aber im Ernst: Soll Sappho tatsächlich Unterricht erhalten?«
»Nicht so wie unsere Jungen, mehr nebenbei und spielerisch – ganz ohne Zwang. Sie soll spüren, dass sie nicht lernen muss, sondern darf, solange sie daran Freude hat.«
Plötzlich verdüsterte sich sein Gesicht.
»Was hast du, mein Lieber?«, fragte Kleis erschreckt.
»Ich muss dabei an Erigyos denken. Er lässt mich und seine Lehrer stets spüren, dass er dieses Lernenmüssen verachtet und im Grunde für nutzlos hält. Sein Lehrer hat mir kürzlich berichtet, Erigyos habe ihn gefragt, wie hilfreich Kenntnisse von Schrift oder Grammatik seien, wenn ein Schiff zu sinken drohe oder sich im Kampf der Feind mit gezogenem Schwert nähere. Da seien freilich, sagte der Lehrer, andere Fähigkeiten nötig, doch eines schließe das andere nicht aus. Ihm schiene, sagte Erigyos, Schwimmen oder Fechten sei ungleich wichtiger, denn als Toter könne man auch mit Schreiben und Rechnen nichts mehr anfangen. So redet er immer daher und bringt seine Lehrer zur Verzweiflung. Die haben inzwischen nicht nur eine Rute auf seinem Rücken zerhauen, aber das scheint ihn kaum zu beeindrucken.«
Kleis nickte betrübt. »Ja, ich habe davon gehört. Vielleicht wäre es für ihn besser, mehr Gewicht auf die körperliche Erziehung zu verwenden, um seinen aufsässigen Geist zu beruhigen. Soll er bis zur Erschöpfung im Meer schwimmen, soll ihm ein tüchtiger Fechtlehrer so lang alle Finten beibringen, bis er kaum noch den Arm heben kann. Irgendwie wird dem Jungen doch beizukommen sein …«
Dronymos dachte darüber nach und musste seiner Frau Recht geben. Während nun Erigyos draußen mit Schwimmen und Fechten, Speerschleudern und Bogenschießen beschäftigt war, durfte Sappho mit dem elfjährigen Charaxos am Unterricht teilnehmen; spielerisch – wann immer und so lange sie wollte. Zwei Fächer liebte sie besonders: den Umgang mit Schrift und Sprache und das Spielen auf der kithara. Sie lernte so schnell, dass der Lehrer nichts zu tadeln fand, und nach zwei Jahren hatte sie den Kenntnisstand ihres Bruders Charaxos erreicht. Bei Erigyos aber ging es nur langsam voran, dafür übertraf er den Älteren im Bogenschießen, Reiten, Schwimmen und beim Wettlauf. Für seine Schwester hatte er nur Spott übrig.
»Dein künftiger Gatte wird sich schön bedanken, wenn du ihm Hesiodos oder Homeros zitierst, in deiner Küche aber das Chaos herrscht. Ich hoffe nur, er wird dir deine Flausen aus dem Kopf prügeln.«
Sappho lachte unbekümmert. »Mit Prügeln hast du ja die besten Erfahrungen, mein lieber Bruder. Auf diesem Gebiet werde ich dich kaum noch einholen können.«
Da verzerrte sich sein Gesicht, er griff nach Sapphos Haaren und zog so grob daran, als wolle er sie ausreißen. Sie schrie leise auf, fuhr gedankenschnell mit der rechten Hand in sein Gesicht und zerkratzte ihm eine Wange. Er ließ sofort ihr Haar los, befühlte die Furchen, sah das Blut an seinen Fingern und grinste.
»Gut herausgegeben, Schwesterchen. Dir fehlt nur noch der Schwanz zwischen den Beinen, dann könntest du einen Krieger abgeben.«
»Das überlasse ich gerne dir. Dir ist dein bisschen Verstand in die Muskeln gerutscht, aus dir wird nichts werden als ein Schwertrassler und Schlagetot.«
Da wusste Erigyos nichts mehr zu erwidern, sagte nur verächtlich: »Pah!«, und ging weg.
Zu jener Zeit war Dronymos häufig abwesend, da es bei den Adelsversammlungen in Mytilene heiß herging. Ursache dafür war ein gewisser Melanchros, den Tyrannengelüste plagten und der alles tat, um sich zum Alleinherrscher aufzuschwingen. Seine ursprünglich große Gegnerschaft schmolz nach und nach dahin und das lag an seiner geschickten Familienpolitik.
Melanchros entstammte einer alten wohlhabenden Familie aus Antissa, der am weitesten im Westen gelegenen Siedlung auf Lesbos – einer blühenden und sehr stolzen Stadt. Hier nämlich war in alten Zeiten der Kopf des göttlichen Sängers Orpheus an Land gespült worden. Seinen Körper hatten thrakische Mainaden auf Befehl des Dionysos zerrissen, weil er sich weigerte, ihn als Gott zu verehren. Der Kopf aber sang wundersame Weisen und mit ihm warf das Meer auch seine berühmte Lyra an Land. Als das Haupt dann schwieg und die Augen schloss, bestatteten es die Bewohner von Antissa in ihrem Apollon-Tempel und stellten davor die Lyra auf. Neben Mytilene galt Antissa als die wichtigste und volkreichste Stadt, sodass Melanchros als ihr Sprecher im Adelsrat entsprechend gewichtig auftrat. Seinen Eltern war es gelungen, ihn mit der reichsten Erbin von Antissa zu verheiraten, und er wiederum tat alles, um seinen Sohn und die beiden Töchter mit Sprösslingen aus einflussreichen und wohlhabenden Familien zu verbinden. Als ihm das schließlich gelungen war, versuchte er, der Adelsversammlung einzureden, dass Länder und Gemeinwesen unter der Herrschaft eines Einzigen – mag er sich nun König oder tyrannos nennen – weit besser wachsen und gedeihen konnten als die von einer ständig zerstrittenen Oligarchie beherrschten.
»Muss ich Namen nennen?«, rief er mit seiner raumfüllenden und wohlklingenden Stimme. »Hat nicht König Kyros von Persien sein Land geschickt aus allen Zwisten herausgehalten? Hat nicht Alyattes von Lydien Smyrna erobert und seinen Einfluss bis Karien ausgedehnt? Und wie ist es mit Aigyptos? Blüht nicht das Land am Neilos seit über zweitausend Jahren unter der Führung seiner Pharaonen? König Nechos hat sein Reich bis Syrien ausgedehnt und besitzt vermutlich mehr Reichtümer als alle Fürsten dieser Welt. Lesbos ist groß und fruchtbar, liegt zudem an einer Stelle, die für Handel und Wandel nicht günstiger sein kann.«
Er trug seine Thesen so beredt und überzeugend vor, dass er nach und nach Anhänger und Fürsprecher fand. Doch es bildete sich auch eine erbitterte Gegnerschaft unter der Leitung des Pittakos, eines sehr angesehenen Mannes, der trotz seiner vierzig Jahre aussah wie ein Jüngling und mit jugendlichem Feuer seine Ansichten vertrat. Ihm schloss sich Dronymos an, und als es Melanchros endlich gelang, sich als Tyrann auf der Akropolis von Mytilene niederzulassen, schmiedeten seine Gegner Pläne für seinen Sturz.
Das war nun der Grund, warum Dronymos in dieser Zeit ein seltener Gast im eigenen Haus war. Er hielt sich jetzt oft bei Kamon auf, dem Bruder von Kleis. Allzu sehr wurde er in dieser Zeit nicht vermisst, denn Kleis hatte ihm einen dritten Sohn geschenkt – eine leichte, schnelle Geburt – und Sappho freute sich, dass sie nun nicht mehr die Jüngste war. Sie fühlte sich Larichos gegenüber wie eine zweite Mutter und Kleis hinderte ihre Tochter nicht daran, den Kleinen zu füttern und zu hüten, sah es als eine gute Schule für später, wenn sie selbst Kinder haben würde.
Wäre jetzt nicht der Augenblick gekommen, da ich die Erzählung abbrechen und mit dem eigenen Bericht beginnen soll? An die Geburt meines jüngeren Bruders erinnere ich mich sehr genau und auch daran, dass ich in den ersten Jahren eher wie eine zweite Mutter für ihn empfand. Eifersüchtig hütete ich meine nach und nach erkämpften Vorrechte, ihn einmal am Tag füttern und zwei Mal pro Dekade baden zu dürfen. Meine älteren Brüder hatte ich niemals nackt gesehen und so war ich schon ein wenig erstaunt, dass bei Larichos etwas zwischen seinen kleinen prallen Schenkeln war, das ich nicht hatte. Die Kinderfrau lachte.
»Irgendwie müssen wir uns ja von denen unterscheiden, oder? Drum schlagen sie ja ihr Wasser im Stehen ab, weil sie mit ihrem Röhrchen besser zielen können.«
»Gibt es noch andere Unterschiede?«
»Ja, wir kriegen als Frau einen Busen, bei Männern bleibt die Brust flach und ist oft noch behaart wie bei Tieren – bäh!« Sie verzog ihr Gesicht und tat, als ekle sie sich davor.
Mir genügten diese Auskünfte fürs Erste, und auch als Larichos älter war und ich mich als seine Schwester verstand, blieb er mein Liebling und eigentlich hörte ich niemals auf, ihn zu bemuttern. Jetzt aber zum Eigentlichen. Da sich damals noch vieles außerhalb meines Gesichtskreises abspielte, möchte ich mit dem eigenen Bericht noch ein wenig abwarten bis zu jenem Einschnitt, der mein, der unser Leben völlig veränderte.
Kapitel 4
Die Verschwörung gegen den Tyrannen nahm anfangs keinen so großen Umfang an, wie Pittakos, Dronymos und andere erhofft hatten. Das lag nicht zuletzt an seinen glänzenden Auftritten. An ihm war keineswegs etwas Finsteres, er besaß angenehme Gesichtszüge, lachte gern, war zu jedermann höflich, konnte genau zuhören und redete mit klangvoller Stimme, wobei es zunächst den wenigsten auffiel, dass er anders sprach, als er handelte. Dem Adelsrat hatte er seine Erhebung mit den Worten schmackhaft gemacht: »Hellas ist im Aufbruch, verehrte Herren, und Lesbos wird sich nur behaupten können, wenn ein Mann – von euch erwählt – für alle das Wort führt. Bei wichtigen Verhandlungen über Krieg und Frieden, über Bündnisse und Verträge, über Handel und Wandel war es doch bisher so, dass Lesbos nicht mit einer Stimme, sondern mit vielen sprach. Die einen wollten dies, die anderen das und am Ende kamen Kompromisse heraus, die der Gegenseite nur nützten. Die politische Entwicklung erfordert es nun dringend, dass wir nur mit einer Stimme sprechen durch einen von euch Erwählten. Im Grunde bleibt es ja wie früher, nur sollen künftig unsere Meinungsverschiedenheiten hier im Adelsrat ausgetragen werden, und zwar unter höchster Geheimhaltung. Nach außen hingegen vertritt ein Tyrannos vor aller Welt eine feste Position und nur so werden wir von anderen ernst genommen. Als Beispiel aus vielen möchte ich nur Korinth nennen. Solange dort eine Adelsherrschaft das Ruder führte, kam es immer wieder zu Aufständen und nach außen hin war Korinth schwach und angreifbar. Seit aber der Tyrannos Kypselos herrschte und nach ihm sein Sohn Periandros, ist Korinth groß, reich und mächtig geworden, hat ein gewaltiges Kolonialreich aufgebaut. Diesem Vorbild sollten wir nacheifern. Und ein Letztes noch: Hat nicht der große Homeros im zweiten Gesang der Ilias seinen Helden Odysseus sagen lassen: Nie bringt Segen die Herrschaft vieler – einer sei Herrscher!«
So sprach Melanchros und von seiner Zunge tropfte der süße Honig eitler Hoffnung und nicht wenige gingen ihm auf den Leim. Nachdem der Adelsrat ihn mit großer Mehrheit zum Tyrannos von Lesbos erwählt hatte, kümmerte er sich kaum noch um die Beschlüsse der immer seltener stattfindenden Versammlungen. Er tat einfach, was er wollte, und nach und nach wurde es auch einem Teil seiner Anhänger klar, dass dieses Tun fast ausschließlich dem eigenen Wohl, der eigenen Sippe galt. Auf dunklen Wegen brachte er Weinberge, Ländereien und Handelsschiffe an sich. Die Betrogenen konnten sich kaum wehren, wurden als Verräter und Staatsfeinde hingestellt und immer waren es solche, die damals gegen ihn gestimmt hatten.
Als ein großer Teil der Adelsfamilien sich der Verschwörung zum Sturz des Melanchros angeschlossen hatte, versammelten sich ihre Führer im Haus des Kamon, einem älteren Bruder unserer Mutter. Pittakos war ihr unbestrittener Sprecher und hatte es mit Geduld, Klugheit und Wortgewalt erreicht, dass alle auf ihn hörten und seinen Vorschlägen folgten. Als er seine Hand hob, verstummten die leisen Gespräche.
»Da wir uns zwar körperlich unterscheiden, aber in unserem Ziel zum Sturz des Tyrannen Brüder im Geiste sind, fühle ich mich euch so nahe wie ein Bruder. Vorweg gesagt: Melanchros macht es uns leicht. Dummdreist stolziert er durch die Stadt, eitel wie ein Pfau, und glaubt in seiner Verblendung – sagt es auch noch! –, die Liebe des Volkes trage ihn so sicher wie eine gut gebaute triere auf ruhiger See. Seine engsten Anhänger bestätigen es ihm und er kann es nicht oft genug hören. Legt man ihm nahe, bald wieder eine Adelsversammlung einzuberufen, so wehrt er nur lachend ab. Er halte das nicht für nötig, er stehe mit allen im Einklang, sei aber jederzeit bereit, bei nahender Bedrohung, in kritischer Lage – und so fort. Meine Brüder, nehmen wir ihn doch jetzt beim Wort! Seit Jahren schwelt ein Kleinkrieg um Sigeion in der Troas, wo sich – auf dem Siedlungsgebiet von Lesbos! – zunehmend Einwanderer aus Athen festsetzen. Freilich, von dort lässt sich die Zufahrt zum Hellespontos am besten überwachen und das ist für Athen von großer Bedeutung. Wollen wir aber dort nicht unseren ganzen, bitter erkämpften Einfluss verlieren, muss dem Zwist ein Ende bereitet werden, und zwar nicht irgendwann, sondern in allernächster Zeit. Aus diesem Grund werden wir eine Ratsversammlung einberufen und Melanchros zwingen, dazu deutlich Stellung zu nehmen. Er wird sich herum- und herausreden wollen – nichts anderes ist von ihm zu erwarten.«
Pittakos schwieg und ließ seine klugen, etwas grüblerischen Augen über die Versammlung wandern. Niemand sagte etwas, doch aus fast allen Mienen war unbedingte Zustimmung zu lesen.
Dann hob er seine Stimme: »Bei dieser Gelegenheit, meine Brüder, wird der Tyrann Melanchros sterben.« Er sagte es ohne Betonung, aber so bestimmt, als sei es schon geschehen.
»Wer Einwände hat, mag sie jetzt vorbringen.«
Eine Stimme fragte: »Würde eine Verbannung auf Lebenszeit nicht genügen?«
»Nein, mein Lieber. Verbannte Tyrannen haben die Eigenschaft, zur Unzeit wiederzukommen – das lehrt uns die Geschichte. Verbannen werden wir seine Anhänger und Nutznießer. Er muss sterben.« Da erhob sich kein Einwand mehr.
Dronymos fragte: »Wie soll es geschehen?«
»Wir müssen zeigen, dass nicht der Hass eines Einzelnen, sondern der Wille einer Mehrheit hinter diesem Entschluss steht. Wie sicher zu erwarten, wird Melanchros keinen richtungsweisenden Entschluss fassen, sondern nur auf geschickte Art herumreden. Ich als euer Sprecher werde aufspringen und rufen: ›Aber wir müssen handeln – jetzt!‹ Auf dieses Zeichen hin erhebt ihr euch und jeder, der an ihn herankommt, versetzt ihm einen Dolchstich.«
»Die Saalwächter? Sie werden uns zuvor nach Waffen durchsuchen!«
Pittakos lächelte sanft. »Sie tun es gewiss, doch sie werden nichts finden, denn ich habe sie bestochen.«
»Können wir uns auf sie verlassen?«