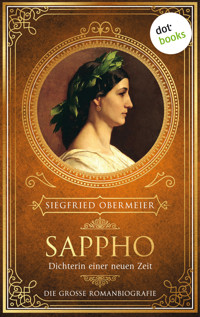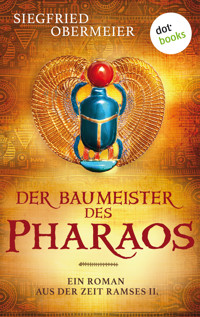16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Siegfried Obermeier hat sich als Autor von über 30 Romanen und Sachbüchern, meist historischen Inhalts, einen guten Namen gemacht. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Hier beschreibt er auf mitreißende Art und Weise ganz persönlich erlebte Geschichte: wie er mit der Naivität eines Kindes die schleichenden Anfänge des Zweiten Weltkrieges kaum wahrnimmt und nach den verheerenden Bombennächten 1943 erstaunt und gleichzeitig ergriffen die geschundene Heimatstadt München erkundet. Mit seiner Mutter verbringt der Autor später über ein Jahr im Freisinger Zufluchtsort, wo er jedoch den feindlichen Angriffen auf das Münchner Umland nicht entkommen kann. Nachdem ihm seine Kindheit rückblickend stets "wie ein dunkler Vorhang" vorkam, zieht Siegfried Obermeier heute abschließend das Fazit, dass diese autobiographische Reise wertvolle Erinnerungen auftauchen lässt, welche er zuvor verloren geglaubt hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Meinem Enkel Felix gewidmet
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfotos: oben: Privatbesitz des Autors unten: Archiv Rupprecht-Gymnasium, München Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54499-6 (epub)
Worum geht es im Buch?
Siegfried Obermeier
Verlorene Kindheit Erinnerungen aus der Kriegszeit
Siegfried Obermeier hat sich als Autor von über 30 Romanen und Sachbüchern, meist historischen Inhalts, einen guten Namen gemacht. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Hier beschreibt er auf mitreißende Art und Weise ganz persönlich erlebte Geschichte: wie er mit der Naivität eines Kindes die schleichenden Anfänge des Zweiten Weltkrieges kaum wahrnimmt und nach den verheerenden Bombennächten 1943 erstaunt und gleichzeitig ergriffen die geschundene Heimatstadt München erkundet. Mit seiner Mutter verbringt der Autor später über ein Jahr im Freisinger Zufluchtsort, wo er jedoch den feindlichen Angriffen auf das Münchner Umland nicht entkommen kann. Nachdem ihm seine Kindheit rückblickend stets »wie ein dunkler Vorhang« vorkam, zieht Siegfried Obermeier heute abschließend das Fazit, dass diese autobiographische Reise wertvolle Erinnerungen auftauchen lässt, welche er zuvor verloren geglaubt hatte.
Inhalt
Vorbemerkung
1. Geboren in »großer Zeit«
2. Der Krieg beginnt
3. Die ersten Bomben
4. Flucht aufs Land
5. Widerstand
6. Leben auf dem Land
7. Verschüttet?
8. Die Wunderwaffe
9. Finale
10. Die Stunde null
11. Mutter Courage
12. Gefährliche Spiele
13. Omama und Opapa
14. Circus
15. Oberschüler und Ministrant
16. Ende der Kindheit
Ausklang
Literatur
Der Autor
Vorbemerkung
Noch nie hat mir bei einem Roman oder Sachbuch der erste Satz Schwierigkeiten bereitet. Zwar hält sich hartnäckig die Mär, dass Schriftsteller verzweifelt vor einem leeren Blatt sitzen und um die Formulierung des ersten Satzes ringen, doch konnte ich das bis jetzt nicht bestätigen. Jetzt aber, da ich dabei bin, etwas Autobiografisches zu schreiben, bin ich plötzlich in einiger Verlegenheit. Etwas in mir sperrt sich dagegen, mich selbst zum Inhalt eines Buches zu machen. Um diesem Widerstreben auf den Grund zu gehen, erlaube ich mir eine kurze Vorbemerkung.
Der Begriff »Roman« lässt sich ganz grob in zwei Kategorien unterteilen. Die eine, von mir bevorzugte und ausschließlich angewandte, ist die – wenn auch im historischen Rahmen – erfundene Geschichte mit erfundenen Protagonisten, soweit diese nicht historisch vorgegeben sind. Da sich meine Romane – zwei ausgenommen – mit der Antike und dem Mittelalter befassen und hier die Überlieferung meist sehr spärlich ist (bei Napoleon wäre es schwieriger …), kann der Autor ziemlich frei schalten und walten. Natürlich gilt das auch für den Gegenwartsroman: Handlung und Personen sind frei erfunden, wenn auch häufig dabei Autobiografisches – bewusst oder unbewusst – mit verarbeitet wird.
Davon unterscheidet sich die zweite Romankategorie – der autobiografische Roman, der sich weitgehend mit dem Leben des Autors befasst und sich nur unwesentlich von dem, was man früher als Memoiren bezeichnete, unterscheidet. Bleiben wir beim autobiografischen Roman, der zwar die Namen verändert, doch die Ereignisse – wenn auch aus subjektiver Sicht – wahrheitsgetreu darstellt. Eine schwere Kindheit und Jugend oder andere einschneidende Ereignisse sind häufig der Anlass zu solchen Berichten. Hat der Autor auch noch Talent zum Schreiben, dann kann ein anspruchvolles Werk entstehen. Aber was kommt danach? Was macht ein solcher Schriftsteller, wenn das Autobiografische erschöpft ist und begeisterte Leser auf ein neues Werk warten?
Der österreichische Autor Franz Innerhofer gelangte an einen solchen Punkt, nachdem er drei romanhafte Bücher über seine harte Kindheit und Jugend und schließlich über seine erfolgreiche Loslösung aus diesem Elend verfasst hatte. Er erhielt eine Reihe von Literaturpreisen und einmütiges Lob seitens der Rezensenten, und seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Aber sein einziges Thema war das eigene Schicksal, und darüber hatte er nun alles gesagt. Trotz seines Versuchs fand Innerhofer aus diesem Dilemma nicht mehr heraus, suchte Trost im Alkohol und nahm sich schließlich das Leben.
Ich könnte noch einige ähnliche Beispiele nennen, die zwar nicht so tragisch endeten, bei denen aber der Autor gleichwohl in die literarische Bedeutungslosigkeit absank. Doch es gab auch glänzende Ausnahmen: Allen voran schaffte es Thomas Mann, sich nach den weitgehend autobiografischen »Buddenbrooks« vom eigenen Schicksal zu lösen, wenn er sich auch in fast allen weiteren Werken an tatsächlich existierenden Personen orientierte, was nicht selten zu Schwierigkeiten führte. Gerhart Hauptmann etwa hat sich sofort in der Person des Mijnheer Peeperkorn im »Zauberberg« erkannt und war jahrelang beleidigt.
Mit diesen Andeutungen möchte ich ausdrücken, was mich – vielleicht? – davon abhielt, autobiografische Themen zu wählen. Doch es mag auch noch weitere Gründe geben: Möglicherweise hielt ich meine eigene Person, mein eigenes Leben nicht für so wichtig, um dies zum Gegenstand einer Darstellung zum machen. Oder war es die Scheu davor, etwas von mir selbst preiszugeben? Einige Male in den letzten Jahren habe ich flüchtig erwogen, eine nicht romanhafte Autobiografie zu verfassen, stieß aber dann immer wieder auf historische Themen, die ich weitaus interessanter fand.
Wie aber kam es dazu, dass ich mich dann doch spontan entschloss, über meine Kindheit zu berichten? Das ist schnell erzählt. Während täglich die schrecklichen Berichte über die Bombardierung irakischer Städte in den Medien erschienen und etwa ein Junge gezeigt wurde, der dabei beide Arme verloren hatte, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich Ähnliches erlebt hatte und mich nur ein gnädiges Schicksal vor solch einer Verstümmelung bewahrt hatte.
Mein damals fünfjähriger Enkel war der zweite Anstoß. Zieht man die eigenen Kinder groß, so geschieht das spontaner, unbewusster, weil man – wie es so schön heißt – mitten im Leben steht, einen Beruf, einen großen Freundeskreis und manches andere hat. Als Großvater aber begann ich zu vergleichen: Unterschied sich die Kindheit meiner Tochter wesentlich von der ihres Sohnes – meines Enkels? Nicht allzu sehr, aber wie war es mit der eigenen Kindheit? Je mehr ich darüber nachdachte, umso deutlicher zeigte sich mir das Besondere meiner Erlebnisse als Kriegskind, und deshalb entschloss ich mich, diese zu schildern.
1. Geboren in »großer Zeit«
Den berühmten ersten Satz habe ich noch immer nicht gefunden – einen Satz, der den Leser hinreißen und neugierig machen soll und von dem angeblich so viel abhängt. Stattdessen erzähle ich etwas über meine Eltern. Meine Mutter – während ich das schreibe, steht sie im 94. Lebensjahr – hat es zeitlebens meinem Vater nicht verziehen, dass er sie hochschwanger allein ließ und – wie gewohnt – im Januar zum Skifahren ging. Freilich sind solche Berichte oft mit Vorsicht zu genießen, denn nicht selten stellen sie nur die halbe Wahrheit dar oder das, was der jeweilige Elternteil sich als Wahrheit zurechtgelegt hat.
Nun ist es aber so, dass ich vor einigen Wochen im Keller kramte und dabei auf einen Pappkarton mit Postkarten stieß, die meine Mutter – als Corpora Delicti? – getreulich aufbewahrt hat. Zum überwiegenden Teil handelt es sich um Nachrichten meines Vaters aus irgendwelchen Wintersportgebieten.
Am 21. Januar 1936, dem Tag meiner Geburt, schrieb mein Vater aus Bayrischzell:
»Bin gut, aber bei Nacht angekommen. Heute früh Schnee, aber nur 1 Meter. Nebel-Waschküche.«
Schon seltsam, dass ein werdender Vater einen Wetterbericht liefert, anstatt sich nach dem Zustand seiner Frau zu erkundigen! Aber warum habe ich ihn niemals danach gefragt? Bis zu seinem Tod im Jahr 1983 wäre dies möglich gewesen, doch für mich waren damals solche Dinge einfach kein Thema. Warum?
Das betrifft auch andere Bereiche. Heute würde es mich brennend interessieren, was mein Vater über Hitler und das Dritte Reich dachte, aber damals versäumte ich es, ihn danach zu fragen. Es ist halt so, dass ein Vierzigjähriger andere Fragen an sich und seine Umwelt stellt als ein fast Siebzigjähriger.
Zurück zu meiner Geburt am 21. Januar und zu dem Bericht meiner Mutter, die sich mit ihrem Sohn im Arm einsam und verlassen fühlte. Beim damaligen Stand der Nachrichtenübermittlung dauerte es drei Tage, bis mein Vater auf seiner Skihütte von meiner Geburt erfuhr. Man kann es sich heute nur noch schwer vorstellen, wie es war, als nur ganz wenige Menschen ein privates Telefon besaßen und nicht einmal die Autoren von Zukunftsromanen über die fantastischen Möglichkeiten von Mobiltelefonen schwadronierten.
So liegt jetzt die auf den 24. Januar datierte Postkarte meines im »Sudelfeldhaus« befindlichen Vaters vor mir.
»Ich gratuliere! Auf unseren Jungen (wenn die Nachr. stimmt) bin ich sehr sehr stolz. Als der Anruf kam, saß ich gerade im Hotel und ich war natürlich vollkommen überrumpelt. Das Glücks-Hufeisen habe ich schon ergriffen u. auf Euer Wohl angestoßen.«
Überrumpelt? Das klingt schon seltsam, wo er doch wusste, dass ich um diese Zeit auf die Welt kommen würde. Laut Bericht meiner Mutter konnte ihn auch dieses Ereignis nicht zum Abbruch seines Urlaubs bewegen, und als er mich zum ersten Mal sah, war dies bereits in unserer neuen Wohnung am Giesinger Berg. Erschwerend kam noch hinzu, dass meine Mutter ihn auf der »Vereins-Skihütte« vermutete, er aber im »Berghotel Sudelfeld« aufgespürt wurde. Warum dies?, so lautete ihre fast triumphierend hervorgebrachte – rhetorische – Frage. Weil er dort mit seiner Geliebten wohnte! Davon – ich meine von Geliebten im Allgemeinen – sollte im Laufe meiner Kindheit und auch später noch oft die Rede sein. Eines aber machte mich bei dem Fund der Karte stutzig: Mein Vater wollte offenbar nicht vortäuschen, auf der »Vereinshütte« zu sein, sonst hätte es nicht am 24. Januar geheißen: »… saß ich gerade im Hotel …«
Nun gut, es wird sich einfach vieles nicht mehr aufklären lassen, denn das Gedächtnis meiner Mutter ist – trotz sonstiger geistiger Klarheit – sehr lückenhaft geworden, und die von ihr vertretenen Thesen in Bezug auf die Liebesverhältnisse meines Vaters sind schon lange fest gefügt – bis zu ihrem Tod im Oktober 2004 wird sich daran wohl nichts geändert haben.
Während ich, wenige Wochen alt, als Säugling mit meiner ersten Gelbsucht kämpfte, begann der Kampf unserer Olympioniken in Garmisch um Gold, Silber oder Bronze. Laut Bericht meiner Mutter kam ich mit einem üppigen dunklen Haarschopf zur Welt und muss mit meinem von der Neugeborenen-Gelbsucht verfärbten Gesicht so kurios ausgesehen haben, dass mich die Schwestern den »kleinen Napoleon« nannten.
Die Winterolympiade fand in Garmisch statt, brachte für Nazi-Deutschland aber nur bescheidene Ergebnisse. Wenn hierzulande der Spruch kursiert: »Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze«, dann trifft das eher auf die einstmals so frenetisch gefeierten Sportgrößen zu. Zumindest Theaterbegeisterte wissen durchaus noch, wer eine Jenny Lind, ein Josef Kainz oder ein Leo Slezak war. Wer aber kennt noch Christl Cranz, Franz Pfnür oder die Paarläufer Herber/Baier? Sie waren die Goldmedaillengewinner der Winterolympiade.
Meine Mutter ist heute davon überzeugt, dass meinen Vater nach dem schmählichen Verhalten bei meiner Geburt das schlechte Gewissen geplagt und er deshalb für einige Zeit bei Frau und Kind geweilt habe. Dementsprechend ist sie auch der Meinung, er habe die olympischen Wettkämpfe in Garmisch nicht besucht. Indes, eine Postkarte vom Februar 1936 aus Garmisch widerlegt dies: »Eben kam ich vom Zweier-Bob-Rennen …« Auch vom Eislauf ist dort die Rede, und am Ende steht der Satz: »Und unser Sohn?«.
Um diese Zeit hatte Hitler das von ihm beherrschte Deutschland schon mit einer Reihe von Gesetzen und Verfügungen geknebelt, die sich auch massiv gegen die deutschen Juden richteten.
Schon am 1. April 1933 riefen die Formationen der Nazis auf Geheiß von Hitler und Goebbels die Bevölkerung zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Zwar wurde diese Aktion schnell wieder abgebrochen, doch setzte der Staat am 7. April den Juden erneut zu, indem er die Beamten unter ihnen zwangspensionierte. Die Aufhebung der Gewerkschaften folgte am 2. Mai, und am 10. Mai wurde die Bücherverbrennung inszeniert, die nicht nur jüdische Autoren traf, sondern alle, die sich nicht vom nationalsozialistischen Gedankengut vereinnahmen ließen – Thomas Mann, Heinrich Mann, Erich Kästner, Oskar Maria Graf, Erich Maria Remarque und viele andere. Wie absurd dieser Kampf gegen einen vermeintlich »undeutschen Geist« war, zeigt allein schon der Umgang mit dem Lied der »Loreley«: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …« – das stammte von dem konvertierten Juden Heinrich Heine, war aber so populär, dass man es nicht einfach aus den Gedichtsammlungen verbannen konnte; also löschte man den Autorennamen und bezeichnete das Lied als »Alte Volksweise«.
Am 14. Oktober 1933 trat Deutschland aus dem Völkerbund (Vorläufer der jetzigen UNO) aus, und am 12. November wurde so etwas wie eine »Reichstagswahl« inszeniert, die mit verdächtigen 92 Prozent Ja-Stimmen endete. Am 2. August 1934 starb der greise Hindenburg, und der »Führer« wird aufgeatmet haben, denn nun konnte er endlich frei schalten und walten. Am gleichen Tag wurde die Reichswehr auf ihn vereidigt; die Ämter des Kanzlers und Staatsoberhauptes wurden vereinigt. Dass die Volksabstimmung im Saargebiet am 13. Januar 1935 91 Prozent für eine Rückgliederung ins Deutsche Reich erbrachte, halte ich für glaubhaft. Hitler, dem politischen Hasardeur, war es in wenigen Jahren gelungen, wenn nicht die Sympathie, so doch den neidvollen Beifall etlicher Nachbarländer zu gewinnen, was auch auf sein eigenes Volk nicht ohne Wirkung blieb. Am 15. September 1935 wurden die »Nürnberger Gesetze« erlassen, die unter anderem Ehen zwischen Juden und »Ariern« untersagten.
Als in meinem Geburtsjahr 1936 die ganze Welt ihre Augen auf das im nationalistischen Taumel »erneuerte« Deutsche Reich richtete, da waren also all diese Maßnahmen bereits durchgeführt. Doch wer aus dem Ausland kam, der wird, auch wenn er Augen und Ohren weit aufsperrte, davon kaum etwas gemerkt haben. Denn ein gewaltiger, von Joseph Goebbels geleiteter Propaganda-Apparat beseitigte flugs alle schon sichtbaren Zeichen rassistischer Unterdrückung, und kein Ausländer wird über einem jüdischen Geschäft die Aufforderung »Kauft nicht bei Juden!« gefunden haben. Wer alle Machtmittel in der Hand hat, auf nichts und niemand Rücksicht nehmen muss, kann der Welt einige potemkinsche Dörfer vorsetzen, die – wenn nicht mehr benötigt – schnell wieder abgerissen werden.
Während des olympischen Jahres, am 7. März 1936, wurde durch den Einmarsch in die entmilitarisierte Zone des Rheinlands der Vertrag von Locarno brutal gebrochen. Nur wenige werden mit dieser Bezeichnung heute noch etwas anfangen können – es war der am 16. Oktober 1925 in Locarno abgeschlossene Sicherheitsvertrag zwischen Deutschland und weiteren sieben europäischen Ländern. Hitlers aggressive Außenpolitik in den Jahren nach der »Machtergreifung« nahm keinerlei Rücksicht auf diese Verträge und machte sie zunichte. Aufgrund der Gleichschaltung der Medien war aber über dergleichen Rechtsbrüche in Deutschland nur Positives zu hören und zu lesen.
Wie standen nun meine Eltern zu diesen Ereignissen? Ich mache den Versuch einer Erklärung. Mein Vater war zur Zeit meiner Geburt Funker bei der Bayerischen Landespolizei – also ein Staatsbeamter im Mittleren Dienst (er trug während der Arbeit immer Uniform). Mit niederbayerischer Zähigkeit zielte der gebürtige Landshuter auf Höheres. So nahm er eine staatliche Förderung in Anspruch, holte das Abitur nach und kam 1938 in den Gehobenen Dienst. Nun stand weiteren Beförderungen nichts mehr im Weg.
Wirklich nichts? Jeder Mann im Beamtenstand, der halbwegs Karriere machen wollte, wurde nach 1933 Parteigenosse. Dass mein Vater es nicht gleich wurde, sagt schon einiges darüber aus, wie er zu dem neuen Regime stand. Ich glaube nicht, dass er lauthals protestiert oder offen seine Abneigung gegenüber einer Parteimitgliedschaft gezeigt hat. Er wartete einfach ab und nützte die Zeit, sich fortzubilden, um in eine höhere Beamtengruppe aufzusteigen. Als das gelungen war und er sich Zahlmeister nennen durfte, setzten ihm die Kollegen zu.
Nach dem Krieg hat er mir das selber gesagt, wie sie besorgt auf ihn einredeten und ihm vor Augen hielten, dass ein Mann mit Familie sich heutzutage einer Parteimitgliedschaft nicht mehr entziehen könne. So wurde Ludwig Lorenz Obermeier 1938 Parteigenosse – fünf Jahre nach der »Machtergreifung«.
Die Einstellung meiner Mutter lässt sich in einem einzigen Satz beschreiben: Sie war ein völlig unpolitischer Mensch. Sich um Politik zu kümmern, war für sie ausschließlich Männersache, und ich kann mich nicht erinnern, dass sie nach Kriegsende jemals zu einer Wahl gegangen wäre. So beurteilte sie Hitler auch nicht nach seinen Taten, sondern nach seinem Aussehen und Auftreten. Sie hat immer betont, wie unsympathisch er ihr war, und das mag daran gelegen haben, dass sie herrisch und anmaßend auftretende Männer verabscheute. Mein Vater war von solchen Eigenschaften keineswegs frei und darum selbst immer wieder ihrer Kritik ausgesetzt.
Nun gilt es von einem Ereignis zu berichten, dessen Zeuge ich als Kleinkind wurde (natürlich ohne spätere Erinnerung): Am 29. September 1938 trafen sich Chamberlain, Daladier und Mussolini – die Staatschefs von England, Frankreich und Italien – mit Hitler im »Führerbau« an der Arcisstraße (jetzt Musikarchiv), um über die sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowakei zu verhandeln. Die Gespräche führten am folgenden Tag zum »Münchner Abkommen«, das den tschechischen Staat zwang, die überwiegend von deutschsprachiger Bevölkerung bewohnten Grenzgebiete Böhmens an das Deutsche Reich abzutreten. Das war immerhin etwa ein Fünftel der Gesamtfläche und ein Viertel der Bevölkerung der CSR. Dem verbliebenen Teil wurde – auch mit Hitlers Unterschrift – die Sicherheit garantiert. An jenem Septembertag wurden die europäischen Staatsmänner für ihren Schandvertrag frenetisch bejubelt und in den europäischen Medien als »Retter des Friedens« gefeiert. Doch was ihre Unterschriften wert waren, das zeigte der »Führer« bereits ein knappes halbes Jahr später, als deutsche Truppen auch die übrige Tschecho-Slowakei besetzten.
Mein Vater, damals noch bei der Landespolizei, musste mit seinen Kameraden den »Königlichen Platz« – so tauften die Nazis ihn um – absperren, als Hitler und Mussolini auf den Balkon des »Führerbaues« traten.
Als meine Mutter erfuhr, dass danach eine feierliche Rundfahrt durch München geplant war und der »Führer« auch den Stiglmaierplatz passieren würde, packte sie mich in den Kinderwagen und machte sich auf den Weg zum »Löwenbräukeller«, weil man von dort den besten Überblick hatte.
Seit einigen Monaten wohnten meine Eltern nicht weit entfernt in einer sog. Dienstwohnung. Das nur zweistöckige Haus (Ecke Nymphenburger/Lazarettstraße) stand in einem wunderschönen Garten mit großen Kastanien- und Ahornbäumen. Obwohl nicht vom Krieg zerstört, ist es heute verschwunden, der größte Teil des Gartens von einem Bürohaus überbaut. Einige der Kastanienbäume haben den Umbau überlebt, und ich kann sie niemals ohne leise Rührung betrachten.
Einmal wenigstens, so sagte meine Mutter später, wolle sie den »Führer« sehen, auch wenn er ihr als Mann so gar nicht sympathisch war.
Natürlich bildeten sich bereits Menschenmassen um den Stiglmaierplatz, doch als Frau mit Kinderwagen machte man ihr widerwillig Platz. Die Aussicht, so berichtete sie später, war zwar gut, aber als der »Führer« in seinem Mercedes nahte, flogen die Arme hoch, und die Sicht war versperrt. Sie hat das Hitler so übel genommen, dass sie ihn von da an noch weniger mochte.
Jetzt komme ich zu der Frage, wie weit das menschliche Erinnerungsvermögen zurückreicht. Da gehen die Ansichten ziemlich auseinander: Wenn die einen behaupten, sie hätten Erinnerungen bis ins zweite Lebensjahr zurück, so setzen andere dagegen, dass diese frühestens ab dem dritten, meistens sogar erst ab dem vierten Lebensjahr einsetzten.
Für mich kann ich mit einiger Sicherheit behaupten, dass ich mich als knapp Dreijähriger an das Oktoberfest des Jahres 1938 erinnere. Naheliegender und wahrscheinlicher wäre es gewesen, dies für 1939 anzunehmen, weil ich da schon ins vierte Jahr ging, aber die Vergangenheit – unser einziger fester Besitz – lässt sich nicht beliebig verändern. Die schon im Aufbau begriffene »Wiesn« des Jahres 1939 wurde wegen des Kriegsbeginns am 1. September abgesagt. Also muss es doch 1938 gewesen sein, und meine Erinnerungen daran sind zwar lückenhaft, aber in den Einzelheiten sehr deutlich.
Meine Mutter wuchs seit ihren Säuglingsjahren bei Pflegeeltern auf und verlebte bei ihnen nach eigenem Bekunden eine sehr glückliche Kindheit. Ihre leibliche Mutter wollte den Vater ihres ledigen Kindes nicht heiraten und legte ihm den nur wenige Wochen alten Säugling auf die »Ladenbudel« eines kleinen Gemischtwarengeschäftes in Brannenburg. Dabei soll sie mit gehässigem Spott gesagt haben: »Da hast deinen Schrazn!« Wer des Bayerischen nicht mächtig ist: Schrazn ist die etwas abfällige Bezeichnung für einen Säugling.
Der verblüffte Kindsvater stand eine Weile hilflos da und lief dann in seiner Not zu seinem Spezi, dem Thallmaier Heini, der mit seiner Frau Lina schräg gegenüber einen Laden für Haushaltsgeräte betrieb. Das kinderlose Ehepaar erklärte sich spontan bereit, das kleine Mädchen aufzuziehen. So kam es, dass ich die beiden lange für meine richtigen Großeltern hielt, während ich meinen leiblichen Großvater niemals und meine tatsächliche Großmutter erst sehr spät kennen lernte. Sie hat sich zeitlebens kaum um ihr Kind gekümmert und zeigte erst Interesse, als meine Mutter als Verkäuferin Geld zu verdienen begann. Aber da war sie schon sechzehn und entschied selber, bei wem sie leben wollte.
Heinrich Thallmaier war von Aussehen und Gehabe her der typische Altmünchner »Raunzer«, der an allem herumkrittelte, was aber nicht allzu ernst gemeint war. Er soll – so meine Mutter – Zigeunervorfahren gehabt haben und war zeitlebens etwas unstet. Die Thallmaiers zogen oft um, vom Land in die Stadt und von der Stadt aufs Land, bis sie schließlich in der Schellingstraße 32 hängen blieben. Genau gegenüber etablierte sich später der »Völkische Beobachter«, bald das offizielle Blatt der Nazis, das dann zu Kriegszeiten bevorzugtes Ziel der britischen und amerikanischen Bomber wurde. Schräg gegenüber lag die Metzgerei Strauß, die der Vater des späteren bayerischen Ministerpräsidenten betrieb. Um seine Abkunft vornehmer erscheinen zu lassen, sagte Strauß, er entstamme einer »Altmünchner Handwerkersfamilie«.
Heinrich Thallmaier hatte das Glück, einige Jahre hintereinander die Konzession für ein Ladengeschäft auf der Wiesn zu erhalten. Er war aber beileibe kein wohlhabender Mann, und besondere Beziehungen wird der gelernte Glaser und Zinngießer auch nicht gehabt haben.
Da setzt nun meine Erinnerung an das Oktoberfest – das im September beginnt – des Jahres 1938 ein, und ich war zwei Jahre und neun Monate alt. Vor allem zwei Dinge blieben mir im Gedächtnis haften: Zum einen die herrlich rauen und buntfarbigen Zuckerstangen, die ich im Laden des Opas nach Lust und Laune bekam. Da schleckte man gut eine halbe Stunde daran, hatte dann aber eine wehe Zunge und wunde Lippen. Zum anderen handelte es sich um das »Angelwerfen«. In dem kleinen Laden des Opas (bayerisch »Opapa«) gab es Postkarten, Süßigkeiten, allerlei Wiesnkitsch und eine kleine Wand aus Sperrholz. Wer zehn Pfennig bezahlte, bekam eine Angel in die Hand und durfte Schnur und Haken über die Barriere werfen. Meine Oma (bayerisch »Omama«) befestigte dann ein kleines Päckchen daran, und der Angler konnte seine Beute herausziehen. Was in den Päckchen war, weiß ich nicht mehr – vermutlich irgendwelche von Kindern begehrten Schätze.
2. Der Krieg beginnt
Aus der Sicht des Jahres 1938 hatte sich – jedenfalls für die meisten – das politische und wirtschaftliche Leben durchaus zum Positiven hin entwickelt. Selbst in jüdischen Kreisen hofften viele im Sommer – das bestätigen spätere Berichte von Betroffenen – auf eine gewisse Stabilisierung. Hitler, so dachte man, habe nun all seine Ziele erreicht – das Großdeutsche Reich war Wirklichkeit geworden. Seit März gehörte Österreich zu Deutschland, seit September auch das Sudetenland. Die Diskriminierungsmaßnahmen gegen die Juden galten vielen als vorläufig, und jetzt, da es mit Deutschland so sichtbar aufwärts ging, würde sich manches wieder auf einem irgendwie erträglichen Niveau einpendeln und insofern normalisieren.
Der Anschluss Österreichs stieß vielerorts auf Beifall und Verständnis. Es verwundert mich noch heute, dass die Alliierten nach Kriegsschluss den Österreichern die Opferrolle abnahmen. Wer sich die Filmaufnahmen von Hitlers Rede vor der jubelnden Menge auf dem Heldenplatz anschaut, mag an eine ernsthafte Gegnerschaft kaum glauben.
Welch ein Triumph, als Hitler auf die Hunderttausende hinunterposaunte: »Als der Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.«
Auch meine Eltern, damals 28 und 34 Jahre alt, mögen diese Euphorie empfunden haben, denn alles stand zum Besten: Es gab so gut wie keine Arbeitslosen mehr, mein Vater war unkündbarer Beamter und würde bald zum Oberzahlmeister aufsteigen, der Sohn war gesund, und man bewohnte eine sehr geräumige Dienstwohnung mit Bad und Herrenzimmer. Ja, diese Wohnung im zweiten Stock des Hauses Nummer 92 in der Nymphenburger/Ecke Lazarettstraße! Da summieren sich meine Erinnerungen zu einem deutlichen Bild, ich werde damals fünf bis sechs Jahre alt gewesen sein.
Es gab eine große Küche, ein Wohnzimmer, ein Herrenzimmer, das elterliche Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Das Bad war von der Toilette getrennt. Das war schon etwas ganz Besonderes, denn die meisten Wohnungen in München besaßen so einen Luxus nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Freunde meiner Eltern besuchten, die nicht nur kein Bad hatten, sondern ihre Bedürfnisse auf einem gemeinsamen Etagenklo verrichten mussten. Auch Gasbeleuchtung war noch sehr häufig, da musste man bei Einbruch der Nacht auf einen Hocker steigen, um den »Gasstrumpf« zu entzünden.
Zurück zu unserem Bad, das natürlich – verglichen mit den heutigen »Nasszellen« – ein Fossil war. Da gab es den turmartigen, bis zur Decke reichenden Wasserbehälter aus gehämmertem Kupfer. Das sah aus wie eine von Dellen übersäte Metallwalze. Unten musste er – möglichst mit Holz – geheizt werden; eine halbe Stunde später überzeugte sich Mutti per Handberührung, ob das Wasser schon heiß genug war. Wenigstens in meiner Familie gab es den damals gewiss noch bei vielen geübten Brauch nicht, den Badetag quasi hierarchisch zu gestalten. Zuerst badete der Vater, dann die Mutter und nach ihr die Kinder, dem Alter nach abgestuft. Das letzte, vielleicht dreijährige Zwergerl musste dann mit dem längst schon lauwarmen Schmutzwasser vorlieb nehmen.
Natürlich nahm auch bei uns die ganze Familie ihr samstägliches Bad, und wenn ich mich an die Reihenfolge auch nicht mehr erinnern kann, so weiß ich doch, dass so lange nachgeheizt und nachgefüllt wurde, bis jeder sein eigenes, sauberes Bad genommen hatte.
Durch die häufige Verwendung von Kohleöfen und Gas, auch für die Betuchten, kam es zu Unfällen, wie es sie heute gar nicht mehr gibt. Halt – manchmal doch, und zwar bei sehr alten Öfen in Wohnwagen: Bei schlechter Durchlüftung kann es nachts zu einem fatalen Anstieg des Kohlenmonoxyd-Gehalts kommen. Das damalige Leuchtgas kam übrigens nicht – wie das jetzt entgiftete – aus Russland, sondern wurde am östlichen Stadtrand in zwei gewaltigen Gaskesseln erzeugt. Einen davon wollte man später als museales Relikt stehen lassen – schließlich hat man dann doch beide abgerissen.
Besonders im Winter bei geschlossenen Fenstern war auch der Umgang mit dem Leuchtgas gefährlich, und es musste den Kindern eingeschärft werden, nicht mit den Drehknöpfen am Gasherd herumzuspielen. Es war eine tragische Begleiterscheinung dieser technischen Unzulänglichkeiten, dass es Selbstmörder in jener Zeit relativ leicht hatten, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen: Sie mussten nur den Kopf in das Backrohr des Gasofens stecken. Ich kann mich erinnern, dass eine der besten Freundinnen meiner Mutter die Untreue ihres Mannes auf solche Weise bestrafen wollte, doch sie wurde rechtzeitig entdeckt.
Zwar wuchs ich in einer Großstadt auf, doch die äußeren Umstände waren fast ländlich zu nennen. Unser aus rötlichem Klinker erbautes Haus umfasste in drei Etagen sechs Wohnungen, sodass der rund ums Haus angelegte Garten mit Kastanien, Ahorn, Buchen und verschiedenen Sträuchern für uns Kinder eine willkommene Welt des Abenteuers war. Es gab zahlreiche Möglichkeiten, sich zu verstecken, eine Rasenfläche, um Ball zu spielen, eine Sandkiste für die Kleinen.
Was ist davon heute noch übrig? Wie schon erwähnt, wurde das Haus in den Siebzigerjahren abgerissen, und weite Teile des Gartens wurden überbaut. Im Norden grenzte unser Grundstück an die niedrigen, auch aus Klinker erbauten Gebäude des Richard Pflaum-Verlags, dessen Druckmaschinen – ging man an der Lazarettstraße 4 vorbei – mit ihrem metallischen Klirren und Rattern deutlich zu hören waren. Es klingt fast wie ein Märchen, wenn ich sage, dass es diesen Verlag in demselben alten Gebäude und unter seinem originalen Namen heute immer noch gibt.
Ging es bei sechs Familien in diesem Garten nicht ein wenig lebhaft zu? Nein, denn nur drei davon hatten Kinder, eine davon (und zwar unsere unmittelbaren Nachbarn) allerdings gleich fünf. Das war mir als Einzelkind natürlich höchst willkommen, und ich schloss mich gern deren nur um ein Jahr älteren Spross Helmut an. In dieser vielköpfigen Nachbarsfamilie spielte die katholische Religion mit Tischgebet, regelmäßigen Kirchgängen und der Absicht des zweitältesten Sohnes, Missionar zu werden, eine bestimmende Rolle.
Obwohl mein Vater von den Eltern her aus stockkatholischen Gegenden (Gäuboden und Bayerischer Wald) stammte, war in unserer Familie Religion kein Thema. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Eltern – Weihnachten ausgenommen – je eine Kirche besucht hätten. Wie wir später sehen werden, färbte die fromme Einstellung unserer Nachbarn über meinen Freund Helmut zeitweise doch ein wenig auf mich ab.
Wenn jetzt die Nymphenburger Straße – als eine der Zufahrten zur Stuttgarter Autobahn – bis in die Nacht hinein von tosendem Verkehr erfüllt ist, so konnte man sie damals fast als vorstädtisches Idyll bezeichnen. Geht mir da die Fantasie nicht ein wenig durch? Nein, es war tatsächlich so, auch weil nach Kriegsbeginn – und von da an setzen meine Erinnerungen ein – nach und nach alle privaten Kraftfahrzeuge für das Militär eingezogen wurden.
Durch unsere Straße – damals noch mit Kopfstein gepflastert – ratterte in etwa halbstündigen Abständen die Trambahnlinie 4. Es gehörte nun zu unseren kindlichen Vergnügen, einen Kupferpfennig auf die Schienen zu legen, den wir dann – von der Trambahn platt gefahren – hauchdünn und groß wie ein Markstück wieder einholten. So ein Pfennig war schnell stibitzt und schnell verfremdet, aber schon beim Zehnerl begann ein ernst zu nehmender Marktwert: Damit konnte man als Kind Trambahn fahren, ins Dantebad gehen, eine Eiskugel kaufen oder sich ein Tonpfeiferl mit Liebesperlen besorgen.
Als gewitzter Fünf- oder Sechsjähriger gab es verschiedene Möglichkeiten – das Stibitzen gehörte dazu –, sich ein solches Zehnerl zu verschaffen, und wenn der oder die Spielkameraden gleichzogen, dann verließ die Gruppe – meist unter Führung eines etwas Älteren – den von einem hohen, spitzen Metallzaun umgebenen Garten, und wir machten uns auf den Weg nach Westen, zum Rotkreuzplatz. Ich weiß nicht, warum, aber es war Tradition, die kindlichen Einkäufe stadtauswärts zu tätigen. Stadteinwärts, also Richtung Stiglmaierplatz, war man nur mit den Eltern unterwegs.
Unser Ziel war dann das Kaufhaus »Kleinpreise«, das noch vor dem Rotkeuzplatz, etwa in Höhe der Landshuter Allee, zu finden war. Es wurde schon bald im Krieg zerstört, und ich kann mich kaum noch darauf besinnen, wie dieses »Kaufhaus« – das aus heutiger Betrachtung gewiss keines war – ausgesehen hat. Etwas Niedriges, Barackenähnliches habe ich vor Augen, aber wie dem auch gewesen war, für uns verkörperte es eine Art Kindereinkaufsparadies. Was konnte man da alles für ein Zehnerl kaufen! Eine Tüte Waffelbruch, die schon genannten Liebesperlen in einer Tonpfeife, eine kleine Zuckerstange, ein Stück Bärendreck, ein starkfarbiges Schlangenbonbon – a Schlangaguatl, wie es auf Bayerisch hieß.
Etwa zwanzig Jahre später – da lernte ich meine Frau kennen – haben wir erstaunt festgestellt, dass wir unsere Kindheit in nur etwa einem Kilometer Entfernung verbracht hatten. Meine Frau wuchs nämlich in der Neuhauser Schulstraße auf und hat, wie ich, mit ihren Freunden bei »Kleinpreise« eingekauft.
Da vorher das bayerische Wort »Schlangaguatl« gefallen ist: Mein Vater, obwohl gebürtiger Landshuter, sprach – so lange ich ihn kannte – niemals ein bayerisches Dialektwort. Er habe sich, so sagte er, das Bayerische abgewöhnt während seiner Zeit als Landwirtschaftseleve im Rheinland. Da war er wohl 16 bis 18 Jahre alt, und diese Zeit mag ihn auch sprachlich geprägt haben. Meine Mutter, die gewiss nicht in allem seiner Meinung war, folgte ihm dabei, sodass ich von den Eltern her an ein dialektfreies Hochdeutsch gewöhnt war. Mein perfektes Bayerisch kam aus dem Umgang mit Spielkameraden und aus der Volksschule, wie man seinerzeit die Hauptschule nannte. Ausländer oder Nichtbayern gab es damals im Schulzimmer so gut wie keine. Mit dem Lehrer sprach man ein gestelztes Hochdeutsch, aber auf dem Pausenhof oder dem Spielplatz war das münchnerische Bayerisch ein absolutes Muss.
Mein Enkel Felix wächst da unter ganz anderen Umständen auf, und wenn er von seinen Großeltern gelegentlich ein paar bayerische Sätze hört, dann versteht er kein Wort, plappert sie aber kichernd nach.
Mitten in meine frühe Kindheit hinein hatte der Krieg begonnen, aber das war für die Vier- bis Sechsjährigen kein Thema. Da mein Vater im Heeresbekleidungsamt einen kriegswichtigen Posten innehatte und sich altersmäßig schon auf die Vierzig zubewegte, blieb ihm das »Einrücken« erspart. Anders als im späteren »totalen Krieg«, wurden im Jahr 1939, beim Einmarsch in die »Rest-Tschechei« und ins Memelgebiet sowie auch für den Polen-Feldzug ab dem 1. September, nur Teile der jetzt schon gewaltigen Armee gebraucht.
Eine Woche vor dem Überfall auf Polen hatten Hitler und Stalin einen Nichtangriffspakt geschlossen mit der geheimen Zusatzklausel, dass Polen zwischen den beiden Ländern aufgeteilt würde. Der abgefeimte Georgier rechnete gewiss mit einer Unterstützung Polens durch England und Frankreich und erhoffte sich davon wohl eine Selbstzerfleischung der »kapitalistischen« Länder. Damit wäre der Boden für den weltweiten Sieg des Kommunismus bereitet gewesen. Aus dieser dreisten Utopie ist bekanntlich am Ende nichts geworden, aber welch unvorstellbar hohen Preis musste doch die Welt für derartige Hirngespinste von Diktatoren bezahlen …!
Hier vielleicht ein kleiner Rückblick auf mein Geburtsjahr und das den vielen zur Olympiade angereisten Ausländern vorgeführte »Musterland«. Damit war es nun vorbei, und der Druck auf Juden und Regimegegner wuchs, die im ganzen Reich angelegten Konzentrationslager füllten sich.
Dachau bei München war das erste Lager solcher Art, doch bald folgten Sachsenhausen, Buchenwald, Lichtenburg und andere. Dort saßen nicht nur Juden und Regimegegner ein, sondern auch andere, als »Volksschädlinge« bezeichnete Gruppen: unbotmäßige Priester, Bibelforscher, Emigranten, Sinti und Roma, sog. Arbeitsscheue, Wiederholungstäter, Homosexuelle.
Nicht alle Juden nahmen diese schändlichen Maßnahmen so ohne weiteres hin. So verübte der junge und zornige Herschel Grynzspan ein Attentat auf den Sekretär der deutschen Botschaft in Paris. Der Mann starb, und Hitler muss mit seinen Paladinen wohl einen Freudentanz aufgeführt haben. Endlich gab es einen konkreten Anlass, der »Empörung des Volkes« Ausdruck zu verleihen. Hitler sprach von einem »Anschlag des Weltjudentums«, und dem kleinen Gesandtschaftsrat, der noch schnell zum Legationssekretär befördert wurde, wurde eine Trauerfeier bereitet, wie sie sonst nur höchsten Staatsmännern zukam. Der Tod des Diplomaten lieferte dem Regime den propagandistischen Vorwand zur sog. Reichspogromnacht (Joseph Goebbels erfand dafür den Begriff »Reichskristallnacht«), in der Partei- und SA-Schergen auf Weisung der obersten Ebenen in »Räuberzivil« einen Volkszorn vortäuschten und dabei Synagogen anzündeten, viele Tausend jüdische Geschäfte verwüsteten und plünderten und an die hundert Menschen ermordeten. Gleichzeitig wurde die Polizei angehalten, nicht einzugreifen. Dazu kamen an die 30000 Verhaftungen jüdischer Männer und Frauen.
Die Gestapo verschleppte sie in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen, wo viele von ihnen ums Leben kamen – ein grausamer Vorbote der im Weltkrieg einsetzenden systematischen Vernichtungspolitik.
Überdies wurde den deutschen Juden als »Buße« eine Sondersteuer von einer Milliarde Reichsmark auferlegt – damals eine ungeheuere Summe. Es darf nicht vergessen werden, dass die Preise um die Zeit von 1940 für die täglichen Grundnahrungsmittel meist unter einer Reichsmark lagen. Eine Semmel etwa kostete vier Pfennige, zwei Semmeln erhielt man für sieben Pfennige. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber meine Mutter erwähnte einmal, dass der Verdienst meines Vaters um diese Zeit bei 200 Reichsmark lag. Der Mietpreis einer geräumigen Vier-Zimmer-Wohnung bewegte sich um 40 Reichsmark.
Das veranschaulicht, welch ungeheuere Summe die Naziregierung den Juden abpresste.
Menschen meiner Generation könnten es sich einfach machen und den Eltern vorwerfen, sie hätten nur Hitlers »Mein Kampf« lesen sollen, da sei alles dringestanden, was der Diktator später in die Tat umsetzte. In diesem Schand- und Schundwerk ist die Vernichtung des Judenvolks zwar nicht direkt angesprochen, aber es ist eine einzige Hasstirade, die sich durch das ganze Pamphlet zieht und die nur einen Schluss zulässt: Befreit euch von den schädlichen Einflüssen dieses Volkes, und die meisten Weltprobleme sind gelöst.
Ich habe gehört, wie Herren aus der Generation meines Vaters, die eine humanistische Bildung genossen hatten, sagten: Man habe in die Geschichte zurückgeblickt und sei da immer wieder auf Herrscher gestoßen, die ihren Machtanspruch mit blutigen Mitteln so lange durchgesetzt hätten, bis sie sicher auf dem Thron saßen; dann aber hätten sie milde und gerecht regiert – das beste Beispiel dafür sei Kaiser Augustus. Doch Hitler war kein Augustus, und er ist niemals von seinen Welteroberungs- und Judenvernichtungsplänen abgewichen. Mit der Welteroberung ist er zum Glück gescheitert, während ein Teil der »Endlösung der Judenfrage« leider verwirklicht werden konnte. Auch wenn man meiner Generation (und den folgenden) keine unmittelbare Schuld an diesen Verbrechen anlasten kann, so müssen wir doch die Erinnerung an diese Ereignisse wach halten als Mahnung, niemals wieder einen Hitler oder Stalin hochkommen zu lassen.
Viele Deutsche und zum Teil auch das europäische Ausland sahen Hitlers Programm, ein Großdeutsches Reich zu schaffen, mit der Annexion des Sudetenlandes und dem »Anschluss« Österreichs als abgeschlossen an. Doch diese Illusion zerplatzte wie eine Seifenblase, als Hitler am 1. September 1939 Polen überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg auslöste.
Einiges spricht dafür, dass Hitler eine »Weltherrschaft« – dabei war zunächst wohl nur an Europa gedacht – nur als sekundäres Ziel angestrebt hat. Sein Hauptziel aber war die völlige Vernichtung der Juden, von denen er unbeirrbar annahm, dieses Volk habe die Absicht, die ganze Welt zu kontrollieren. Davon ist in »Mein Kampf« mehrmals ausführlich die Rede. Das Mittel, mit dem dies erreicht werden solle, sei der Bolschewismus.
Ich war damals kaum vier Jahre alt und kann mich nicht daran erinnern, wie Hitler ebenso gehässig wie irreführend im Radio verkündete: »Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen!«. Und wenn, dann hätte ich doch nichts davon verstanden. Aber seltsamerweise kann ich mich genau daran erinnern, wie Mitte oder Ende Oktober die siegreichen Truppen aus Polen zurückkehrten. Ich habe es noch deutlich vor Augen: Wir standen am Anfang der Lazarettstraße und schauten den feldgrauen Soldaten zu, wie sie in Reih und Glied vermutlich in Richtung Max-II-Kaserne marschierten. Diese um 1870 errichtete Kaserne wurde im Krieg völlig zerstört, und ihr Schutthügel diente uns Kindern in den Frostjahren 1945–47 als willkommener Schlittenberg.
Wurden die Heimkehrer mit Jubel empfangen? Ich bin mir nicht sicher, aber die Grundstimmung wird wohl doch positiv gewesen sein. Eine verbreitete Redewendung, die mir aber vermutlich erst später aufgefallen sein mag, lautete: Der Führer wird schon wissen, was er tut!
Damit war jede Kritik erstickt, und wer zu laut etwas Gegenteiliges äußerte, dem drohte Dachau. Wer später behauptete, nichts von Dachau gewusst zu haben, log oder hatte es verdrängt. Dieser Name war ein Synonym für brutalste Strafe. Wer laut an Hitler und seinen Kriegsplänen herumkritisierte, wer »Feindsender« hörte, wer etwa als Lebensmittelhändler die »Volksgemeinschaft« betrog oder wer auf irgendeine andere Arten gegen die vielen Gesetze des Regimes verstieß, dem drohte Dachau, später sogar das Fallbeil.
Mochten die Erwachsenen ihre Kämpfe unter sich oder an der Front austragen, so war der kindliche Kampfplatz die Spielwiese rings ums Haus. Meine Mutter hat später immer wieder betont, ich sei ein sehr gutmütiges, leicht lenkbares und auch gutwilliges Kind gewesen. Unter Gleichaltrigen mag das eher ein Nachteil sein, und da das elterliche Auge uns Kinder von einem der Wohnungsfenster aus fast immer überwachen konnte, wurde meine Mutter mehrmals Zeuge, wie man ihren Sohn schurigelte.
Daran mag sich heute die erstaunte Frage knüpfen, wie eine damals 30-jährige Frau mit nur einem Kind immer zu Hause sein konnte. Dafür gab es mehrere Gründe:
Erstens war es für die Frau eines höheren Beamten undenkbar, dass sie eine berufliche Arbeit ausübte, auch wenn sie kinderlos gewesen wäre. Zum anderen muss man sich die Größe unserer Dienstwohnung und die damit verbundenen Umstände vor Augen führen. Die Zimmer waren äußerst geräumig, der Flur zog sich endlos, und man begnügte sich damals nicht mit einer Raumhöhe von heute im Durchschnitt 2,40 Metern, sondern wohnte in Sälen, deren Decken sich auf 3,30 Metern befanden. Das bedeutete, dass sämtliche Fenster sog. Oberlichter besaßen, an die man nur mit einer Leiter herankam.
Die kohlebeheizten Öfen in Küche, Wohn- und Herrenzimmer mussten in der kühleren Jahreszeit ständig gewartet werden.
Für den »Waschtag« setzten die Frauen je nach Familiengröße ein bis zwei, manchmal sogar drei Tage an. Diese Arbeit fand nicht in der Wohnung statt, sondern in dem eigens dafür errichteten »Waschhaus«, einem garagenähnlichen Gebäude in der Nordostecke unseres Gartens. Dort trugen die Frauen leichte, lockere Kleidung, da sie sich in der reinsten Dampfsauna befanden. In gewaltigen Kesseln siedete das Wasser; die Wäsche wurde ausgekocht, mit gewaltigem Kraftaufwand auf dem Waschbrett geschrubbt, ausgewrungen (das ging meist nur zu zweit) und schließlich an die Leine gehängt. Dann die Küche! Es gab keine vorgegarten Nahrungsmittel, keine Fertiggerichte – alles musste von Hand vor- und zubereitet werden. Meist waren die Frauen schon Stunden vor der Mahlzeit mit den Vorarbeiten beschäftigt, und ich sehe meine Mutter heute noch rohe Kartoffeln reiben, um daraus die entsprechenden Knödel zu bereiten. Ein Reisbrei musste über eine halbe Stunde gerührt werden, ein Hefeteig brauchte Stunden, um backfertig zu sein, verschiedene Fleischgerichte – die es dann bald nicht mehr gab – wurden schon nach dem Frühstück gebeizt, eingelegt, geklopft, um dann am späten Vormittag bratfertig zu sein.
Vom Krieg war in dieser Zeit – also um 1939/40 – kaum etwas zu bemerken. Freilich gab es beim Polenfeldzug und den Überfällen auf Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und Frankreich auch Gefallene, doch das bewegte sich noch in Dimensionen, die kaum wahrgenommen wurden. Die männlichen Bewohner unseres Hauses waren überwiegend höhere Beamte im Heeresdienst, und Söhne im wehrpflichtigen Alter gab es hier keine.
Kommen wir also zurück zu den kindlichen Auseinandersetzungen, bei deren Beobachtung meine Eltern fanden, dass ich – wie man heute sagt – meistens zu den Losern gehörte. So wurde mir eingeschärft, ich solle mir nicht alles gefallen lassen, und so folgte ich dergestalt, dass ich bald darauf Elisabeth, der älteren Schwester meines Freundes Helmut, eine Sandschaufel auf den Kopf haute. Das gab eine blutende Platzwunde und einigen Aufruhr, der sich aber bald wieder legte.
Ein unverzichtbarer Teil von Kindheitserinnerungen scheint der Bericht über »Doktorspiele« zu sein. Kaum eine Autobiografie, die diese – völlig normale – kindliche Neugier, seinen Körper und den der anderen zu ergründen, nicht mehr oder weniger ausführlich schildert. Doch damit kann ich leider nicht dienen. Entweder es hat so etwas in unserem Kreis tatsächlich nicht gegeben, oder ich habe es – weil unwichtig – einfach vergessen. Natürlich unterbrachen wir Kinder, wenn uns die Blase drückte, nicht lange unser Spiel. Wir gingen halt etwas abseits, die Buben pinkelten an einen Baum oder in die Sträucher, die Mädchen hockten sich – meist noch in Sichtweite – hin und ließen es laufen. Dieser Unterschied war aber schon alles, was wir wahrnahmen.
Manchmal spielten wir auch unsere Eltern nach – da gab es feierliche Hochzeiten mit einer gänseblumengeschmückten Braut und einem Bräutigam mit Papierzylinder. Die Jüngsten mussten dann manchmal die Kinder des Ehepaares spielen, und diese Rolle fiel natürlich Helmut und mir zu. Als wir ins Schulalter kamen, entzogen wir uns dieser Aufgabe – wir hatten Wichtigeres zu tun.
Neben solchen Spielen, die Mädchen und Buben gemeinsam machten (etwa Häuselhupfen, Fangen, Verstecken, Räuber und Schandi und verschiedene Ballspiele), gab es natürlich auch Aktivitäten, bei denen wir Buben unter uns waren. Wir kletterten zum Beispiel auf Bäume, was damals Mädchen niemals taten, schon weil sie ausnahmslos Röcke trugen.
Wir bastelten uns Steinschleudern, Pfeil und Bogen, Blasrohre, auch Holzschwerter aus alten Zaunlatten oder Haselstöcken. Da wurde auf Teufel komm raus geschossen und gefochten, aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich einen anderen Gegner gehabt hätte als den fast gleichaltrigen Helmut. Unsere kindliche Hierarchie war sehr streng: Jüngere wurden bevormundet, vielleicht auch geschützt, aber nicht ernst genommen. Ältere kamen für den näheren Umgang nicht in Frage – natürlich mit Ausnahme der eigenen Geschwister.
Zum eben genannten Thema Baumkraxeln muss ich noch von einem Unfall berichten, den ich etwa als Sechsjähriger erlebt habe. Damals (wie heute) war die Lazarettstraße eine Allee mit Reihen aus Kastanienbäumen. Ob es jetzt noch dieselben sind, kann ich nicht sagen – sie sehen nämlich so verdächtig jung aus …
Die Lazarettstraße war nach dem damaligen Militärkrankenhaus benannt, das sich von der Thorwaldsen- bis zur Dachauer Straße erstreckte und heute in ein Herzzentrum umgewandelt ist.
Wollten wir Kinder nach draußen, wanderten wir diese Straße entlang, wobei sich manchmal Kinder aus dem gegenüberliegenden Haus Nymphenburger Straße 94 anschlossen. Das war gleichsam ein Zwilling unseres Anwesens, ebenso dreistöckig, mit insgesamt sechs Wohnungen und einem gleich großen Garten. Ohne dass ich mich an einzelne Namen erinnern könnte, so waren die Kinder von dort doch befreundete Nachbarn, während wir die aus anderen Wohngebäuden – gegenüber oder in Richtung Rotkreuzplatz – eher für »Feinde« hielten.
Zurück zu jenem Ausflug, der uns etwa in Höhe der Thorwaldsenstraße führte, weil dort ein herrlicher Kletterbaum stand. Er hatte die ganz entscheidende Eigenschaft, dass seine Äste weit herunterreichten. An diesen konnte man sich mit einem lässigen Klimmzug hochziehen, und von da aus ging es bequem und beinahe unbegrenzt weiter. Einer ist immer der Schnellste, und der machte sich flugs ans Kraxeln, klomm wie ein Äffchen Ast um Ast empor bis hinauf zur Krone, wo das Geäst sehr dünn und kaum noch tragfähig war. Der Bub aber wollte es den anderen zeigen! Plötzlich hörten wir ein bedrohliches Knacksen und Splittern, und der kühne Kletterer stürzte kopfüber herab auf das Klinkerpflaster. Da lag er nun, der Sieben- oder Achtjährige in seinen kurzen Hosen, das Gesicht halb auf dem Boden, die Beine angewinkelt. Langsam verbreitete sich um seinen Kopf ein dunkelroter Fleck, eines seiner Beine zuckte leicht. Wir standen wie erstarrt, bis eines der größeren Kinder hinüber ins Lazarett lief – wir anderen sausten davon, als wir einige Erwachsene kommen sahen. Ich empfand etwas wie Schuld, weil ich stumm zugesehen hatte, wie der Bub immer höher kletterte. Den anderen wird es vielleicht ähnlich ergangen sein. Der Junge soll dann im Lazarett gestorben sein, erfuhren wir später – aber es war nur ein Gerücht, und so weiß ich es nicht mit Gewissheit.
Die Statistik der Kindersterblichkeit wird damals eine andere gewesen sein. Heute stehen die tödlichen Verkehrsunfälle zahlenmäßig an der Spitze, zu jener Zeit dürften sie das Schlusslicht gebildet haben. Vom Verkehrsaufkommen in der Nymphenburger Straße habe ich schon gesprochen; die Lazarettstraße aber war – weil ohne Trambahn – noch ruhiger. Wenn dort gelegentlich ein Kraftfahrzeug auftauchte, dann war es meist einer jener leichten dreirädrigen Mini-Laster, die offenbar als frontuntauglich eingestuft waren und damals das Stadtbild prägten. Dann und wann fuhr ein Sanka (Sanitätskraftwagen) vorbei, der Verwundete vermutlich vom Bahnhof ins Lazarett transportierte.
Eine besondere Gefährdung – vor allem für Buben – lag in dem unbekümmerten Umgang mit selbst gebastelten Waffen. Nahezu in jeder Schulklasse gab es damals einen Einäugigen, der durch eine Steinschleuder oder einen Pfeil ein Auge verloren hatte.
Eine Steinschleuder – im Norden Zwille genannt – war ziemlich leicht mit dem herzustellen, was man in der Natur und zu Hause fand. Dazu gehörte eine stabile Astgabel, die insgesamt auf etwa 25 bis 30 Zentimeter zurechtgestutzt und mit einem – damals in jeder Familie vorhandenen – Einmachgummi versehen wurde. Um Obst, Pilze, Gemüse und anderes für den Winter oder für Notzeiten haltbar zu machen, wurde das Material in ein ca. 0,7 Liter fassendes kochfestes Glas geschichtet, dann in einem Kessel stark erhitzt, wobei der Glasdeckel mit einem ringförmigen Gummiband versehen und beim Abkühlen durch den Unterdruck luftdicht darauf gepresst wurde. Diese eingemachten oder eingeweckten Nahrungsmittel hielten sich in kühlen Kellern über viele Jahre.
Das erwähnte Gummiband hätten die wenigsten Mütter freiwillig zu dem genannten Zweck herausgerückt, denn eine Steinschleuder galt auch bei den meisten Eltern als gefährlich. Ich könnte mich aber nicht darauf besinnen, dass es einen Buben zwischen sechs und zwölf Jahren gab, der diese Waffe nicht besessen hätte.
Steine in der geeigneten Größe lagen genug herum, und wenn wir nicht auf Spatzen zielten, so beschossen wir uns gegenseitig – in aller Freundschaft. Meines Wissens bin ich niemals im Gesicht getroffen worden, schon weil man den Kopf abwandte, während der Gegner den Gummi spannte. Aber schmerzhafte Treffer an Beinen, Hüften und Brust gab es schon gelegentlich.
Die zweithäufigste Bubenwaffe war der Bogen – fast noch leichter herzustellen. Da genügte eine heimlich abgeschnittene, etwa kleinfingerdicke Haselgerte, die man zum Bogen krümmte und mit einer nicht zu dicken Schnur bespannte. Als Pfeil eignete sich dann jedes dünne, halbwegs gerade gewachsene Stück Holz, wenn es so ungefähr 60 bis 80 Zentimeter lang war. Einen Pfeil mit Dornen, spitzen Steinen, Nägeln oder Ähnlichem gefährlicher zu machen, galt als regelwidrig und kam auch kaum vor. Wenn man sich gegenseitig damit beschoss, so war das relativ ungefährlich, weil man den Pfeil heranfliegen sah und ihm ausweichen konnte. Trotzdem traf ich später in einer ländlichen Volksschule (während der Evakuierungszeit) auf einen älteren Buben, der durch einen Pfeil ein Auge verloren hatte.
Wenig ernst wurden die aus Holunderästen gefertigten Blasrohre genommen. Da musste man zuvor das Mark entfernen und dann einen Bolzen finden, der so eng wie möglich hineinpasste. Eine Zeit lang war es Mode, sich so etwas anzufertigen, aber mehr als damit die nackten Beine der Mädchen zu beschießen, ließ sich damit nicht anfangen.
3. Die ersten Bomben
Es ist müßig zu fragen, wer als Erster mit der Bombardierung von Städten begonnen und damit den Krieg von der Front auf ziviles Gebiet ausgeweitet hat. Entscheidend ist allein, wer den Krieg begonnen hat.
Dennoch gibt es eine Entstehungsgeschichte, und sie ist ein klassisches Beispiel militärischer Eskalation. Am Anfang stand nichts anderes als ein Irrtum. Ende August 1940 warfen zwölf missgeleitete deutsche Flugzeuge ein paar fast völlig wirkungslose Bomben auf die Docks von London. Ein paar Tage später sandte Churchill 50 Bomber nach Berlin, von denen drei abgeschossen wurden und weitere drei beim Rückflug in die Nordsee stürzten. Im Berliner Vorort Rosenthal gab es zwei Leichtverletzte und eine zerstörte Gartenlaube.
So gering die Schäden auch waren, so reichten sie doch aus, die Gemüter einiger hoher Nazis – mit Hitler an der Spitze – zum Kochen zu bringen. Am 5. September brüllte Hitler mit sich überschlagender Stimme im Berliner Sportpalast:
»Und wenn die britische Luftwaffe zwei- oder drei- oder viertausend Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150000, 180000 … eine Million Kilogramm. Wenn sie erklären, sie werden unsere Städte in großem Ausmaß angreifen – wir werden ihre Städte ausradieren! Wir werden diesen Nachtpiraten das Handwerk legen, so wahr uns Gott helfe. Es wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische Deutschland sein.«
Fünf Jahre später wussten wir es besser.
Gleich nach Kriegsbeginn reagierte die deutsche Bürokratie prompt und gründlich. Ende September wurden die »Reichskarten für Lebensmittel« ausgegeben – die Brotkarte rot, die Fleischkarte blau, die Milchkarte grün, die Karten für Zucker und Marmelade weiß.
Damals wurde der Begriff »Normalverbraucher« geboren, und ein solcher erhielt pro Woche: 2400 Gramm Brot, 500 Gramm Fleisch oder Fleischwaren, 80 Gramm Butter, 125 Gramm Margarine, 65 Gramm Schweineschmalz oder Speck, 62,5 Gramm Käse oder 125 Gramm Quark (in Bayern Topfen genannt), 100 Gramm Marmelade, 250 Gramm Zucker, 100 Gramm Nährmittel. Für Kinder, chronisch Kranke und Schwerarbeiter gab es Varianten davon. Dazu ein Kuriosum: Seit 1933 wurde die Parole ausgegeben: »Eine deutsche Frau raucht nicht!« Trotzdem teilte man dem erwachsenen weiblichen Teil unserer Bevölkerung ab 1942 bis zum Kriegsende solche »Raucherkarten« zu – allerdings gab es für sie nur die Hälfte der den Männern zugestandenen Menge.
Zum Kriegsbeginn schreibt Kurt Preis in seinem vorzüglichen Buch »München unterm Hakenkreuz«:
»Es war keinerlei Begeisterung in der Stadt, keine Fahnen, keine Blumen für die Soldaten.«
Aus alten Filmaufnahmen wissen wir, dass dies 1914 noch ganz anders ausgesehen hatte. Da wurden die Soldaten bei ihrem Auszug wie Helden bejubelt, die Frauen busselten sie ab, man steckte ihnen von allen Seiten Päckchen zu und Blumen in die Gewehrläufe. Eines aber war wie damals: Illusionen. Dem Ersten Weltkrieg gab man eine Dauer von wenigen Monaten, und es ging der Spruch um: Bis Weihnachten seid ihr alle wieder zu Hause.
Auch im September 1939 gab es solch ein Wunschdenken, doch es hätte spätestens nach vier Tagen in Nachdenklichkeit umgeschlagen müssen, nämlich als bekannt wurde, dass England und Frankreich zu ihrem Bündnisvertrag mit Polen standen und Deutschland den Krieg erklärt hatten. Damit hatten weder Hitler noch seine Paladine ernsthaft gerechnet. Sogar der stets optimistisch angelegte Göring murmelte düster:
»Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann möge uns der Himmel gnädig sein.«
Doch die Stimmungslage änderte sich schnell, als die deutschen Truppen in einem »Blitzkrieg« – wie einst Alexander durch Kleinasien – siegreich durch Europa zogen und bereits Ende Juni 1940 neben Polen auch Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien und Frankreich kontrollierten.
Für Stalin war diese Entwicklung in einem düsteren Kalkül durchaus willkommen. Denn dass die USA – um England beizustehen – eines Tages in den Krieg eintreten würden, war abzusehen, und wenn Europa schließlich zerschmettert am Boden läge, würde die Sowjetunion dafür sorgen, diese Länder in kommunistische Arbeiterparadiese zu verwandeln. Dass Hitler indes das Mutterland des Sozialismus selbst angreifen könnte, lag so weit außerhalb der Vorstellungswelt Stalins, dass dieser am 22. Juni 1941, dem Tag des Überfalls, die eingehenden Meldungen nicht glaubte.
Wenn man lange verheiratet ist, dann werden die Kindheitserinnerungen so nach und nach zum gemeinsamen Eigentum. So möchte ich im Zusammenhang mit dem Russlandfeldzug erwähnen, dass der Vater meiner Frau ihn von Anfang an mitmachte und – siegesgewiss wie Führer und Volk – in Windeseile fast bis nach Moskau vorstieß. Von dort erhielt meine Schwiegermutter ein auf den 5. Dezember 1941 datiertes Schreiben, aus dem ich zitiere:
»Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Gatte, der Gefreite E.S. am 27. November 1941 im Feldlazarett verwundet eingeliefert wurde. Trotz aller ärztlichen Bemühungen … ist er am 04. Dezember 1941 um 19 Uhr 15 verstorben … Möge Sie in Ihrem tiefen Leid um den Verstorbenen der stolze Gedanke trösten, dass er sein Leben für Groß-Deutschland und seinen Führer hingegeben hat.«
Er tat es gewiss nicht freiwillig oder gar mit Begeisterung. Als er starb, war er 29 und meine künftige Frau viereinhalb Jahre alt.
Feldpostbriefe dieses stereotypen Inhalts werden zuvor schon tausende von Frauen erhalten haben, und viele hunderttausende kamen in den folgenden Jahren dazu.
Besonders schlimm für meine Schwiegermutter war ein Brief, den sie Tage nach der Todesnachricht erhielt, in dem der Verwundete sich guten Mutes zeigte und nur bedauerte, einen Teil seiner Zähne verloren zu haben.
Zurück zum Jahr 1940. So manchen Skeptiker mögen die Siege eines »Besseren« belehrt haben, nun ausgedrückt in der Haltung: »Der Führer weiß schon, was er tut!«
Meine völlig unpolitische Mutter hatte dazu – wie immer – keine Meinung, und wenn ich mit meinem Vater darüber sprach, wich er mir aus. Zwar verhehlte er mir nicht, auch damals von der Euphorie angesteckt worden zu sein, aber in seiner alle Möglichkeiten abwägenden niederbayerischen Art scheint er auch ein negatives Ende in Betracht gezogen zu haben. Zumindest gibt es dafür so manche Andeutungen: In der von mir anfangs erwähnten Postkartensammlung sind einige auch von Freunden oder Kollegen an ihn gerichtet, und da heißt es manchmal »Mit deutschem Gruß« oder »Heil Hitler«. Seine eigenen – sie reichen bis 1942 – enden immer »Mit herzlichen Grüßen«.
Dazu noch eine weitere, sehr bezeichnende Episode. Irgendwann – mit sechs oder sieben Jahren – muss ich zu der Erkenntnis gelangt sein, dass ein anständiger deutscher Mann in der Partei ist und das runde, etwa markstückgroße Parteiabzeichen am Revers trägt. Mein Vater trug es nicht, bestätigte mir aber, in der Partei zu sein. Bekanntlich sehen sechs- bis zwölfjährige Buben in ihrem Vater ein Vorbild und wollen ihn gern zum Helden stilisieren. So ließ ich nicht locker und sagte, ich wolle das Parteiabzeichen gerne sehen. Ich glaube, es war beim Frühstück, und er vertröstete mich bis zum Abend. Da musste ich ihn dann nochmals erinnern, und er begann zu suchen. In Schachteln, in Kleidertaschen, in abgelegten Geldbörsen – nein, das Parteiabzeichen war nicht auffindbar.
Nach dem Krieg hat mein Vater erwähnt, dass er – mit einer einzigen Ausnahme – niemals eine Parteiversammlung besucht hatte. Ihm war die sportliche Betätigung wichtiger. Im Winter verbrachte er – meist zusammen mit meiner Mutter – nahezu jedes Wochenende und natürlich auch die Urlaubstage in den Bergen beim Skifahren. Im Sommer ging es zum Wandern oder zum Baden. Für sich allein pflegte er den Reitsport, und den betrieb er mit besonderer Hingabe. Nahe seiner Dienststelle – an der Schweren-Reiter-Straße – gab es seit dem Ersten Weltkrieg die Ställe der Militärpferde.
Mein Vater hatte sich von seiner einfachen Herkunft völlig gelöst und mit dem Aufstieg in die Offizierskaste etwas angenommen, das ich als »Herrenreiternatur« bezeichnen möchte. Wer ihn hoch zu Ross sitzen sah, dachte eher an einen britischen Adelsspross als an einen ehemaligen Polizeifunker. Er hat sich dann an mehreren Wettkämpfen beteiligt und einmal das silberne Reitersportabzeichen gewonnen, das er stets an seiner Uniform trug und in verkleinerter Form an seine Zivilkleidung heftete. Da er vom Kriegsdienst befreit war, gab es für ihn sonst keine Möglichkeit, Auszeichnungen zu erwerben; aber ich vermute, er hätte auch wenig Wert darauf gelegt. Sein Reitersportabzeichen jedoch hielt er zeitlebens in hohen Ehren.
Manchmal durfte ich die Pferdeställe besuchen, und ich erinnere mich noch besonders gut an die Boxen, die den erkrankten Tieren vorbehalten waren, denn Papa beschrieb mir genau die Leiden jedes einzelnen Pferdes.
Auch mit Mutter verbinde ich für mich recht einschneidende Erlebnisse aus jener Zeit. Es wird im Sommer 1940 gewesen sein, ich war also viereinhalb Jahre alt. Ohne den Vater waren wir für einige Tage nach Taufkirchen an der Vils gefahren, wo dessen nächste Verwandten lebten. Das war Tante Maria, seine jüngere Schwester, die dort verheiratet war und drei Kinder hatte – zwei Cousins und eine Cousine namens Marianne. Sie war mir vom Alter her am nächsten, während German jünger und Peregrin – genannt Perry – zwei Jahre älter war. Als Erstgeborenem hatte man ihm den seltenen Vornamen seines Vaters gegeben – das war meinen Onkel Perry Huber, der dem Naziregime sehr nahe stand und es bis zum SA-Hauptsturmführer brachte. Als er dann später in Russland gefangen genommen wurde und erst 1949 als so genannter Spätheimkehrer zurückkehrte, war ihm dieser Wahn gründlich vergangen.
Zurück zu jenem Sommer, da wir Kinder mit unseren Müttern im Freibad an der Vils einen sonnigen Tag genossen. Viele kleinere Gemeinden, die an einem Fluss lagen, sparten sich damals die Kosten für ein echtes Freibad mit einem richtigen Becken und trennten stattdessen einfach mit Seil und Netz ein Stück vom Fluss ab. Das davor gelegene Areal wurde eingezäunt, man legte Liegewiesen an und errichtete darauf eine Reihe von hölzernen Umkleidekabinen. Zu jener Zeit war man noch so »gschamig«, dass man lieber auf ein Bad verzichtet hätte, als sich vor aller Augen umzuziehen.
Mir ist nur so viel in Erinnerung, dass ich fröhlich in den Fluss hineinwatete, und dann wurde mir plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich ging unter, schwebte in einem grün-milchigen Licht dahin, und meine Lungen begannen sich mit Wasser zu füllen. Der Fluss trieb mich schnell weiter, und zwar gegen die Beine eines Erwachsenen, der gerade ins Wasser watete. Der reagierte schnell, packte mich am Arm und zog mich an Land. Das bisschen Wasser hatte ich schnell wieder ausgehustet, aber meine Muter war so erschrocken, dass ich gleich in den nächsten Tagen das Schwimmen lernen musste. Später sagte sie, dass dies sehr schnell ging – jedenfalls konnte ich mich danach im Münchner Dantebad zu den Schwimmern zählen.
Im Jahr darauf oder vielleicht auch etwas später kam meine Tante Maria mit ihren Kindern zu uns auf Besuch. Perry, mein ältester Cousin, war damals schon über zehn und deshalb als »Pimpf« bei der Hitlerjugend – und nun wanderte er stumm und mit großen Augen durch unsere Wohnung. Schließlich trat er mit vorwurfsvollem Gesicht vor meine Mutter und fragte erstaunt, aber mit kritischem Unterton: »Tante Erna, wo ist denn bei euch das Führerbild?«
So hat es mir später meine Mutter erzählt, und dass sie darauf eine ausweichende Antwort gegeben habe. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich vielleicht eine ähnliche Frage gestellt. Es wird damals kaum einen Zehnjährigen gegeben haben, der Hitler nicht als eine Art Übervater verehrt hätte, und wie weit das ging, zeigen vereinzelte Fälle, da übereifrige Hitlerjungen ihre eigenen Eltern wegen »defätistischer« Bemerkungen oder des Abhörens von »Feindsendern« angezeigt haben. Kinder dieses Alters denken weitgehend in Schwarz-Weiß-Bildern, da gibt es keine Zwischentöne: Gut oder böse, dafür oder dagegen, in Treue fest oder Verräter.
Seit November 1940 wurden nord- und westdeutsche Städte in zunehmendem Maß von britischen Bombern angegriffen. Was mit Hamburg begonnen hatte, setzte sich mit bekannten Industriestädten wie Leuna, Magdeburg und Gelsenkirchen fort. Zunächst wollte man die Ölversorgung und den Schiffsbau treffen, dann waren Stahlwerke und Rüstungsbetriebe an der Reihe, dazu sollten die Transportwege lahm gelegt werden. Berlin, als die Hauptstadt des Reiches, war ohnehin bevorzugtes Ziel.
Fast zwei Jahre lang erfuhren die Münchner nur aus der Zeitung etwas über diese »Terrorangriffe«, und irgendwie machte sich die Meinung breit, dass München kein lohnendes Ziel für den Feind sei. Industrie gab es hier so gut wie keine – in und um München wurden weder Waffen noch andere Rüstungsgüter produziert; der Bahnhof war ein so genannter Sackbahnhof, von dem nichts Kriegswichtiges hinaus ins Reich ging.