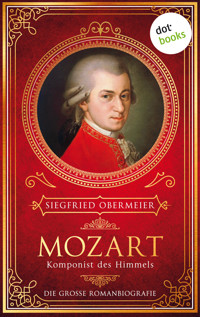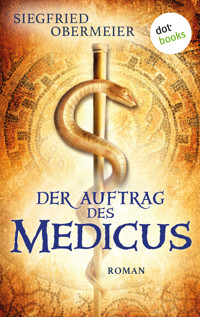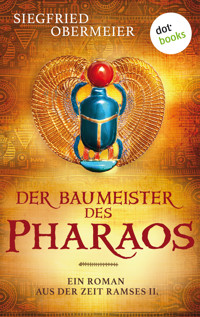6,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Er wurde des Verrats beschuldigt – zu Unrecht! Der große historische Roman »Judas – Der letzte Apostel« von Siegfried Obermeier als eBook bei dotbooks. Judäa in den Zeiten der römischen Besatzung. Diese Begegnung wird das Leben des jungen Judas Ischariot für immer verändern: Als einer der zwölf Männer, die sich Jesus von Nazareth, einem charismatischen Prediger, angeschlossen haben, zieht er durch die Lande und verkündet das Wort Gottes. Doch ein schreckliches Missverständnis führt dazu, dass Judas den Kreis seiner Gefährten verlassen muss – und Jesus für immer Lebewohl sagen. So beginnt er eine abenteuerliche Reise durch das Herz des Okzidents: Sein Weg führt ihn zu den Kultstätten Griechenlands und Siziliens, ins reiche Alexandria und zu den Pyramiden von Ägypten. Er wird Zeuge von rauschenden Festen und brutalen Exzessen, lernt große Gelehrte und wahnsinnige Despoten kennen. Ein Leben voller Wunder und Wagnisse – aber auch eines das immer im Schatten des einen Mannes stehen wird, den er angeblich verraten haben soll … Wer war der Mann, der Jesus Christus für dreißig Silberlinge verriet, wirklich? Siegfried Obermeier schildert mit viel Feingefühl die bemerkenswerte und augenöffnende Geschichte des Judas Ischariot – inspiriert von dem lange verschollenen, legendären »Judas-Manuskript«! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die bewegende Romanbiografie »Judas – Der letzte Apostel« von Siegfried Obermeier – mitreißend und bildgewaltig wie die Bestseller von Noah Gordon! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Ähnliche
Über dieses Buch:
Judäa in den Zeiten der römischen Besatzung. Diese Begegnung wird das Leben des jungen Judas Ischariot für immer verändern: Als einer der zwölf Männer, die sich Jesus von Nazareth, einem charismatischen Prediger, angeschlossen haben, zieht er durch die Lande und verkündet das Wort Gottes. Doch ein schreckliches Missverständnis führt dazu, dass Judas den Kreis seiner Gefährten verlassen muss – und Jesus für immer Lebewohl sagen. So beginnt er eine abenteuerliche Reise durch das Herz des Okzidents: Sein Weg führt ihn zu den Kultstätten Griechenlands und Siziliens, ins reiche Alexandria und zu den Pyramiden von Ägypten. Er wird Zeuge von rauschenden Festen und brutalen Exzessen, lernt große Gelehrte und wahnsinnige Despoten kennen. Ein Leben voller Wunder und Wagnisse – aber auch eines das immer im Schatten des einen Mannes stehen wird, den er angeblich verraten haben soll …
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba«, »Das Spiel der Kurtisanen«, »Der Auftrag des Medicus«, »Sizilien« und »Die Hexenwaage« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Dieses Buch erschien bereits 1978 unter dem Titel »Kreuz und Adler. Das zweite Leben des JUDAS Ischariot« bei Bertelsmann
Copyright © der Originalausgabe 1978 by C. Bertelsmann Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Eduardo Estellez, SergeyBitos
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-608-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Judas – Der letzte Apostel«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Judas – Der letzte Apostel
Die große Romanbiografie
dotbooks.
Erstes BuchJudäa
Kapitel 1
Dies schreibe ich, Fulvius Judas, Sohn des Simon aus Chariot in Judäa. Ich tue dies allein für mich und um mein Alter kurzweiliger zu gestalten, vielleicht auch, um meinen Söhnen mehr zu hinterlassen als ein Haus in Tibur. So will ich auch keinen Wunsch und keine Widmung voranstellen, wie Catullus es bei seinen Gedichten tat. Was er sich im ersten Vers von der Muse erbat: »O gib, Schutzherrin Muse, daß es länger als ein Jahrhundert dauere«, das wünsche ich mir nur für meine ›Geschichte der römischen Provinzen‹.
Dieses unselige Jahr steht unter einem schlechten Stern; das Volk nennt es Dreikaiserjahr, und wir wollen hoffen, daß es bei dreien bleibt. Der grausame und gefräßige Vitellius hat Galba und Otho abgelöst, aber alle wünschen, Otho wäre geblieben und hätte nicht aus Angst beim Anrücken der Aufständischen Selbstmord begangen. Nero Claudius Caesar Augustus endete vor einem Jahr auf dieselbe Weise, und es gehört zu den Wundern dieses festgefügten Reiches, daß dieser blutrünstige Tyrann und maßlose Verschwender auch nach fast vierzehnjähriger Herrschaft dem Staat keinen wesentlichen Schaden zufügen konnte. Ich selbst habe bisher acht Kaiser erlebt und werde noch zu berichten haben, daß ich zweien von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Trotz allem bin ich stolz auf dieses Rom, das vielen Völkern Wohlstand und Frieden gebracht hat, wenn auch mit harter Hand und unter vielen Opfern. Wer mich deshalb einen Verräter an meinem Volk schimpft, der möge meine Geschichte der römischen Provinzen lesen und dann sein Urteil sprechen.
Einen Verräter an Jesus, den seine Gemeinde für den Messias hält, nennen sie mich noch heute, doch glaube ich nicht, daß dies alles dauern wird. Sie werden einen neuen Messias finden, so wie es vor Jesus schon viele gegeben hat, deren Namen oft schneller vergangen sind als alljährlich der Schnee auf den Sabinerbergen.
Eli, mein Diener seit vielen Jahren, ist ein gläubiger Christ und versäumt keine der seit Nero verbotenen Versammlungen. Von ihm erfahre ich schnell, was dort gedacht und gesprochen wird. Eine ihrer Schriften habe ich mir beschafft; sie wird unter der Bezeichnung ›Das Leben Jesu Christi‹ in den Versammlungen eifrig gelesen, enthält aber nur eine bunte Mischung von Halbwahrheiten und Legenden, die bewirken soll, daß der Mensch Jesus seiner Gemeinde als der göttliche Messias erscheint. Meine Rolle als Verräter bleibt darin nicht unerwähnt. So soll der Satan in mich gefahren sein und mich zu Verrat und Selbstmord getrieben haben.
Soviel ich weiß, ist keiner von denen, die mit mir an Jesu Seite waren, in Rom. Von Petrus, Andreas, Paulus und Jakobus weiß ich sicher, daß sie tot sind. Von den anderen fehlt mir bis jetzt jede Nachricht. Eli versichert mir zwar, daß sie in aller Welt die Lehre Christi predigen, doch auch er weiß nichts Genaues. Vielleicht bin ich als einziger von ihnen noch am Leben. Wie dem auch sei, man wird sie und den sie für den Messias hielten bald vergessen haben, wie auch die ägyptischen, römischen, germanischen und die vielen Götter anderer Völker einst vergessen sein werden. Es ist nur ein Gott, und die da glauben, Jupiter, Baal oder Jehova seien dreierlei und nur einer könne der rechte sein, leben im Irrtum. Freilich ist nur einer, aber er hat viele Namen, und ich muß lachen, wenn ich höre, dieser sei Gott und jene seien Götzen. Alle Namen gelten doch nur diesem einen. Er aber wollte das nicht glauben, ihm galt nur der Judengott, und er nannte sich seinen Sohn. Jesus Christus, Sohn Gottes, der sich aus vielen Jüngern zwölf erwählte, davon einer ich war. Sein Tod war bitter, und als alle ihn verließen, als sogar Simon Petrus, sein Liebling, ihn verleugnete, war ich es, der zu Kaiphas, dem alten gichtigen Wüstling, lief und ihn zornig anbrüllte, warum er Jesus, den harmlosen Prediger, ans Kreuz liefern wolle und nicht Barabbas, den berüchtigten Straßenräuber. Da krächzte der Alte wütend zurück, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern und, anstatt ihm Vorwürfe zu machen, lieber meine Schulden bei seinem Sohn begleichen. Er wußte natürlich, daß ich dem Nichtsnutz Joram dreißig Denar schuldete; doch trug ich das Geld schon einige Zeit bei mir, war aber im Trubel der letzten Tage nicht dazu gekommen, es zurückzugeben. So warf ich ihm den Beutel vor die Füße, daß die Silberlinge herausfielen und ihm um seine dürren Beine sprangen. Da verdrehte er die Augen wie ein geköpfter Hahn, schrie etwas von Sündengeld, das er nicht haben wolle, und ich sei überhaupt der böse Geist seines armen Joram. Als ob dieser Nichtsnutz und notorische Mädchenschänder einen bösen Geist nötig gehabt hätte!
So habe ich nun das Pferd am Schwanz aufgezäumt, was mir als bekanntem Geschichtsschreiber keine besondere Ehre macht. Jetzt aber soll Ordnung in diesen Bericht kommen; denn ein schlechtes Vorbild will ich euch, meinen Söhnen, nicht geben.
Am Anfang eines jeden Menschenlebens stehen Geburt und die süßen Jahre am Busen und auf dem Schoß der Mutter, wohl behütet, frei von Sorgen und Angst. Gerade diese Jahre aber sind unserem Gedächtnis entschwunden, und meist betrifft die erste Erinnerung Schmerz oder Angst. Mein Vater, Simon, Sohn des Asor aus dem Stamme Juda, besaß in Chariot den schönsten Ölgarten und einen der besten Weinberge. Er war ein kluger Mann, der Familie und Gesinde mit leichter Hand regierte.
Esther, meine Mutter, beugte sich ihm in allen Dingen, die jenseits der Türschwelle geschahen, doch innerhalb des Hauses regierte sie allein, und er respektierte das. Sie führten eine gute Ehe und waren beide auf ihre Art glücklich. Heute glaube ich, daß auch ich es war. Glücklich ‒ das bedeutet für ein Kind, aufzuwachsen in einer sicheren und behüteten Welt, ein anerkannter Teil zu sein von ihr. Wenn ich meinen Vater klug nannte, so muß ich ihn auch gerecht nennen. Er maß jedem das Seine zu, nicht mehr und nicht weniger, er haßte alles Schwankende und Launenhafte, und wer ihn nicht liebte, zollte ihm doch zumindest ehrlichen Respekt.
Meiner Mutter aber wurde beides zuteil, Liebe und Respekt. Mein Vater gehörte auch keineswegs zu diesen strenggläubigen jüdischen Patriarchen, die nichts, aber auch nichts neben der mosaischen Lehre und Überlieferung gelten ließen. Freilich, er fehlte am Sabbat niemals in der Synagoge, hielt auch die Feiertage und alle sonstigen Gebräuche ein. Ein anderer Teil seines Wesens aber verehrte die griechisch-römische Kultur, deren geschmeidige Eleganz er schätzte. Er hatte schon in jungen Jahren das römische Bürgerrecht erworben und besaß den lateinischen Zunamen Fulvius, der dann auf mich überging. Das Griechische war ihm geläufig, Latein aber sprach und schrieb er vollendet. Diese Vorliebe habe ich ungeschmälert übernommen, wenn mir auch das heimatliche Aramäisch noch immer gut vertraut ist. Mit meinem Diener Eli spreche ich diese Sprache fast täglich. So wuchs ich als einziger Sohn meiner Eltern mit einer jüngeren Schwester heran, ging in die Synagogenschule und hatte daneben Privatlehrer, die mich in Latein, Griechisch, Literatur und Geschichte unterrichteten. Als ich geboren wurde, regierte in Rom Kaiser Augustus, und als ich mit dreizehn Jahren mein Bar Mizwah feierte, trug Tiberius den Purpur. Er regierte, als ich von Jesus zum Jünger erwählt wurde, und als Jesus starb, hockte der greisenhafte Kaiser auf Capri, mißtrauisch, grausam, beschützt von einer riesigen Leibwächtergarde, die der sonst so Geizige fürstlich entlohnte, um seines jämmerlichen Lebens sicher zu sein. Rom, das mächtige, allgegenwärtige Rom, machte meinem Vater seine Verehrung für die griechisch-lateinische Kultur nicht leicht.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern übte Tiberius keine religiöse Toleranz, sondern verfolgte alle fremden Kulte, besonders jüdische und ägyptische. Die wenigen Synagogen Roms wurden auf seinen Befehl geschlossen, die Kultgeräte mußten verbrannt werden, die Priester zwang man zur Opferung vor den Standbildern der römischen Götter. Was den ägyptischen Priestern des Amon oder der Isis leichtfiel, weil für sie alle fremden Götter nur Inkarnationen der eigenen waren, bedeutete für unsere Rabbiner ein schweres Sakrileg. Wie immer, wenn es um die Durchsetzung sinnloser Verfügungen ging, scheuten die kaiserlichen Beamten kein Mittel, um die Betroffenen zu demütigen. Wo man Widerstand spürte, wurden die strengsten Strafen ausgesprochen, und wieder einmal waren es die Juden, die am meisten zu leiden hatten, weil ihr religiöser Starrsinn ihnen keine Kompromisse gestattete. Tiberius scheute zwar davor zurück, sie alle umbringen zu lassen, doch schien er gesonnen, ihre Ausrottung auf Umwegen zu betreiben. Die reichen Familien traf Einzug ihres Vermögens und Verbannung in irgendwelche fernen Provinzen; die jungen Männer steckte er ins Militär und ließ sie in berüchtigten Gegenden am Rande der zivilisierten Welt Dienst tun. Wer sich diesem Zwang nicht fügte, dem drohte der Sklavenstand auf Lebenszeit.
Die Statthalter Annius Rufus und Valerius Gratus waren ehrliche, pflichteifrige Beamte, die ihre Zeit in Palästina abdienten und den Tag ihrer Heimkehr ins goldene Rom herbeisehnten. Einige Jahre nach meiner Volljährigkeit wurde Pontius Pilatus nach Jerusalem berufen. Er war ein echter Prüfstein für meinen alles Römische verehrenden Vater. Vom ersten Tag an unbeliebt wegen seiner zynisch-stolzen, unnahbar-hochmütigen Art, tat Pilatus alles, um das Land gegen sich aufzubringen. Schon am Tag nach seiner Ankunft in Caesarea gab es dort schwere Unruhen, weil er in Jerusalem Standarten mit dem Bild des Kaisers hatte aufstellen lassen, was den gläubigen Juden natürlich ein schwerer Greuel war. Die Bevölkerung sah ihre verbrieften und geheiligten Rechte dadurch verhöhnt und rottete sich auf den Plätzen Caesareas zusammen. Hierher, in die Residenzstadt der römischen Prokuratoren, wurden nun aus ganz Palästina Abordnungen gesandt, um den Statthalter zu einer Rücknahme seiner frevelhaften Befehle zu bewegen, denn in Jerusalem, der Heiligen Stadt, durfte kein Bildwerk gezeigt werden. Pilatus empfing niemanden, sondern ließ die Bittsteller durch seine Sekretäre abfertigen. Er denke nicht daran, nur ein Jota seiner Entscheidungen zurückzunehmen, und sie sollten niemals vergessen, daß Rom ‒ Rom allein ‒ hier zu befehlen habe. Rom aber sei von nun an er, Pontius Pilatus. Die Abgesandten zogen sich mit diesem Bescheid zurück, worauf alle in die Stadt eingedrungenen Juden sich vor dem Haus des Statthalters auf den Boden legten und fünf Tage unbeweglich liegenblieben. Ich muß hier einfügen, daß ich solch ein starres, würdeloses Verhalten ablehne. Kein Menschenleben verläuft ohne Kompromisse, und Starrsinn gegen Starrsinn hat noch nie ein Ergebnis gebracht.
Zuerst versuchte Pilatus, die Leute einzuschüchtern, indem er seine Soldaten auf die Straßen schickte und sie martialisch mit ihren Schwertern rasseln ließ. Mehr wagte auch er nicht zu unternehmen, weil es einfach zu viele waren, die passiven Widerstand leisteten. So ließ er sich etwas anderes einfallen und tat dem Volke durch Ausrufer kund, daß er am Morgen des nächsten Tages in der Arena sprechen werde.
Man muß wissen, daß die zu Ehren des Augustus gegründete Stadt Caesarea überwiegend von Nichtjuden bewohnt war und so dem Statthalter ein völlig falsches Bild von der Provinz Judäa vermittelte. Pilatus wurde schnell eines Besseren belehrt. Als sich die Judenschar in der Arena versammelt hatte und geduldig schweigend wartete, erschien der Statthalter nach über einer Stunde auf der Rednertribüne, wo er sich auf einem Sessel niederließ und lange Zeit über die Menge hinwegstarrte. Daß dies nicht Hochmut, sondern Taktik war, erwies sich bald, denn er hatte alle verfügbaren Truppen zusammengezogen und wartete ab, bis seine Soldaten das Theater in dreifacher Reihe umstellt hatten. Kaum war dies geschehen, sprang er auf und begann mit hoher, schneidender Stimme zu reden. Er sprach nicht lange, aber was er sagte, war eindeutig. Der Kaiser habe ihn hierher gesandt, um Rom in diesem Lande zu vertreten. Seine Befehle seien die des Kaisers, und wer sie mißachte, riskiere sein Leben. Wer gegen die in Jerusalem aufgestellten Standarten sei, möge die Hand heben und sei hiermit standrechtlich zum Tode durch Enthaupten verurteilt.
Danach trat eine Reihe Soldaten mit gezogenen Schwertern vor, und gleichzeitig erhoben sämtliche Juden ihre Arme.
»Lieber den Tod als die Gesetze der Väter mißachten«, rief es im Chor.
Mit einer solchen todesmutigen Einstimmigkeit hatte Pilatus nicht gerechnet. Daß Judäa die schwierigste Provinz des Reiches sei, war ihm in Rom wohl gesagt worden, aber er hatte die Juden unterschätzt.
Man sah, wie er die Fäuste ballte, wie er seinen schmalen Mund zu einem Befehl öffnete, sich aber dann wortlos auf den Sessel zurückfallen ließ. Mit einer müde wirkenden Geste ließ er die Soldaten zurücktreten, dann stand er langsam auf, schaute grimmig auf die schweigende Menge und zog sich zurück. Kurz darauf verkündeten Aufrufe und Anschläge, daß die Bildnisse aus Jerusalem abgezogen seien und jeder unverzüglich in seinen Heimatort zurückkehren solle. Pilatus hatte verloren und Judäa einen erbitterten Feind gewonnen. Dies zeigte sich bald an seinen Maßnahmen, nachdem er in Jerusalem eingetroffen war. Pilatus sah sich gerne als fortschrittlichen Mann und wollte sein Wirken in Judäa durch ebensolche Taten verewigt wissen.
Die Wasserversorgung in Jerusalem war besonders in den heißen Monaten unzureichend. Pilatus erkannte diesen Mangel und suchte ihm abzuhelfen, indem er einen Aquädukt über eine Entfernung von vierhundert Stadien zu bauen befahl. Da, wie er meinte, weder er noch der Kaiser, noch das römische Reich für etwas bezahlen sollten, das allein den Juden zugute käme, forderte er die Stadtväter auf, das Geld für den Bau der Wasserleitung beizubringen. Nun aber mußte der Statthalter erfahren, wie schwierig es ist, von den Juden Geld zu erlangen, wenn sie glauben, eine Sache sei unnötig. Da sie dies von der Wasserleitung törichterweise glaubten und Pilatus nichts geben wollten, beschlagnahmte dieser den Tempelschatz und beglich damit die Kosten für den Aquädukt. Damit hatte er wieder einmal gefrevelt, und die Stadt summte vor Empörung wie ein Volk wilder Bienen. Pilatus ließ die stärksten Schreier niederknüppeln, wobei nicht wenige zu Tode kamen, einige von ihnen ließ er verhaften und auspeitschen, die Vornehmeren verurteilte er zu empfindlichen Geldstrafen. So erzwang er sich in wenigen Stunden wieder die Ruhe. Aber es war eine gefährliche Ruhe.
Kapitel 2
Unbeschwert und glücklich verliefen die Jahre meiner frühen Jugend. Bis zu meinem siebenten Lebensjahr blieb ich das einzige Kind meiner Eltern, ängstlich gehütet von Esther, meiner Mutter, und liebevoll geführt von meinem Vater, der immer für mich Zeit hatte und jede meiner kindlichen Fragen ernst nahm. Dann wurde meine Schwester Rachel geboren, und fast schien es, als müßte das neue Leben mit einem schweren Opfer erkauft werden, denn meine Mutter trug viele Tage lang die Blässe des Todes auf ihrem Gesicht. Ich werde den Tag nicht vergessen, als mein Vater mich zu sich rief, um mir seine bevorstehende Reise nach Jerusalem anzukündigen; denn er wollte Herophilos, den berühmten griechischen Arzt, an das Krankenlager meiner Mutter holen.
»Du bist noch ein Kind, Judas, und doch wirst du für die nächsten Tage der Herr sein in unserem Hause. Dir vertraue ich an, was unser Eigen ist, hüte und bewahre es bis zu meiner Rückkehr.«
Noch heute empfinde ich den Schrecken, aber auch den Stolz bei den ernsten Worten meines Vaters.
Mit nur einem Diener und den drei schnellsten Pferden war er am Morgen losgeritten. Bereits am Abend kehrte er mit dem Arzt Herophilos, doch ohne Diener zurück, denn eines der Pferde war schwer gestürzt.
Mit Angst im Herzen und Tränen in den Augen, mit der Scheu des Kindes vor Krankheit und Tod hatte ich das Leidenslager meiner Mutter erlebt. Als der berühmte Arzt, ein noch junger Mann, an ihr Bett trat, kehrten wieder Hoffnung und Zuversicht in unsere Herzen ein.
Herophilos stammte aus Athen und nannte sich selber stets einen »bescheidenen Schüler und Diener des Asklepios«, doch wer seine Erfolge kennt, wird ihm eher den Ehrennamen eines zweiten Hippokrates zubilligen.
In jüdischen Familien war es niemals der Brauch, den Arzt mit einer Frau oder einem Mädchen allein zu lassen, doch Herophilos verlangte dies, und mein Vater fügte sich sofort seinen Wünschen. Euch, meinen Söhnen, sind diese Erinnerungen gewidmet, und da es sich vielleicht fügen mag, daß sich einer von euch dem Arztberuf zuwendet, sollt ihr wissen, wie Herophilos meine Mutter heilte. So will ich berichten, was sie selbst mir später erzählte. Trotz ihres Fiebers und der Todesmattigkeit hatte sie nichts von dem vergessen, was ihr damals geschah.
Nachdem der junge Arzt sich etwas erfrischt und ein neues Gewand angelegt hatte, trat er in das Gemach meiner Mutter, begrüßte sie mit einem freundlichen Lächeln, wobei ‒ sie hat es oft erwähnt ‒ »seine Augen wie Sterne strahlten«.
Dann trat er an das Fenster, schob die Vorhänge zurück und sagte:
»Die erquickende Luft des Abends und das milde Licht der späten Sonne werden dich gesund machen, Esther.«
Worauf meine Mutter mit schwacher Stimme, doch in fester Frömmigkeit antwortete: »Nur Gott kann Gesundheit schenken.«
Der Arzt nickte. »Sind nicht auch die Sonne und der kühle Hauch des Abends Gottes Werk?«
Darauf geschahen viele seltsame Dinge. Auf Anordnung des griechischen Arztes mußten unsere Diener die Rinde von Bergeichen herbeischaffen, während er anderen befahl, von schadhaften Eisengeräten den Rost abzuschaben und zu sammeln.
Den in Wasser gelösten und mehrmals geklärten Eisenrost mischte Herophilos mit schwerem roten Wein und gab meiner Mutter jede Stunde einige Schlucke davon zu trinken. Damit, so meinte er, ließe sich ein Teil des verlorenen Blutes ersetzen. Aus der Eichenrinde wurde unterdessen ein Absud bereitet, dem der Arzt noch Laserpicium beifügte, eine aus den Wurzeln der Wolfsmilchpflanze gewonnene Essenz, die man in Rom noch jetzt gegen vielerlei Krankheiten, aber auch als Gewürz verwendet.
Mit dem so bereiteten Balsam behandelte nun eine vertraute Dienerin den wunden Leib meiner Mutter.
Gegen das verzehrende Fieber hatte der Arzt eine fertige Medizin mitgebracht, die schon bald den Schweiß vom bleichen Antlitz Esthers nahm. Meinem Vater wurde das Herz so leicht, daß er Geschenke an das Hausgesinde verteilte und dem still lächelnden Arzt jede gewünschte Belohnung versprach. Simon muß sein Weib sehr geliebt haben; ich selbst kann nur berichten, daß meine Eltern bis zu meines Vaters Tod in bester Eintracht lebten.
Herophilos verließ nach vier Tagen unser Haus, reich entlohnt und von vielen Segenswünschen begleitet. Seine Kunst und gewiß auch Gottes Wille hatten Esther dem Tode entrissen, meinem Vater die Gattin, mir und meiner kleinen Schwester die Mutter erhalten. Herophilos war später Leibarzt des Königs Herodes, fiel dann in Ungnade und ging nach Ägypten, wo ich ihm durch Zufall wiederbegegnen sollte.
Bald nach der völligen Genesung meiner Mutter wurde das Purimfest gefeiert, das nach römischer Zeitrechnung diesmal auf die ersten Tage des Monats März fiel. Ich kann mich nicht erinnern, meinen Vater später wieder so ausgelassen und fröhlich gesehen zu haben. Jeder Jude weiß, daß dieses Fest an die Rettung unseres Volkes durch Mordechai und Esther ‒ deren Namen meine Mutter trug ‒ erinnern soll und immer als ein Freudenfest begangen wird. Die schon zuvor beschenkten Diener unseres Hauses wurden noch einmal mit reichen Gaben bedacht, während das ganze Dorf von meinem Vater zu einem Festmahl geladen wurde. Beim herkömmlichen Verlesen der Esther-Legende im Tempel soll mein Vater in Tränen ausgebrochen sein.
Ich möchte aber noch von einem anderen Purimfest berichten, das meine Erinnerung deutlicher bewahrt hat, denn ich zählte damals schon fünfzehn Jahre.
Bei Jünglingen dieses Alters pflegt ein unreifer, suchender und oft noch hilfloser Geist im Widerstreit mit einem schon reifen Körper zu stehen. Ich wußte längst, daß Gott Mann und Weib geschaffen hat, um ein Fleisch zu werden und dadurch neues Leben zu zeugen. Mein junger Körper brannte in den warmen Sommernächten wie eine Fackel und glühte im kühlen Hauch des Winters beharrlich weiter, wie die Glut im kalten Mantel der Asche.
In Chariot und andernorts wurde es so gehalten, daß man am Morgen in der Synagoge die Geschichte der Esther vorlas, während man mittags die engsten Freunde zu Tisch lud und die Dienerschaft des Hauses beschenkte. Am Abend fand das ganze Dorf sich zu einem gemeinsamen Freudenmahl im Freien zusammen. Sitte und Brauch wollten es, daß die Wohlhabendsten für Speise und Trank sorgten, während die anderen den Festplatz zu richten hatten.
Seit vielen Jahren war es mein Vater, der für Speise sorgte, während der Weinbauer den Trank lieferte. Wie immer auch der Besitzer des zweitgrößten Anwesens von Chariot heißen mochte ‒ das Dorf nannte ihn den Weinbauern, weil dies sein ausschließlicher und einträglicher Erwerb war. Jakob Ben Azor hieß der Besitzer zur Zeit meines Vaters. Seine Frau war die schöne Debora, die aber schon in jungen Jahren zur Witwe wurde, weil Jakob nach einem Sturz vom Pferd starb. Debora führte das Anwesen für ihre beiden unmündigen Kinder weiter, und sie tat es mit fester Hand. Ich darf sagen, daß ganz Chariot diese Debora auf ehrsame Art liebte; denn sie war ihrem Gesinde eine gute und gerechte Herrin, wie sie für die Armen eine offene Hand und für ihre Nachbarn ein offenes Ohr hatte.
»Sie ist eine Jüdin von der rechten Art«, pflegte mein Vater zu sagen, und er unternahm keine Fahrt nach Jerusalem, ohne bei Debora anzufragen, ob sie ihm eine Besorgung aufzutragen hätte.
Debora steuerte nun auch zu diesem Purimfest den Wein bei, und mein Vater sandte mich mit einem Knecht zu ihrem Haus, um Hilfe anzubieten.
»Sieh da«, sagte sie lächelnd und nicht ohne leisen Spott, »Simons Sohn beehrt Deboras Haus. Fast bist du ja schon ein Mann, kleiner Judas, wenn auch die Zeit noch nicht fern ist, da ich dich auf meinen Knien schaukelte und dich mit Honig fütterte. Nun bin ich eine alte Frau und werde bald erleben müssen, daß mein kleiner Judas sich eine Braut erwählt.«
Ich schlug die Augen nieder und spürte, wie das Blut in meine Wangen schoß. Sie war keineswegs eine alte Frau, sondern gerade zur vollen Reife erblüht und schön wie eine hochsommerliche Frucht. Da ich vor Verlegenheit keine Worte fand, fuhr ich barsch meinen grinsenden Knecht an und schickte ihn hinaus an die Arbeit. Debora aber umfaßte mich mit einem leuchtenden Blick ihrer großen schimmernden Augen und lud mich mit einer Handbewegung ins Haus.
»Honig kann ich dir nun keinen mehr ins Mäulchen streichen, aber ein Glas meines besten Weines darf ich dem Sohn meines geschätzten Simon wohl anbieten.«
Ich fühlte mich so klein vor dieser prächtigen Frau und war mit meinen fünfzehn Jahren vor dem Gesetz doch schon ein Mann. So folgte ich ihr ins Haus, wo sie mir in einem kühlen schattigen Raum einen Becher Wein kredenzte. Sie nahm neben mir auf einem der weichen Lederkissen Platz, während ich mich ein wenig umsah und die karge, aber sehr kostbare Einrichtung bewunderte. Auf schönen farbleuchtenden Teppichen standen mehrere niedrige Tische aus duftendem Sandelholz, kostbar geschnitzt und mit bunten Steinen eingelegt. In den Trinkbechern aus schwerem ziselierten Silber schimmerte matt der dunkle süße Wein.
Ich weiß nicht mehr, welches Gespräch wir führten, ich erinnere mich nur noch an den betörenden Duft, der von Debora ausging, der meine Sinne verwirrte und mich nicht weniger betörte als der lächelnde spöttisch-freundliche Blick ihrer dunklen Augen.
Ich sagte etwas von meinem Knecht, der auf meine Befehle wartete, und wollte aufstehen, doch Debora faßte mich sacht am Arm und zog mich an ihre Seite. Dann fühlte ich eine kühle zarte Hand an meiner nackten Brust, und es war, als fielen die Kleider wie durch Zauberei von mir ab. So öffnete die schöne Debora mir ihre Arme und ihren Schoß, umfing meinen jungen, unerfahrenen, heiß entflammten Körper mit ihrer reifen warmen Weiblichkeit. In ihren Armen wurde ich zum Mann, und ich habe sie deshalb nie geringgeachtet, wie dies bei Jünglingen nicht selten geschehen mag, wenn eine ältere Frau sie verführt. Es war dies mein schönstes Purimfest, und ich weiß noch gut, daß ich bei der abendlichen Tafel die Augen nicht von ihr lassen konnte, was meine Mutter wohl bemerkte, weil sie mich am nächsten Morgen damit neckte. Debora aber zeigte frohe unbefangene Festesfreude, und niemand sah ihr an, daß sie noch kurze Zeit vorher in meinen Armen gelegen hatte. Ich war vor ihr wie ein kleiner Junge und spürte wohl zum ersten Mal, wie unsagbar überlegen die Frauen uns Männern in Liebesdingen sein können. Sie besitzen eine Kraft, die uns nicht gegeben ist. Merkt es euch gut, meine Söhne.
Ich war danach noch oft in Deboras Haus und trank noch oft ihren süßen Wein, aber ihren Leib durfte ich nicht mehr genießen. Meine schüchterne Werbung wies sie sanft und freundlich zurück.
»Die Schönheit dieser Stunde«, meinte sie, »wollen wir nicht zerstören. Ich bin nicht dein Weib, und deine Geliebte zu sein schickt sich nicht für mich. Du wirst noch viele Frauen genießen und jedesmal mit ihrem Leib den meinen umfangen; denn in meinen Armen bist du zum Mann geworden, und das wirst du nicht vergessen können.«
Sie hat recht behalten, und weil sie sich mir verweigerte, habe ich sie um so höher geachtet. Vielleicht bin ich deshalb, trotz allem, nie zu einem kalten, eigensüchtigen Liebhaber geworden, der die Frauen nur benützt, ohne sie zu achten. In jeder meiner Geliebten habe ich den Geist Deboras gespürt, und niemals bin ich in Zorn oder Feindschaft von einer Frau gegangen.
Kapitel 3
Mein Vater meinte, er könne mich nicht früh genug mit seinen Geschäften vertraut machen, erinnerte mich an einige Verwandte, die der Herr im besten Mannesalter abberufen hatte, und begann, mich in die Quellen unseres Erwerbs einzuweihen. Da gab es eine stattliche Anzahl von Häusern in Jerusalem, die ihm gehörten und deren Verwaltung oft Schwierigkeiten verursachte, die sein persönliches Eingreifen und damit seine Anwesenheit in Jerusalem erforderten. Manchmal hatte er schon erwogen, sich für immer in der Hauptstadt niederzulassen, doch hing sein Herz mehr an den Äckern und Weinbergen als am städtischen Besitz, so daß er unser großes und blühendes Landgut nicht einem Verwalter anvertrauen mochte. Die Häuser in Jerusalem waren überwiegend an Handwerker und Geschäftsleute vermietet, deren Zahlungen nicht immer pünktlich, manchmal auch gar nicht eintrafen. Klagen über zu behebende Schäden, streitsüchtige Nachbarn, schlechten Geschäftsgang und anderes mehr pflegten sich im Laufe der Zeit anzuhäufen, bis mein Vater sich einmal wieder nach Jerusalem aufmachte, um die Dinge ins Lot zu bringen.
Seit Pontius Pilatus als römischer Statthalter regierte, scheute mein Vater vor der Begegnung mit seinen römischen Freunden zurück, denn er schämte sich für sie. Zu mir sagte er: »Solange dieser Pilatus sich im Lande aufhält, will ich Chariot nicht mehr verlassen, denn ich könnte nicht für mich einstehen, würde ich ihm ‒ sei es durch Zufall, sei es bei Freunden ‒ begegnen.« Durch meine spätere lange Abwesenheit mußte mein Vater diesem Vorsatz zwar untreu werden, doch er hatte das Glück, Pilatus niemals zu treffen.
Mein Vater fand es nun an der Zeit, daß ich mich allein in Jerusalem bewähren sollte. Stolz auf das in mich gesetzte Vertrauen, wohl versehen mit Geld und guten Ratschlägen zog ich in Begleitung eines Dieners los.
Natürlich war mir Jerusalem nicht fremd, da ich meinen Vater schon mehrmals dorthin begleitet hatte, doch ist es ein großer Unterschied, in väterlicher Hut gleichsam geführt zu werden, oder allein, für den Vater und mit seinen Rechten ausgestattet, sich in einer großen Stadt zu behaupten. Wer solches erlebt hat, weiß, wie einem Jüngling dabei zumute ist, kennt die Vielfalt der aus Stolz, Abenteuerlust, aber auch Furcht gemischten Gefühle, die seine Reise begleiten und ihn berauschen wie feuriger Wein.
Nach der Ankunft in Jerusalem suchte ich sogleich unser kleines Haus auf, das in der Oberstadt beim Berg Zion lag. Ein altes Verwalterehepaar ‒ sie erinnerten mich an Philemon und Baucis ‒ hielt es instand. Würdevoll wurde der junge Herr begrüßt, dem Diener sein Quartier zugewiesen, die Maultiere versorgt, das Bad bereitet.
Voll Ungeduld brach ich gleich am nächsten Morgen auf, um die mir aufgetragenen Geschäfte abzuwickeln. Ich merkte aber bald, daß dies alles viel Zeit brauchte, und folgte dem Rat meines Vaters, jeden unserer Mieter geduldig anzuhören, keine Klage, auch nicht die belangloseste, leichtzunehmen, die Vorwände säumiger Schuldner gründlich zu prüfen, hart zu sein, wo es angebracht war, und nachsichtig, wo dies ratsam schien. Keine leichte Aufgabe für einen tatendurstigen Jüngling, der den süßen Duft der Freiheit spürt, aber dem steinigen, dornenreichen Weg der Pflichten zu folgen hat.
Ich lernte dieses Jerusalem lieben auf meinen Wegen kreuz und quer durch die Stadt; heiß fühlte ich den Stolz auf mein Volk in mir brennen, begann den Glanz seiner Geschichte zu ahnen, hörte die Sprüche Salomos und Davids klingen, als ich vordem großen Tempel stand. Der von Herodes erneuerte Bau war damals noch unvollendet, obwohl die erweiterte Vorhalle und die Vorhöfe für Priester, Männer und Frauen schon fertiggestellt waren. Mit meinem Maultier durchquerte ich langsam die untere und obere Stadt, besuchte die Neustadt und rastete am Bethseda-Teich, bis mich die Neugier und meine Pflichten weitertrieben.
Zwar befand sich der Sitz des römischen Statthalters an der Küste in Caesarea, doch römisches Militär lag auch in Jerusalem, und Pilatus, der kurz zuvor sein Amt angetreten hatte, hielt sich während meines Besuchs hier auf.
Meine Geschäfte waren bis auf weniges abgewickelt, als ich eines Nachmittags müßig durch die Oberstadt schlenderte. Um das Gefühl der Freiheit voll auszukosten, hatte ich meinen Diener beurlaubt. Im späten Sonnenlicht warfen die Häuser lange Schatten, und die allmählich nachlassende Hitze lockte das bunte Volk der Händler und Müßiggänger, der Handwerker und hastig dahineilenden Sklaven wieder auf die Straße.
In diese friedliche Stunde brach plötzlich wüster Lärm, der aus einer kleinen Schenke drang. Neugierig blieb ich stehen, sah, wie sich Menschen ansammelten, um schnell wieder auseinanderzuweichen, als ein betrunkener römischer Soldat durch die niedrige Türöffnung taumelte. Grölend und fluchend zerrte er ein schlankes schreiendes Mädchen hinter sich her, dessen Widerstand zu wachsen schien, je weiter der Soldat es von der Schenke wegzog. Inzwischen hatten sich einige Kameraden des Betrunkenen dazugesellt, die ebenfalls aus der Schenke kamen. Anstatt, wie ich hoffte und erwartete, die Würde Roms zu verteidigen und das Mädchen aus dem rohen Zugriff zu befreien, ermunterten die Soldaten den Betrunkenen noch, wobei der eine dem schreienden Mädchen roh an die Brüste griff, während der andere grunzend wie ein Schwein ihre Schenkel betastete.
Mir blieb vor Empörung der Atem stehen, und flammender Zorn erstickte jede Furcht. Ich lief über die Straße und schlüpfte in die Schenke, wo der jammernde Wirt den am Tisch eingeschlafenen Centurio aufzurütteln versuchte.
»Herr!« rief er flehend und in schauderhaftem Latein, »deine Leute tun meiner Tochter Gewalt an!«
Der Kopf des Centurio pendelte hin und her, die halbgeschlossenen, verquollenen Augen blickten verständnislos, aus seinen weinfeuchten Lippen kamen nur wirre Laute. Händeringend wandte sich der Wirt jetzt an mich:
»Junger Herr, laß nicht zu, daß sie meine Esther schänden, meine unschuldige Taube, die Freude ihrer Eltern. Sie ist versprochen und wird bald heiraten, ich flehe dich an, laß mich …«
Vielleicht war es der Name des Mädchens, den auch meine Mutter trug, der mich so schnell und furchtlos handeln ließ. Ich wandte mich von dem Alten ab und ergriff wie im Traum zwei der schweren Weinkrüge. Einer davon war noch halbvoll, den goß ich geschwind dem Centurio über den Kopf, ging dann hinaus und schlug den anderen blitzschnell auf das helmlose Haupt des Soldaten, der das Mädchen Esther wie einen Sack über die Straße schleifte. Der Betrunkene sank wie vom Blitz gefällt in den Straßenstaub. Die schlanke Esther sprang auf und verschwand so gedankenschnell im Gewirr der Häuser wie eine Eidechse im Gesträuch. Noch immer ganz ruhig, ging ich zur Schenke zurück, wo sich die beiden sprachlos erstarrten Kameraden des Betrunkenen mit einem einzigen Schrei auf mich warfen. Sie schlugen mich mit ihren harten Fäusten zu Boden, zerrten mich dann hoch, um wütend auf mich einzudreschen. Ich war nicht imstande, mich zu wehren, wollte es auch gar nicht und versuchte nur, mit beiden Händen mein Gesicht zu schützen. Ein lallender Befehlsruf ließ meine beiden Quälgeister erstarren und Haltung annehmen. Der Centurio war zu sich gekommen, stand schwankend und halb gebückt in der niedrigen Tür und glotzte uns mit trüben Augen an, während der rote Wein wie Blut von seinem Gesicht troff. Jetzt redeten alle gleichzeitig: der Wirt, die beiden Soldaten, die Straßenpassanten, doch der zusehends nüchterner werdende Centurio gebot mit donnernder Stimme Ruhe, winkte mich und die beiden Soldaten ins Innere der Schenke, schob den jammernden Wirt zur Seite und begann die »Vernehmung«. Andere Soldaten hatten inzwischen den Bewußtlosen hereingetragen. Plötzlich wimmelte es überall von römischen Kriegern, während sich alle anderen Gäste aus dem Staub gemacht hatten. Der Centurio stank wie ein Weinfaß. Er starrte mich verblüfft an.
»Dieser junge Lümmel hat einen römischen Soldaten ‒ einen römischen Soldaten! ‒ niedergeschlagen.«
Er schüttelte seinen kantigen Schädel. »Weißt du, was dir blüht? Du bist kein Sklave, das sehe ich, so ein gepflegtes Jüngelchen wird nicht ans Kreuz geschlagen, das nicht, aber, beim blitzeschleudernden Jupiter, das Fell werden wir dir gerben, daß du für dein Leben genug hast. Weißt du, was das heißt? Da gibt es nicht neununddreißig hinten drauf, wie bei euch Juden mit eurem Zahlenfimmel, da sind wir Römer viel großzügiger, da wird so lange zugeschlagen, bis dein Rücken sich von oben bis unten in Hackfleisch verwandelt hat. So lange!«
Er nickte zufrieden und bekräftigend, als heische er von mir Bewunderung für die römische Großzügigkeit. Ich hatte bisher zu allem geschwiegen.
»Wer bist du eigentlich, wer ist dein Vater?«
»Judas, Sohn des Fulvius Simon aus Chariot.«
Der Centurio nickte. »Nun, Judas, Sohn des Simon« ‒ er wies mit dem Kopf zu dem Bewußtlosen ‒, »wenn dieser da stirbt, dann bedeutet es für dich Geißelung und Kopf ab! Schade, daß man nur Sklaven kreuzigt.«
Ich schaute den Centurio fest an und sagte: »Dein Soldat war dabei, ein jüdisches Mädchen zu schänden. Hast du es ihm befohlen? Ist dies römische Art? Durfte er das tun? Ich habe ihn vor dieser Tat und damit vor Schlimmerem bewahrt. Du solltest mir dankbar sein.« Dann setzte ich mit lauter Stimme hinzu: »Fulvius Simon, mein Vater, ist römischer Bürger und war ein Freund des Statthalters Valerius Gratus.«
Der Centurio runzelte seine niedrige Stirn, und ich sah, wie ihn der Zorn packte. »Ein Freund des Statthalters! So ist das …«
»… und römischer Bürger«, warf ich ein.
»Und römischer Bürger«, äffte er mich nach. »Ich werde dich … ich muß jetzt …« So etwas war ihm noch nicht begegnet, das überstieg seinen vom Wein und vom Dienstreglement begrenzten Geist. »Abführen!« schrie er zornbebend, »abführen! Damit soll sich der Statthalter befassen! Der weiß besser, wie man diese jüdischen Aufwiegler bändigt.«
Er fluchte noch lange vor sich hin, und so sollte ich vor Pontius Pilatus gebracht werden.
Mit zerfetzten Kleidern, blutverschmiertem Gesicht und schmerzenden Gliedern humpelte ich zwischen zwei römischen Soldaten durch Jerusalem ‒ begafft, aber auch bewundert, denn meine »Heldentat« hatte sich schnell herumgesprochen. So, wie ich war, wollte ich vor den Statthalter treten, um ihm die Behandlung des Sohnes eines römischen Bürgers durch römische Soldaten vor Augen zu fuhren, doch da spielte der Centurio nicht mit. Mein verstocktes Schweigen half auch nichts, denn es genügte, nach dem Haus des Simon aus Chariot zu fragen, um bald den richtigen Weg zu finden.
Erschrocken und besorgt watschelten Philemon und Baucis um mich herum; ich wurde gebadet, gesalbt und neu eingekleidet, während draußen die römischen Soldaten Wache hielten. Als ich meine schmerzenden Glieder in frische Kleider zwängte, zogen mir allerlei Gedanken durch den Kopf. Man weiß, daß die Jugend in ihrem Ungestüm nicht fähig ist, abzuwägen und ruhig bis zum Kern einer Sache zu dringen. Alles stellt sich einem in schwarzen und weißen Bildern dar, zwischen Gut und Böse bleibt kein Raum.
»Das also ist Rom«, murmelte ich voll Verachtung, »Rom, ein geißelschwingender Sklavenhalter, der seine Sklaven, die Provinzen, auspreßt und knechtet, dessen Soldaten straflos unbescholtene Mädchen entführen und schänden dürfen.«
Dieses Rom, dachte ich bestürzt weiter, liebt dein Vater Simon, der stolz ist, römischer Bürger zu sein, der Latein und Griechisch beherrscht und doch auch ein Jude ist … Liebte mein Vater ein anderes Rom?
Es blieb mir keine Zeit, diese Erwägungen fortzusetzen, denn ich mußte vor Pilatus erscheinen. Im Gegensatz zu manchen seiner Vorgänger, die es liebten, sich mit ägyptischem Prunk zu umgeben, bevorzugte Pilatus altrömische Einfachheit, ohne dabei einen gewissen Luxus zu verleugnen, den er seinem Amt schuldig zu sein glaubte.
Inzwischen war es Abend geworden, und das sanfte rotgoldene Licht des unter den Horizont tauchenden Tagesgestirns vergoldete die kostbaren Marmorsäulen im weiten Vorraum des Prätoriums (Statthalterpalastes), ließ die bunten Steine der Boden- und Wandmosaiken sprühend aufblitzen und hauchte einen warmen Schein über die bronzenen Paraderüstungen der statuengleich verharrenden Wachsoldaten. Dieser Palast war von dem älteren Herodes erbaut worden und zeugte von der Prunkliebe dieses mächtigsten Despoten unter den Trägern des Herodesnamens.
Ich glaubte schon, eine lange, demütigende Wartezeit hinnehmen zu müssen, wurde aber bald in einen kleinen Raum geführt, wo Pilatus an einem mit Schriftrollen bedeckten Tisch saß.
Ich will hier gleich die später von vielen geäußerte Meinung berichtigen, Pilatus sei ein kahlköpfiger Fettwanst gewesen. Den Beinamen Pilatus (= Kahlkopf) hatte er von seinem Vater geerbt, der wirklich kahl gewesen sein soll; er trug ihn wie einen Familiennamen.
Pilatus war damals ein schlanker, mittelgroßer Mann mit vollem dunklen Haar und einem fast schön zu nennenden Antlitz, das allerdings den häßlichen Stempel des hochmütigen Zynikers trug und sich im Zorn bis zur Fratze entstellen konnte.
Mit einem Ruck wandte er sein Haupt und sagte leise, mit sanfter Stimme: »Raus!«
Damit waren die mich flankierenden Wachsoldaten gemeint, die sofort kehrtmachten und verschwanden.
»Nimm Platz, Judas Ben Simon«, forderte er mich auf, doch ich blieb trotzig stehen. Ruhig betrachtete er mich eine Weile, ohne von meiner Weigerung weiter Notiz zu nehmen. »Dein Vater war ein Freund meines verehrten Vorgängers, nicht wahr? Ein Jude zwar, doch eine Stütze Roms, ein Bürger unseres Weltreiches.«
Ich nickte. »So ist es, Pilatus. Der Sohn dieses römischen Bürgers wurde heute von römischen Soldaten mißhandelt, als er einen von ihnen, der sinnlos betrunken war, an der Entführung und Schändung eines jüdischen Mädchens hindern wollte.«
Pilatus lächelte. »Jüdisches Mädchen ‒ gewiß. Tochter eines Schankwirts und Zuhälters ‒ also gewiß auch Hure. Du hast eine kleine Hure verteidigt, mein Judas. Wir wollen es vergessen. Trotzdem sollen die Soldaten wegen ihrer Trunkenheit bestraft werden. Bei einem hast du es ja schon selber besorgt, er liegt verletzt im Spital. Was weiter?«
Ich war so ratlos wie empört. »Hure …? Aber wie … was sagst du da? Sie ist ein unbescholtenes Mädchen, zur Ehe versprochen … eine Braut …«
Pilatus stand langsam auf und ging ein paar Schritte auf mich zu. »Du bist jung, Judas, du bist einfältig, du darfst es sein, es ist das Recht der Jugend.« Damit trat er zum Fenster, drehte sich blitzschnell um und schrie mit schneidend-kalter Stimme: »Wer aber bin ich? Ich bin Rom, mein kleiner Judenbengel, Rom, das die Gnade besitzt, dieses dreckige, verlauste und aufsässige Volk zu kultivieren, ihm Frieden und Wohlstand zu bringen! Dein Volk, Judas! Man sollte euch ins Meer treiben und ersäufen wie Ratten; vielleicht gäbe es dann auch in diesem Teil der Welt endlich Frieden. Den römischen Frieden, den ihr nicht wollt und auch nicht verdient! Er wird euch aber trotzdem zuteil, die Gnade unseres göttlichen Kaisers leuchtet auch über Judäa, und diese Gnade verkörpere ich ‒ ich bin des Kaisers Arm! Ich bin aber auch seine Faust, und diese Faust wird so lange auf eure Köpfe niedersausen, bis ihr begreift, was es heißt, ein Teil Roms zu sein.«
Ich war wie betäubt und konnte nichts erwidern.
Pilatus schlug mit dem Knauf eines auf dem Tisch liegenden Dolches heftig gegen ein Bronzebecken, worauf sofort die Wache eintrat. »Geh nach Hause zu deinem Vater, Judas, und überdenke meine Worte.«
So verlief meine Begegnung mit Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter in Judäa.
Kapitel 4
Es mag seltsam klingen, wenn ich sage, daß die unerfreuliche Begegnung mit Pontius Pilatus mich schließlich auf den Weg zu Jesus Christus führte. Dieser Weg verlief freilich nicht in gerader Linie ‒ eigentlich war es ein Umweg, und nicht nur ich bin ihn gegangen.
Nachdem ich meinem Vater die Erlebnisse in Jerusalem berichtet hatte, meinte er, Pilatus habe mich gnädig behandelt, denn ich habe mich wie ein dummer Junge und nicht wie ein Mann verhalten. Diese Worte kränkten und empörten mich; hatte ich doch von meinem Vater Verständnis und Zustimmung erwartet. Ich fand, daß er wie ein Römer und nicht wie ein Jude dachte, und mißbilligte es. Unsere Geschichte, unsere Kultur sei zehnmal älter, begehrte ich auf, und recht besehen seien die Römer, mit uns verglichen, Barbaren, auch wenn sie dieses Schimpfwort gerne gegen die eroberten Völker anwendeten. Mein Vater bewies viel Geduld und versuchte mich zu belehren:
»Wohl ist unsere Kultur älter, aber sie hat sich, wie du siehst, keineswegs als die stärkere erwiesen. Der griechisch-römische Geist ist es, der die Welt seit langem beherrscht und wohl noch lange beherrschen wird. Die zivilisierte Welt spricht griechisch und lateinisch, mein Judas, damit mußt du dich abfinden. Für deine Enkel wird die hebräische Sprache und die mosaische Lehre vielleicht nur noch eine ferne Erinnerung sein, ein Schulstoff, den man durcharbeitet und dann vergißt. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich auf die Seite des politisch und kulturell Stärkeren zu stellen, sondern ein Gebot der Klugheit. Wenn nicht jetzt, so wirst du dies doch später einsehen müssen.«
Ich wollte und konnte meinem Vater nicht recht geben, ich begehrte auf und fühlte plötzlich ein warmes Verlangen, tief und gründlich in die Geschichte meines Volkes einzudringen.
In Jerusalem hatte ich an einen Freundeskreis gleichaltriger junger Männer Anschluß gefunden. Meist waren es Söhne von Kaufleuten, Priestern, Gutsbesitzern und wohlhabenden Handwerkern, mit denen ich mich abends in den Schenken traf. Wir tranken, redeten und machten gelegentlich das nächtliche Jerusalem unsicher.
Woher wir auch kamen, wie immer unsere Eltern denken mochten ‒ wir waren uns einig im Haß gegen die Römer und hätten für ein freies Judäa jederzeit zum Schwert gegriffen. Doch dazu war damals die Zeit noch nicht reif, und so redeten wir uns nur die Köpfe heiß, tranken mehr als uns guttat und besuchten nicht selten verschwiegene Häuser, wo schöne Mädchen, warme Bäder, erlesener Wein und köstliche Speisen auf gutgefüllte Börsen warteten.
Ich genoß diese Freuden sehr mäßig und begann sie mit der Zeit zu verachten, denn mein suchender Geist hatte sich mit jugendlicher Heftigkeit der Religion bemächtigt.
Mein Vater hatte es niemals an der genauen Beachtung aller jüdischen Gebräuche fehlen lassen, doch in seinem Sohn Judas fand er sich bald übertroffen. Ob es sich nun um Sabbatregeln handelte oder um das zeremonielle Anlegen der Gebetskleidung mit Mantel und Riemen bei der Morgenandacht ‒ ich erwies mich als ein strenger Eiferer, der auch niemals versäumte, beim Betreten oder Verlassen des Hauses andächtig die Mesusa zu küssen. Hatte mein Vater mit besonderer Vorliebe den Gesängen Homers, Vergils oder Ovids gelauscht, wenn mein Lehrer Aulos sie uns mit klingender Stimme vortrug, so war ich es, der ihm jetzt mit langen Lesungen aus den Büchern der Propheten zu verstehen gab, daß ich Sprache und Geschichte unseres Volkes allem anderen voranstellte.
Besonders liebte ich das Lied der Lieder, den wunderschönen Gesang König Salomos. Wenn ich die Stelle vortrug, wo es heißt: Sie halten alle Schwerter und sind geschickt, zu streiten. Ein jeglicher hat sein Schwert an seiner Hüfte um des Schreckens willen in der Nacht …
Wenn ich dies las, dann gedachte ich haßerfüllt der Stunde, als ich vor Pilatus stand und mich schelten ließ.
Wenn ich aber vortrug:
Siehe, meine Freundin, du bist schön, schön bist du! Deine Augen sind wie Taubenaugen zwischen deinen Zöpfen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen …
Wenn ich dies vortrug, stand mir Debora vor Augen.
Bei der Stelle:
Deine zwei Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge, die unter den Rosen weiden … fühlte ich mein Herz zittern und mir war, als seien Debora und Judäa eines, als sei Salomos Liebeslied nicht einer Frau, sondern ganz Palästina zugedacht.
Mein Vater spürte wohl, welche Unruhe in mir war, und er wußte auch, wie wenig er mir helfen konnte. Oft glaubte ich, eine andere Sprache zu sprechen als er, fühlte mich einsam und unverstanden. Dann geschah es, daß ich mein Pferd aus dem Stall holte und weit über das Land ritt, ohne Ziel, ohne auf die Zeit zu achten. Manchmal überraschte mich dabei die Nacht, dann band ich mein Pferd an den nächsten Baum und legte mich daneben nieder zum Schlaf. Einmal kehrte ich erst nach drei Tagen zurück, nicht ohne Furcht vor meines Vaters Zorn. Simon aber schwieg, und meine Mutter umarmte mich nur stumm mit Tränen in den Augen.
Schließlich war es mein Vater, der vorschlug, ich solle eine Reise durch Judäa unternehmen, um nachher, wie er hoffte, einsehen zu lernen, daß man auch in der Enge des Heimatortes Freiheit empfinden kann.
»Freiheit oder Beschränkung«, sagte er, »ist in dir selber verborgen, und an dir wird es liegen, welches davon dein Leben bestimmt. So mancher Gefangene mag in der Enge seiner Kerkermauern mehr Freiheit empfinden als ein König, der sich in seinem Palast wie ein Gefangener fühlt. Sei so frei, mein Sohn, wie Gott dich geschaffen hat, und bedenke, daß die wahre Freiheit ihre Grenzen hat wie unser Dasein auf Erden. Was dieses Dasein begrenzt, ist der Tod, der aber kennt keine Grenzen.«
Ich achtete nur wenig auf die Worte meines Vaters, denn ich war jung und fieberte meiner Reise entgegen wie die Braut dem Bräutigam.
Natürlich wurde mir ein zuverlässiger Diener mit auf die Reise gegeben, ein schweigsamer Mann in mittleren Jahren, dem mein Vater vertraute. Dieser Joel stammte aus Jamnia, einem Ort im Westen Judäas, nicht weit von der Küste entfernt.
Ihn bewegte schon lange der Wunsch, seine Heimat wiederzusehen, ein Wunsch, der sich nun in Verbindung mit unserer Reise erfüllen sollte.
Ungeduldig ließ ich die Abschiedswünsche und den Reisesegen meiner Eltern über mich ergehen, als wir im Morgengrauen eines leuchtenden Frühlingstages aufbrachen.
Den ersten Aufenthalt nahmen wir in Hebron, der Kalebiter-Stadt. Durchdrungen von glühender Frömmigkeit, schaudernd vor dem Eishauch uralter Geschichte, erzitternd vor dem Klang heiligster Namen kniete ich vor der Höhle Machpela, die Abraham von dem Hethiter Efron als Grabkammer für sich und seine Familie erworben hatte. Dieser Stammvater unseres Volkes ruht dort mit seinem Weib Sarah und seinen Kindern und Enkeln. Etwas weiter von Hebron entfernt wanderte ich durch den Eichenhain Mamre, wo Abraham sich mit den Seinen die Heimstatt, Gott aber einen Altar errichtete.
Über Herodeion reisten wir nach Bethlehem, das ich ehrfürchtig durchwanderte, denn hier wurde König David geboren. Vielleicht bin ich auch an Josephs, des Zimmermanns, Haus vorbeigegangen, vielleicht ist Jesus mir schon damals begegnet ‒ ich weiß es nicht.
Wir rasteten in Bethanien, umgingen aber Jerusalem, das ich verachtete, seit ich dort vor Pilatus gestanden hatte, und dessen ehrwürdiger Name mir so lange befleckt schien, als noch ein Römer in seinen Mauern weilte.
Viele Tage dauerte der Weg nach Westen, bis wir Joppe erreichten und ich zum ersten Mal die unendliche Fläche des Meeres schaute, dessen rauschende, an den goldenen Sand des Ufers brandende Wogen mir wie ein ewig währendes Ein- und Ausatmen erschienen. Während mein Diener Joel in Joppe Verwandte besuchte, lag ich im warmen Sand und betrachtete stundenlang den blauen, wie mit winzigen Silberschuppen bedeckten Riesenleib des Meeres, auf dessen Rücken die bunten winzigen Segel der Schiffe wie Kinderspielzeug tanzten. Ich selber aber ‒ meine kecke Jugend möge es verzeihen ‒ fühlte mich keineswegs klein vor dieser Unendlichkeit, sondern atmete in tiefen Zügen die frische salzige Luft, spürte, wie Brust und Seele sich weiteten, wie eine gewaltige Kraft mich durchdrang. Solch köstliche Freuden werden dem jungen tatenfrohen Menschen umsonst zuteil. Seine besten Gaben pflegt Gott zu verschenken, wenn er in ein junges, offenes Herz blickt. Im Alter mag man sich mit einem Krug guten Weines ein kleines Stückchen davon zurückkaufen können ‒ um den Preis eines schmerzlichen Erwachens.
Von Joppe erreichten wir dann endlich Jamnia, das Ziel unserer Reise. Joel wurde von seinen Geschwistern freudig begrüßt; auch mich, seinen jungen Herrn, hieß man gastlich willkommen. Jeden Tag speisten wir als gefeierte Gäste in einem anderen Haus, jede Nacht empfing uns ein anderes Bett.
Dieses Städtchen war von einer heiteren, genußfreudigen Wohlhabenheit durchdrungen, die sich sehr von der bedächtigen, eher kargen Lebensart der Bergdörfer um Jerusalem unterschied.
Ich will nicht leugnen, daß sich mein frommer Sinn in diesen Tagen wandelte. Wer am Morgen in den Armen einer Frau erwacht, läßt die Gebetsriemen im Beutel, wer die Nächte bei süßem Wein und in froher Gesellschaft verbringt, den gelüstet es nicht nach heiligen Stätten.
Ich will aber auch nicht leugnen, daß ich während unserer Heimreise doch einige Reue empfand, denn vom Pfad eines strenggläubigen Juden war ich während der letzten Wochen um einiges abgewichen.
Was kann ich sonst noch von dieser Reise berichten? Aufregendes hatten wir nicht erlebt, die pax romana hüllte das ganze Land in ihren schützenden friedlichen Mantel, aber in Caesarea saß Pontius Pilatus, und der Mantel zeigte einige häßliche Löcher.
Ich sah, wie römische Soldaten eine Gruppe junger Männer mit Peitschenhieben einen Galgenberg hinaufjagten, wo das Kreuz auf sie wartete. Als ich nach ihrer Schuld fragte, hieß es, das seien gefährliche Aufrührer, die den römischen Frieden gestört hätten. Auf einen Juden mehr oder weniger käme es nicht an, meinte einer der Soldaten, und ich könne mich meinen Landsleuten ohne weiteres anschließen, wenn deren Schicksal mich so sehr bewege. War es Hochmut, war es Feigheit, was mich entgegnen ließ:
»Ich bin Jude und römischer Bürger, meine Steuern und Abgaben tragen dazu bei, daß Rom und seine Provinzen erhalten bleiben, also habe ich auch das Recht, Fragen zu stellen. Wem dies nicht paßt, der möge dem Statthalter meinen und meines Vaters Namen nennen!«
Diese stolzen Worte taten ihre Wirkung, denn die Soldaten zogen mit ihren Opfern weiter, ohne mich noch zu behelligen.
»Gut gesprochen, Judas«, meinte Joel, »aber vergiß nicht, daß du Jude bist, wie diese da, auch wenn dein ererbter Bürgerbrief dich schützt.«
Ich vergaß es nicht, konnte es nicht vergessen, wenn ich mit ansehen mußte, wie die römischen Soldaten sich auf ihren Märschen durch Judäa benahmen. Sie raubten nicht, sie mordeten nicht, sie wurden in der Regel sehr streng bestraft, wenn sie einen Juden ohne Grund belästigten ‒ und doch war es, als fege ein eisiger Wind die Straßen leer, wenn eine Centurie waffenklirrend durch eine Ortschaft marschierte. Manchmal erlebte ich, daß die Soldaten Rast hielten, sich über ein Städtchen verteilten, immer in Gruppen zu fünf oder sechs. Dann schlugen sie sich nach Soldatenart in einer Schenke den Bauch voll, tranken mehr Wein, als ihnen erlaubt war und sahen es hohnlachend, wenn die Schenke sich schnell leerte, denn es gab nur wenig Juden, die sich mit einem römischen Soldaten an einen Tisch setzten.
Es muß nun allerdings auch gesagt werden, daß es sich dabei meist nicht um Römer handelte, auch wenn ich die Bezeichnung römische Soldaten gebrauchte. Richtiger müßte es heißen nichtjüdische Soldaten im Dienste Roms, denn überwiegend waren es Syrer und Samariter, die in Judäa Dienst taten und gerade so viel Latein sprachen, daß sie die Befehle ihrer Führer verstanden. Diese allerdings waren Römer, und auch die gutwilligsten von ihnen kränkte es, wenn man ihre Soldaten wie Aussätzige behandelte. Zu Hause war ihnen gesagt worden, die Juden seien ein wunderliches und schwieriges Volk, dem man mit Vorsicht begegnen müsse, wenn es auch keinen Zweifel gebe, daß römische Kultur und Sitte der jüdischen weit überlegen sei. Nun mußten sie aber erfahren, daß die meisten Juden nicht im geringsten gesonnen waren, sich von dieser Kultur beeindrucken zu lassen.
Kapitel 5
Als ich von meiner Reise zurückkehrte, empfing mein Vater mich mit Tränen in den Augen, drückte und umarmte mich, als sei ich von den Toten auferstanden. Meine Mutter schaute mich nur lange stumm und glücklich an, streichelte immerzu meine Hände und wehrte meine Schwester Rachel ab, die hundert Fragen zugleich stellte und vor Freude durchs Haus tanzte, als ich ihr mein Geschenk, einen wundervoll ziselierten syrischen Armreif, überreichte. Rachel war in der letzten Zeit erblüht wie eine Lilie, wenn sie sich auch mit ihren elf Jahren noch wie ein rechtes Kind benahm. Übermut, Zärtlichkeit, Unbeholfenheit und eine herbe Lieblichkeit waren in ihrem Wesen vereinigt. Sie war gerade dabei, eine Frau zu werden, Körper und Geist begannen sich zu wandeln, was sie verwirrte und oft liebenswert hilflos machte. Ich fühlte mich als großer Bruder und wäre jedem an die Kehle gesprungen, der es gewagt hätte, sie zu berühren.
Und doch litt es mich nicht lange zu Hause, ich fühlte mich fremd und glaubte, meine Heimat anderswo suchen zu müssen. Auf meiner Reise war ich nicht bis zum großen Salzmeer gekommen, obwohl es gar nicht weit von Chariot entfernt im Osten lag. So preßte ich meinem Vater die Erlaubnis ab, eine zweite, kleinere Reise unternehmen zu dürfen, und zwar allein.
Es gedeihen weder Fische noch Pflanzen in dem von wüsten Bergen umgebenen Salzmeer, an dessen Ufer die Städte Sodom und Gomorra lagen, die der Herr um ihrer Sünden willen ausgelöscht hat, wie die Bücher Moses berichten. Keine Spur kündet von ihrer Existenz, nur ihre Namen haben sich als ewige Warnung erhalten. Ob dies der geschichtlichen Wahrheit entspricht, möge dahingestellt sein; ich jedenfalls glaubte fest daran und verbrachte mehrere Tage an den öden, salzverkrusteten Ufern des westlichen Wüstenmeeres, um irgendwelche Spuren der verfluchten Städte zu entdecken. Ich werde nicht der erste gewesen sein, der vergeblich danach gesucht hat.
Schließlich rastete ich in dem kleinen Ort Masada, dessen Name damals noch nicht durch König Herodes’ gewaltige Festung bekannt war. Hier wie auch in der weiter nördlich gelegenen Oase Engedi lebten kleinere Gruppen der Essener, doch kam ich mit ihnen nicht in Berührung. Ich wußte, daß ihr Hauptsitz am Nordende des Wüstenmeeres bei dem allgemein als »Salzstadt« bezeichneten Orte lag.
Nach einem anstrengenden Ritt in der glühenden Hitze des Spätsommers gelangte ich vor die Mauern des Klosters. Halb besinnungslos vor Durst glitt ich von meinem erschöpften Maulesel und klopfte an die Eingangspforte. Ich wurde empfangen wie ein hochwillkommener Gast, wurde so liebevoll gebadet, gespeist und getränkt, daß es mich ganz verlegen machte. Nach einem langen erquickenden Schlaf wurde mir am Morgen des nächsten Tages ein Führer zugeteilt, der mir die gesamte Anlage zeigen sollte. Erstaunt und erfreut, denn man war meiner Bitte zuvorgekommen, folgte ich dem ernsten jungen Mann durch die von einer gewaltigen Mauer umgebene Klosterstadt. Mein Begleiter beantwortete bereitwillig alle Fragen, doch was er sagte, klang wie eingelernt, und er psalmodierte, als seien es Gebete.
Der gesamte Klosterkomplex wirkte von außen eher wie eine wehrhaft befestigte Stadt dem als eine Stätte des Gebets und des Studiums der heiligen Schriften.
Während der wenigen Tage meines ersten Aufenthalts erfuhr ich nicht viel über das geistige Leben der Bruderschaft, wurde aber immer wieder eindringlich darauf hingewiesen, daß die wahre Lehre und das rechte Leben in Gott allein hier zu finden seien. Diese Andeutungen genügten damals, um einer aufgewühlten Seele Frieden zu bringen. Das ruhige, geregelte Dasein in Gebet und Arbeit, die feste Überzeugung, hier die Wahrheit zu finden, ließen meinen Entschluß schnell reifen. Solchermaßen gewappnet und fest entschlossen, jedem Widerstand zu begegnen, kehrte ich heim.
Kapitel 6
Ein eigensinniger Trotz versperrte mir in jener Zeit den Zugang zum Herzen meines Vaters. Um so seltsamer berührte es mich, daß er meinem Plan, in die Bruderschaft der Essener einzutreten, keinen Widerstand entgegensetzte. Er muß wohl gespürt haben, daß ich auch gegen seinen Willen mein Elternhaus verlassen hätte, und gab mir nur einen Rat mit auf den Weg, einen Rat, mit dem ich damals noch wenig anzufangen wußte:
»Bleib immer du selbst, mein Sohn, treibe den Gehorsam niemals so weit, daß andere über dein Schicksal verfügen. Sei mit dem Herzen dabei, vergiß aber das Denken nicht. Sage nicht ja, wenn eine laute Stimme in deiner Brust nein, nein, nein ruft. Mehr vermag ich dir nicht zu sagen. Ich weiß, daß du zurückkehrst, und flehe zu Gott, daß wir uns an Leib und Seele gesund wiederfinden werden.«
Ich aber war voll Ungeduld und vernahm die Worte meines Vaters nur mit halbem Ohr. Ungeduld begleitete mich auch auf meinem Weg zur Salzstadt, wo ich wie ein Verdurstender an das Tor des Klosters pochte.
Ich wurde weder mit Freude, noch mit Ablehnung empfangen, es war, als sei ich an einen mir gebührenden Platz zurückgekehrt. Im Gemeinschaftshaus der Novizen erhielt ich einen Schlafplatz und wurde gleich für den nächsten Morgen zur ersten Belehrung befohlen. Meiner jugendlichen Begeisterung und Hingabe fiel es sehr schwer, zu verstehen, daß eine zweijährige Prüfung der Aufnahme in die Bruderschaft der Essener voranging. Die heute bei den Historikern übliche griechische Bezeichnung Essener für die Bruderschaft leitet sich vom aramäischen chasaja ab, das heißt: die Frommen.
Der freundliche alte Priester weihte mich in die Geschichte und Ziele der Bruderschaft ein, soweit es einem Novizen zukam. So erfuhr ich, daß vor nunmehr 170 Dezennien der Lehrer der Gerechtigkeit ‒ sein Name wurde nur den Brüdern offenbart ‒ die Gemeinschaft begründete. Er hatte seine Anhänger am Salzmeer versammelt, weil er den Tempelkult in Jerusalem als gottesfeindlich ansah und den amtierenden Hohenpriester Jonathan als Frevelpriester entlarvte. Getreu dem Bibelwort: »In der Wüste bereitet die Wege des Herrn« war er mit seinen Jüngern hierher in die Einsamkeit gezogen. Das Hauptanliegen des Lehrers der Gerechtigkeit war die von Gott befohlene Heiligung des Sabbats, die am Tempel zu Jerusalem längst mißachtet und durch den Sonne-Mond-Kalender unmöglich gemacht wurde. Der vom Lehrer der Gerechtigkeit neu gestaltete Sonnenkalender ließ sämtliche Jahresfeste auf Werktage fallen, wodurch die Sabbatruhe über das ganze Jahr gewahrt blieb. Ich verstand nur wenig von dem, was mir der alte Priester mitteilte, doch etwas blieb mir an diesem Tag im Gedächtnis, denn er ließ es mich Wort für Wort wiederholen: