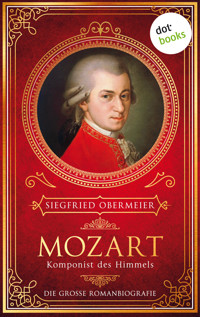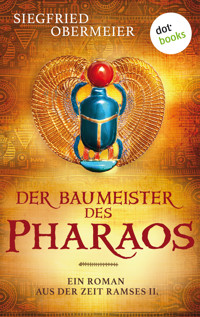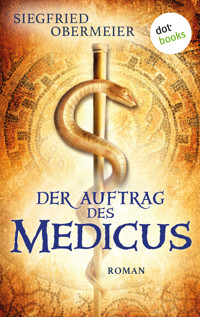
6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Verhältnis mit fatalen Folgen … Der mitreißende historische Roman »Der Auftrag des Medicus« von Siegfried Obermeier jetzt als eBook bei dotbooks. In der Hauptstadt des römischen Weltreichs kann ein Mann hoch steigen – und genauso tief fallen … Rom zur Zeit des Kaisers Augustus: Trotz seiner griechischen Herkunft hat es der Medicus Herophiles in der »Ewigen Stadt« zu Ansehen gebracht– bis eine schicksalshafte Begegnung alles verändert: Die junge Patrizierin Julia gewährt ihm Zugang zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft … doch ihre verbotene Liebe bringt ihn auch ins Visier der berüchtigten »schwarzen Lucretia«, die in den Schatten der römischen Unterwelt ihre Fäden spinnt. Ehe er weiß, wie ihm geschieht, ist Herophilos in einem Netz aus Verrat und Intrigen gefangen. Bald geht es nicht nur um seinen Ruf und seine Liebe, sondern um sein Leben – und so sehr der Medicus auch versucht, sich aus dem Spinnennetz zu befreien, seine Gegenspielerin scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Auftrag des Medicus« von Siegfried Obermeier ist perfekt recherchiert und spannend wie ein Krimi – historische Unterhaltung für alle Fans von Ellis Peters und John Maddox Roberts! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Ähnliche
Über dieses Buch:
In der Hauptstadt des römischen Weltreichs kann ein Mann hoch steigen – und genauso tief fallen … Rom zur Zeit des Kaisers Augustus: Trotz seiner griechischen Herkunft hat es der Medicus Herophiles in der »Ewigen Stadt« zu Ansehen gebracht– bis eine schicksalshafte Begegnung alles verändert: Die junge Patrizierin Julia gewährt ihm Zugang zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft … doch ihre verbotene Liebe bringt ihn auch ins Visier der berüchtigten »schwarzen Lucretia«, die in den Schatten der römischen Unterwelt ihre Fäden spinnt. Ehe er weiß, wie ihm geschieht, ist Herophilos in einem Netz aus Verrat und Intrigen gefangen. Bald geht es nicht nur um seinen Ruf und seine Liebe, sondern um sein Leben – und so sehr der Medicus auch versucht, sich aus dem Spinnennetz zu befreien, seine Gegenspielerin scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein …
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba«, »Das Spiel der Kurtisanen«, »Sizilien« und »Die Hexenwaage« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit«, »Mozart, Komponist des Himmels« und »Judas – Der letzte Apostel«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel »Die schwarze Luctretia« im Econ & List Taschenbuch Verlag
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/80’s, Krikkiat
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-607-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Auftrag des Medicus«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Der Auftrag des Medicus
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Mein Vater Apollonios stammte aus Alexandria und war ein Freigelassener des Gaius Octavianus. Dieser hatte dem begabten Jungen auch das Studium in einer guten Medizinschule ermöglicht. Nur die Götter wissen, wieviel schlechte es daneben gibt, die vorwiegend Quacksalber und Kurpfuscher produzieren, und jeder kranke Mensch ist zu bedauern, der solchen pseudogelehrten Betrügern in die Hände fallt.
In aller Bescheidenheit darf ich bemerken, daß sich diese Begabung auf mich, Herophilos, vererbte, und ich meine schulische und vorwiegend theoretische Ausbildung in der taberna meines Vaters praktisch fortsetzte. Aufgrund seiner Herkunft und seines Namens galt er als griechischem Arzt, was die Römer bekanntlich überaus schätzen, weil die Heilkunst in Hellas eine uralte Tradition hat. Das meiste habe ich daher bei meinem Vater und im direkten Umgang mit Patienten, Arzneien und den sich daraus ergebenden Problemen gelernt. Es gibt einfache Arzneien und einfache Patienten, und es gibt von beiden sehr schwierige, wie man später noch gelegentlich sehen wird.
Diese Geschichte ist meinem Freund und Diener Gallus gewidmet, der mir vor allem bei Letzteren immer eine große Hilfe war – bis zu seinem plötzlichen Tod. Unsere Begegnung hätte wohl niemals stattgefunden, wäre nicht Gaius Octavianus später von Julius Caesar adoptiert worden und Marcus Antonius und Marcus Lepidus zu triumviri aufgestiegen.
Doch was jeder Schuljunge lernt, brauche ich hier nicht im Detail darzustellen, aber wir wissen, daß dieses Triumvirat zerbrach und am Ende Octavianus dem Antonius als Feind gegenüberstand.
Und hier setzt nun meine, setzt unsere Geschichte ein. Octavianus – ich werde ihn von nun an mit seinem späteren Ehrennamen Augustus nennen – gehörte wohl zu den ersten Feldherren, die in ihrer Truppe Militärärzte beschäftigten. Anfangs nur sporadisch und mehr versuchsweise eingesetzt, gehörten sie schon bald zum festen Bestand jeder römischen Legion. Sie erhielten den Rang eines Centurio, und jeder hatte Anspruch auf einen servus medicus, einen Arztgehilfen, den er sich selbst wählte und ausbildete.
Mein Vater, der damals noch lebte, war strikt dagegen, seinen Sohn in ein militärisches Abenteuer zu entlassen, aber ich meinte, nirgends würden chirurgische Erfahrungen vielfältiger und zahlreicher vermittelt als bei der Truppe, außerdem seien damit ein guter Lohn und die sofortige Aufnahme in die römischen Bürgerlisten verbunden. Letzteres war ein Argument, dem sich mein Vater, wenn auch widerwillig, beugte. Er selber konnte als Freigelassener das Bürgerrecht nicht erwerben, aber ich wußte recht gut, daß er es für mich erhoffte. Das wäre an sich nicht schwierig gewesen, weil schon Julius Caesar ein Gesetz erlassen hatte, das allen frei geborenen in- und ausländischen Ärzten auf Antrag das Bürgerrecht gewährte, aber solange ich nur als Gehilfe meines Vaters galt, besaß dieses Gesetz für mich keine Gültigkeit.
So setzte ich meinen Willen durch, und als es darum ging, mir einen Gehilfen auszusuchen, fiel mein Auge auf Gallus.
Ich zählte damals etwa zweiundzwanzig Jahre, Gallus wußte sein Alter nicht genau anzugeben, meinte aber, älter als achtzehn könne er nicht sein. Sein Vater war nach dem gallischen Krieg als Sklave nach Ostia in den Haushalt eines dominus navis, eines großen Reeders, gekommen und durfte mit Zustimmung seines Herrn eine syrische Sklavin heiraten, die ihm einen Sohn gebar. Diesen nannte er, in Erinnerung an seine alte Heimat, Gallus. Sklaven werden meist nicht alt, weil besonders die reichen Herren an ihnen Arzt und Pflege sparen und sich lieber neue und jüngere servi besorgen. Als die Eltern von Gallus kurz nacheinander starben, war er noch ein halbwüchsiger Junge mit nicht gerade rosiger Zukunft, wie er mir selber erzählte:
»Dann brachen schlechte Zeiten für mich an. Ein Sohn unseres dominus hatte die Geschäfte seines schon kranken und hinfälligen Vaters übernommen, und wenn der Alte streng aber gerecht über seinen riesigen Haushalt regiert hatte, so geschah dies bei seinem Sohn je nach Laune und völlig unberechenbar. Eines Tages hielt er Sklavenschau, und da fiel ihm plötzlich auf, daß ich für einen etwa Sechzehnjährigen schon sehr kräftig war. Er meinte, mit solchen Muskeln sei es eine Verschwendung, im Haus herumzulungern, und schickte mich an den Hafen zur Schwerarbeit. Auf die Dauer ist es eine mörderische Sache, den ganzen Tag Schiffe zu be- und entladen. Sie bürden dir Lasten auf, Herr, daß du am Ende des Tages nicht mehr weißt, welcher Knochen und welcher Muskel dich am meisten schmerzt. Man ist nur noch eine Menschenmaschine, die sich schnell abnützt und genauso schnell ersetzt werden kann. Doch die Götter hatten ein Einsehen mit mir, und mein Schicksal wendete sich zum Besseren. Unser junger Herr kam bei einem Sturm auf der Fahrt nach Alexandria ums Leben, und den Alten traf dies so schwer, daß er wenig später starb. Nun galt sein Testament vor dem des Sohnes, und sämtliche Haussklaven wurden in die manumissio entlassen. Das ist nun auch so eine Sache. Vorher bist du unfrei und willenloses Werkzeug deines Herrn, das sich mit viel Prügel, wenig Essen und ohne jedes Geld durchs Leben schlagen muß. Dann bist du plötzlich frei, hast einen eigenen Willen, wirst nicht mehr geprügelt – aber woher den Lebensunterhalt nehmen?
Da Geschäft und Familie meiner früheren Herrschaft auseinanderfielen, gab es für mich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich verdiente mein Brot mühsam als Tagelöhner am Hafen, vielleicht auch in Rom, oder ich ließ mich zur Truppe anwerben. Wer die Ohren offenhält, hört auch als kleines, unbedeutendes Arbeitstier gelegentlich etwas von dem, was um einen herum vorgeht. Und daß der noch immer schwelende Bürgerkrieg nur durch ein Kräftemessen zwischen Octavianus und Marcus Antonius beendet werden konnte, davon wurde in den Hafenkneipen wahrhaftig mehr als genug geredet. So ließ ich mich als einfacher gregarius in eine legio des Imperators Octavianus aufnehmen, der dabei war, seine Land- und Seestreitkräfte zusammenzuziehen. Dann kamst du, Herr, ein frischgebackener medicus militaris, und dank deiner überaus großen Weisheit und Bildung …«
Soweit der Bericht meines Gallus, den ich aus ein paar Dutzend anderer, ohne lange zu überlegen, auswählte und zu meinem servus medicus machte. Das hatte nichts mit Weisheit und Bildung zu tun, wie Gallus mir in gespielter Schmeichelei versicherte, denn im Grunde war ich ja auch nur ein grüner Junge, wenn auch mit einigen ärztlichen Kenntnissen.
Schon nach ein paar Tagen wußte ich, daß ich nicht nur keinen Fehlgriff getan hatte, sondern daß dieser Bursche offenbar von den Göttern zum Heilberuf bestimmt war. Vielleicht hatte Aesculapius seine Hand dabei im Spiel – wer weiß.
Gallus war kräftiger, als er auf den ersten Blick aussah, so daß ich später bei chirurgischen Eingriffen meine Patienten häufig nicht festbinden mußte, weil er sie eisern umklammert hielt. Seine graugrünen Germanenaugen blickten klug und freundlich aus einem fröhlichen, noch bubenhaften Gesicht, und selbst, wenn wir uns mit Schwerverwundeten beschäftigen mußten, blieb er heiter und zuversichtlich und gab damit so manchem dieser Männer neue Hoffnung.
Inzwischen gingen die wildesten Gerüchte um, etwa von der Art, daß Marcus Antonius nach einem Sieg die Stadt Rom an seine königliche Buhle Kleopatra verschenken und den Sitz seiner Regierung nach Alexandria verlegen würde. Die Erbitterung gegen ihn und seine Geliebte wuchs von Tag zu Tag, und sein Gegner Augustus konnte sich kaum noch des Zustroms von Freiwilligen erwehren.
Auch gab es allerlei Vorzeichen, die auf eine Niederlage des Antonius hinwiesen: So wurde zum Beispiel berichtet, daß sein Standbild auf dem Albanerberg Blut verströme. Die Begeisterung bei der Truppe war groß, und sie stieg noch, als bekannt wurde, daß Kleopatra die reichste Königin der Welt sei und Schätze winkten, die alles übertrafen, was römische Legionäre jemals in vergangenen Kriegen erbeutet hatten.
Unser erstes Marschziel hieß Brundisium, und dahin zogen wir im Frühjahr über das bucklige Pflaster der Via Appia.
Ich war dem Landheer zugeteilt und durfte den kurzen, anstrengenden Weg auf einem kräftigen Maultier zurücklegen, ebenso mein Gehilfe Gallus. Mein Sammelsurium an Instrumenten und Arzneien war auf sorgfältig geölte, wasserdichte Ledersäcke verteilt. Wenn die jetzt so munteren und zuversichtlichen Legionäre gewußt hätten, was ihr Medicus da mit sich schleppte, so wäre manches Gesicht beim Anblick der Knochensägen und -heber, Brandeisen, Messer, Schaber, Sonden und Nadeln wohl sehr nachdenklich geworden.
Im Frühsommer wurden die Truppen Schiff um Schiff nach Hellas übergesetzt, und es dauerte viele Wochen, bis das Landheer am Fuß der Keraunischen Berge versammelt war, während die Flotte weiter südwärts zog, wo Antonius bei Actium am Ambraeischen Golf sein Lager aufgeschlagen hatte.
Wer nun glaubt, ein medicus militaris sei ohne Beschäftigung, solange es nicht zu Kampfhandlungen kommt, der irrt gewaltig. Schon beim Marsch nach Brundisium hatte es Knochenbrüche, schwere Prellungen, Vergiftungen und andere Unfälle gegeben, und jetzt, da wir die epirotische Küste entlang auf einem sehr beschwerlichen Marsch nach Süden zogen, waren Abstürze und Unfälle mit den schweren Troßwagen an der Tagesordnung.
Gallus erwies sich als geschickter, lerneifriger und, wenn es angebracht war, durchaus behutsamer und mitfühlender Heilgehilfe. Er lernte leicht und schnell, wenn er es auch manchmal an Respekt mir gegenüber fehlen ließ, weil sein von Jugend an aufs Überleben geschulter Sklavenverstand oft andere und bessere Lösungen fand. Freilich lag das auch an mir, denn ich zeigte mich durchaus einsichtig, wenn ich sah, daß er recht hatte, was er anfangs als weichliches Nachgeben auslegte. Doch wie man so sagt: Wir rauften uns zusammen, und als es dann wirklich bei Actium zur Begegnung mit dem Feind kam, konnte einer sich auf den andern felsenfest verlassen.
Ich halte es für überflüssig, den Verlauf des Kampfes zwischen Augustus und Marcus Antonius zu schildern – das gehört nicht hierher, und andere haben es schon ausführlich und wohl auch besser getan, als ich es könnte.
Viel lieber will ich erzählen, warum aus dem früheren Sklaven Gallus ein lebenslanger Freund und unentbehrlicher Gehilfe in meiner römischen Praxis wurde.
Die entscheidende Seeschlacht Anfang September wurde für Antonius zur schmählichen Niederlage – Kleopatra konnte sich mit ihrer Flotte rechtzeitig nach Alexandria absetzen. Der geschlagene Imperator ließ dreizehn Legionen Landtruppen zurück, deren Angriffen Augustus geschickt auswich, da er diese Armee nicht vernichten, sondern für sich gewinnen wollte.
Bei einem dieser Scharmützel versuchte ein kleiner Trupp, unser Sanitätszelt zu erstürmen, wohl in der Hoffnung auf Beute, und noch ehe ich meinen Lederpanzer anlegen konnte, erschien ein feindlicher Soldat, holte aus, um sein pilum zu schleudern, während ich dastand wie gelähmt und meinen thorax fest an die Brust drückte. Doch plötzlich hielt der Soldat mitten in der Bewegung inne, verzog schmerzlich-erstaunt sein Gesicht und fiel dann nach hinten. Gallus hatte ihm mit Wucht seinen gladius zwischen die Schulterblätter gestoßen – quasi im Laufen –, ergriff meine Hand, zerschnitt das Zelt und stürzte mit mir hinaus, wo wir wenig später unseren eigenen Leuten in die Arme Hefen.
Am Abend erholten wir uns bei einem Becher Wein.
»Du hast mir heute das Leben gerettet, Gallus. Der Kerl hätte mich aufgespießt wie einen Eber.«
»Ach was – vielleicht hat Fortuna mir die Hand geführt oder die Parcae oder Jupiter persönlich – wer weiß?«
Ich tätschelte seine Schulter.
»Spiele deinen Anteil nicht herunter, sonst bist du ja auch nicht so bescheiden. Vielleicht kann ich mich einmal erkenntlich zeigen.«
»Bei Castor und Pollux, hoffentlich nicht! Dieser Krieg wird doch jetzt zu Ende sein – oder?«
Er war es noch nicht ganz, aber nach dem Selbstmord von Kleopatra und Marcus Antonius zogen wir siegreich in Alexandria ein.
Mein erster Gang führte natürlich zum Museion wegen der dortigen berühmten Ärzteschule. Obwohl wir nichts Militärisches an uns trugen, so waren wir an unserer Kleidung doch leicht als Römer zu erkennen, und plötzlich stürzte sich ein Wahnsinniger auf den neben mir gehenden Gallus und stach ihm einen Dolch in die Brust. Er holte gerade zum zweiten Stoß aus, da schlug ich ihm mit der Handkante auf die empfindliche Halsader, und er fiel um, wie vom Blitz getroffen. Zum Glück erschien kurz darauf eine römische Streife. Ich wies mich aus, gab kurzen Rapport, und der Mann wurde abgeführt.
Gallus trug man gleich ins Museion, wo sich nach und nach ein Dutzend Ärzte um ihn versammelte, die – das möchte ich schon erwähnen – in den folgenden Tagen alles unternahmen, um diesen Römer zu retten, wohl auch, weil er so etwas wie ein Kollege war. Der lange dünne Dolch war haarscharf am Herzen vorbei in den linken unteren Lungenlappen gedrungen, was zwar keine tödliche Verletzung war, aber durch eine Entzündung des Wundkanals leicht zu einer hätte werden können. Anfangs schien es auch so, das Wundfieber brachte Gallus zum Zittern und Glühen, er begann zu phantasieren und um sich zu schlagen. Die griechischen Ärzte setzten ihren ganzen Ehrgeiz daran, um meinen Diener zu retten, und nach elf Tagen Krankenlager konnte er aufstehen und die ersten, noch wackeligen Schritte erproben.
Von da an hatten wir beide genug vom Soldatenleben, und ich reichte meinen Abschied ein. Der wurde ehrenvoll gewährt, und für mich und wohl auch für Gallus war es keine Frage mehr, daß wir auch künftig zusammenbleiben wollten.
Mein Vater war so froh und erleichtert, daß ich gesund zurückkehrte, daß er mir seine taberna überließ und sich nach Tibur ins Privatleben zurückzog.
Kapitel 2
Besser hätte ich es nicht treffen können, denn die meisten Patienten meines Vaters blieben auch dem Sohn treu und ich tat alles, um sie nicht zu enttäuschen.
Die Praxis lag nahe der Pons Fabricius, gegenüber der Tiberinsel mit dem Aesculapius –Tempel – ein Gebiet, wo auch viele Kollegen ihre tabernae unterhielten. Eine geräumige Wohnung im angebauten Nachbarhaus war mit der Praxis verbunden; hier bewahrte ich meine stets wachsende Bibliothek auf, und für Gallus gab es zwei Räume mit einem eigenen Eingang von der Rückseite, so daß er seine schnell wechselnden Liebschaften ungestört und ungesehen ins Haus bringen konnte.
So lebten und arbeiteten wir während der nächsten Jahre in Eintracht und ungetrübter Freundschaft, bis das Unheil mit einer Patientin begann, die aus einer Nebenlinie des julischen Hauses stammte.
Damals war Julia schon länger geschieden, und zwar aus Gründen der julischen Familienpolitik. Ihr Gatte hatte sich verspekuliert, seinen Besitz und damit die Ritterwürde verloren, die ja ein Mindestvermögen von 500 000 Sesterzen erfordert. Hätte man ihm geholfen, wäre bei seinem Naturell zu erwarten gewesen, daß auch dieses Geld sich verflüchtigte wie Spreu im Wind. So zahlten sie ihm eine Abfindung, und er willigte in die Scheidung ein.
Schon bei ihrem dritten Besuch ging das Gespräch zwischen Julia und mir weit über die üblichen Worte zwischen Arzt und Patientin hinaus. Wir sprachen über unsere Vergangenheit und hatten dabei mehr und mehr eine gemeinsame Zukunft im Auge.
Bei meinen Hausbesuchen in ihrer kleinen Villa am Forum Julium lernte ich eine Welt kennen, die mir bisher verschlossen gewesen war – die der altrömischen Nobilität. Freilich hatte ich so manche Patriziervilla betreten dürfen, aber nur als Arzt, um einem bettlägerigen Kranken den Puls zu fühlen oder seinen Urin zu betrachten. Danach brachte mich der Majordomus sogleich wieder zur Pforte.
Julia war nach ihrer Scheidung in dieses bescheidene alte Haus zurückgekehrt, das ihr ein kinderloser Onkel mit der Bedingung vermacht hatte, die darin zusammengetragene kleine, aber sehr feine Kunstsammlung zu hüten und sie für einen geeigneten Nacherben zu bewahren.
Staunend stand ich vor diesen erlesenen Zeugnissen griechischer, etruskischer und auch ägyptischer Kunst, die – man sah es ihr an – ohne besonderes System, aber mit Liebe und Kennerschaft zusammengetragen worden war. Da ich von diesen Dingen nicht allzuviel verstehe, erklärte Julia mir im Vorbeigehen dieses oder jenes, wies auf Skarabäen in Regalen, auf schöngeformte etruskische Öllampen, zeigte mir im ›Saal der Büsten‹ einige griechische Originale, darunter die Bildnisse von Homer, Hesiod, Sappho, Platon und anderen hellenischen Dichtern und Philosophen. Das winzige Atrium bot gerade Platz für ein halbes Dutzend lebensgroßer Marmor- und Bronzestatuen, wobei mir ein bronzener Poseidon mit Dreizack wegen seiner altertümlichen Form besonders auffiel. Auch Malereien gab es dort, griechische, etruskische und römische, meist von Wänden abgelöste Fragmente, darunter eine eindrucksvolle Darstellung des großen Alexander zu Pferd.
Damals war Julia schon meine Geliebte geworden, doch unsere Begegnungen hatten immer nur in meiner taberna stattgefunden und waren so heftig wie kurz gewesen, weil wir stets mit einer plötzlichen Störung rechnen mußten. Nun, Gallus wachte wie Cerberus vor meiner Tür und hatte die Aufgabe, etwaige neu erscheinende Patienten mit Vorwänden hinzuhalten.
Hier aber, im Hause von Julia, waren wir allein, ungestört, aber auch in einer anderen Situation, die mich befangener, sie hingegen sicherer machte.
Auf den ersten Blick war an Julia nichts Besonderes. Für eine Frau war sie groß gewachsen, besaß einen kräftigen, doch sehr anmutigen Körper mit üppigen Schenkeln und Brüsten. Ihr rundes Gesicht mit vollen Lippen und nicht zu kleiner, doch schmaler und wohlgeformter Nase ließ sie wie eine Inkarnation der Juno erscheinen, dieser altrömischen Gottheit, die hier als Stadtherrin Juno Regina verehrt wird und zugleich als Juno Moneta die Patronin der Münzstätte ist.
Nach kurzer Besichtigung der Kunstsammlung führte Julia mich in ihre privaten Wohnräume, wo – es war in der kalten Jahreszeit – einige kleine fornacis vor sich hin glimmten und einen Hauch Wärme um sich verbreiteten. Sklaven waren keine zu sehen, so daß ich annahm, Julia wollte mit mir ungestört sein. Auf zwei niedrigen Tischen – aus Zedernholz mit zierlichen Mosaiken geschmückt – stand ein Imbiß bereit, und als sie mich mit einer anmutigen Bewegung einlud zuzugreifen, fühlte ich plötzlich nagenden Hunger. Sie sah und spürte meine Befangenheit, und als wir später über den Grund sprachen, meinte Julia, in dieser anderen, mir fremden Umgebung, sei etwas von meiner ärztlichen auctoritas verlorengegangen, die ich bei den flüchtigen Liebesstunden in meiner Praxis sozusagen mit einbezog, oder anders ausgedrückt: Ich hätte den Phallus als Arznei verwandt, was damals nicht unbedingt falsch gewesen, als Dauerbehandlung aber nicht geeignet sei.
Im stillen gab ich ihr recht, doch meine schon vorhandene tiefe Zuneigung verweigerte das Einverständnis, und ich wich auf die – übrigens durchaus wahre – Behauptung aus, ich hätte während meiner ganzen ärztlichen Laufbahn noch niemals die Behandlungsräume für Liebesstunden verwendet, und diese Ausnahme zeige nur, daß es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick durchaus gebe.
Wir aßen und tranken, und der dieser Jahreszeit angemessene heiße Würzwein brachte meine Gefühle in Wallung, und meine Befangenheit löste sich auf wie der Rauch nach vollzogenem Opfer.
Sie führte mich ins cubiculum und sagte, dies sei der einzige Raum, den sie hier nach ihrem Geschmack neu eingerichtet habe, – und in diesem Bett habe noch nie ein Mann gelegen. Ich fühlte mich sehr geehrt und entkleidete meine Juno voll Verlangen, und da wir beide vor Erwartung glühten, fiel uns nicht auf, wie kalt es in dem ungeheizten Raum war.
Julia gehörte offenbar zu den Frauen, die sich schon lange vorher innerlich auf die kommende Liebesstunde einstellen, so daß es keines langen Vorspiels bedarf, sie zu erwecken. Sie war bereit, mehr als bereit, und so versank ich in diesem weichen Junokörper mit den vollen Brüsten und den üppigen Schenkeln, die mich wie weiche warme Kissen umklammerten, während ich ihren Schoß durchpflügte, wie ein Landmann die warme, feuchte und duftende Erde im Latium.
Ja, wir genossen sie sehr, diese körperliche Liebe, aber sie war uns nicht das Wichtigste, denn es konnte ebensogut geschehen, daß wir nur beieinandersaßen, aßen, tranken, redeten und danach nicht weniger zufrieden waren als nach einer Liebesstunde. Nun, wir waren beide keine jungen Leute mehr, und in der zweiten Lebenshälfte hatte sich unsere Einstellung zu vielen Dingen des Daseins geändert.
Wir trafen uns nun regelmäßig in dem kleinen Haus am Forum Julium, nicht ahnend, daß wir längst beobachtet wurden und Julias Familie auf Gegenmaßnahmen sann. Wir kannten uns etwa ein halbes Jahr – inzwischen war es Sommer geworden –, als die ersten Warnzeichen kamen. Julia nahm sie, wie es schien, weniger ernst als ich.
»Meine Familie hat einen neuen Mann für mich gefunden«, berichtete sie so unbefangen, als ginge es um den Kauf einer Ackerparzelle. Mich traf die Nachricht wie ein Schlag, und der heitere, sonnige Julitag draußen schien mir plötzlich wie ein Hohn. Die Sonne hätte verlöschen, Sturm und Gewitter aufziehen müssen, um sich dieser schrecklichen Lage anzupassen. Daß ein über vierzigjähriger Mann noch so kindische Gedanken hegen kann, ist kaum vorstellbar, aber ich gebe meine Stimmung wieder, wie sie damals war. Zuerst brachte ich kein Wort heraus und begann dann hilflos zu stottern:
»Aber – aber – da – das geht doch nicht! Sie können – sie dürfen – sie dürfen dich nicht –«
»Beruhige dich, mein geliebter Heilkünstler. In der ars medicina bist du geschickter als im praktischen Denken. Ich nehme diese Ankündigung vorerst nur als Warnung, nicht einmal als Drohung. Unser adelsstolzer pater familias – ich habe dir schon von diesem Großonkel erzählt – deutete an, daß mein Umgang in gewissen Kreisen Anstoß errege und ich es ihm und der gens Julia schuldig sei, mein Verhalten zu ändern. Wenn nicht, werde er, im Einverständnis mit meiner Mutter, für mich einen geeigneten Mann suchen müssen – eine Überlegung, die er schon länger und unabhängig von meiner Lebensführung angestellt habe.
Lebte mein Vater noch, ginge das nicht so leicht, aber meine Mutter unterwirft sich in fast allem den Wünschen dieses Tattergreises, der geistig noch in der Zeit des alten Sulla lebt. Jedenfalls dürfen wir nicht den Fehler begehen und so tun, als gäbe es ihn und seine Zuträger nicht. Ich werde mich einige Wochen an den Lacus Sabatinus zurückziehen, wo eine Freundin ein Sommerhaus besitzt und wo es, soviel ich weiß, im Umkreis weder Villen noch Landgüter der Julier gibt – übrigens eine Seltenheit in der Umgebung Roms. Dort könnten wir uns treffen und ungestörte Tage verbringen. Du solltest deine taberna schließen und das Gerücht ausstreuen, eine dringende Familienangelegenheit habe dich nach Alexandria gerufen.«
Ich sah, welche Freude es ihr bereitete, diese Pläne zu schmieden, konnte mich aber fürs Erste nicht damit anfreunden. Meinen Hinweis auf hilfesuchende Patienten, die vor verschlossener Tür stehen würden, tat sie ab.
»Wer ist im Juli und August schon in Rom? Wichtige Leute jedenfalls nicht, und dazu gehören doch fast alle deine Kunden.«
Da hatte sie freilich recht, und sie setzte noch eines drauf.
»Außerdem verbringt mein lästiger Großonkel den Sommer wie stets in Baia, wo sich um diese Zeit halb Rom aufhält. Es könnte für uns gar nicht günstiger sein!«
Sie riß mich mit, ich gebe es zu, außerdem dachte ich, es würde mir guttun, einmal meine in letzter Zeit stark frequentierte Praxis zu schließen und mir eine Erholung zu gönnen. So instruierte ich Gallus, schrieb ihm die Namen einiger Patienten auf, die sich regelmäßig bestimmte Arzneien abholten, und bereitete sie im Voraus zu. Aus ihm war inzwischen ein halber Arzt geworden, der jedoch genau seine Grenzen kannte.
So trat ich die Reise zum Lacus Sabatinus an, anfangs mit einem leisen Unbehagen, wenn ich an meine taberna und den alleingelassenen Gallus dachte. Doch wie das so ist: Je größer der Abstand zu Rom wurde, um so mehr fielen die Sorgen von mir ab; zudem ich dann einen halben Tag damit beschäftigt war, die im Uferdickicht versteckte Sommervilla zu finden.
Das zum Teil aus Holz erbaute Haus ragte tief in einen Schilfgürtel hinein, so daß es vom Eingang her eher bescheiden wirkte, während es sich im Innern als sehr geräumig, aber auch sehr verwinkelt erwies. Offenbar hatten seine Besitzer es mit den Jahren durch willkürliche Zubauten erweitert, ohne nur im geringsten auf ein architektonisches Konzept zu achten.
Vor der Tür erwartete mich eine weibliche Gestalt unbestimmten Alters, nämlich – wie Julia mich vorbereitet hatte – die Sklavin Servilia, derzeit einzige Bewohnerin und Hüterin des Hauses. Ihr Gesicht war durch eine Hasenscharte stärkster Ausprägung entstellt, mit gespaltener Oberlippe, die sich, wie ich wohl wußte, in einer Gaumenspalte fortsetzte. Auf dieser zweigeteilten Lippe sproß zudem noch ein stattlicher schwarzer Bart. Sie redete auf mich ein, aber ich hörte nur ein unverständliches Quäken, denn nichts anderes bringen Menschen mit einer solchen Mißbildung zustande. Ihr Körper aber war schlank und wohlgestaltet, die kurze Sklaventunika zeigte schöngeformte, von der Sonne gebräunte Beine.
Mit diesem Wesen sollte ich nun ein paar Tage hier alleine hausen, denn Julia hatte es für sicherer gehalten, nicht beide gleichzeitig aus Rom zu verschwinden.
Servilia ging unentwegt quäkend vor mir her und führte mich durch dieses seltsame Hauslabyrinth in das für mich vorgesehene Zimmer, dessen eines Fenster zum See, oder besser gesagt auf ein Schilfdickicht schaute.
Es war ein sehr heißer Tag gewesen, und das niedrige Haus speicherte die Wärme noch für einige Stunden auf. Ich versuchte, Servilia verständlich zu machen, daß ich baden, mich waschen, mich abkühlen wollte. Schließlich verstand sie meinen Wunsch, nickte eifrig, quäkte vor sich hin und winkte mir, ihr zu folgen.
An der Westseite des Hauses führte eine Tür ins Freie und zu einem langen schmalen Steg, der durch den Schilfgürtel ins Wasser führte. Da es schon dämmerte, konnte ich die Bohlen nur undeutlich erkennen, doch einige davon knackten so bedenklich, daß ich schließlich wie ein Seiltänzer voranschritt, vorher jedes einzelne Brett auf seine Trittfestigkeit prüfend. Das angenehm kühle Wasser erfrischte und belebte mich, und ich schwamm und planschte so lange darin herum, bis mir die Zähne klapperten.
Am Steg erwartete mich Servilia mit einem Trockentuch und begann, mich sorgsam abzureiben – Hals, Rücken, Brust, Bauch … Als sie sich quäkend und kichernd zwischen meinen Beinen zu schaffen machte, nahm ich ihr das mantele schließlich aus der Hand. Sie gab es nicht gerne her, die gute Servilia, aber einen gewissen Abstand wollte ich doch gewahrt wissen.
Die Zeit allein in dem Haus, bis Julia nachkommen sollte, gehörte zu den seltsamsten meines Lebens. Jeder Tag brachte eine Überraschung besonderer Art, angefangen nach dem erfrischenden Bad, als ich in der cenatio eher skeptisch auf die Erzeugnisse von Servilias Kochkunst wartete. Es gibt Berufe und Berufungen. Zum Dichter etwa muß man berufen sein – erlernen läßt sich diese Kunst nicht. Auch berufene Ärzte gibt es oder Gärtner mit der berühmten grünen Hand. Servilia, die vermutlich zeitlebens nie über das Gebiet des Lacus Sabatinus hinausgekommen war, erwies sich als zur Kochkunst berufen.
Es begann mit einer Kräutersuppe, und ich dachte mir, nun, das könnte ein Zufall sein. Gemüse und Kräuter gab es hier im Überfluß, und da hatte sich wohl von selbst eine ländlich-lokale Kochkunst mit wohlschmeckenden Gerichten entwickelt. Was dann aber folgte, paßte kaum in dieses Schema. Es gab gebratene Drosseln oder Wachteln mit einer unglaublich raffinierten Füllung aus Kleingehacktem, das nicht zu identifizieren war, aber köstlich schmeckte. Dazu reichte Servilia eine grünliche dicke Brühe, aus der ich Erbsen, Knoblauch, Kümmel, Basilikum und Pfeffer herausschmeckte, die aber gewiß noch anderes enthielt. Danach gab es eine Art Aalsuppe, das heißt, in einer nicht sehr einladend aussehenden graugrünen Flüssigkeit schwammen bleiche Stücke von gekochtem Aal, und der Geschmack war einfach überwältigend. Die Brühe schmeckte nach Wein und süßlicher Schärfe, aber ich bezweifle, ob einer der berühmten römischen Köche alle ihre Zutaten herausgeschmeckt hätte.
Ich lobte Servilia in bewegten Worten, und obwohl sie mich wohl kaum verstand, wird sie dem Ton und der Gestik meine begeisterte Zustimmung entnommen haben.
Von der Reise und den genußvollen Speisen ermüdet, ging ich in mein Zimmer, das heißt, Servilia führte mich wieder dorthin, da ich es alleine kaum gefunden hätte. Sie deutete aufs Fenster, quäkte, zischte, bewegte die Arme wie Flügel und tippte mit dem Zeigefinger auf Gesicht, Arme und Beine. Erst als sie mir eine tote Stechmücke unter die Nase hielt, verstand ich, was sie meinte. Dann nahm sie ein Salbgefäß vom Tisch, tunkte den Finger hinein und rieb es mir auf den Arm. Ein scharfer Geruch nach menta und melisphyllum stieg auf – Mückensalbe, die ich in ähnlicher Form auch meinen Patienten verschrieb.
Ich nickte, und schon fuhr sie mit dem Daumen in die Salbe, kniete nieder und begann, in Windeseile meine Waden und Schenkel einzureiben, hatte schon zielsicher unter dem üblichen Kichern und Quäken mein Geschlecht ergriffen, bevor ich mich ihr entziehen konnte. Ich trat zurück, nahm das Salbtöpfchen und wies auf die Tür.
»Gute Nacht, Servilia, und vielen Dank. Ich mache das schon alleine …«
Sie grinste, daß ihre Lippenspalte sich öffnete wie ein zweiter Mund, quäkte etwas und verschwand.
Ich schlief wunderbar bis in den Morgen hinein, fand dann durch Zufall, oder weil ich die Richtung behielt, den Ausgang zum See und schwamm munter wie ein Fisch zwei oder drei Stadien hinaus. Als ich umkehrte, sah ich schon Servilias Gestalt klein und fern am Ende des Steges warten. Mich fror etwas und ich schnappte nach Luft, als ich zu ihr emporkletterte, empfangen von fröhlichem Gequäke und einem großen Tuch, das ich ihr diesmal gleich aus der Hand nahm.
Zum Frühstück gab es frisches Weißbrot, Fruchtsäfte und ova spongia ex lacte, süße Pfannkuchen, heiß und frisch aus der Pfanne, mit Honig übergossen und mit Pfeffer bestreut.
Danach holte ich mein Maultier aus dem Stall – der groß genug war für zehn Pferde und zehn Esel – und ritt in den sonnigen Morgen hinein, der nach der Nachtfrische wieder einen heißen Tag versprach. Ich nahm den Weg hinauf in das Hügelland der Montis Sabatinis, durchquerte Wälder, Äcker und Felder und fand überall die Spuren bäuerlicher Frömmigkeit. Hier waren am Feldrand Steine aufgetürmt und mit Feldblumen geschmückt, dort hingen an einem uralten Baum farbige Bänder, auch winzige Wegkapellen begegneten mir, mit kleinen rohen Figuren lokaler Gottheiten, die man in Rom so wenig kannte, wie hier den kapitolinischen Jupiter. Mit den hehren Staatsgöttern waren die bukolischen Menschen hier nicht vertraut, sie richteten ihre Gebete an die alten, vermutlich noch etruskischen Wald-, Feld-, Fluß- und Quellengottheiten und legten kleine Opfergaben vor die bescheidenen Altäre.
Die Mittagshitze trieb mich bald wieder zurück, und ich verschlief den ganzen Nachmittag.
Das Hauptgericht an diesem Abend war geschmortes Kaninchen in einer köstlichen Kräutertunke, gefolgt von einer flaumleichten, nach Honig, Pfeffer und gemahlenen Pistazien schmeckenden Süßspeise. Als Servilia das Geschirr abtrug, glaubte ich aus der Küche Stimmen zu vernehmen, und tatsächlich erschien sie kurz darauf mit einem zwölf- oder dreizehnjährigen Mädchen an der Hand. Sie schien Servilias knappe Tunika von gestern zu tragen, doch ihre knospenden Brüste waren kaum zu sehen und die mageren Schenkel verrieten das noch wachsende, keineswegs zur Frau erblühte Kind.
Servilia deutete auf ihren Schoß und dann auf das Mädchen, das seinen Kopf gesenkt hielt. Was wollte sie damit sagen? Sollte es heißen, dies ist meine Tochter, sie kam aus meinem Leib oder –? Doch ich wurde des Nachdenkens enthoben, denn Servilia hob die knappe Tunika der Kleinen und schob sie in meine Richtung.
Ich stand auf und sagte:
»Servilia, du solltest dich schämen! Hältst du mich für einen Kinderschänder?«
Ich holte ein paar Sesterzen aus dem Beutel und drückte sie dem Mädchen in die Hand.
»Hinaus mit euch, aber sofort!«
Als Servilia zögerte und zu quäken begann, griff ich nach meinem Tunikagürtel; diesen Wink verstand sie gleich und zerrte die Kleine zur Tür.
Das ist nun ausgestanden, dachte ich erleichtert und hoffte inständig, Julia möge bald erscheinen. Stattdessen kam am nächsten Tag ein Bote mit einem Schreiben von Julias Freundin, der das Haus gehörte. Julia lasse mir ausrichten, sie käme vier Tage später als besprochen. Auch gut, dachte ich, ein paar Tage mehr oder weniger, hier ist es so ruhig und erholsam und Servilia habe ich in ihre Schranken gewiesen.
So schien es jedenfalls, denn am nächsten und übernächsten Tag verhielt sie sich mustergültig, kochte, als müsse sie eine fürstliche Tafel versorgen, und machte sich ansonsten unsichtbar. Ich schwamm viel, las mit Begeisterung in den Werken des Catullus, den ich für den genialsten, aber auch frechsten römischen Dichter der Gegenwart halte. Daß er schon über zwanzig Jahre tot ist, tut dem Wert seiner Werke keinen Abbruch, denn er starb als Dreißigjähriger, und seine Dichtung scheint mir immer noch so frisch und gegenwärtig, daß sie wohl auch die kommenden Jahrhunderte überdauern wird.
Am Tag darauf hatten sich gegen Morgen schwere Wolken zusammengezogen, die Luft hing in feuchten Schwaden drückend über dem See, und während ich neugierig und voll Vorfreude auf Servilias mittägliche Überraschungen wartete, warf Jupiter Bündel von Blitzen über das Land, die den Speiseraum, das triclinium, für kurze Augenblicke in grelles unwirkliches Licht tauchten. Unmittelbar darauf ließen schwere, dumpf hallende Donnerschläge das Haus erzittern. Vom Boden her spürte ich ein leises Beben, als rege sich da unten ein riesiges Tier. Angst vor Gewittern habe ich nie empfunden, vielleicht weil mir dieses Phänomen wahrend meiner Kindheit unbekannt war. In Alexandria gehören solche Ereignisse zu den Seltenheiten, ausgenommen des im Delta während der Wintermonate einsetzenden Regens, der aber sanft und stetig fällt und weder Blitz noch Donner braucht, um sich theatralisch anzukündigen. Ja, ich gebrauche dieses Wort, denn so ein Donnerwetter hatte für mich immer etwas von einem Theaterereignis, nicht ganz wirklich und ohne direkten Bezug zu meiner Person. Vielleicht muß man in Ägypten aufgewachsen sein, um zu verstehen, was ich meine.
Servilia empfand das freilich anders. Ich sah, wie sie geduckt ins triclinium kam, wie sie bei jedem Donnerschlag zusammenzuckte und beim Blitz ihr Gesicht mit beiden Händen bedeckte. Vor dem Fenster sank sie auf die Knie, hob die Hände und begann laut zu beten, während ich hoffte, daß der für Blitz und Donner zuständige Gott ihr verzweifeltes Quäken gnädig erhörte. (Später sagte mir übrigens Julia, daß ich Servilia auch ohne Hasenscharte nicht verstanden hätte, weil sie einen alten etruskischen Dialekt sprach.)
Nun gut, auch dieses Gewitter zog vorbei, der Himmel hellte auf, der Donner verklang im Süden mit einem leisen fernen Grollen.
Am nächsten Tag erschien Julia und schüttete mir sogleich ihr Herz aus.
»Da nun mein Großonkel in Baia ist, hatte ich gehofft, für ein paar Wochen Ruhe zu haben, aber ich werde das Gefühl nicht los, daß er aus seiner clientela ein paar Leute beauftragt hat, mich nicht aus den Augen zu lassen. Zuerst ist es meiner Sklavin – die kleine schlaue Phryne, du kennst sie ja – beim Einkaufen auf dem Markt aufgefallen, daß uns ein Mann ins dichteste Gedränge folgte, aber stets einen gewissen Abstand hielt. Dieser Mensch trieb sich dann auch vor meinem Haus herum, aber ich wagte es nicht, ihn anzusprechen. Vor drei Tagen dann erschien ein advocatus bei mir, sagte, er käme im Auftrag des Großonkels und wolle mir eine eheliche Verbindung vorschlagen, die von Vorteil für alle sei. Ob das auch für mich gelte, fragte ich ihn. Nun, gewissermaßen schon, meinte er, weil es meinen guten Ruf wiederherstelle, der bei einer geschiedenen Frau ohnehin angeschlagen sei … Da verlor ich die Beherrschung und schrie ihn an, daß auch mein erster Mann mir aufgezwungen worden sei, wie ihm dann die Scheidung. Alles über meinen Kopf hinweg – immer zum Wohl der Familie! Ehe er noch weiterreden konnte, warf ich ihn hinaus.«
»Aber hierher ist dir niemand gefolgt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, das hätte ich gemerkt.«
Im Laufe der folgenden Tage beruhigte sie sich wieder, und es wurden recht schöne Ferien mit lustvollen Nächten und dank Servilias Kochkünsten genußreichen Tagen.
Kapitel 3
In Rom erwartete mich eine böse Überraschung: Meine taberna war völlig ausgebrannt. Ein verhärmter und niedergeschlagener Gallus streckte mir seine dick verbundenen Hände entgegen.
»Lauter Brandblasen bis hinauf zu den Ellbogen …« Wir gingen in unsere Wohnung, die zum Glück verschont geblieben war, und Gallus ließ sich erschöpft auf einen lectus fallen.
»Ach, Herr, es ist alles so traurig, so unverständlich … Vorgestern kam ich von einem Krankenbesuch zurück – das war beim alten Festus, der immer will, daß wir ihm Wein als Arznei verschreiben –, räumte die Praxis auf und schloß die Fensterläden. Dann ging ich zu Bett und muß wohl schon einige Stunden geschlafen haben, als mich laute Rufe weckten. Ich warf mir die Tunica über und rannte hinaus. Da waren schon einige Nachbarn zusammengelaufen und im Licht ihrer Fackeln sah ich Rauch aus den Ritzen der Fensterläden hervorquellen.
Einer zog mich am Ärmel: ›Der Brand muß an der Rückseite entstanden sein, ich wohne hinter eurem Garten, wollte gerade die Fensterläden schließen, dann sah ich das Feuer …‹
Wir liefen hinters Haus, wo einige Nachbarn schon zu löschen begonnen hatten. Später kam noch die Feuerwache, doch da war in der taberna schon nichts mehr zu retten. Wenigstens konnten sie verhindern, daß auch noch die Wohnung ausbrannte.«