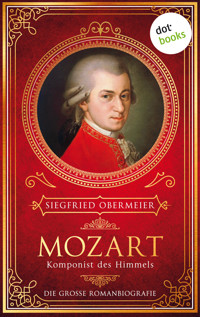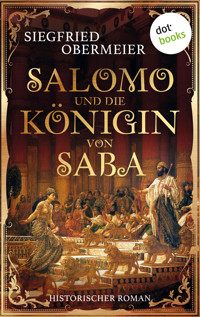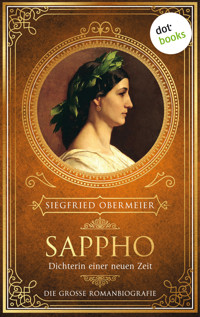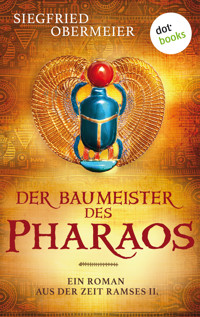4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er stellt seine Welt auf den Kopf, dieser ägyptische König Amenophis IV., der sich später Echnaton nennt. Seine Regierungszeit ist von dunklen Geheimnissen umgeben, er wird als maßlos beschrieben, als der Revolutionär und Visionär auf dem Pharaonenthron – als der Ketzerkönig, der durch seinen Sonnenkult radikal mit allen religiösen Traditionen Ägyptens brach. Spannend und kenntnisreich erzählt Siegfried Obermeier das Leben dieses wohl geheimnisvollsten aller Pharaonen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 885
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Siegfried Obermeier
Echnaton
Im Zeichen der Sonne
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560290-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Buch I
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Buch II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Nachwort
Personen
Namen und Begriffe
[Karte]
Buch I
Prolog
Niemals vergaß er diesen schrecklichen Augenblick, als sein Bruder mit ausgebreiteten Armen und einem vor Staunen und Schrecken verzerrten Gesicht vom Rücken des Pferdes durch die Luft flog und kopfüber im Sand aufschlug.
Amenhotep lachte. Was mußte der Kerl sich auch auf ein Pferd setzen! Das taten sonst nur Sklaven und Krieger, aber für einen Vornehmen galt es als unschicklich, für einen Prinzen gar als undenkbar. Nun, dieser Sturz würde ihn lehren, in Zukunft besonnener zu handeln. Amenhotep trat näher, zwei Leibdiener liefen herbei.
Thotmes, Erstgeborener des Guten Gottes und Herrn Beider Länder, des Sohnes der Sonne und Starken Stieres Neb-Maat-Re Amenhotep, war auf einen im Sand verborgenen Stein geprallt, hatte sich den Schädel eingeschlagen und zudem das Genick gebrochen. Sein jüngerer Bruder Amenhotep wurde dadurch zum Thronfolger, und die Geschichte des Landes Kemet nahm einen anderen Verlauf.
Dabei hatte alles so fröhlich und hoffnungsvoll begonnen. Vor drei Jahren hatte der König seinen Erstgeborenen nach Men-nefer geschickt, der «Stadt mit den weißen Mauern» am Eingang zum fruchtbaren Delta des Nils. Dort stand der alte Tempel des Schöpfergottes Ptah, als dessen «lebende Seele» der Apis-Stier verehrt wurde. Der König hatte Thotmes dort zum Hohenpriester ernannt, weil, wie er sagte, es gut sei, in der früheren Reichshauptstadt einen Fuß am Boden zu haben. Als der König nun immer kränker und hinfälliger wurde, wollte er den Thronfolger um sich haben, und so sandte er seinen Zweitgeborenen in die «Weiße Stadt», damit er das Amt des Bruders übernehme.
Zuerst zeigte sich der Sechzehnjährige keineswegs erfreut. Er war ein stiller, nachdenklicher Junge, der sich viel mit Geschichte, alten Legenden und den verwickelten Götterlehren befaßte – alles in allem das genaue Gegenteil seines lauten und lustigen Bruders, der in seiner lärmenden, großtuerischen Art eher dem Vater nachgeriet.
Der Gute Gott Nebmare Amenhotep scherte sich wenig um Dinge, die sich außerhalb des Landes Kemet abspielten. Um diese Welt der Fremdländer – wenn es denn nötig war – kümmerte sich sein Wesir Ramose, während der Herrscher um sich und seinen Hof eine ungeheure Pracht entfaltete.
Mit seiner mittelgroßen Gestalt und dem gedrungenen, muskulösen Körper wirkte der König derb, fast ein wenig bäurisch, was der breite, schwere Kopf noch unterstrich. In seinem Gesicht lagen die großen klugen Augen im Widerstreit mit der kurzen, schön geformten Nase und dem breiten Genießermund über dem kräftigen Kinn. Dieser Mund redete gern, prahlte mit Großtaten auf den Gebieten der Jagd, der Waffenführung und einer ungeheuren Baulust, die Waset auf dem anderen Ufer mit einem gewaltigen Tempel beschenkt hatte, während der König im Westen nicht gesonnen schien, jemals mit dem Bauen aufzuhören.
Sein genialer und namensgleicher Baumeister Amenhotep – genannt Huy – hatte in kürzester Zeit nahe dem Nil einen riesigen Totentempel aus dem Boden gestampft und vor die Pylonen zwei Monumentalstatuen des Königs gesetzt, aus einem Stück gearbeitet und über vierzig Ellen hoch. Die Ausmaße dieses Tempels übertrafen alles bisher Dagewesene, ja sogar – und gewiß nicht ohne Absicht – den Umfang der Amun-Heiligtümer auf dem Ostufer.
«Ja, das ist schon was!» hatte der König seinen Baumeister gelobt und ihm dabei freundlich die Schulter getätschelt. Der vielseitig gebildete Mann wurde mit Ehren und Besitztümern überhäuft und durfte sich sogar in der Nähe einen eigenen kleinen Totentempel neben seinem Grab erbauen.
Schon bald nach seinem Regierungsantritt begann der König sich auf der Westseite, etwa zwei Pfeilschüsse von seinem Tempel entfernt, einen Palast zu errichten, der im Laufe der Jahre die Ausmaße einer mittleren Stadt annahm und einen seltsamen Namen trug: «Das Haus des Königs erglänzt wie Aton.» Gleichzeitig waren Tausende von Arbeitern damit beschäftigt, im Osten dieses Palastes einen See auszuheben, den in wenigen Wochen ein Verbindungskanal zum Nil mit Wasser füllte. Warum er nicht wie seine Vorgänger auf der Ostseite residieren wollte und sich quasi im Reich des Totengottes Osiris niederließ, verriet Amenhotep nur engen Vertrauten, später auch seinen Söhnen, als sie ins verständige Alter kamen.
«Es ist Amuns wegen. Nicht daß ich den Gott fürchte oder ihn nicht verehre – nein, es betrifft seine Priester. Freilich, nach Brauch, Recht und Gesetz gibt es im Land Kemet nur einen einzigen Priester, und der bin ich.»
Er lächelte und hob seine großen, derben Hände, als wolle er um Verständnis bitten.
«Aber ich kann nicht überall sein, und so muß ich in den großen Tempeln von Junu, Men-nefer, Eschmun, Abidu und auch hier in Waset Stellvertreter ernennen. Amun ist mit den Jahren reicher und reicher geworden und mit ihm seine Priester, denen schon – so sagt man – gut ein Viertel unseres Landes gehört. Auf seine Weise ist Amun-Re ein König – ein König unter den Göttern. Der König auf Erden bin ich, aber es schickt sich nicht, daß zwei Könige auf dem gleichen Boden leben. Jetzt liegt der Nil zwischen uns, und wir stehen im besten Einvernehmen. Dir, Thotmes, rate ich, es später genauso zu halten, wenn ich meine Ewige Wohnung im Westen bezogen habe.»
Dem Zweitgeborenen nickte der König nur flüchtig zu. Was er dachte, schien nicht so wichtig, und so empfand es auch der junge Prinz und schwieg.
Dann stand die große Fahrt bevor, viele Reisetage auf dem Nil mit vielen Nächten dazwischen, bis die «Weiße Stadt» im Norden erreicht war. Der König hatte seinen Zweitgeborenen nur kurz verabschiedet.
«Du bist klug, gebildet, kennst dich bei den Göttern nicht weniger gut aus als in der Geschichte des Landes. Dein künftiges Amt als Hoherpriester des Ptah wird dir kaum Schwierigkeiten bereiten, und du darfst dich wie ein zweiter König fühlen. Ich regiere den Süden und du den Norden, und wenn dein Bruder mir nachfolgt, wird sich nichts daran ändern. Re möge dich begleiten und beschützen auf all deinen Wegen!»
Der Prinz stutzte. Der Vater hatte Re, den Sonnengott, um Schutz gebeten und nicht Amun-Re, seine Erscheinung als Widder. Er verneigte sich.
«Danke, Majestät. Ich werde mich bemühen, ein würdiger Nachfolger meines Bruders zu werden.»
Der König ging nicht auf den förmlichen Ton ein, sondern verzog den breiten Mund zu einem bübischen Grinsen.
«Das wird nicht schwer sein, mein Lieber. Thotmes ist mir zu ähnlich, so daß ich fürchte, er hat sein Amt nicht immer mit der gebotenen Würde ausgefüllt. Du bist eher deiner Mutter nachgeraten, du wirst es besser machen.»
Nur im engen Familienkreis zeigte der König dann und wann solche Anfälle von Ehrlichkeit. Nach außen aber, wenn es galt, sein hohes Amt als Guter Gott und Sohn der Sonne zu repräsentieren, vergab sich Amenhotep nichts. Etwa beim Opet-Fest, wenn in Waset alljährlich der Gott Amun seinen Südlichen Harim aufsuchte. Dann saß der König steif, würdig und allem Irdischen entrückt auf seinem von jungen Priestern getragenen Thronsessel, die Doppelkrone auf dem Haupt, Nechech und Heka – also Geißel und Szepter – vor der Brust gekreuzt, von Wedelträgern und Weihrauchschwenkern umringt. Da jubelte das Volk seinem Guten Gott zu, den es nur aus der Ferne und in Weihrauchwolken gehüllt vorüberschweben sah, wie es dem Sonnensohn gebührte – ihm, der mit den Göttern verkehrte wie mit vertrauten Freunden.
Das Innere des gewaltigen Palastkomplexes «Aton glänzt» war in vier Abschnitte aufgeteilt: der Bereich des Königs, einen für die Große Königliche Gemahlin und zwei kleinere Paläste für den Kronprinzen und den Wesir Ramose. Solange Prinz Amenhotep sich erinnern konnte, stand dieser Hofbeamte dem Vater zur Seite. Von seiner Anwesenheit war im Palast wenig zu bemerken, denn der Wesir besaß am Ostufer ein großes Haus, wo er sich häufig aufhielt und von dort seine Amtsgeschäfte führte.
Nachdem der König ihn verabschiedet hatte, suchte Amenhotep die Große Königsgemahlin Teje auf – seine Mutter, der er äußerlich weit mehr glich als der derben bäurischen Erscheinung des Vaters.
Sie führten ein langes, vertrautes Gespräch, bei dem meist der Prinz redete, während Teje ihre schrägen, dunklen Augen liebevoll auf den Sohn gerichtet hielt, der augenscheinlich eher ihr Fleisch und Blut war als Thotmes, der mit den Jahren immer mehr seinem Vater glich.
Die Königin legte zart eine Hand auf den Arm des Sohnes, so daß Amenhotep seine Rede unterbrach.
«So gesprächig bist du sonst nie», bemerkte sie, und ihr etwas strenger, skeptisch verzogener Mund löste sich zu einem Lächeln.
«Sonst hört mir ja keiner zu, und dann schweige ich lieber.»
«Gut, Meni, gut. Du sollst eines wissen: Ich lasse dich ungern ziehen, obwohl ich weiß, daß der König recht hat.»
Sie senkte ihre Stimme und beugte sich vor: «Deinem Vater geht es nicht sehr gut; er leidet unter der Gicht und seinen ewigen Zahngeschwüren. Die Ärzte können wenig für ihn tun … Du wirst gespürt haben, daß ich dich stets als meinen Sohn betrachtet habe, während dein Bruder in allem ein richtiges Vaterkind ist. Sie jagen und fischen gern, rasen auf klapprigen Wagen durch die Wüste, trinken mehr, als ihnen guttut, und daß Thotmes schon als Zwölfjähriger bei Sklavinnen lag, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Auch da hat dein Vater Beträchtliches geleistet.»
Ich selber bin auch nicht zu kurz gekommen, wollte sie hinzufügen, aber das gehörte sich nicht für Sohnesohren, und so dachte sie es nur.
Amenhotep schmerzte der Abschied von seiner Mutter, doch als er das wimpelgeschmückte, goldglänzende Staatsschiff betrat und die kleine Flotte ablegte, war sein Sinn nach vorn gerichtet, und unbändige Freude erfüllte ihn. Der König hatte dem Flottenführer Anweisung gegeben, zunächst an Men-nefer vorbeizufahren und erst bei dem weiter nördlich an einem Seitenarm des Nils gelegenen Sonnenheiligtum Junu anzuhalten.
Mit dieser Mitteilung hatte ihn der Vater verabschiedet.
«Du sollst im Norden zunächst die heiligste Stätte unseres Landes kennenlernen – Junu, wo Re zum ersten Mal am Horizont aufstieg hinter dem Urhügel, den dir die Priester dort zeigen werden.»
Mit einer lässigen Handbewegung schickte der König die gebückt herumstehenden Hofbeamten außer Hörweite und sagte leise: «Amun ist nur ein Nachkömmling, ein Usurpator, den es noch nicht gab, als die Priester in Junu schon die Sonne verehrten.»
Sein breiter Mund wölbte sich verächtlich nach unten.
«Dieser anmaßende Hammel ist groß und fett geworden, weil dumme Pilgerscharen ihn mästen. Wir brauchen ihn, Meni, aber wir müssen ihn nicht lieben.»
An diese verächtlichen Worte seines Vaters fühlte der Prinz sich erinnert, als er inmitten kahlköpfiger, weißgekleideter Priester durch einen Wald von Obelisken aus verschiedenen Zeiten die weitläufige Tempelanlage von Junu betrat. Beim Gang zum Allerheiligsten begleiteten Dutzende von Priestern aller Ränge den Prinzen, doch je näher sie der Wohnung des Gottes kamen, um so mehr mußten zurückbleiben, und als sie den schmalen, dämmrigen Raum betraten, war nur noch der Hohepriester an seiner Seite. Der verbeugte sich vor dem Kultbild, streckte beide Arme vor und rezitierte halblaut:
«Du bist Re, der Höchste der Götter,
der hold erscheint, dessen Anmut Liebe erweckt,
majestätisch mit deinen beiden Sonnen,
mit hohen Hörnern und spitzem Gehörn,
der Bart leuchtet, die Augen sind Weißgold, mit Türkis geschmückt,
Leuchtender mit goldenem Leib!
Seine Knochen sind aus Silber, seine Haut aus Gold,
seine Haare aus echtem Lapislazuli,
seine Zähne aus Türkis –
der vollendete Gott, der in seinem Leib wohnt.»
Danach waren sie in zeremonieller Runde bei einem Festmahl versammelt, und der junge Prinz hatte das respektvoll lauschende Priesterkollegium mit seinen genauen Kenntnissen über die Weltschöpfungslehre von Junu überrascht.
Der Hohepriester hatte seine Begrüßungsansprache mit den Worten begonnen:
«Waset, wo der Herr Beider Länder, dein göttlicher Vater – er lebe, sei heil und gesund – zum Nutzen des Landes Kemet regiert, steht ja ganz im Zeichen Amuns, während wir hier dem Alten, dem ganz Alten anhängen und Re-Atum als Schöpfer alles Irdischen verehren. Dieser ehrwürdige Gott nämlich hat sich …»
Amenhotep hob die Hand.
«Darf ich dich unterbrechen, Ehrwürdiger? Was du mir erzählen willst, ist mir wohlvertraut. Atum hat sich durch einen Willensakt selbst erschaffen und – um in einer noch nicht existenten Welt einen Standpunkt zu finden – gleich einen Hügel dazu. Durch Selbstbegattung zeugte er seinen Sohn Schu und seine Tochter Tefnut; diese wieder zeugten Geb und Nut, also die Erde und den Himmel. Die vier Kinder dieses Götterpaares hießen Isis, Osiris, Nephtys und Seth, und so kam die göttliche Neunheit von Junu zustande.»
Der verblüffte Hohepriester räusperte sich und wußte offenbar nicht mehr weiter. Schließlich sagte er höflich, wenn auch ein wenig mühsam: «Und später erschien der widderköpfige Amun, und …»
«Lassen wir Amun aus dem Spiel, wir sind hier nicht in Waset», sagte Amenhotep schroffer, als er beabsichtigte, und dachte bei sich: Vater hätte an mir seine Freude gehabt …
Auf dem kurzen Weg nach Men-nefer ging ihm eines nicht aus dem Kopf: Atum erschuf sich durch göttlichen Willen selbst. Schon sein Lehrer hatte ihn mit dieser Schöpfungsversion vertraut gemacht, aber ein Kind hört einfach darüber weg, weil die Welt so bunt, vielfältig und staunenswert ist, daß es alles beiseite schiebt, was der Verstand nicht – noch nicht – fassen kann. Jetzt, fast zehn Jahre später, hatten Wissen und Geist sich erweitert, aber dieser Schöpfungsvorgang entzog sich seinem Verständnis. Wer sich selber schuf, den muß es doch schon vorher gegeben haben! Nach langem Grübeln fand Amenhotep eine Lösung, auch wenn sie ihn nicht völlig befriedigte. Das ist, wie wenn ein Schreiner einen Stuhl macht. Ehe der Stuhl entsteht und im Materiellen existiert, gibt es ihn schon im Herzen des Handwerkers als Vorsatz, als Gedanke. Und so muß es auch mit Re-Atum gewesen sein: Er existierte nur als Gedanke im leeren Raum und schuf sich und den Urhügel durch einen Akt des Willens.
Das religiöse Sinnieren und Spekulieren verging dem jungen Prinzen von dem Augenblick an, als er seinem älteren Bruder gegenüberstand. Der gebrauchte den auch bei den Eltern üblichen Kosenamen.
«Meni! Bei Ptah und der schrecklichen Sachmet! Du bist ja gewachsen wie ein Schilfstengel nach der Nilschwelle! Wie geht es den Alten – ich meine natürlich Seiner Göttlichen Majestät und der Großen Königlichen Gemahlin? Der Vater, höre ich, hat schwer zu leiden unter …»
«Ja, Thotmes, dem König geht es nicht sehr gut. Nach und nach eitern ihm die Zähne heraus, die Glieder werden zunehmend unbeweglich, immer häufiger müssen die Diener ihm am Morgen aus dem Bett helfen. Freilich gibt es auch Zeiten, wo er sich besser fühlt, ja, sogar auf die Jagd ist er kürzlich gegangen, aber – nun ja …»
Thotmes grinste.
«Da ist wohl nicht mehr viel herausgekommen, oder? Nichts, was es wert wäre, einen Gedenkskarabäus auszugeben? Du wirst dich ja erinnern, oder warst du damals noch zu klein?»
Sie saßen in einem erlesen eingerichteten Raum eines Hauses, das der Hohepriester sich im Schatten des Tempels erbaut hatte. Er deutete auf ein Wandbord aus Ebenholz, das sich von der Tür bis zum Fenster zog.
«Da liegen sie alle aufgereiht, einer neben dem anderen und schön chronologisch.»
Er griff hinauf und nahm behutsam einen der handtellergroßen Skarabäen herab.
«Es begann, als er unsere Mutter heiratete, die liebliche Teje. Wie geht es ihr?»
«Sie ist gesund und läßt dich grüßen.»
Ein Grinsen flog über das breite Gesicht des Thronfolgers.
«Geht immer noch der Spruch um: Teje regiert den Palast und der Wesir das Land?»
Amenhotep kannte dieses Gerede, aber er wollte seinem Bruder nicht den Gefallen tun, es zu bestätigen.
«Davon weiß ich nichts. Du solltest mich jetzt in mein künftiges Amt einführen …»
Thotmes legte den Gedenkskarabäus zurück.
«Hat das nicht noch Zeit? Schließlich bist du eben erst angekommen. Heute feiern wir unser Wiedersehen, und morgen zeige ich dir die lebende Seele des Ptah – den Apis-Stier und seinen erlesenen Harim.»
Amenhotep ging hinter seinem Bruder her, und wieder fiel ihm die Ähnlichkeit mit dem Vater auf: der feste, stampfende Gang, das leichte Wiegen der Schultern, und sogar die tiefe, rauhe Stimme des Königs – wenn auch mit hellerem Klang – hatte der jetzt Achtzehnjährige geerbt.
Da wird sich später nicht viel ändern, dachte Amenhotep. Wenn Thotmes auf dem Horus-Thron sitzt, wird es sein, als hätte Vater sich unter einem anderen Namen verjüngt. Dieser Gedanke beruhigte ihn, weil er selber nicht nach der Doppelkrone strebte, froh und dankbar war, diese Last nicht tragen zu müssen. Ihm schauderte, wenn er daran dachte, wie er als König bei den großen Festen dem Volk in starrer Haltung als lebende Gottheit vorgeführt werden würde und daß er diese Pose oft mehrere Stunden lang durchhalten müßte. Dem Vater fiel dies zunehmend schwerer, und schon beim Sed-Fest zur Feier des dreißigsten Regierungsjahres hatte er – zum Entsetzen der Amun-Priester – die Zeremonie beträchtlich abgekürzt.
Als sie einen kleinen Innenhof durchquerten, blieb Thotmes stehen und wies auf eine Nische in der Wand. Amenhotep trat näher. Da stand ein kleiner Sarg aus Sandstein, auf dem eine Katze mit Halsband abgebildet war, die vor einem mit Speisen überladenen Tisch saß. Dahinter war sie als Mumie dargestellt mit der Inschrift darüber: «Der Osiris Ta-Miat, der Gerechtfertigte.»
«Meine Lieblingskatze», erläuterte Thotmes, «sie ist vor zwei Monaten gestorben. Eine große Jägerin …»
Zu seinem Erstaunen sah Amenhotep, wie die Augen seines Bruders feucht wurden und er sein Gesicht abwandte.
«Geht es dir so nahe?»
Thotmes nickte.
«Miat hatte in meinem Herzen einen großen Platz. Wenn ich mit ihr redete, schloß sie halb ihre Augen, und es sah aus, als verstände sie jedes Wort. Vielleicht war es tatsächlich so … Ich hoffe, daß sie auch im Jenseits reichlich Mäuse zu jagen hat.»
Dann gingen sie schnell weiter.
Die von Thotmes ausgerichtete Wiedersehensfeier fand in der großen Festhalle statt, die an die Ostmauer des Tempelkomplexes angebaut und – der Kühle wegen – nach Norden ausgerichtet war.
Alles, was in Men-nefer Rang und Namen besaß, war dazu geladen, vor allem die drei «Propheten des Ptah», die den Apis-Stier betreuende Priesterschaft, die Tempelverwalter, dazu die unteren Ränge der Opfer-, Ritual-, Vorlese-, Reinigungs- und Balsamierungspriester. Diese etwa hundert Menschen stellten nur einen kleinen Teil derer dar, die im oder am Tempel beschäftigt waren, und nicht einmal Thotmes kannte ihre genaue Zahl. Als sein Bruder ihn fragte, hob er gleichgültig die Schultern.
«Was weiß ich, so um die tausend werden es wohl sein, vielleicht hundert mehr oder hundert weniger.»
Amenhotep und sein Bruder Thotmes saßen an der Stirnseite des Saales auf thronartigen Sesseln, und die Gästeschar zog langsam an ihnen vorüber. Ihre Huldigung galt zugleich dem künftigen König wie dem neuen Hohenpriester des Ptah, und da gab es viele gebeugte Rücken, langatmige Glückwünsche und allerlei Geschenke, die sich an der Wand zu einem ansehnlichen Haufen stapelten.
Amenhotep war solche öffentlichen Auftritte nicht gewohnt, vermied sie, wo es ging, und das fiel ihm um so leichter, als der König es überaus schätzte, daß aller Glanz auf ihn und seine Gemahlin fiel, ohne durch irgendwelche Prinzen geschmälert zu werden. Das war nun einmal seine Art und keineswegs böse gemeint. Der Gute Gott war durchaus stolz auf seine Söhne und Töchter, aber er pflegte gerne zu bemerken: «Habt Geduld, bis ich nach Westen gehe, dann kommt auch eure Zeit.»
Thotmes, der Hohepriester des Ptah, war angetan mit allen Würdenzeichen seines Amtes, trug den weißen, fast bis zum Knöchel reichenden Schurz aus gestärktem Leinen, die Schulterbinde um den nackten Oberkörper. In seinem Arm ruhte das goldene Szepter des Ptah, gebildet aus dem die Ewigkeit symbolisierenden Djed-Pfeiler und dem gegabelten Was-Szepter, einem alten Glückszeichen. Kaum war der offizielle Teil vorbei, übergab er das Szepter einem Diener, um die Hände frei zu haben für die überreichlich gebotenen Genüsse der Tafel. Auf den Tischen türmte sich das gebratene Geflügel – Gänse, Enten, Hühner und Wachteln, auch Fleisch von Lämmern, Schweinen und Ziegen wurde aufgetragen, dazu frisches Gemüse und Obst, wie es jetzt zu Beginn der Schemu-Zeit in Hülle und Fülle vorhanden war: Rettiche, Gurken, Melonen, Lattich, Zwiebeln, auch frische Trauben, Feigen, Datteln und Granatäpfel. Kleine Schalen mit köstlichen Tunken aus Sesam, Knoblauch, Feigen und Honig ließen jedem die Wahl, ob er das Gebratene pur oder gewürzt genießen wollte. Brot gab es in den unterschiedlichsten Formen, von winzigen knusprigen Sesamkringeln bis zu riesigen Laiben in Gestalt des Apis-Stieres, den man nur auf diese Weise genießen konnte, denn Rindfleisch war am Tempel des Ptah streng untersagt.
Emsige Diener versorgten die Gäste mit vielerlei Getränken, vor allem Wein und Bier, doch wer nichts Berauschendes mochte, konnte sich an Milch, Wasser und Obstsäften gütlich tun und diese nach seinem Geschmack mit Honig versüßen.
In einem glichen sich die königlichen Brüder – beide aßen und tranken gern, wobei Thotmes Becher um Becher des würzigen Gerstenbieres hinunterstürzte, während Amenhotep verdünnten und leicht mit Honig gesüßten Wein vorzog.
«Hast du auch vom Lamm genommen?» fragte Thotmes mit hinterhältigem Grinsen. Natürlich wußte Amenhotep gleich, worauf die Frage zielte, gab sich aber ganz unbeteiligt.
«Natürlich, warum auch nicht? Die Köche hier sind vorzüglich, und ich kann dir versichern, daß ich kein Gericht ausgelassen habe.»
Thotmes schlug seinem Bruder derb auf die Schulter.
«Wenn deine Amun-Priester das wüßten! Die würden sich vor Kummer über dieses Sakrileg auf den Boden werfen und den Widdergott mit Sonderopfern zu versöhnen suchen.»
«Es sind nicht meine Amun-Priester!» sagte Amenhotep abweisend. «Im Palast unseres Vaters kümmert man sich darum nicht. Die Priester mögen es halten, wie sie wollen, der Gute Gott steht über allem. Was er tut, kann niemals falsch sein.»
Thotmes nickte.
«Sehr richtig, aber das gilt nicht für uns. Du jedenfalls darfst als Ptah-Priester kein Rindfleisch essen und kein Leder aus Rinderhaut tragen.»
Er drohte ihm scherzhaft mit dem Finger.
«Ich hoffe, du hältst dich daran!»
«Warum nicht? Es wird mir nicht schwerfallen, auf diese Dinge zu verzichten.»
Thotmes lachte und strich mehrmals über seinen glattgeschorenen Schädel.
«Und die Haare müssen weg – alle! Auch die hier …»
Er wies auf seine Achseln und deutete auf das Geschlecht.
«Wir haben einen guten Barbier, so daß du um deinen Schwanz keine Angst haben brauchst. Der hebt ihn mit zwei Fingern hoch und schabt behutsam drum herum – ein wahrer Künstler!»
Er stand auf und klatschte in die Hände. Mit seinem Amtsstab stieß er auf den Boden, daß der Saal dröhnte.
«Schluß für heute, verehrte Gäste! Eure Sklaven sollen die Tische abräumen und nach Hause tragen, was nicht verzehrt ist. Der heilige Apis sei mit euch und eurer Familie!»
Amenhotep war befremdet von der lauten und derben Art seines Bruders, ein Fest zu beenden. Schließlich befanden sich hohe Gäste im Saal, wie der Bürgermeister von Men-nefer, die Priester aller wichtigen Tempel, an ihrer Spitze die drei Propheten des Ptah, und die wurden nun verabschiedet wie vom Wirt einer Straßenkneipe.
Thotmes faßte ihn am Arm.
«Für uns, Brüderchen, ist das Fest freilich noch nicht zu Ende – komm mit!»
Er führte den Bruder in einen kleinen, behaglich eingerichteten Raum, wo sich ein Dutzend bequemer Sessel um einen niedrigen Tisch gruppierten.
«Hier feiern wir weiter – ganz unter uns.»
Danach trafen noch einige Gäste ein, junge Männer meist, die Thotmes freundschaftlich begrüßte und mit denen er offenbar – fast alle berührte er an Arm oder Schulter – auf sehr vertrautem Fuß stand.
Ganz wie der Vater, dachte Amenhotep, der muß alle Menschen, die er mag, anfassen, betasten, tätscheln. Er selber mochte das nicht, zuckte bei jeder, auch zufälligen Berührung zusammen, sogar wenn sie von der Mutter oder den Schwestern kam.
So setzte er sein hoheitsvolles Prinzengesicht auf, nickte jedem leicht zu und ließ die belanglosen Namen an sich vorbeirauschen wie Windstöße, die nur das Ohr berühren, aber nicht eindringen. Abschätzige Blicke trafen ihn. In einigen Tagen war dieser Prinz der neue Hohepriester des Ptah und obendrein noch ein Sohn des Guten Gottes und Herrn Beider Länder – er lebe, sei heil und gesund! –, also der künftig Ranghöchste in Men-nefer. So hörte Amenhotep manche devote Rede, sah manches servile Lächeln auf den jungen Gesichtern, von denen einige schon gezeichnet waren von Lastern und Nichtstun.
Der feingliedrige Prinz mit dem schmalen, hoheitsvollen Gesicht und den schrägen, dunklen Augen blickte die jungen Männer verschleiert und etwas abwesend an oder besser durch sie hindurch. Die Empfindsameren fühlten sich im Sinne des Wortes durchschaut, und ihnen war, als blicke der Prinz strafend und mit Abscheu auf ihr nutzloses und lasterhaftes Leben.
Doch die hereinstiebenden fast nackten Tanzmädchen und die sie begleitenden Musikanten fegten alle düsteren Gedanken hinweg.
Laute, Flöte und Handtrommel ertönten, die Glieder der schlanken, geschmeidigen Tänzerinnen wirbelten gedankenschnell durch die Luft, und ihre langen Haare flogen hinterher wie die Wimpel bei einer rasenden Fahrt mit dem Streitwagen.
Als Amenhotep einen Schluck Wein nahm und Thotmes einen Becher davon hinunterstürzte, war das für die Gäste wie der Auftakt zu einem Wetttrinken, bei dem beflissene Diener so schnell die lässig hingehaltenen Becher nachschenkten, wie sie dann wieder geleert wurden.
Amenhotep fröstelte es, denn er war die kühlere Nachtluft des Nordens nicht gewohnt, und so trank er, um warm zu werden, mehr, als er es sonst gewöhnt war. Da er den Wein nicht mehr verdünnte, stieg er ihm schnell zu Kopf, und bald war er von der lärmenden Heiterkeit der jungen Männer angesteckt, redete schnell und viel und lachte zu den einfältigsten Witzen.
Er gleicht seinem Bruder doch mehr, als es zuerst schien, dachte der Sohn des Bürgermeisters erfreut. Er wird sich an das lustige Leben hier gewöhnen und bald einer der unsrigen sein.
Es gehörte zu den Gewohnheiten solch intimer Feiern, daß die Gäste sich nach und nach eines der Tanzmädchen heraussuchten und es herbeiwinkten. Natürlich ließ man den beiden Prinzen den Vortritt bei der Auswahl, und Thotmes griff auch schnell zu. Amenhotep zögerte. Freilich, zu Hause war er schon dann und wann bei Sklavinnen gelegen, aber hier fand er es nicht schicklich, sich vor Rangniederen eine Blöße zu geben. Außerdem scheute er davor zurück, sich mit völlig fremden Mädchen abzugeben; seine bisherigen Gespielinnen waren Palastsklavinnen, die er zumindest vom Sehen her kannte und dann in Ruhe auswählen konnte. Aber irgendeine fremde Tänzerin … Noch einen Grund gab es, aber den mochte er sich nicht eingestehen, weil es für einen königlichen Prinzen unschicklich war, sich in ein namenloses Mädchen zu verlieben. So ganz ohne Namen war sie freilich nicht, die Tochter des Dritten königlichen Schreibers Eje, der früher als Priester des Fruchtbarkeitsgottes Min amtiert hatte.
«Verzeih, Thotmes, aber dazu bin ich heute nicht in Stimmung.»
Thotmes lachte trunken und knetete die Brüste des Mädchens, das sich lüstern auf seinem Schoß räkelte und ihn anstrahlte wie ein göttliches Wesen.
Amenhotep erhob sich, und gleich sprangen auch die anderen auf. Sie wußten, was sich gehörte. Thotmes blieb sitzen, ließ seine Hand unter den Schurz des Mädchens gleiten.
«Willst du dich schon zur Ruhe begeben, Brüderchen?»
«Ja, du wolltest mir morgen doch …»
Thotmes winkte ab.
«Ja, ja, ich hab’s nicht vergessen. Aber niemand drängt uns – wer sollte es auch? Unser göttlicher Vater erwartet mich nicht vor Ende der Schemu-Zeit zurück, oder gefällt dir meine Gesellschaft nicht?»
Die Frage war lächelnd und mit sanfter Stimme gestellt, aber Amenhotep erkannte den Ernst dahinter. Als sie noch unter einem Dach lebten, hatten sie sich niemals sehr gut verstanden – Thotmes hielt sich an den Vater, er lieber an die Mutter.
«Wie kannst du so etwas glauben – wir sind doch Brüder!»
«Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wenn Ptah dich mit schönen Träumen beglückt, dann kannst du morgen seiner herrlichen Seele, dem hochheiligen Apis-Stier, eine Opfergabe spenden.»
«Das werde ich in jedem Fall tun.»
Thotmes hielt sein Wort und führte den Bruder in sein künftiges Amt ein, aber er tat es so nach und nach, ließ sich dazu viel Zeit. So fütterte Amenhotep den schwarzen, juwelenbedeckten Apis mit einem Büschel seiner Lieblingskräuter, die der junge, schon recht fette Stier gierig nahm, weil man ihn vorsorglich einen Tag hatte hungern lassen. Thotmes führte seinen Bruder ins Allerheiligste des Ptah, wo in einer engen, finsteren Kammer die lebensgroße Goldstatue des Gottes in erhabener Feierlichkeit stand, und nur wenn aus einer handgroßen Öffnung in der Decke gegen Mittag ein Lichtstrahl auf den Kopf der Statue fiel, erstrahlte das göttliche Antlitz unter der enganliegenden blauen Kappe in magischem Glanz.
«Sieht recht gut aus, nicht wahr?» bemerkte Thotmes, den der heilige Ort wenig zu beeindrucken schien. Wie um sich zu rechtfertigen, setzte er noch hinzu: «Man gewöhnt sich an den Anblick und findet dann nichts Besonderes mehr dabei.»
Amenhotep war in einem Umfeld aufgewachsen, das die ersten Künstler des Landes gestaltet hatten. Alles, was ihn im väterlichen Palast «Aton glänzt» umgeben hatte – Wandbilder, Statuen, Geräte, Webereien, Möbel –, war von den besten Handwerkern des Landes geschaffen worden und hatte ihm Auge und Sinn geschult.
So beeindruckte ihn hier vor allem die feine, erlesene Arbeit, aber – und es erstaunte ihn selbst – er sah dahinter nichts Göttliches. Jeder in den Weltschöpfungslehren Bewanderte wußte, daß Ptah als «Herr des Schicksals» und «Schöpfer der Welt» erst groß und bekannt geworden war, als es Junu, das Sonnenheiligtum des Re, schon lange Zeit gab. Doch Men-nefer war die Residenz der alten Könige gewesen, und mit ihnen gewannen die Ptah-Priester an Macht und Einfluß. So gerieten sie in den Wettstreit mit den Sonnenpriestern in dem nur wenige Schiffsstunden entfernten Junu. Seit zwei Jahrhunderten residierten die Könige nun in Waset, und Amun-Re war zum allmächtigen Reichsgott geworden. So blieb der Wettstreit zwischen Junu und Men-nefer unentschieden, oder besser gesagt: Das Sonnenheiligtum erleuchtete das ganze Land mit seinem überirdischen Licht, und vor allem die Gebildeten sahen in ihm einen Ursprung alles Göttlichen. Ptah, Neith, Thot, Hathor, Sobek, Isis, Amun, Osiris, dazu andere, über eine lokale Verehrung nicht hinausreichende Gottheiten waren eher volkstümlich, auch weil sie meist in Triaden auftraten, also mit einem Ehepartner und einem Kind, und so besser in die Herzen einfacher Menschen fanden.
Amenhotep neigte sich tief vor dem goldfunkelnden Götterbild und streute eine Handvoll Weihrauch in das Glutbecken. Im Gegensatz zu anderen Gottheiten erschien der «Weltschöpfer» immer nur in Menschengestalt, gewickelt in ein mumienartiges Gewand, den Kopf mit einer enganliegenden Kappe bedeckt, beide Hände um ein Szepter gefaltet. Einer seiner Beinamen war Nefer-her – «schön an Gesicht», und alle Bildhauer mühten sich ab, dem Rechnung zu tragen.
Als sein künftiger Hoherpriester würde Amenhotep unter anderen den Titel «Oberster der Handwerker» tragen, denn Ptah galt auch als Erfinder der Künste und war der Patron aller Handwerker.
Ich will das nicht, dachte Amenhotep und überlegte, ob er den Vater bitten sollte, einen anderen Hohenpriester zu ernennen. Gerade er, der zu den Amun-Priestern Abstand hielt, müßte doch dafür Verständnis aufbringen. Sollte er darüber mit dem Bruder sprechen? Nein, das hätte wenig Sinn, denn wer Thotmes näher kannte, sah, daß er sein Amt nur mit dem Körper, nicht aber mit dem Herzen ausübte.
Als hätte ihn der Besuch im Allerheiligsten überaus angestrengt, seufzte Thotmes tief.
«Für heute reicht’s! Ich will jetzt frei atmen, brauche Luft – Wüstenluft. Begleitest du mich auf die Jagd?»
«Wenn ich selber nicht jagen muß …»
Thotmes tätschelte die Schulter seines Bruders, der – wie immer bei solchen Berührungen – leicht zusammenzuckte.
«Es geht ja auch nicht um die paar Pfeilschüsse auf Gazellen oder Straußenvögel. Ich will raus aus dieser Stickluft von Weihrauch, geschlachteten Opfertieren und den nach Duftölen stinkenden Priestern. Ihnen genügt nicht die Vorschrift, sich zweimal täglich und zweimal nächtlich zu reinigen – nein, sie müssen sich zur Ehre der Gottheit auch noch mit Duftölen übergießen!»
Er lachte.
«Da ist mir der Geruch von Pferdemist, Schweiß und Wüstenstaub allemal lieber.»
Schon einen Pfeilschuß vom Tempel entfernt begann die Wüste, und so rasten die Brüder auf ihren zweirädrigen Gespannen dahin. Thotmes führte die Pferde selber, während Amenhotep hinter dem Wagenlenker stand und sich an die Haltegriffe klammerte. Hinter ihnen galoppierten einige Leibwachen und Diener, die ausgebildet waren, auf dem Rücken der Pferde zu sitzen und auch bei schnellem Lauf nicht herunterzufallen.
Mitten in der Wüste hielten sie an, und Thotmes sprang vom Wagen. Er deutete nach vorne.
«Da! Siehst du es? Links von dem Hügel, wo etwas Grün wächst, grasen einige Antilopen.»
«Zu weit für einen Pfeilschuß, Herr», bemerkte ein Diener und streckte ihm fragend den Köcher hin.»
«Ich versuch’s trotzdem! Der Wagen ist zu laut, ich reite ein Stück und pirsche mich dann zu Fuß näher.»
«Aber Ehrwürdiger, du kannst doch nicht …»
Thotmes winkte unwillig ab, sprang geschickt auf das nächste Pferd und ergriff die Zügel. Das Tier erschrak, tat einige Sätze, bäumte sich plötzlich auf und warf seinen Reiter ab. Der flog mit hilflos ausgebreiteten Armen und einem mehr erstaunten als erschreckten Gesicht über den Kopf des Pferdes in den Sand.
Amenhotep lachte. Das hatte er nun davon; zumindest würde ihm tagelang der Rücken weh tun. Doch Thotmes, dem jungen Hohenpriester des Ptah, tat nichts mehr weh. Er blickte mit halbgeöffneten Augen in den blauen Himmel, wo hoch die Sonne stand, die ihn nicht mehr blendete.
Da werde ich mein Amt wohl schon heute übernehmen müssen, dachte Amenhotep erschreckt. Aber nicht als Hoherpriester am Ptah-Tempel, sondern als Thronfolger. Als Falke im Nest, Sohn des Goldhorus und Guten Gottes, des Starken Stieres und Herrn Beider Länder würde er der nächste Träger der Doppelkrone sein – der weißen des Binsenlandes und der roten des Bienenlandes.
1
Nebmare Amenhotep, Sohn der Sonne, Guter Gott und Herr Beider Länder, quälte sich wieder einmal mit seinen langjährigen Übeln herum: eiternde Zähne, Gichtanfälle und ein von tagelanger Verstopfung aufgetriebener Leib. Eine Schar von Ärzten hatte vergeblich versucht, dieser Leiden Herr zu werden, doch mit Ungeduld und Jähzorn vereitelte der König jeden Versuch, seinen Zustand zu bessern. Bis jetzt hatte auch Teje, die Große Königsgemahlin, nichts daran ändern können. Da erhielt sie von einer ihrer Kammerfrauen einen Wink, es doch mit einem vor kurzem aus Amurru zugewanderten Arzt zu versuchen, dessen Erfolge in Waset schnell von sich reden machten. Teje, bei solchen Empfehlungen stets mißtrauisch, fragte:
«Kennst du ihn näher; hat er jemand aus deiner Familie behandelt?»
«Nein, Majestät, ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Aber, wie gesagt, die ganze Stadt redet von Pentu und seinem tüchtigen Sohn, der genauso heißt.»
«Was, Vater und Sohn tragen den gleichen Namen?» Teje schüttelte mißbilligend den Kopf.
«Aber dein Zweitgeborener, Majestät, heißt doch auch wie …»
«Bei Königen mag das angehen, die stehen über Brauch und Gesetz!» wies Teje ihre vorlaute Dienerin zurecht. «Also gut, bestelle den Wundermann hierher, und ich werde versuchen, den Guten Gott zu überreden, ihn zu empfangen.»
Das erwies sich weitaus weniger schwierig, als Teje es sich gedacht hatte. Der König stimmte mit schwacher Stimme zu.
«Dann versuchen wir es eben auch mit diesem Pentu, denn schlimmer, als es jetzt ist, kann es nicht mehr werden.»
«Armer Amani …»
Sie strich dem Gatten zärtlich über den schon halbkahlen Kopf. Er seufzte.
«Nicht einmal mehr eine Perücke halte ich aus. Das Toben und Pochen beginnt im Kiefer und zieht sich bis hinauf zur Schädeldecke.»
Der faulige Gestank aus dem Mund des Königs umgab sein Lager, als käme er von einer verwesenden Leiche. Doch Teje ließ sich nichts anmerken, küßte den Gatten auf die heißen, geschwollenen Wangen und erhob sich.
«Für morgen früh ist Pentu hierherbestellt. Versuche, ihn gut zu behandeln, und jage ihn nicht schon bei der ersten Berührung fort.»
Amenhotep hörte aus den freundlichen Worten die feste Erwartung heraus, er möge sich diesmal beherrschen.
«Ist gut, Teje, ich werde es versuchen. Schlimm genug, wenn so ein Quacksalber meine heilige Person anfassen darf.»
«Amani», sagte sie geduldig, «der Mann ist kein Zauberer und wird dich kaum aus der Ferne heilen können.»
«Wenn überhaupt …» seufzte der König mit schmerzlicher Miene. «Übrigens, wann wird Thotmes endlich heimkehren? Ich habe ihm ausdrücklich gesagt, noch ehe die Schemu-Zeit endet, muß er zurück sein!»
«Ja, aber wir sind doch erst mittendrin – zehn oder fünfzehn Tage werden wir uns schon noch gedulden müssen.»
Am nächsten Morgen erschien gleich nach Sonnenaufgang Pentu mit seinem Sohn und ließ sich – wie es der Hauptmann der Palastwache angeordnet hatte – beim Zeremonienmeister melden. Der tat sehr beschäftigt, und es dauerte eine Weile, bis er geruhte, die Besucher wahrzunehmen.
«Pentu, nicht wahr, und sein Sohn –?»
«Auch Pentu, gnädiger Herr.»
Der Höfling lachte meckernd: «Pentu der Zweite sozusagen … Ist der Junge dein Gehilfe, will sagen, muß er bei der Behandlung des Königs zugegen sein?»
Über Pentus fremdländisches Gesicht mit der großen Nase und dem etwas wulstigen Mund flog ein Lächeln.
«Ich brauche seine Hilfe, ja, gewiß …»
«Gut, dann wartet hier, man wird euch abholen.»
Kaum waren die Schritte des Hofbeamten verklungen, fragte der Sohn den Vater mit gedämpfter Stimme: «Der König wird uns doch nichts antun? Wenn die Behandlung mißlingt oder wir ihm Schmerzen zufügen, dann schickt er uns vielleicht in die Steinbrüche oder läßt uns hängen …»
Pentu tätschelte dem Sohn beruhigend die Schulter.
«Bis jetzt hat keiner der Ärzte dem König nachhaltig helfen können, aber keiner hat – soviel ich weiß – deswegen Leben oder Freiheit verloren. In Kemet herrschen Recht und Gesetz, aber der König steht darüber, und wir können nur abwarten und hoffen.»
Der Beamte kam nach etwa einer Stunde zurück und stellte eine Wasseruhr auf den Tisch.
«Das Schälchen ist in genau einer halben Stunde gefüllt, dann werden euch die Diener abholen. Inzwischen gebe ich Anweisungen, wie ihr euch beim Empfang zu verhalten habt. Also: Sobald sich die Tür zum Gemach des Königs öffnet, werft ihr euch zu Boden, den ihr dreimal küßt, denn die Anwesenheit des Guten Gottes heiligt jeden Raum. Nach einer Weile wird Seine Majestät oder sein Sprecher euch aufstehen heißen. Dann geht ihr gebückt auf den König zu, werft euch ein paar Schritte vor ihm nieder und küßt erneut den Boden. Beim dritten Mal dürft ihr dem Gott schon die Sandalen küssen. Dann wird er oder sein Sprecher euch erlauben, aufzustehen und die Schönen Befehle Seiner Majestät zu erwarten. Habt ihr alles verstanden?»
«Ja, Herr, wir werden uns genau so verhalten, wie du es gesagt hast.»
Doch Pentu sprach nicht aus, was er dachte, und das war: Nicht ich will etwas von der Majestät, der König fordert etwas von mir. Ich bin kein Bittsteller, sondern ein Arzt, der einem Kranken zu helfen versucht. Allerdings ist es schon ein besonderer Fall, dachte Pentu nüchtern, und ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen.
Der König empfing sie in einem kleinen, privaten Raum, in einen bequemen Sessel gebettet, das gichtgeschwollene Bein auf einem Hocker ausgestreckt. Teje saß neben ihm; beide trugen kein königliches Ornat, sondern nur leichte Perücken, bequeme Kleidung und als einziges Zeichen ihres Ranges einen schmalen Goldreif mit der sich aufbäumenden Uto-Schlange um die Stirn.
Nachdem Pentu und sein Sohn sich einmal zu Boden geworfen hatten, forderte Amenhotep ungeduldig: «Nun kommt schon her, wir sind hier nicht im Audienzsaal!»
Pentu und sein Sohn küßten dennoch ihm und der Königin die Sandalen und blieben dann in gebückter Haltung stehen. Der König wandte sich an den Zeremonienmeister.
«Ich erteile dem Arzt Pentu und seinem Sohn hiermit die Erlaubnis, den Körper Meiner Majestät in Ausübung ihres Berufs berühren zu dürfen, wo und wie sie es für nötig finden.»
Ein am Fenster hockender Schreiber notierte den Befehl, und ein Diener drückte das königliche Siegel darauf.
«Jetzt hinaus mit euch!» rief der König ungeduldig und blickte Teje an.
«Soll ich …?»
«Nachdem du dich nun einmal entschlossen hast, mein Gemahl – vielleicht kann Pentu dir wirklich helfen.»
«Doch zuvor müßte ich dich untersuchen, Majestät. Vor allem ein Blick in deinen Mund …»
Der König ging nicht darauf ein.
«Warum hast du deine Heimat verlassen, Pentu?»
Der Arzt blickte kurz seinen Sohn an.
«Dort konnten wir nicht mehr ruhig leben und arbeiten, ständig gab es Streit um die Thronfolge …»
«Aber Amurru ist uns doch tributpflichtig! Wir haben Truppen dort stehen, die hätten doch für Ordnung sorgen können – ich verstehe das nicht!»
Über das strenge Antlitz der Königin flog leiser Unmut.
«Der Wesir wird sich darum kümmern oder hat es längst getan. Aber warum gleich nach Waset, Pentu, so weit im Süden? Mennefer ist doch auch eine große, bedeutsame Stadt, wo ein guter Arzt gewiß sein Auskommen hat?»
Sie zögern es hinaus, dachte Pentu, der König, weil er die Untersuchung fürchtet, die Königin, um von der Politik abzulenken.
Er hob bedauernd die Hände.
«In Men-nefer eine ärztliche Praxis zu eröffnen, das ist, als trüge man Wasser zum Nil. Die Stadt steht im Zeichen von Ptah und seiner Gemahlin Sachmet. In den Tempeln dieser Göttin müssen die Priester zugleich Ärzte sein, und sie behandeln jedermann kostenlos.»
Trotz seiner Schmerzen verzog der König sein aufgedunsenes Gesicht zu einem Lächeln.
«Was habe ich der Löwenköpfigen nicht alles geopfert; habe unseren Ptah-Tempel reich beschenkt, habe ihr Hunderte der schönsten Granitstatuen errichten lassen, aber du siehst», der König berührte leicht seine geschwollene Wange, «ihre Gunst hält nicht lange vor.»
Pentu verbeugte sich.
«Vielleicht hat sie mich zu dir gesandt, um Deiner Majestät auf solche Weise zu helfen?»
«Was verstehst du schon von unseren Göttern? In deiner Heimat beten sie doch irgendeinen Baal an …»
«Majestät, ich opfere stets den Göttern meines Gastlandes – Amun, Mut, Chons, Month und andere erhalten regelmäßig ihre Gaben.»
Da verzerrte sich das Antlitz des Königs in jähem Zorn. Er hob die Faust und rief: «Amun! Mut! Hältst du es für richtig, diese schon immens reichen Götter noch mehr zu mästen? Nun, tue, was du willst, aber laß Amun aus dem Spiel. Manchmal frage ich mich schon, wer Herr ist in Kemet – dieser fette Hammel oder ich, der Lebendige Horus, der Sohn der Sonne!»
Er ächzte und lehnte sich zurück.
«Geh mir aus den Augen, du Amun-Anbeter!»
Teje kannte ihren Gemahl und wußte, er hatte diesen Streit gesucht, um den Arzt unter einem Vorwand wegzuschicken. Sie legte zart eine Hand auf sein Knie.
«Dein Zorn ist berechtigt, mein hoher Gemahl, aber Pentu ist wohl das falsche Ziel. Er opfert Amun wie alle Welt, und wir sollten es ihm nicht verargen. Jetzt aber laß den Arzt seine Pflicht tun.»
Der König seufzte. Er hatte es längst aufgegeben, Teje zu widersprechen, und so fügte er sich und versuchte einen matten Scherz.
«Also gut, du Jünger Sachmets, dann entfalte deine Kunst an Meiner Majestät.»
Pentu schien das wie ein Traum. Noch gestern abend hatte er einem Bäcker den vereiterten Zeh aufgeschnitten, und jetzt, einen Tag später, stand er dem Herrn Kemets gegenüber, dem Gottmenschen und höchsten Wesen auf Erden, dessen Leib heilig, dessen Wort Gesetz und dessen Entschlüsse unumstößlich waren. Ein Schnippen dieser gichtigen Finger, und sein Kopf rollte in den Sand …
Pentu straffte sich.
«Zuerst ein Blick auf die Zähne, Majestät.»
Er trat näher, und der König öffnete unwillig zur Hälfte seinen Mund.
«Verzeih, aber so geht es nicht. Ich muß tiefer hineinschauen können, um auch die hinteren Zahnreihen zu prüfen. Pentu, nimm den Spiegel und leuchte mir!»
Nach einigem Hin und Her hatte sich der König halb zum Fenster gedreht, während der junge Pentu das Sonnenlicht in den Mund spiegelte. Mit einem Elfenbeinstäbchen prüfte der Arzt der Reihe nach die Zähne, wobei der König manchmal gurgelnd aufschrie. Weil aber Teje dabeisaß, wollte er sich nicht zu wehleidig gebärden.
«Soweit ich es sehen kann, sind fünf Zähne vereitert, zwei davon sind bereits locker. Alle fünf müßten heraus …»
«Was? Hat der grimmige Seth dir den Verstand getrübt? Du willst dem König einfach fünf seiner Zähne stehlen? Wie stellst du dir das vor?»
«Verzeih, Majestät, aber ich stehle sie dir nicht, denn sie sind wertlos – ja hochgiftig. Das ist wie bei einem brandigen Glied: Nimmt man es nicht rechtzeitig ab, vergiftet es nach und nach den ganzen Körper. Bei deinen Zähnen ist es nicht anders. Sie sitzen im eitrigen Zahnfleisch und sind dabei, den ganzen Körper zu verderben. Es könnte sogar sein, daß deine Gicht dort ihren Ursprung hat.»
«Und was schlägst du vor?»
«Ich mische dir einen Trank, der dich nicht nur einschläfert, sondern zum Teil auch unempfindlich macht. Dann ziehe ich dir die fünf kranken Zähne heraus, so schnell es geht – einen nach dem anderen.»
«Und ich spüre nichts?»
«Nicht viel, später noch einige Tage Wundschmerz. Aber dann, Majestät, wirst du dich fühlen wie ein neuer Mensch – oh, verzeih – wie ein neuer Gott.»
«Was meinst du, Teje?»
Die Königin beugte sich vor, und ihre schrägen, schwarzen Augen musterten Pentu wie einen betrügerischen Markthändler.
«Übertreibst du nicht ein wenig? Doch wenn du mir versprichst, daß der Zustand des Königs sich bessert, will ich zufrieden sein.»
Pentu lächelte.
«Dafür stehe ich ein, doch die Zähne müssen raus – alle fünf!»
Teje blickte auf ihren Gemahl, der mit matter Stimme wiederholte: «Ja, alle fünf …»
Pentu verbeugte sich tief.
«Und wann soll das Ereignis stattfinden?»
«Wie lange brauchst du zur Vorbereitung?»
«Ich mische heute noch den Trank und lege meine Instrumente über Nacht in Wein. Morgen früh, wenn es recht ist?»
Teje gab dem König keine Gelegenheit zu einer Antwort und sagte schnell: «Es ist uns recht, Arzt Pentu. Bleibst du gleich hier, oder mußt du noch einmal zurück nach Waset?»
«Nein, Majestät, es ist alles zur Hand.»
Sie erhielten ein geräumiges Gästezimmer. Während der junge Pentu sich staunend umsah und die leuchtenden Malereien an Wänden und Decken bewunderte, holte sein Vater alles Nötige aus dem großen Binsenkorb. Zuerst suchte er zusammen, was er für den Betäubungstrank brauchte. Das war ein Ledersäckchen mit pulverisierter Mandragorawurzel, ein verstöpseltes Alabasterfläschchen mit bröseligen, blaßbraunen Körnern des getrockneten Saftes von Schlafmohn. Dieser Stoff war hier wenig bekannt, während in Amurru jeder Quacksalber damit arbeitete. Pentu hatte einen Vorrat davon mitgebracht, doch machte er nur in ganz schwierigen Fällen davon Gebrauch.
Er blickte auf und sah den Sohn noch immer in die Malereien vertieft. Leise stand er auf und boxte den Jungen von hinten leicht in die Rippen.
«Aufwachen, junger Mann! Wir sind nicht zum Vergnügen im Palast des Königs. Ruf einen Diener und laß etwas Wein bringen – es muß der sein, den die Majestät bevorzugt; dazu einen zweiten Krug starken, einfachen Weines, etwa ein halbes Hekat. Außerdem brauche ich ein Töpfchen Honig und eine große Schale mit frischem Wasser. Wenn wir alles beisammenhaben, mischen wir den Schlaftrunk, aber uns darf kein Fehler unterlaufen – hörst du! Den Kopf wird es nicht kosten, aber es wäre schon Strafe genug, wenn uns der König nach Amurru zurückschickt. Der König ist kein Greis, aber für eine starke Dosis nicht mehr jung und kräftig genug.»
Ein Diener stellte das Verlangte auf den Boden, Pentu wartete, bis er draußen war.
«Der König soll ein schwerer Trinker sein», sagte er leise.
«Woher weißt du das, Vater?»
«So reden die Leute. Schon wegen seiner Schmerzen wird er sich oft mit Wein betäuben …»
«Und das heißt?»
«Bist du Arzt oder nur ein dummer Küchensklave?» fragte Pentu unwillig. «Manchmal glaube ich, du hast schon die Hälfte von dem vergessen, was ich dir im Laufe der Jahre eingebleut habe.»
Der Junge ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, er kannte seinen Vater und dessen stets wache Spottlust.
«Das heißt, daß unser Patient schwer oder nicht auf Betäubungsmittel anspricht. Du wirst die Mandragoramenge verdoppeln müssen.»
Pentu schüttelte den Kopf.
«Diese Wurzel hat ihre Tücken, und ich möchte nicht wissen, wie viele Ärzte ihre Patienten mit einer Falschdosierung umgebracht haben. Ich werde etwas mehr vom Schlafmohn opfern müssen – schließlich geht es um den König!»
Der junge Pentu grinste.
«Und um etwas noch viel Wertvolleres, um unsere Köpfe …»
«Ja, spotte nur, doch die Verantwortung trage ich.» Schließlich war der Trunk fertig, die Instrumente – Zange, Messer, Schablöffel – lagen die Nacht über in dem großen Krug Wein, das Wasser stand für die Waschung am Morgen bereit. Als der Sohn nach draußen zum Abtritt ging, nahm Pentu einen tüchtigen Schluck von des Königs Betäubungstrank.
Am Morgen waren sie bereit, Pentu verdrängte jeden Gedanken an ein Mißlingen aus seinem Herzen. Er ahnte nicht nur, daß alles gutgehen würde, er wußte es mit ziemlicher Sicherheit.
Das Königspaar erwartete sie im selben Raum wie gestern, umringt von Dienern, Höflingen und vier Mann der baumlangen nubischen Leibwache. Das Niederwerfen auf den Boden blieb ihnen diesmal erspart, und so küßten sie nur die Sandalen des Herrscherpaares.
«Nun triff deine Anordnung!» forderte die Königin auf.
«Gut – diese Leute müssen alle raus, bis auf zwei sehr kräftige Männer.»
«Warum?» fragte Amenhotep mißtrauisch.
«Um dich festzuhalten, Majestät.»
«Mich festhalten? Soll das heißen, daß ich vor Schmerzen um mich schlage, daß ich …»
«Beruhige dich, mein Gemahl. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme für alle Fälle – nicht wahr, Pentu?»
«So ist es, Majestät. Vielleicht können zwei von den Leibwachen …?»
Der König winkte ab.
«Den Kuschiten ist es nicht erlaubt, mich zu berühren. Holt den Barbier und seinen Sohn!»
Die beiden erschienen, und Pentu betrachtete zufrieden ihre muskulösen Oberkörper. Alle anderen mußten auf Tejes Wink den Raum verlassen. Dann reichte Pentu dem König den Betäubungstrank.
«Bitte austrinken, Majestät.»
Der König nahm einen Schluck.
«Etwas bitter, aber sonst nicht schlecht …»
Es dauerte keine Viertelstunde, dann lag der König zurückgelehnt im Sessel und schnarchte laut mit offenem Mund. Pentu rieb sich die Hände.
«Gut, daß Seine Majestät schnarcht! So brauchen wir den Mund nicht gewaltsam zu öffnen.» Er postierte den Barbier und seinen Sohn zu beiden Seiten des Königs mit der Anweisung, im Bedarfsfall die Arme festzuhalten und die Schultern niederzudrücken.
Der junge Pentu hakte behutsam die silberne Kieferklemme ein, während sein Vater sich an die Königin wandte.
«Majestät, es kann sein, daß der König aufwacht und zu toben beginnt. Ich muß dann sicher sein, daß der Barbier und sein Sohn ihn nicht vor Schreck loslassen und davonlaufen.»
Teje nickte und sagte streng: «Habt ihr das gehört, ihr beiden? Was Pentu wünscht, ist nun mein Befehl: Wie immer Seine Majestät sich verhält, was immer er sagt oder anordnet – solange die Behandlung nicht abgeschlossen ist, achtet ihr nicht darauf, verstanden?»
«Jawohl, Majestät!»
Pentu ergriff die langstielige Zange und entfernte zuerst mit einem schnellen Ruck die beiden lockeren Zähne. Als er einen der noch festsitzenden in Angriff nahm und daran zu drehen und zu rütteln begann, brach das Schnarchen ab, der König stieß einen hohen Schmerzenslaut aus und begann sich zu wehren. Ein kalter Blick von Teje genügte, um den Barbier an seine Pflicht zu erinnern. Er und sein Sohn ergriffen je einen Arm des Herrschers und drückten mit der anderen Hand auf die Schulter. Es knirschte, und der Zahn war draußen. Beim zweiten ging es schneller, aber der dritte, ein dicker Backenzahn mit drei Wurzeln, wehrte sich nicht weniger hartnäckig gegen seine Entfernung als sein Träger. Der König wand sich in den Händen seiner Diener wie ein Gefolterter, fluchte, lallte Befehle und riß vor Schmerz und Entsetzen beide Augen auf.
Endlich war auch der fünfte Zahn draußen, und der Patient sank erschöpft zurück.
«Weiter festhalten», befahl Pentu, «ich muß noch die Wunden behandeln.»
Er hatte eine Tinktur aus Alaun, rotem Ocker, Natron, Salz und Tamariskensaft vorbereitet, die er nun in die blutenden Wunden pinselte. Der König regte sich kaum noch, er hatte die Augen geschlossen und war in einen Halbschlaf gesunken.
«Ihr könnt den König jetzt loslassen. Ich werde unterdessen eine Arznei vorbereiten, mit der Seine Majestät mehrmals täglich kräftig den Mund ausspülen soll. Das läßt die Entzündungen abklingen und fördert die Heilung. Im übrigen empfehle ich strenge Bettruhe für die nächsten drei Tage.»
«Gut», sagte Teje und gab den Helfern einen Wink. «Bringt Seine Majestät in das Schlafgemach – Pentu soll euch auf alle Fälle begleiten. Sein Sohn kann hier auf ihn warten.»
Der Barbier und sein Sohn hoben den Sessel mit dem noch halb betäubten König hoch, draußen schlossen sich mehrere Diener an, die vorangingen.
«Du scheinst ein Lieblingskind der Götter zu sein», flüsterte der Barbier Pentu zu, «bis jetzt haben nur sehr wenige Menschen die Schlafkammer des Guten Gottes von innen gesehen.»
Das riesige Bett war aus zwei Löwen gebildet, deren Beine das Bett trugen und deren Köpfe den Eindringlingen mit grimmiger Miene entgegenblickten.
Während die Diener den König behutsam niederlegten, bestaunte Pentu die sieben großen Geier an der Decke, die mit ausgebreiteten Flügeln den Raum bewachten und zu deren Füßen Namen und Titel des Königs in großen, bunten Schriftzeichen standen. Die Wände waren mit mannshohen, farbigen Anch-Zeichen und Djed-Pfeilern dekoriert, dem König auf magische Weise Leben und Dauer verheißend.
«Gefällt es dir?»
Pentu erschrak, Teje stand in der Tür. Er verneigte sich tief.
«Gut, Pentu. Du und dein Sohn werdet so lange im Palast bleiben, bis die Wirkung eurer Behandlung sich zeigt. Danach soll der König bestimmen, was weiter mit euch geschehen wird.»
«Danke, Majestät – aber wie darf ich das verstehen: was weiter mit uns geschehen wird?»
Über Tejes schönes, ernstes Gesicht flog ein Lächeln. «Nun, vielleicht ernennt der König dich zum Hofarzt – wer weiß?»
Während sich der König in seinen Privatgemächern von der Behandlung erholte – sichtlich erholte, denn er wurde von Tag zu Tag munterer –, hatte das Boot mit den Schnellruderern schon Eschmun, die heilige Stadt des Weisheitsgottes Thot passiert, was etwa der halben Strecke nach Waset entsprach. Die Götter von Kemet hatten dem Land nicht nur den fruchtspendenden Nil, sondern auch einen stetigen Nordwind beschert, so daß die flußaufwärts fahrenden Schiffe die Kraft der Ruderer noch durch Segel unterstützen konnten.
Ein hoher Tempelbeamter aus Men-nefer saß im Heck des Schnellbootes unter einem Sonnensegel und bangte seiner Ankunft in Waset entgegen. Er war durch das Los auserwählt worden, dem Königspaar die Trauerbotschaft zu überbringen, verbunden mit der Frage, wo der Osiris Thotmes künftig seine Ewige Wohnung erhalten solle, in Men-nefer oder im Westen von Waset. Doch das hatte Zeit, denn die Gottessiegler – das war der Ehrenname für die Einbalsamierer – brauchten siebzig Tage, um einen Menschenkörper in den für die Ewigkeit geeigneten Zustand zu bringen. Der junge Prinz Amenhotep vertraute dieses Geschäft nicht der wenig angesehenen Schar von Einbalsamierern an, die Tag und Nacht für die Einwohner von Men-nefer in ihrem anrüchigen Beruf tätig waren. Er beauftragte damit die am Ptah-Tempel beschäftigten Balsamierungspriester, allesamt würdige Männer, von denen die meisten auch den Arztberuf ausübten. Zu ihnen gesellte sich ein Vorlesepriester, der zu den Verrichtungen der Gottessiegler die alten heiligen Texte las. Er führte dabei sozusagen auch die Aufsicht, damit bei dieser langwierigen Verrichtung nichts Unziemliches geschah, was aber hier eher symbolisch aufzufassen war. Den Einbalsamierern für die unteren Stände mußte jedoch gelegentlich auf die Finger geschaut werden, denn es war schon vorgekommen, daß diese sich an verstorbenen Frauen vergangen hatten, ehe sie mit ihrer Arbeit begannen.
Die ersten Schritte der Gottessiegler wurden von Gehilfen unter Aufsicht ausgeführt, denn da ging es um wenig schöne Dinge wie das Entfernen des Gehirns mit metallenen Haken durch die Nase, doch da immer ein Rest dieser unnützen Masse zurückblieb, mußte der Schädel noch mit zersetzenden Flüssigkeiten ausgespült werden. Als nächstes öffnete man den Leib an der Weiche mit einem einzigen Schnitt, wobei sämtliche Eingeweide mit Ausnahme des Herzens entfernt wurden. Den nun leeren Körper spülte man mehrmals mit Wein aus und füllte ihn mit den geeigneten Spezereien. Danach wurde er vernäht und siebzig Tage lang in Natronlauge gelegt, um das ebensolange Verschwinden des Sothis-Sternes nachzuvollziehen, als Gleichnis für Sterben und Wiedergeburt des Menschen.
Amenhotep nahm an diesen Vorbereitungen nicht teil, ließ sich aber genau über den Fortgang berichten. Während der langen Wartezeit übte er das Amt seines verstorbenen Bruders aus, unterstützt und beraten von den drei Propheten des Ptah, denen er weitgehend freie Hand ließ. Er wollte sie mit seiner Gegenwart nicht in Verlegenheit bringen, denn alle Welt begegnete dem Thronfolger gebückt und voll Devotion. Über seinem Haupt schwebte die Doppelkrone, und da kein Mensch die Absichten der Götter kannte, mußte man damit rechnen, daß ihm heute oder morgen der Horus-Thron zufiel.
Am letzten feierlichen Akt der Einbalsamierung nahm Amenhotep teil, als nämlich die Gottessiegler den Leib des Toten in Binden hüllten, was sehr langwierig war und mit aller Sorgfalt geschah. Die schmalsten und feinsten Streifen wickelte man um Finger und Zehen – jedes Glied einzeln. Für den Körper wurden breitere Lagen verwendet, Elle um Elle wand sich um den toten Körper, jeweils getränkt mit Harz und Duftölen.
Mit in die Binden wurden zahlreiche Amulette aus Gold und Edelsteinen gewickelt, um der Mumie magischen Schutz zu verleihen. Udjat-Augen, Djed-Pfeiler, Isis-Knoten, Skarabäen und viele andere, die geeignet waren, die einzelnen Glieder und Sinne des Toten wieder zu beleben und sie zugleich zu schützen.
Zu jedem der Amulette trug der Vorlesepriester mit leiser, feierlicher Stimme ein Gebet vor – beim Udjat-Auge lautete es:
«Sieh, ein Udjat-Auge aus Smaragd geschnitten,
sicherer Schutz gegen der Übel Macht.
Thot selbst hat es jenen verliehen, die meiden,
was den Göttern mißfällt.
Siehe, wenn Udjat gedeiht, gedeihe auch ich.»
Am nächsten Tag vollendete ein als Gott Anubis mit Schakalmaske verkleideter Priester das Werk. Die Gehilfen legten unter seiner Aufsicht die Mumie in den geschnitzten, bemalten und vergoldeten Holzsarg, dessen Deckel als zeitlos schönes Abbild des Verstorbenen geformt war. Bei der Grablegung in der Ewigen Wohnung würde man den Holzsarg in einen größeren aus Rosengranit betten.
Amenhotep bedankte sich mit freundlichen Worten bei den Priestern und ihren Gehilfen und ließ an alle Geschenke verteilen. Dann gab er seinen Dienern den Befehl, die Abreise vorzubereiten.
Für ihn gab es keine Wahl, die Götter hatten entschieden, aber im Grunde hatte er weder Ptah-Priester noch König werden wollen. Vielleicht hatte der Gute Gott noch einen anderen Prinzen im Auge, der für die Thronfolge in Frage käme, denn der König hatte seinen Samen weit im Harim verstreut, und einige der namenlosen Nebenfrauen hatten ihm sicher auch Söhne geboren. Ein solcher könnte dann Sat-Amun oder Isis – Amenhoteps Schwestern – heiraten, das wäre durchaus üblich, und er selbst könnte sich wieder zurückziehen und sein gewohntes stilles Leben führen. Dann wäre es gewiß auch möglich, vom König die Erlaubnis für eine Heirat mit Nofretete zu erhalten, der kleinen Schreiberstochter. Für einen Thronfolger wäre sie freilich weniger geeignet, es sei denn …
Der junge Prinz verlor sich in Zukunftsträumen, die sich kaum verwirklichen ließen, doch schließlich hatte er sich noch vor kurzem kaum vorstellen können, plötzlich der Thronfolger zu sein.
Der Tod des Bruders hatte ihn nicht übermäßig berührt; Thotmes war für ihn schon vorher fast so etwas wie ein Fremder gewesen, das Vaterskind eben, mit dem er wenig gemeinsam hatte. Nun aber hatte sein plötzlicher Tod bewirkt, daß Amenhoteps Zukunft sich völlig anders gestaltete.
2
Während der Zustand des Königs sich zusehends besserte, hatte der Schnellruderer aus Men-nefer am späten Abend Abidu erreicht, die heilige Stadt von Osiris, dem Gott der Unterwelt. Als sein schrecklicher Bruder Seth ihn mit List und Tücke ermordete, seinen Leib in vierzehn Teile zerriß und über Kemet verstreute, fiel das Haupt des Osiris hier zu Boden und heiligte das Gebiet für ewige Zeiten.
Der Hofbeamte ließ eine Pause einlegen – zum einen, damit die erschöpften Ruderer sich gründlich erholen konnten, zum anderen, weil er gerne die Begegnung mit dem Herrn Beider Länder um einen Tag hinausschieben wollte. Er rechnete damit, daß der Gute Gott, blind vor Trauer und Jähzorn, ihn sofort hinrichten oder zumindest auf Lebenszeit in einen der berüchtigten Steinbrüche verbannen ließ. Das mochte noch schlimmer sein als eine schnelle Hinrichtung, denn ein schrecklicheres Ende war kaum denkbar, als sich in der Steinwüste zu Tode arbeiten zu müssen.