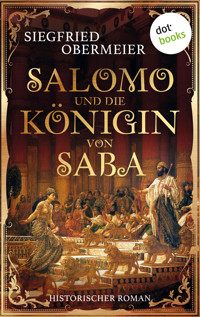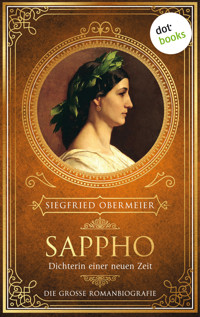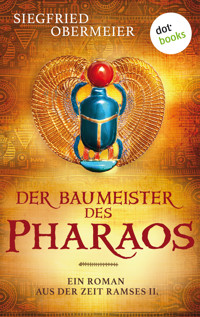4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siegfried Obermeier versteht es wie kein anderer, Geschichte lebendig werden zu lassen. Glänzende Feste und bösartige Intrigen, ehrgeizige und wahre Liebe neben Haß, Krieg und Mord: Hier wird Weltgeschichte zum persönlichen Schicksal von Menschen, die ihren Schwächen, Launen und Lastern, mehr noch aber dem großen Spiel um Macht und Herrschaft ausgeliefert sind. Ein großer historischer Roman über Kleopatra, eine der faszinierendsten und schillerndsten Frauengestalten der Geschichte. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Siegfried Obermeier
Kleopatra
Im Zeichen der Schlange
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560289-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Meiner lieben Frau gewidmet, [...]
I. Buch
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
II. Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog
Meiner lieben Frau gewidmet, mit Dank für Rat und Tat
I. Buch
Prolog
Nicht ganz freiwillig werde ich hier zum Chronisten – ich, Olympos, der ich zeitlebens ein Arzt war. Unser göttlicher Octavius Augustus hat mir diesmal bei dem alljährlichen Symposion für seinen größeren Freundeskreis – zum engeren gehörte ich nie – einige Minuten unter vier Augen gegönnt.
«Olympos, wir sind nicht mehr die Jüngsten und sollten, ehe die Götter uns abrufen, für die Nachwelt festhalten, was wir erlebt, getan und bewirkt haben.» Der Göttliche hob seine Hände, lächelte und sagte: «Ich habe das meine dazu getan – im Schatzhaus des Olympischen Jupiter liegt mein Index rerum gestarum, die Abrechnung über mein Leben, nach meinem Tode zu veröffentlichen. Jetzt bist du an der Reihe, Olympos.»
Ich neigte mein Haupt.
«Göttlicher Augustus, das ist eine wertvolle Anregung, aber was habe ich, der unbedeutende Arzt Olympos, schon getan und bewirkt?»
«Einiges doch, und du warst Kleopatras Arzt, hast sie bis zum Ende auf nahezu allen Wegen begleitet. Ihr Tod liegt fast drei Dezennien zurück, und es wäre an der Zeit, einiges richtigzustellen. Du brauchst dabei auf niemand Rücksicht zu nehmen.»
Nun, das sagte der Göttliche so hin, aber ich dachte dabei an einige Verbannte, die eine ähnliche Aufforderung zu großzügig ausgelegt hatten, und beschloß, auf der Hut zu sein. Wir alle haben dem Erlauchten gegenüber ein schlechtes Gewissen. Wer in Rom eine schöne Villa bewohnt, muß daran denken, wie bescheiden Augustus auf dem Palatin im früheren Haus des Hortensius lebt und dort seit Jahrzehnten nur drei einfache Zimmer bewohnt. Wer seine Gäste mit zehn Gängen verwöhnt, sollte nicht vergessen, daß der Erhabene meist nur drei, höchstens sechs servieren läßt und selber nur Brot, Fisch, Käse und Obst zu sich nimmt und dazu frisches Quellwasser trinkt. Wenn er abends oder im Freundeskreis den von ihm bevorzugten raetischen Wein trinkt, dann nie mehr als einen Sextarius.
Wie streng er von Brauch und Sitte denkt, haben wir im Falle seiner Tochter Julia gesehen, die er wegen ihres anstößigen Lebenswandels auf die unwirtliche Insel Pandataria verbannte – die eigene Tochter und sein einziges leibliches Kind!
Ich selber habe Octavius Augustus viel zu verdanken, das will ich nicht verschweigen. Er hat, seit ich in Rom lebe, immer seine Hand über mich gehalten, doch manches mußte ich gegen meinen Willen dulden, etwa das mit bunten Steinen eingelegte Mosaik vor meinem Haus, und da stand für jedermann in Latein und Griechisch zu lesen:
Olympos, Medicus Cleopatrae
Olympos, Iatros Kleopatres.
Das hat mir viel Geld, aber auch viel Häme und Mißgunst eingetragen. Nun, das ist vorbei, ich praktiziere nicht mehr und lebe ziemlich unbehelligt in meiner schönen Villa in Tibur. So kann ich nur hoffen, daß nach meinem Tod ein Verleger es wagen wird, diese Erinnerungen zu kopieren und wenigstens in einigen Bibliotheken unterzubringen. Sowohl Kleopatra wie der göttliche Augustus werden da in anderer Gestalt erscheinen als in der bisherigen offiziellen Geschichtsschreibung.
Zeitlebens nannte sie mich «Hippo», weil mein tatsächlicher Name ihr nicht zusagte – ja, ihren Unwillen erregte. Als mein Vater mich der jungen Königin – sie befand sich damals auf der Flucht – vorstellte und sagte: «Dies ist mein Sohn Olympos, ein tüchtiger Arzt, trotz seiner Jugend», da runzelte sie unwillig die Stirn, ganz kurz nur, um dann über andere Dinge zu reden. Dann aber, als ich in ihre Dienste trat, legte sie meinen Namen ab und gab mir einen anderen. «Olympos», erklärte sie mir freundlich, «ist ein Name, der nicht zu dir paßt. Du bist kein Olympier, und bestenfalls – abgesehen von den seligen Göttern – dürfen sich Menschen aus königlichem Geschlecht mit dieser Bezeichnung schmücken. Du aber bist ein Jünger des Hippokrates, und ich wünsche, daß du es als Auszeichnung empfindest, wenn ich dich künftig so nenne.»
Sie wünschte es, und wenn sie es wünschte, kam dies einem Befehl gleich. Ich gehorchte diesem Befehl und wurde zu Hippokrates, Leibarzt Ihrer Königlichen Majestät, Herrin Beider Länder, Tochter der Sonne und irdisches Abbild der Isis, Kleopatra, der siebten ihres Namens.
Auf welche Weise ich an ihren Hof kam und was ich in ihrem Dienst erlebte, will ich hier erzählen und mich dabei nicht schonen, denn – dieses Geständnis will ich gleich an den Anfang setzen – ich habe für sie zweimal den Eid des Hippokrates gebrochen, wofür ich mich schäme, was ich tief bedauere, aber nicht bereuen kann. Zweimal habe ich in ihrem Auftrag getötet – beide Male bat sie mich darum. Wer mich einen Verräter am Arztberuf nennt oder gar einen Eidbrüchigen, der um Fürstengunst das höchste Gebot des Hippokrates mißachtete, nämlich Leben zu bewahren, der wird – so hoffe ich – anderen Sinnes werden, wenn er diese Aufzeichnungen liest. Nicht rechtfertigen will ich mich, sondern manches zurechtrücken, aber auch um Nachsicht und Verständnis bitten.
Mein Vater Herakles – die olympischen Namen waren bei uns eine Familientradition – kam aus einer der alten makedonischen Familien, die Ptolemaios I. nach der Gründung von Alexandria dort ansiedelte und wo er als Satrap und dann als König von Ägypten über ein halbes Jahrhundert glücklich regierte.
Kleopatra hat mir einmal eine Tetradrachme mit seinem Bildnis geschenkt; sie liegt auf meinem Schreibtisch, und ich sehe sie mir immer wieder gerne an. Nur auf den ersten Blick wirken diese Züge grob, mit dem kräftigen Kinn, dem kleinen, vollippigen Mund und der weit vorspringenden Nase – ein Erbteil, das Kleopatra von ihrem Urahn übernommen hatte. Ihre Nase war jedoch schmal und wie von einem Bildhauer gemeißelt, doch manche meinten, sie rage weiter aus dem Gesicht, als es der weiblichen Schönheit zuträglich sei. Darüber kann man heute streiten, zu ihren Lebzeiten wagte niemand eine Bemerkung darüber, zumindest nicht in Ägypten. Die Römer freilich ließen nach ihrem Sturz kein gutes Haar an ihr, und besonders ihre Nase wurde zum Gegenstand geistlosen und billigen Spottes.
Mein Großvater hieß Hermes und nahm ein Mädchen zur Frau, deren Familie aus Argolis stammte – also die feinste griechische Herkunft. Um so entsetzter zeigte er sich, als sein Sohn – mein Vater – eine Ägypterin zur Frau nahm. Es mag für manchen, der die Verhältnisse in Alexandria nicht kennt, seltsam klingen, daß ein Untertan des Königs von Ägypten seinem Sohn die Ehe mit einem Landeskind verwehren wollte. Dazu ist zu sagen, daß Alexandria zwar in Ägypten liegt, aber in der griechischen Geschichtsschreibung stets als «Alexandria bei Ägypten» bezeichnet wird. Die Stadt ist griechisch geprägt, wird überwiegend von einer griechischstämmigen Bevölkerung bewohnt, und das hier amtierende Herrscherhaus stammt aus Makedonia, dessen König Philipp – des großen Alexanders Vater – nicht müde wurde zu betonen, auch sein Land sei ein Teil von Hellas. Ihn mag man deshalb in Athen noch gutmütig verlacht haben, aber als sein Sohn die Welt an sich riß, hielten sich auch die größten Spötter klug zurück. Also – in Alexandria leben Griechen, Ägypter und Juden, letztere meist im Osten der Stadt.
Mein Großvater Hermes nun – griechischer, als ein Grieche im alten Hellas je sein konnte – handelte mit feinen Töpferwaren, und mein Vater sollte als Erstgeborener das Geschäft übernehmen, das im Westen der Stadt in der Nähe des Mondtores lag. Doch bei ihm zeigten sich schon früh seine wahren Neigungen. Wenn einer aus der Bubenbande, die das Viertel unsicher machte, sich verletzte, dann spielte mein Vater mit ernster und wichtiger Miene den Iatros, verband aufgeschlagene Knie, säuberte Schnittwunden und kühlte Beulen mit Quellwasser und Kräuterkompressen. Die feinen Töpferwaren aus Griechenland und Süditalien interessierten ihn nur wenig, woran auch die Prügel meines Großvaters nichts ändern konnten. Schließlich gab er nach, zog seinen jüngeren Sohn ins Geschäft und schickte meinen Vater als Lehrling zu einem angesehenen Arzt. Das war zur Zeit von Kleopatras Vater, nämlich des Königs Ptolemaios XII. Theos Philopator Philadelphos Neos Dionysos. So dunkel seine Herkunft war – er galt als illegitimer Sohn von Ptolemaios XI. Alexander –, so lange waren seine Beinamen, die aber heute kein Mensch mehr kennt, denn das Volk nannte ihn Auletes, den Flötenspieler, und mit diesem Namen ist er – nicht sehr rühmlich allerdings – in die Geschichte eingegangen. Er war ein Liebhaber von feuchtfröhlichen Symposien und griff dann oft, vom Wein beschwingt, zur Flöte, die er recht gut spielte. Dieser «Gott, der seinen Vater und seine Geschwister liebt, der neue Dionysos» trug noch einen Beinamen, der allerdings nicht laut ausgesprochen wurde, nämlich Nothos, der Bastard. Doch weder seine angemaßte Göttlichkeit noch sein kundiges Flötenspiel oder seine dunkle Herkunft änderten etwas daran, daß Auletes ein erzschlauer, listenreicher und ränkevoller Staatsmann war, der sich durch allerlei Schwierigkeiten auf den Thron mogelte. Dieser fiel ihm nach zwei Königsmorden zu, weil kein echtstämmiger Ptolemäer mehr lebte. Ägypten, damals vom erstarkenden Rom mehr und mehr abhängig, holte Auletes aus Syria auf den vakanten Thron, ohne den mächtigen Dictator Sulla um Erlaubnis zu fragen. Doch Sulla trat in jener Zeit zurück, starb kurz darauf, und die neuen römischen Machthaber hatten damals andere Sorgen, als sich um die ägyptische Monarchie zu kümmern.
Die Gefahr kam aus der eigenen Familie, denn irgendein Vetter erhob vor dem römischen Senat Anspruch auf die ägyptische Krone. Auletes handelte schnell, bestach die Senatoren mit Gold und der Vetter mußte abtreten. Rom aber gewöhnte sich an die goldene Flut aus Ägypten, und Auletes kostete es nach und nach fast den ganzen Staatsschatz, sich auf dem Thron zu halten. Dem Volk blieb nicht verborgen, wohin seine hohen Steuern flossen, es gab Aufstände, und gegen Auletes bildete sich eine starke Opposition. Schließlich mußte er Hals über Kopf nach Rom fliehen, wo Pompejus ihn freundlich empfing, weil er einen König, der seit Jahren die römischen Feldzüge finanzierte, nicht verprellen wollte. Auletes’ Gegner hatten inzwischen eine hundertköpfige Abordnung nach Rom gesandt, von denen er durch bezahlte Mörder gleich ein paar Dutzend nach ihrer Ankunft in Puteoli umbringen ließ. Das nahm den anderen die Lust auf weitere Unternehmungen, und sie reisten zurück. Auletes salbte unterdessen in Rom genau die richtigen Hände mit der immer wirksamen Goldsalbe und konnte schließlich unter römischem Schutz auf seinen Thron zurückkehren.
Während seiner dreijährigen Abwesenheit war Kleopatras ältere Schwester Berenike an die Macht gelangt. Als Auletes zurückkehrte, saß sie noch immer auf ihrem wackeligen Thron, und ihr Vater ließ sie unverzüglich wegen Hochverrates hinrichten. Diese Verwandtenmorde waren in der 300jährigen Geschichte der Ptolemäer nichts Ungewöhnliches, waren fast schon zur Tradition geworden.
Ich habe diese Ereignisse kurz geschildert, weil sie meine Jugendzeit begleiteten und weil mein Vater während der ersten Regierungszeit des Auletes eine schnelle Karriere als Militärarzt machte. Er hat nie darüber gesprochen, wie er meine Mutter kennenlernte, jedenfalls war er ein Mann von fünfundzwanzig Jahren, als er die Ägypterin Selkis heiratete, deren Liebreiz und Anstand es schnell gelang, meine Großeltern umzustimmen. Doch es war ein kurzes Glück. Meine Mutter war mit mir hochschwanger, als der Truppenarzt Herakles, mein Vater, in irgendeiner dienstlichen Angelegenheit nach Memphis reisen mußte. Damals lebten meine Eltern in einer Dienstwohnung am Rande des Königsviertels beim Großen Hafen, und als sich bei Selkis vorzeitige Wehen ankündigten, war als erster einer der königlichen Leibärzte zur Stelle, da er in der Nähe wohnte. Ob in der Politik oder im Privatleben: Wenn der falsche Mann am falschen Ort zur Stelle ist, entsteht ein Unglück.
Die Geburt war schwer, der «Leibarzt» mühte sich redlich ab. Schließlich kam ich zur Welt, während im Bauch meiner Mutter etwas gerissen oder geplatzt war und sie langsam verblutete. Als Arzt muß ich zugeben, daß es viel leichter ist, das Blut einer äußeren Wunde zu stillen als den Blutfluß aus dem Inneren des Körpers, gerade bei Frauen, deren innere Geschlechtsorgane weitaus komplizierter sind als die unseren, wo alles schön übersichtlich nach außen gekehrt ist. Dieser Leibarzt hing nun jener alten Schule der Zaubermedizin an, und anstatt blutstillende, das heißt zusammenziehende Mittel – etwa Salbe aus Blättern der Dornakazie – anzuwenden, legte er ihr ein Amulett auf den Leib, hergestellt aus Haar, Haut und Blut von Esel, Schwein und Schildkröte. Ich nehme an, daß dieser Mensch damals der einzige unter den alexandrinischen Ärzten war, der noch an diesen alten Hokuspokus glaubte.
Als mein Vater aus Memphis zurückkam, fand er nur noch zwei weinende Frauen vor – meine beiden Großmütter, die sich übrigens prächtig verstanden. Die ägyptische Schwiegermutter meines Vaters hatte mit unbeugsamer Zähigkeit eine Einbalsamierung durchgesetzt, und während ich an der Brust meiner Amme lag, taten die «Gottessiegler» im «Haus des Anubis» ihr schreckliches Werk – so jedenfalls mag es jemand erscheinen, der griechisch erzogen wurde. Im Zusammenhang mit Selkis, meiner Mutter, mag ich nicht darüber reden, aber wer an Einzelheiten interessiert ist, kann bei Herodot nachlesen, was an den Einbalsamierungsstätten vor sich geht.
Was nun geschah, weiß ich aus dem Mund meines Vaters, und ich kann nur wiedergeben, was er mir darüber erzählt hat. Einige Tage muß er vor Trauer wie gelähmt gewesen sein, dann ging er zu dem «Leibarzt», der – vielleicht – Schuld am Tod meiner Mutter hatte. Er zählte ihm – wie der Lehrer dem Schüler – die blutstillenden Mittel auf, von denen jeder vernünftige Arzt, ob Jude, Grieche oder Ägypter, immer einen Vorrat zur Hand haben müsse. Der Arzt entgegnete ihm darauf, der schreckliche Gott Seth sei für jeden Blutfluß der eigentlich Verantwortliche, und man könne seine Macht nur bannen, wenn man aus Teilen der ihm heiligen Tiere Esel, Schwein, Nilpferd, Antilope oder Schildkröte ein Amulett forme oder eine Medizin bereite. Er habe nun gerade etwas von Esel, Schwein und Schildkröte zur Hand gehabt, vielleicht wäre etwas vom Nilpferd oder …
In diesem Augenblick überkam ein wilder Zorn meinen Vater, und er ohrfeigte den Zauberarzt so lange, bis dieser wimmernd zu Boden sank. Diener zerrten Herakles aus dem Haus, denn, so versicherte er mir mehrmals, er hätte diese jämmerliche Kreatur zu Tode geprügelt. Am nächsten Tag wurde mein Vater zum Obersten Truppenarzt befohlen, der ihm sagte, die Sache sei mit Geld und einer Entschuldigung aus der Welt zu schaffen, denn der Leibarzt wolle mit Rücksicht auf Seine Majestät den Fall in aller Stille bereinigen. Das aber lehnte mein Vater ab.
«Das käme diesem elenden Pfuscher nur gelegen, weil dann seine Unfähigkeit nicht publik wird. Ich bestehe auf einer öffentlichen Untersuchung, zumindest einer Verhandlung vor dem Hofgericht.»
Dem Vorgesetzten war dies vielleicht gar nicht so unrecht, denn er hatte sich als kenntnisreicher und tüchtiger Arzt bewährt und sich seinen Rang weder erschlichen noch erkauft. Pfuscherei war ihm ein Greuel. Irgendwie muß der Fall dem König zu Ohren gekommen sein, denn er zeigte Interesse, der Verhandlung beizuwohnen. In Ägypten herrschten damals friedliche Jahre; Auletes hatte sich mit Rom auf einen Zahlungsmodus geeinigt, außerdem hatte man dort mit innenpolitischen Problemen genug zu tun.
Ich versuche nun, so gut ich es kann, meinen Vater selber erzählen zu lassen, denn diese Verhandlung vor dem Hofgericht in Anwesenheit Seiner Majestät Ptolemaios XII. hat er mir mehrmals und, wenn ich mich recht erinnere, mit großer Genugtuung geschildert: «Der König beschäftigte zwei Leibärzte, von denen ich den einen gut kannte und ihn bat, als Gutachter aufzutreten. Meri-Ptah war ein Ägypter und stammte aus Mendes im Delta, wo man bis heute einen heiligen Stier verehrt. Er galt als strenger und korrekter Mann, abhold jeder Kurpfuscherei, und wenn er zauberische Praktiken anwandte, dann immer zusammen mit der reinen Erfahrungsmedizin und den erprobten Arzneien. Am Hof nannten sie ihn griechisiert Meriptas, und er genoß großes Ansehen. Freilich hatte auch der von mir angeklagte Leibarzt einige Befürworter, die umständlich ausführten, daß Selkis so oder so hätte sterben müssen, weil eine solch heftige Blutung auch mit Arzneien nicht aufzuhalten sei.
Der König saß im Hintergrund auf einem thronartigen Sitz und muß wohl den Entschluß gefaßt haben, dem Hof den Skandal eines wegen Unfähigkeit verurteilten Leibarztes zu ersparen. So wurde ich zusammen mit den zwei Richtern und dem Beklagten in einen kleinen Nebenraum gebeten. Auletes, dick, großnasig und anscheinend in guter Laune, versuchte mich mit Ehrungen und Geld zu bestechen, damit ich die Anklage zurückziehe. Da sagte ich laut, wohl zu laut: ‹Ich lasse mir das Leben meiner Frau auch von einem König nicht abkaufen.› Ptolemaios Auletes, damals gerade dabei, sich von den Priestern als ‹Neos Dionysos› (neuer Dionysos) und damit für göttlich erklären zu lassen, fuhr das in die falsche Kehle. Ich wurde sofort festgenommen und wegen Majestätsbeleidigung unter strengen Hausarrest gestellt. Drei Mann bewachten mich Tag und Nacht und folgten mir sogar auf den Abtritt. Das Strafmaß für Majestätsbeleidigung war in der Regel die Todesstrafe, doch mein Vorgesetzter erreichte es, daß sie in eine Verbannung nach Oberägypten an die Grenze des ‹elenden Kusch› – wie die alten Ägypter Nubien nannten – abgemildert wurde. Wer dort unten im Gluthauch der Wüste Militärdienst tun mußte, war wegen irgendeines Vergehens strafversetzt. Der dortige Truppenarzt hatte sich nach zweijährigem Dienst totgesoffen, und ich sollte ihn nun ersetzen. Deine beiden Großmütter weigerten sich, den Säugling, der du damals warst, herauszugeben, und du warst schon sechs oder sieben Jahre alt, als du mich erstmals besuchen konntest.»
Soweit mein Vater Herakles. Zu seiner letzten Bemerkung ist zu sagen, daß ich als Siebenjähriger niemals die weite Reise hätte unternehmen dürfen, wären meine Großeltern noch am Leben gewesen. Zuerst starben meine griechischen an einer in der Stadt grassierenden Seuche kurz hintereinander, danach meine ägyptischen Großeltern im Abstand von zwei Jahren. Dann lebte ich bei meinem Onkel Perseus – Vaters jüngerem Bruder –, der jetzt den Töpferladen führte und seiner Frau Demetria jedes Jahr ein Kind machte, so daß ich als Sechsjähriger schon mit vier Basen und Vettern aufwuchs. Mir war die Rolle des Stiefkindes zugefallen, des geduldeten Kostgängers, dem man die Brotstücke am Mund zählte.
Mein Vater wurde natürlich über das Ableben seiner Eltern und Schwiegereltern informiert, und in seiner Antwort äußerte er mehrmals den dringenden Wunsch, mich endlich zu sehen. Mein Onkel zögerte, weil er die Reisekosten scheute, doch als mein Vater ihm einen Beutel mit Drachmen übersenden ließ, heuerte er einen Diener an, der mich auf der langen Reise begleiten sollte. Der Abschied, muß ich sagen, fiel mir nicht schwer, außerdem steckt ein Siebenjähriger so voll Abenteuerlust, daß ich dieser Reise tagelang entgegenfieberte.
Als es dann eines Wintermorgens – nach römischem Kalender wird es Dezember oder Januar gewesen sein – soweit war, zappelte ich vor Aufregung wie ein Fisch auf dem Trockenen. Meinen römischen Lesern sei gesagt, daß die Ägypter nur drei Jahreszeiten kennen, nämlich Nilschwemme, Saatzeit (Winter) und Erntezeit (Sommer). Die Überschwemmungszeit dauert vom 15. Juni an vier Monate, danach folgt der Winter mit dem Rückgang des Wassers und einer im Delta verhältnismäßig kühlen Zeit. Den Nilstrom hat die Natur zum Reisen ideal ausgestattet, denn ein steter steifer Nordwind treibt die Schiffe nilaufwärts, während sie nach Norden nilabwärts mit der Strömung driften, also jeweils nur verhältnismäßig wenig Ruderkraft aufgewendet werden muß.
So saß der siebenjährige Olympos mit seinem freundlichen, aber schweigsamen Diener in einer Nilbarke und staunte an, was sich seinen Augen an beiden Ufern bot, vor allem die gewaltigen Tempelbauten in Abydos, Tentyra, Ombos, Theben und Apollinopolis, meist von den Ptolemäern neu errichtet oder erweitert. Mit jedem Tag unserer Fahrt wurde es heißer, während die Wüste nachts einen solchen Kältehauch ausschickte, daß mein Diener mich in mehrere Wolldecken wickeln mußte. Dann, am neunten oder zehnten Tag, erschien Suenet, das die Griechen Syene nennen, ein Städtchen an der Grenze zu Nubien, ein grüner Fleck in der Wüste, umgeben von gewaltigen Granitsteinbrüchen. Diese Gegend am ersten Nilkatarakt nennen die Ägypter Jeb, was Elefantenland bedeutet, und die größte Insel dort trägt den Namen Elephantine. Warum? Mein Vater meinte, es gebe zwei Deutungen. Zum einen soll dort früher ein reger Elfenbeinhandel stattgefunden haben, zum anderen sehen die Granitfelsen um die Inseln tatsächlich aus wie die Rücken untergetauchter Elefanten.
Mein Vater lebte in einem Militärlager am Rande der Stadt und hatte es, wie ich später bemerkte, durch seine ärztliche Kunst und seine Fürsorge auch für bedürftige «Zivilisten» zu großem Ansehen gebracht. Er bewohnte ein weiträumiges, bequemes Haus, nur wenige Schritte vom Nil entfernt, umsorgt von einer Schar Diener und Dienerinnen, die ihn verehrten, obwohl er auch sehr schroff und abweisend sein konnte. Aber er strafte nie hart, war verständnisvoll, nachsichtig und schaute nicht argwöhnisch auf jedes Getreidekorn, das in fremde Mäuler wanderte.
Sein Empfang war keineswegs überschwenglich, er ließ sich lange Zeit, mich zu betrachten, und sagte dann: «Du kommst ganz nach deiner Mutter, Olympos, doch deine grauen Augen sind makedonisch, die hast du von mir.»
Das Gesinde im Haus, entzückt über den Sohn ihres verehrten Herrn, behandelte mich wie einen Prinzen und hätte mich wohl noch schlimmer verhätschelt als meine Großeltern in Alexandria, doch mein Vater achtete streng darauf, daß sie es nicht zu arg trieben. Als erstes mußte ich das Schwimmen lernen, weil mein Vater meinte, wer am Wasser lebt, muß auch in ihm überleben können.
Am Katarakt ist der Nil häufig sehr seicht, springt schnell über die Granitfelsen und verhindert die Ansiedlung von Krokodilen, die träges, trübes und sumpfiges Wasser vorziehen. So wurde der Nil mein liebstes Spielgelände. Ich schwamm und tauchte wie ein Fisch und kannte bald jeden Felsen, jede seichte, tiefe oder durch Strudel gefährliche Stelle. Ich habe Alexandria niemals auch nur eine Träne nachgeweint, und statt meiner hochnäsigen Basen und Vettern fand ich hier eine Schar wilder Spielgefährten, die mich als Sohn des beliebten Arztes respektierten, ohne mir eine Sonderstellung einzuräumen. Die mußte man sich erkämpfen, und unsere Anführer wechselten schnell, weil einmal der, einmal ein anderer sich hervortat.
Zwischen meinem achten und meinem zehnten Lebensjahr hielt es mein Vater für angebracht, mir – über seine Kenntnisse hinaus – eine griechische Ausbildung zu vermitteln, die ein sehr gewissenhafter didaskalos erteilte. Klytos stammte aus Alexandria und war, so munkelte man, aus staatspolitischen Gründen hierher verbannt worden. Er selber sprach nicht davon, und niemand wagte es, ihn danach zu fragen. Heute kann ich mir denken warum, denn Klytos redete mit einer solchen Begeisterung von den alten griechischen Stadtstaaten, die ja fast ausschließlich nach demokratischen Richtlinien regiert wurden. So wird man ihn vermutlich in Alexandria als Feind der Monarchie denunziert und hierher verbannt haben.
Er war ein Lehrer, der bei uns Acht- bis Vierzehnjährigen – nicht ohne Erfolg – an Einsicht und Vernunft appellierte, so daß er den Bambusstock nur in ganz wenigen Ausnahmen gebrauchte, aber dann heftig und mit Nachdruck. Er hat intensiv fortgeführt und vertieft, was mein Vater begonnen hatte, und nach zwei Jahren seines Unterrichts waren mir Kultur, Geographie und Geschichte des alten Hellas so vertraut geworden, daß ich stolz war, aus mazedonischgriechischem Stamm zu kommen, und mich den Ägyptern in manchem überlegen dünkte.
Das rückte dann mein Vater schnell zurecht.
«Gut, Olympos, die alten Griechen haben zeitweise die monarchische Form überwunden und es mit der Demokratie versucht, die aber auch ihre Schwächen hat. Vergiß aber bei alldem nicht, daß die Ägypter schon gut zweitausend Jahre vor den Griechen eine Hochkultur mit Schrift, Handwerk, Ackerbau, Technik, großen Städten und steinernen Tempeln besaßen. Nimm dir einmal den Herodot vor und lies nach, was die Griechen den Ägyptern verdanken.»
Das tat ich dann auch, und ich sah seither keinen Grund mehr, mich meiner mütterlichen ägyptischen Herkunft zu schämen – ganz im Gegenteil.
Es war eine schöne Jugend, ich könnte mir keine bessere denken. Etwa ab meinem zehnten Lebensjahr nahm mein Vater mich immer häufiger auf seinen Krankengängen mit, und vielleicht bin ich einer der wenigen Ärzte, die ihre Kunst von Kindheit an gleichsam spielerisch erlernt haben.
Die politischen Ereignisse drangen nur sehr fragmentarisch, sozusagen in groben Zügen zu uns. Sie hätten mich, den damals Zehn-, Zwölf- und Vierzehnjährigen, auch kaum interessiert. Die Grenze zu Nubien war ziemlich ruhig, weil der dort regierende König Teritekas sich mit der Rückgewinnung eines Stück Landes nördlich des zweiten Katarakts zufriedengab.
Viel beachtet wurden dagegen die Familienereignisse im Königshaus. Jedes Kind seiner Gattin Kleopatra Tryphaina, das zur Welt kam, ließ Ptolemaios Auletes durch Herolde im ganzen Land verkünden, und er zeugte Töchter und Söhne in schneller Folge. Nach Kleopatra – der späteren Königin – und Berenike kamen Arsinoë und die beiden Prinzen zur Welt, die aber von einer anderen Frau stammten, denn Tryphaina war inzwischen gestorben. Dann und wann kommentierte mein Vater diese Ereignisse, vor allem wenn er nach anstrengendem Tagewerk bei einem Krug Wein draußen die einsetzende Abendkühle genoß, um dann – mehr monologisierend als an mich gerichtet – über diese Dinge zu reden. Daß ich im selben Jahr wie Prinzessin Kleopatra geboren war, nämlich im elften Regierungsjahr des Königs Auletes, wußte ich längst, weil Vater mich schon als Kind darauf hinwies.
Wenn ich vorhin sagte, daß ich die ärztliche Kunst spielerisch erlernte, so soll das nicht heißen, daß es immer ein schönes Spiel war. Ich lernte menschliches Leid in all seinen Erscheinungsformen kennen, und bereits als Sechzehnjährigem machte es mir nichts aus, verletzte Menschen brüllen, ächzen und stöhnen zu hören, auch weil mein Vater immer wieder betonte: «Schlimm ist es nur, wenn sie still geworden sind. Wenn sie reglos an dir vorbeistarren und kaum reagieren, wenn du ihre tiefen Wunden säuberst oder sondierst. Dann hat es sie meistens am Kopf erwischt, und du mußt Sachmet den Vortritt lassen.»
Er liebte solche Anspielungen auf ägyptische Gottheiten, und die löwenköpfige Sachmet galt als Göttin des Verderbens und der Vernichtung. Sie war freilich auch die Schutzpatronin der Ärzte – bei den Ägyptern ist das kein Widerspruch –, und mein Vater versäumte nie, einmal im Monat in ihrem kleinen Tempel zu opfern.
So wurde ich achtzehn, und mein Vater meinte, er hätte mich kaum noch etwas zu lehren, aber lernen müsse ein Arzt sein Leben lang.
Frauen gegenüber war ich ein schüchterner Junge, und Erfahrungen auf diesem Gebiet waren so gut wie nicht vorhanden. Daß eine unserer jungen Dienerinnen mir schöne Augen machte, merkte ich zwar, doch es brachte mich in tiefe Verlegenheit, und alles, was ich tat, war an sie zu denken, wenn ich mich selbst befriedigte. Ihre Mutter, eine noch junge Witwe, half gelegentlich bei uns aus, wenn große Wäsche fällig war, was sich weniger auf unsere Kleidung als auf Verbandsmaterial, Kompressen, Armschlingen und andere vom Arzt benötigte Utensilien aus Leinen oder Wolle bezog. Die beiden müssen wohl über mein scheues und verlegenes Benehmen getuschelt haben, denn die junge Witwe half mir recht resolut aus meiner Verlegenheit. Das war an einem Waschtag, als mein Vater dringend weggerufen wurde, während ich zurückblieb und Salben mischte. Dann ging alles recht schnell. Die Witwe sortierte Wäsche und Verbandsmaterial; hinter ihr dampfte der große Bronzekessel über dem Feuer. Sie hatte der Hitze wegen ihr Kleid abgelegt und stand schlank, schweißbedeckt und durchaus verlockend mit ihrem kleinen Lendenschurz mitten im Wäschehaufen – allein. Ich starrte sie mit offenem Mund an, sie lachte, faßte mich am Arm und fuhr mit der anderen Hand unter meinen Schurz. Dort ragte schon hart und steil mein schnell erregbarer Phallos, und ehe ich es versah, lag ich im Wäschehaufen, und sie saß auf mir und ritt mich zu wie ein junges Füllen. Es war, muß ich sagen, kein umwerfendes Erlebnis, machte mich aber ungeheuer stolz. Ich hatte eine Frau geliebt – war endlich ein richtiger Mann! Wir trieben es noch etliche Male, dann blieb sie aus, ich weiß nicht mehr warum, auch ihre Tochter nahm andere Dienste an. Von da an war ich weniger schüchtern, aber ein Frauenheld ist nie aus mir geworden.
Dann kam eine Zeit der politischen Unruhe, spürbar auch bei uns im abgelegenen Syene. Vor etwa zwei Jahren war der dicke Auletes gestorben, und sein ältester Sohn Ptolemaios XIII. folgte ihm auf den Thron, war aber erst zehn Jahre alt. Zuerst regierte er gemeinsam mit seiner Schwester Kleopatra, doch der hinter ihm stehende Regentschaftsrat hetzte und intrigierte gegen sie, so daß Kleopatra den Tod des heiligen Buchis-Stieres von Hermonthis zum Vorwand nahm, für einige Zeit aus Alexandria zu verschwinden. Das war recht geschickt, denn sie brachte ihre Person in Sicherheit und konnte sich zugleich im mittleren und südlichen Ägypten als die neue Herrscherin vorstellen wie auch durch ihre Teilnahme an der «Wiedergeburt» des Buchis-Stieres ihre Verbundenheit mit der ägyptischen Religion demonstrieren. Sie besaß damals schon einen großen Anhang und reiste durchaus königlich mit einem Dutzend Prunkbarken und vielen kleineren Begleitschiffen.
Ich war gerade zwanzig geworden, da erschien Kleopatra VII., Herrin Beider Länder und Tochter der Sonne, um ihren südlichsten Herrschaftsbereich in Augenschein zu nehmen.
1
Seit Menschengedenken hatte kein ägyptischer König Syene, die südlichste Stadt seines Reiches, besucht. Es gab hier auch keine schriftliche Überlieferung, doch galt als sicher, daß Ramses II. sich länger hier aufhielt, als er die beiden ihm und seiner Gattin Nefertari gewidmeten Felsentempel einweihte.
Natürlich war Kleopatras Kommen lange vorher angekündigt, so daß unser festlich aufgeputztes Städtchen auf den hohen Besuch gut vorbereitet war. Der Bürgermeister hatte das Stadthaus – hier tagte er von Zeit zu Zeit mit dem Ältestenrat – mit Blumengirlanden, Sykomoren- und Tameriskenzweigen ausschmücken lassen.
Am Tag ihrer voraussichtlichen Ankunft warteten die Honoratioren von Syene am Hafen auf das Anlegen der königlichen Flotte. Die kleine griechische Kolonie bestand aus dem Statthalter von Jeb, dem Kommandanten der Grenztruppen mit seinen Offizieren, ein paar Verwaltungsbeamten sowie aus meinem Vater und mir, den beiden Ärzten. Der Bürgermeister war ein Ägypter, wie auch die Priester der hier verehrten Götter, an der Spitze die Priesterkollegien des Isis-Tempels auf der Insel Philae und des Osiris-Tempels auf der Nachbarinsel Bigge. Diese Herren gaben sich sehr würdevoll und beeindruckten mit ihren kahlgeschorenen Köpfen und den Leopardenfellen über ihren langen weißen Gewändern. Die Priester des Chnum-Tempels auf Elephantine standen ihnen kaum nach, während die der kleineren Heiligtümer von Amun, Sachmet, Hathor und einiger Lokalgötter etwas bescheidener auftraten.
Kleopatras königliche Prunkbarke war mit ihren vergoldeten Masten, den wehenden Fahnen und farbigen Sonnensegeln schon von weitem zu erkennen. Die kleinen Schnellruderer der Leibwache umgaben das Königsschiff wie eine metallene Schutzwehr; die Lanzen, Schwerter und Streitäxte funkelten bedrohlich in der späten Nachmittagssonne. Schon von weitem kündete vielstimmiger Fanfarenklang die Ankunft des hohen Besuchs an. So einfach die Königin – wie ich später sah – sich in ihrer griechisch geprägten Residenz meist kleidete, so prunkvoll trat sie hier als Nebet taui und sat-Ra – als Herrin Beider Länder und Tochter der Sonne – auf: als Pharaonin wie in den Tagen der altägyptischen Dynastien. Auf ihrem Kopf funkelte eine goldene Uräenkrone, ihre über der Brust verschränkten Hände hielten Zepter und Peitsche. Weißgekleidete Weihrauchträger schwangen ihre vergoldeten Bronzekessel und hüllten Kleopatra in grauweiße, vom Nordwind schnell davongetragene Duftwolken. Bis auf den Lendenschurz nackte nubische Sklaven trugen den vergoldeten Thron mit der Königin an Land, und ihre ägyptischen Untertanen warfen sich sogleich nach alter Sitte in den Staub. Wir Griechen bildeten ein Spalier mit tiefgebeugten Rücken, da hörten wir ihre helle, etwas harte, aber wohlklingende Stimme: «Erhebt euch – erhebt euch!»
Schon als Zwanzigjährige beherrschte Kleopatra mehrere Sprachen, darunter perfekt und akzentfrei die alte Sprache ihres Landes. In ihr richtete sie einige Worte an den Bürgermeister und seine Beamten, dann begrüßte sie uns Griechen und ließ sich vom Statthalter die juwelengeschmückte Hand küssen.
Im Stadthaus fanden wir uns alle wieder zusammen, und der dioecetes Protarchos – ihr Erster Minister – stellte sich neben den erhöhten Thron und las von einer Schriftrolle etwas ab; auch dies in der alten Tradition der Pharaonen, die niemals selbst längere Ansprachen vor ihren Untertanen hielten. Da war die Rede von «meinem geliebten Brudergemahl», der sein königliches Amt in Alexandria versehe, unterstützt von einem tüchtigen Regentschaftsrat, der, so hoffe sie, bald entbehrlich sei. Auch gedachte die Königin ihres Vaters, des «Neos Dionysos», der nun mit den Himmlischen vereint sei und dessen göttliche Hilfe und Unterstützung aus dem Jenseits sie deutlich empfinde. Sie erwähnte auch den Buchis-Stier von Hermonthis, an dessen feierlicher Wiedergeburt sie teilgenommen hatte. In dieser königlichen Rede, vom dioecetes verlesen, wurden die Geschwister als in Eintracht und Frieden herrschendes königliches Ehepaar dargestellt, doch einige der Anwesenden wußten recht gut, daß die Wirklichkeit anders aussah. Danach gewährte Kleopatra jedem der Anwesenden eine kurze Audienz.
So standen auch wir vor ihrem Thron, mein Vater und ich. Der Zeremonienbeamte las von seiner Liste ab: «Truppenarzt Herakles mit seinem Sohn Olympos, ebenfalls Arzt.»
Bei meinem Namen erfolgte das von mir schon erwähnte kurze Stirnrunzeln, dann sagte sie: «Tüchtig, tüchtig, junger Mann. Ich nehme an, du assistierst deinem Vater bei seiner schweren und verantwortungsvollen Arbeit?»
Herakles antwortete für mich.
«Auch, Majestät, aber er ist durchaus imstande, alleine Diagnosen und Behandlungen durchzuführen.»
Während die Königin ihre Augen auf meinen Vater richtete, wagte ich es, sie mir genauer anzusehen. Sie zeigte damals nicht ihr eigenes Gesicht, denn es war nach ägyptischer Art geschminkt und wirkte dadurch etwas starr, wie eine bemalte Mumienmaske. Die großen ausdrucksvollen Augen leuchteten in einem tiefen Grau – wie bei mir das makedonische Erbe –, doch ihre Haarfarbe verbarg eine reichgelockte Perücke. Unter der hohen Stirn sprang weit ihre Nase hervor, schmal und leicht gekrümmt, aber nicht so lang, daß sie häßlich gewirkt hätte. Der Mund war weder klein noch groß, weder üppig noch dünn, sondern edel, schön geformt und mit einer etwas überstehenden Oberlippe, was ihrem Gesicht eine Spur koketter Weiblichkeit verlieh. Ihre spöttische Stimme riß mich aus meinen Betrachtungen.
«Nun, Olympos, studierst du mein Gesicht als Arzt, oder willst du ein Bildnis von mir fertigen?»
«Weder noch, Majestät, und bitte verzeihe mir meine Kühnheit. Eine Königin sieht man eben nicht alle Tage.»
Sie lachte auf eine herzliche und unbeschwerte Art.
«Da hast du wohl recht, Olympos – aber wer weiß, wohin dein Lebensweg dich noch führt.»
Wäre nicht geschehen, was tags darauf geschah, so hätte es wohl für mich keine zweite Begegnung mit der Königin gegeben.
Am nächsten Morgen, noch vor Sonnenaufgang, mußte mein Vater mit einem Schnellruderer nach Süden reisen. Ein Grenzposten war von einem der verräterischen Wüstenstämme überfallen worden, und es hatte Tote und Verletzte gegeben.
«Du bleibst hier, Olympos, wir können nicht beide verschwinden, solange die Königin in Syene weilt.»
Für diesen Tag hatte Kleopatra den Wunsch geäußert, die berühmten Steinbrüche zu besichtigen, wo seit ältester Zeit der begehrte Rosengranit gebrochen und ins Land verschifft wurde. Die Bildhauer schufen aus ihm die schönsten Bildwerke religiöser und profaner Art, und der harte Stein blieb auch nach Jahrtausenden unverändert.
Zusammen mit dem nauarchos der königlichen Flotte, einem Trupp ihrer Leibwache und einigen Dienerinnen machte sich Kleopatra in einer Tragsänfte auf den Weg. Die Steinbrüche liegen am Rande der Stadt und sind schnell zu erreichen. Der nauarchos, ein älterer Herr, ritt auf einem Esel und geriet, als er abstieg, mit dem linken Fuß in eine Steinspalte, stürzte und zog sich einen offenen komplizierten Knöchelbruch zu. Man brachte ihn sofort auf sein Schiff, und zwei Ärzte eilten herbei – Kleopatras damaliger Leibarzt und einer, der für die Schiffsbesatzungen zuständig war. Bei offenen Brüchen, vor allem, wenn der Knochen mehrfach zersplittert ist, gibt es kaum einen Arzt, der nicht zur Amputation rät. Dafür sprechen eine Reihe guter Gründe, wovon der gewichtigste die Gefahr ist, daß das Glied brandig wird und nicht selten durch Vergiftung des ganzen Körpers zum Tode führt.
Als der nauarchos hörte, daß man ihm den Fuß abnehmen wollte, wehrte er sich dagegen und verlangte, einen dritten Arzt zuzuziehen, nämlich den Truppenarzt Herakles, meinen Vater. Ein Diener kam in unser Haus, doch ich mußte ihm sagen, daß Herakles schon eine Tagesreise nach Süden unterwegs war; aber auch ich sei Arzt und würde mir gerne den Fuß ansehen. Der Diener musterte mich abschätzig, wahrscheinlich erschien ich ihm zu jung, doch ich hatte schon das Notwendigste hergerichtet und ging mit ihm zum Hafen.
Kleopatra saß am Bett ihres Flottenchefs und herrschte mich an: «Wo ist dein Vater? Ihn haben wir herbefohlen, nicht dich!»
Ich erklärte die Sachlage, und der Verletzte sagte mit dünner, schmerzgequälter Stimme: «Ein junger Arzt muß nicht zwangsläufig ein schlechter sein …»
Ich betrachtete den schlimm zugerichteten Fuß genau. Er war fast im rechten Winkel abgeknickt, und einige der zersplitterten Knochen hatten sich durch die Haut gebohrt und standen heraus wie Stacheln.
«Ich müßte den Fuß genauer untersuchen, das ist sehr schmerzhaft, dauert aber nicht lange.»
Der nauarchos grinste mühsam.
«Nur zu – nur zu! Schlimmer kann es nicht mehr werden …»
Zwei seiner Diener hielten ihn fest, und ich versuchte den Fuß langsam in seine natürliche Lage zu drehen. Der Verletzte knirschte hörbar mit den Zähnen, begann zu stöhnen und schließlich zu schreien.
Die Königin erhob sich.
«Hör sofort damit auf! Warum quälst du ihn so?»
«Weil es sein muß», sagte ich ungerührt, doch ich hatte gesehen, was zu sehen war, hatte auch mit den Fingern ertastet, daß das Fußgelenk noch weitgehend intakt war und der Bruch nur eine Spanne darüber lag.
«Ich bin der Ansicht, daß es eine Möglichkeit gibt, den Fuß zu retten. Er wird natürlich steif bleiben und nicht mehr belastbar sein. Aber eine Amputation ließe sich vermeiden.»
Der königliche Leibarzt sagte nichts, schnaubte nur verächtlich durch die Nase. Der Schiffsarzt wiegte bedächtig seinen Kopf.
«Hast du dir das genau überlegt? Eine solche Wunde gerät mit Sicherheit in Brand, und schließlich muß doch amputiert werden, dann vielleicht nicht nur der Fuß, sondern der ganze Unterschenkel. Hast du schon einmal ein brandiges Glied gesehen?»
Ich grinste ihn an, vielleicht ein wenig zu frech.
«Nicht nur einmal, verehrter Kollege, sondern viele Dutzend Male. Die Grenztruppen hier sind regelmäßig den Überfällen der Nubier oder räuberischer Wüstenstämme ausgesetzt, und was Steinschleudern, Streitäxte oder Keulen anrichten können, weiß ich besser als jeder andere. Wenn wir da immer gleich amputieren würden, hätte die Armee Ihrer Majestät nur noch einbeinige und einarmige Krüppel aufzuweisen.»
Kleopatra, schon dabei aufzubrausen, lächelte streng.
«Falls deine ärztlichen Fähigkeiten nicht geringer sind als dein freches Benehmen, wirst du es noch weit bringen in deinem Beruf. Der nauarchos soll es selber entscheiden, denn nur ihn geht es an.»
Der Verletzte hatte die Augen geschlossen, über sein blasses, schweißbedecktes Gesicht huschten schmerzliche Zuckungen, die er zu unterdrücken suchte.
«Ich vertraue mich dem Arzt Olympos an», sagte er leise.
«Gut», sagte ich, «aber der Verletzte ist nicht transportfähig. Wir haben in unserem Haus einige Krankenstuben, er muß einige Zeit hierbleiben – vielleicht einen Monat, vielleicht auch länger.»
«Basilissa …», begann der Leibarzt, doch die Königin schnitt ihm das Wort ab.
«Der nauarchos hat entschieden, und dabei bleibt es. Zwei Diener werden ihn begleiten, und sein Schiff wartet hier im Hafen, bis er wiederhergestellt ist. Und dir, Olympos, sage ich eines: Falls dieser Mann unter deinen Händen stirbt, dann rate ich dir, dich rechtzeitig nach Nubien abzusetzen. In Ägypten wirst du nicht mehr froh werden.»
Ich verneigte mich tief.
«Alles geschieht nach dem Wunsch Deiner Majestät.»
Viel später, in einer vertraulichen Stunde, fragte ich, ob sie ihre Drohung – wäre der Oberbefehlshaber der Flotte gestorben – wahrgemacht hätte.
Sie zuckte die Schultern.
«Vielleicht – vielleicht auch nicht. Könige sind launisch, weißt du. Aber die politische Lage war in dieser Zeit sehr gespannt, und ich hatte den Oberbefehlshaber der Flotte schon vergessen, als er nach einigen Monaten plötzlich wiederauftauchte.»
Der nauarchos bezog mit seinen beiden Dienern unsere beste Krankenstube, und ich tat alles, um seinen Fuß und sein Leben zu retten. Mein Vater kam erst nach neun Tagen zurück, und in dieser Zeit war ich auf mich allein gestellt. Ich verabreichte dem Kranken unser spezielles Betäubungsmittel, eine Mischung, die ich hier nicht nennen will, weil ich es meinem Vater versprochen habe. Nur soviel: Sie besteht aus drei verschiedenen Pflanzensäften, Honig, Öl und vergorenem Gerstensaft und wird mit einem Klistier in den After gegeben.
Als erstes hatte ich die herausragenden Knochensplitter mit einer Pinzette entfernt, den Bruch, so gut es ging, gerade gerichtet und mit festen Binden fixiert. Nun kam es vor allem darauf an, Entzündungen oder Eiterung zu vermeiden, und ich weiß, daß es nicht mein Verdienst war, sondern die gute Natur des alten Oberbefehlshabers der Flotte, wenn die Wunde glatt abheilte und die Knochen langsam zusammenwuchsen und zu verknorpeln begannen. Wichtig war nur, daß er den Fuß nicht bewegte, und um dies zu verhindern, band ich ihn am Bettgestell fest.
Als mein Vater zurückkam, ließ er sich den Fall in allen Einzelheiten schildern, nickte dann und wann und sagte schließlich zu mir, der gespannt auf sein Urteil wartete:
«Ich hätte es nicht anders gemacht, aber ich hoffe, du hast das Risiko bedacht. Noch immer können Komplikationen eintreten, der Fall ist noch längst nicht ausgestanden.»
Doch offenbar standen mir Sachmet und Asklepios hilfreich zur Seite – weder gab es Komplikationen noch Rückschläge, und nach fünfundzwanzig Tagen strenger Bettruhe durfte der Oberbefehlshaber der Flotte erstmals sein Lager verlassen.
«Es ist wie ein Wunder …», murmelte er, doch daß es nicht ganz so war, spürte er beim ersten Versuch, mit dem kranken Fuß aufzutreten. Ein unterdrückter Schrei und ein ellenlanger Fluch begleiteten diesen Versuch, und ich hatte alle Mühe, ihn zu beruhigen.
«Es wird niemals so sein wie vorher», warnte ich ihn. «Stock oder Krücken werden dich zeitlebens begleiten, aber dein Fuß ist gerettet, nauarchos. Das ist immer noch besser als ein beinloser Krüppel.»
Mein Vater stand dabei und sagte: «Mein Sohn hat recht, Herr.»
Der Oberbefehlshaber der Flotte humpelte zu seinem Lager und ließ sich behutsam dort nieder. «Ja, ja, ich weiß, aber es ist für mich so ungewohnt.»
Das war nun die alte Klage unserer Patienten, wenn ein Bein steif, eine Schulter schief, eine Hüfte krumm geblieben war: es ist so ungewohnt … Aber sie überlebten es und gewöhnten sich daran, wie sich der Mensch an alles gewöhnt, solange ihm eine Hoffnung bleibt.
Am Tag seiner Abreise bestand der Oberbefehlshaber der Flotte darauf, den Weg zum Hafen auf seinen eigenen zwei Beinen und ohne die Hilfe von Dienern zurückzulegen. Er benutzte Krücken, aber er schaffte es. Er ließ uns fünf Goldstater überreichen, die mein Vater zurückwies.
«Wir dienen beide der königlichen Armee, du auf dem Wasser, ich zu Lande. Es wäre nicht recht, dafür eine Bezahlung anzunehmen.»
Der Oberbefehlshaber der Flotte schüttelte störrisch den Kopf.
«Ich nehm’s nicht zurück! Dann verwende es eben für Kranke, die nicht der Truppe angehören und kein Geld besitzen.»
Mein Vater nickte.
«Gut, nauarchos so soll es geschehen.»
Ich begleitete meinen Patienten aufs Schiff, wo er sich in einen Deckstuhl sinken ließ und die Krücken auf den Boden legte.
«Dir, Olympos, verspreche ich eines: Ich werde bei der Königin dein Lob singen, denn du hast es verdient. Anstatt den einfacheren Weg zu wählen, nämlich meinen Fuß abzuschneiden und mit ihm alle zu erwartenden Komplikationen, hast du es gewagt, eine gefährliche Verletzung nach allen Regeln deiner Kunst und mit großer Geduld zu behandeln. Ärzte wie dich bräuchten wir in Alexandria an der Universität, um deine Einstellung und dein Wissen an die Jüngeren weiterzugeben.»
Ich lächelte geschmeichelt.
«Jung bin ich ja selber noch, und keine Universität würde mich als Lehrer aufnehmen. Vielleicht in zehn Jahren …»
Der Oberbefehlshaber der Flotte nickte.
«Wann auch immer, du bist willkommen.»
Dieses Gespräch nahm ich nicht ernst und hatte es bald wieder vergessen. Dankbare Patienten versprechen viel, jeder Arzt weiß das, sind aber Schmerzen und Krankheit vergessen, muß man froh sein, wenn sie einen auf der Straße noch grüßen.
Ich habe vorhin erwähnt, daß die Eintracht des königlichen Ehe- und Geschwisterpaares nur eine Fiktion war, um das Volk in Sicherheit zu wiegen, doch die Bürger von Alexandria durchschauten den Betrug schnell, und selbst bei den Gebildeten in Syene, an der Grenze zu Nubien, entstand einige Unruhe wegen der damit verbundenen Ereignisse.
Viele römische und griechische Autoren haben diese bewegten Jahre nach dem Tod Ptolemaios XII. Auletes ausführlich dargestellt, aber – so scheint es mir – keiner schöpfte dabei aus erster Quelle, und auch wo die Berichte nicht gerade falsch sind, so erkenne ich doch spürbare Lücken.
Eines gleich vorweg: Kleopatra hat niemals einen Zweifel daran gelassen – was sie eher durch Taten als durch Worte bewies –, daß sie allein sich als Herrscherin der Beiden Länder sah, daß ihre Schwester Arsinoë und die beiden Halbbrüder in ihren Augen nur Randfiguren darstellten, flüchtige Schatten auf dem Bild der Geschichte, die sie – sie allein – in Ägypten und später auch anderswo gestalten wollte.
Der Wille des verstorbenen Königs war es gewesen, daß sie zusammen mit dem älteren ihrer beiden Halbbrüder die Nachfolge antrat. So geschah es zunächst auch, aber Kleopatra ließ erkennen, daß sie nicht gesonnen war, die Macht mit dem zehnjährigen Brudergemahl Ptolemaios XIII. zu teilen. Damit aber war der hinter dem Bruder stehende Regentschaftsrat – angeführt von dem «Pflegevater» Pothinus – nicht einverstanden. Ehe ihr kindlicher Bruder erwachsen und ein ernstzunehmender Machtkonkurrent werden konnte, tat sie alles, um ihn auszustechen, um sich beim Volk beliebt zu machen.
Zurück in Alexandria, nahm Kleopatra den Thron an der Seite ihres Bruders wieder ein. Pothinus und der Regentschaftsrat duckten sich, setzten aber ihre Wühlarbeit im geheimen fort. Dazu zählte ein Dekret, das im Namen «des Königs und der Königin» erlassen wurde, aber nur vom Regentschaftsrat kam und anordnete, alles in Mittelägypten geerntete Getreide nach Alexandria und keineswegs – es war ein Jahr der Mißernte – in die Notstandsgebiete zu schicken. Damit sollte Kleopatras neugewonnenes Ansehen in Unter- und Oberägypten geschwächt und untergraben werden. Aus Rom drohte weiterhin die Gefahr, daß im noch immer tobenden Bürgerkrieg jene Kräfte siegen könnten, die für eine Annexion Ägyptens eintraten.
Wenn ich heute, nur vier Dezennien später, auf Rom und die übrige Welt blicke, fällt es mir schwer zu glauben, daß aus diesen Wirren ein so fester und anhaltender Frieden hervorgegangen ist. Man mag kaum glauben, daß es vor wenigen Jahrzehnten noch Zeiten gegeben hat, da die Anhänger der Triumvirn Caesar, Pompejus und Crassus sich in den Straßen Roms gegenseitig abschlachteten.
Nun war Crassus während eines Partherfeldzuges gefallen; der Machtkampf spielte sich jetzt nur noch zwischen Caesar und Pompejus ab. Letzterer schien in Rom die stärkere Anhängerschaft zu besitzen, doch Caesar jagte ihn davon, und Pompejus suchte in Ägypten nach Unterstützung. Man empfing ihn dort sehr zuvorkommend, weil sein Vater König Ptolemaios Auletes immer geholfen und unterstützt hatte, wenn auch, ich sagte es schon, gegen klingende Münze. Dennoch dachte Kleopatra – sie hat es mir selbst bestätigt – nicht einen Augenblick daran, ihm beizuspringen, weil sie von ihren Spitzeln erfuhr, daß Julius Caesar in Rom und Italien die Macht fest in den Händen hielt. So tat sie das einzig mögliche, nämlich nichts, und überließ dem Regentschaftsrat die Verantwortung für sechzig Schiffe, Soldaten und Proviant, die dieser dem Pompejus zur Verfügung stellte. Ein Teil des mit ihm geflohenen Senats bedankte sich überschwenglich bei Ptolemaios XIII., und Pompejus wurde daraufhin pro forma zum Vormund des jungen Königs ernannt. Ein schönes Spiel, ein rührendes Spiel, dem Kleopatra nicht weiter zuschaute, weil sie ernsthaft um ihr Leben fürchtete. Quasi über Nacht floh sie aus der Stadt und ging mit den ihr treuen Truppen nach Palästina, an die Nordostgrenze ihres Reichs.
Caesar erfuhr davon und horchte auf. Sie also schien eine Gegnerin des Pompejus zu sein, und er bedachte die alte Regel: Der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Von da an stellte sich Julius Caesar auf die Seite von Kleopatra und blieb ihr gewogen bis in den Tod.
Zunächst aber galt es, Pompejus zu besiegen. Caesar, der geniale Feldherr, sicherte sich nach Italien die Iberische Halbinsel, kehrte dann in Eilmärschen zurück und zwang Pompejus bei Pharsalos in Thessalien zur Entscheidungsschlacht, und das war im Sommer des dritten Regierungsjahres meiner Königin. Pompejus wurde vernichtend geschlagen und floh nach Ägypten, um dort beim jungen König um Hilfe und Verstärkung zu bitten. Ptolemaios aber war inzwischen anderen Sinnes geworden. Sein «Pflegevater» Pothinus hatte ihn überzeugt, daß es für Ägypten auf die Dauer nicht von Vorteil sein könne, zum Nebenschauplatz des römischen Bürgerkrieges zu werden. Es hätte auch zuviel gekostet …
Ein paar hohe römische Offiziere wurden bestochen, und als Pompejus zu ihnen ins Boot stieg, um in Ägypten an Land zu gehen, brachten sie ihn um. Gleichzeitig fuhr eine Flotte ägyptischer Kriegsschiffe los und versenkte einen Teil von Pompejus’ Schiffen; der Rest floh aufs offene Meer.
Jetzt schlug die Stunde des einzig Überlebenden aus dem Triumvirat. Crassus und Pompejus waren tot, und nur vier Tage nach des letzteren Ermordung landete Julius Caesar mit einem Heer von etwa elftausend Mann im Hafen von Alexandria. Eine königliche Abordnung überreichte ihm den Siegelring und die einbalsamierte rechte Hand des Pompejus. Caesar verhielt sich sehr kühl, denn Pompejus war zwar sein Feind, aber er war auch ein Römer gewesen, und es paßte ihm nicht, daß Ägypten sich in den Streit gemischt hatte. Er zeigte deutlich seinen Unwillen, gab aber zu verstehen, daß dieser leicht zu besänftigen sei, und zwar mit Geld – viel Geld, das er zur Fortsetzung des Kampfes gegen die Söhne und Anhänger des Pompejus brauchte. Des weiteren erinnerte Caesar daran, daß ihn der verstorbene König Auletes bei allen Göttern und den mit ihm in Rom geschlossenen Verträgen gebeten habe, die Vollstreckung seiner testamentarischen Verfügungen zu überwachen. Das, so Caesar, wollte er als römischer Senator und derzeitiger Konsul jetzt tun. Als erstes sandte er einen Eilboten nach Palästina, um Kleopatra zur Rückkehr und Regierungsübernahme zusammen mit ihrem Bruder aufzufordern. Damit war nun der hinter dem jetzt zwölfjährigen Ptolemaios stehende Kreis gar nicht einverstanden. Sie wollten mit Hilfe ihrer königlichen Strohpuppe weiter ihre Fäden spinnen, sich an Geld und Macht bereichern. So versperrte man Kleopatra den Weg zu Land, und sie mußte sich verkleidet auf einem kleinen Boot in den Hafen und an Land schmuggeln.
Wie sie an Land kam, ist oft kommentiert worden; sie selber hat sich niemals dazu geäußert und keiner – mich eingeschlossen –, der es gewagt hätte, sie danach zu fragen. Im allgemeinen wird der Fall so dargestellt: Aus Angst, an Land auch verkleidet erkannt zu werden, bestach sie den mit seinem Schiff im Hafen liegenden sizilianischen Händler Apollodoros, sie in einen kostbaren Teppich zu wickeln und diesen bei Caesar als Kleopatras Geschenk abzuliefern. So geschah es dann, und sie muß den damals zweiundfünfzigjährigen Konsul derart bezaubert haben, daß er, immer auch das Wohl Roms im Auge, sich für ihre Pläne einspannen ließ – Pläne, die vor allem darauf hinzielten, Kleopatra als Alleinherrscherin auf dem ägyptischen Thron zu installieren. Das war aber nicht leicht, denn die Stimmung in Alexandria – und nur darauf kam es an – war einhellig gegen die Römer gerichtet, angefeuert noch durch Pothinos, den Vorsitzenden des Regentschaftsrates. Die Römer – ob Soldaten oder Zivilpersonen – wurden auf der Straße bespuckt, verbal beleidigt und nicht selten tätlich angegriffen. Die Griechen beschimpften die Römer als ungehobelte Barbaren, Tyrannen und Länderfresser, und die damals geäußerten Meinungen der Römer über die Griechen waren auch nicht besser. Sie seien heimtückisch, skrupellos, schamlos, streitsüchtig und unfähig zur Tat.
Caesar wußte natürlich, daß er bei Pothinus ansetzen mußte, um die Zukunft in seinem Sinn zu gestalten, aber er handelte nicht überstürzt, sondern erfüllte zunächst einmal das Vermächtnis des Auletes und ließ Kleopatra mit ihrem Brudergemahl Ptolemaios als Könige von Ägypten propagieren. Der junge König war jetzt alt genug, um zu erkennen, daß Caesar und seine Schwester sich wie Liebesleute verhielten und daß er, wie man so sagt, nur das fünfte Rad am Wagen war.
Ob aus eigenem Antrieb oder von Pothinos aufgehetzt – sein Zorn darüber wurde augenfällig, als er, begleitet von Freunden und Verwandten, auf die Straße lief, sich sein Diadem vom Kopf riß und ausrief, seine Schwester sei die Hure von Julius Caesar, man habe ihn verraten und sei dabei, ihn zu ermorden. Das entfachte einen Aufruhr in der Stadt, doch die römischen Legionäre brachten den Knaben mit sanfter Gewalt in den Palast zurück, und Caesar erzwang eine Versöhnung der Geschwister. Klug, wie er war, tat er noch ein übriges: Er versprach, das von den Römern besetzte Cyprus den Ptolemäern zu übergeben und dort Kleopatras Halbschwester Arsinoë und ihren jüngeren Bruder Ptolemaios XIV. als Könige einzusetzen. Der später von den Historikern geäußerte Verdacht, Kleopatra habe auf diese Art ihre ungeliebten Geschwister loswerden wollen, wird wohl zutreffen, um so mehr, als Caesar die beiden weiterhin im Brucheion, dem königlichen Palastviertel, festhielt und keine Anstalten machte, sie nach Cyprus zu bringen. Der römische Senat wäre wohl auch sehr empört gewesen, hätte er diese Provinz sozusagen ohne Gegenleistung verschenkt.
Pothinus, «Pflegevater» des jungen Königs und hinter ihm der eigentliche Herrscher, schmiedete inzwischen Pläne, Julius Caesar zu ermorden. Doch in seinem Barbier fand sich ein Verräter, der an die Zukunft dachte und mehr auf Caesar als auf seinen Herrn setzte. Pothinus wurde festgenommen und wegen hochverräterischer Mordpläne gleich am nächsten Tag hingerichtet. Das Urteil war von beiden Königen unterzeichnet, aber Pergament ist ja geduldig, und daß Ptolemaios seinen Pflegevater in den Tod geschickt hätte, ist kaum denkbar. Doch möglich ist alles, und Kleopatra erwähnte mir gegenüber einmal, er habe es getan, um nicht – wie von Caesar angedroht – ins Exil geschickt zu werden.
2
Die Kunde von diesen Ereignissen traf in großen, oft groben, manchmal auch legendären Zügen bei uns in Syene ein. Wohlunterrichtet zeigte sich auch König Teritekas von Meroë, wie er und seine Vorgänger das frühere Kusch nannten, das die Griechen heute als Aithiopia bezeichnen. Er nutzte die Wirren in Alexandria für seine Zwecke und versuchte immer wieder, sich Teile von Ägypten anzueignen – ja, er behauptete frech, alles Land bis zum Ersten Katarakt stünde ihm als Herrschaftsbereich zu.
Für mich und meinen Vater bedeutete das viel Arbeit, weil es bei den Scharmützeln ständig Verletzte gab. Schließlich gab der strategos der Grenztruppen uns den Befehl, in das befestigte Lager südlich des Ersten Kataraktes überzusiedeln, weil dort unsere Hilfe jetzt dauernd und dringlich benötigt werde. Dieses Lager befand sich etwa hundertzwanzig Stadien südlich des großen Felsentempels, und auf dem Weg dorthin sah ich zum ersten Mal dieses gewaltige, von König Ramses II. errichtete Werk. Die vier monumentalen Sitzfiguren des Königs waren bis zur Brust mit Sand bedeckt, auch der kleinere, Königin Nefertari gewidmete Tempel lag zur Hälfte in einer riesigen Sanddüne. Mein Vater wies hinüber.
«Da, Olympos, schau es dir genau an! So verging der Glanz des alten Ägypten. Hier lebten früher Hunderte von Menschen, die das Heiligtum pflegten, der Gottheit des Königs opferten und dafür sorgten, daß Seth, der Herr der Wüsten, es mit seinem Gluthauch nicht zuwehen konnte. Heute wissen nicht einmal mehr die Historiker, warum sich Ramses viermal hat abbilden lassen und welche Gottheiten – von ihm abgesehen – noch hier verehrt wurden. Es gibt nur noch die Legende von des Königs großer Liebe zu Nefertari, denn sie und nur sie hat er zusammen mit sich abbilden lassen, von seinen anderen vier oder fünf Hauptfrauen kennt man nur die Namen. Solltest du je nach Theben kommen, dann lasse dir im Westen Nefertaris Grab zeigen. Es ist zwar ausgeplündert und ihre Mumie ist verschwunden, doch du findest dort die schönsten Malereien, die du je gesehen hast. Da – schau!» Er deutete zum Himmel. «Jetzt kreisen die Geier über dem verschütteten Heiligtum – sie kreisen über Nefertaris Tempel. Weißt du, daß nur die Hauptgemahlin eines Pharaos die Geierhaube tragen durfte, geheiligt durch die Göttin Nechbet? Ja, deine Mutter hat mir viel von den alten ägyptischen Bräuchen erzählt …»
Er schwieg und wandte sich ab. Ich fragte nicht weiter, weil ich wußte, daß ihm heute noch die Tränen kamen, wenn die Sprache auf meine Mutter kam.
Bei den Grenztruppen wurden wir sehnlichst erwartet. Marinos, der phrourarchos, lag schwer verletzt im Zelt und hatte das Kommando seinem ersten Offizier übergeben. Ein Schleuderstein hatte ihn an der oberen Schläfe getroffen, der Knochen war eingedrückt, der Verletzte konnte kaum reden, verdrehte häufig die Augen, schrie manchmal unvermittelt auf.
«Da drücken Knochenteile aufs Gehirn, wir müssen den Schädel öffnen.»
Was da mein Vater so einfach dahinsagte, ist eine Kunst, die nur wenige zivile Ärzte ausüben, die aber jedem Truppenarzt vertraut sein sollte. Dabei wird die Haut über der Verletzung eingeschnitten, zurückgeklappt und der zerstörte Schädelknochen sorgfältig mit Meißel und Pinzette entfernt. Wichtig sind dabei die kleinsten Teile, die in der Gehirnhaut stecken – sie müssen heraus, und der Arzt braucht eine sehr ruhige Hand, um dabei das Gehirn nicht zu verletzen. Bei Marinos hatten wir es insofern leicht, als der Knochen nur eingedrückt war, aber nicht zersplittert. Mein Vater meißelte die Delle sorgsam heraus, dann klappte er die Haut zurück, und ich vernähte sie mit einigen Stichen.
Dann kam jener unselige Tag, da mein und meines Vaters Leben sich auf gewaltsame Weise änderte. Aus Alexandria war eben der langersehnte Befehl gekommen, die Grenztruppen zu verstärken. Der von seiner Kopfwunde genesene Marinos ging nach Syene, um Söldner anzuwerben, auch um etwaige wichtige Neuigkeiten zu erfahren. Seit zehn oder zwölf Tagen hatte es keine Überfälle mehr gegeben, auch unsere Spione meldeten wenig Bewegung im feindlichen Lager. Irgendwie müssen die Nubier aber bemerkt haben, daß unser Kommandant abwesend war und noch dazu zwei Dutzend Mann als Bedeckung mitgenommen hatte.
Der Überfall erfolgte am frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang, denn im Gegensatz zu vielen Stadtbewohnern empfinden die Wüstenvölker keine Angst vor der Dunkelheit und nutzen sie für ihre Zwecke. Wir wußten nicht, wie viele es waren, sie fielen über uns her wie die Heuschrecken, und die meisten unserer Männer wurder niedergemetzelt, ehe sie zu ihren Waffen greifen konnten. Der feindliche Truppenführer schien sehr gut zu wissen, daß es hier Ärzte gab, denn er ließ unser Zelt umstellen, während im benachbarten Krankenlager die Verwundeten in ihren Betten abgeschlachtet wurden. In gebrochenem Griechisch fragte er uns, ob wir die beiden Ärzte seien, und als mein Vater bejahte, ließ er uns fesseln und abtransportieren, noch ehe Gott Ra von seiner nächtlichen Fahrt durch die Unterwelt zurückkam.
Es wäre gelogen, wenn ich hier niederschriebe, man hätte uns schlecht behandelt. Die Krieger von Meroë pflegten in der Regel keine Gefangenen zu machen, doch wir waren die Ausnahme, und das hatte man offenbar schon lange vorher geplant.
So begann unsere endlos erscheinende Reise nilaufwärts. Am Zweiten und Dritten Katarakt mußten die Boote über Land getragen werden, was aber schnell und reibungslos vonstatten ging.
Schon König Teritekas’ Vater hatte die Residenz wieder nach dem weiter nördlich liegenden Napata verlegt, einer Stadt nahe dem Vierten Katarakt – ein Gebiet, das übrigens unter dem kriegerischen Pharao Thutmosis III. schon ägyptisch gewesen war. Nun, diese Zeiten waren vorbei, die Grenze mußte mehrfach nach Norden verschoben werden, und König Teritekas’ Reich umfaßte ein weites, wenn auch dünn besiedeltes Gebiet.
Der gebrochen griechisch sprechende Nubier blieb unser Begleiter und Bewacher bis Napata, und von ihm erfuhren wir, daß der König einen dringenden Bedarf an guten, griechisch ausgebildeten Ärzten habe.
Mein Vater fuhr auf.
«Und euer König glaubt, dieses Problem durch Gewalt lösen zu können? Man überfällt ein Lager, schlachtet Dutzende von Männern ab und entführt zwei Ärzte als Kriegsbeute. Es könnte sein, daß wir für deinen König gar nicht arbeiten wollen. Wir sind freie Griechen und haben unserem» – er betonte das «unserem» – «König einen Eid geschworen.»
Der andere lachte nur unbekümmert.
«Welchem König, Herakles? Dem Auletes? Seinem Sohn Ptolemaios? Seinen Töchtern Berenike und Arsinoë oder vielleicht Kleopatra, der siebten ihres Namens? Sie alle sind als Könige aufgetreten, sehr kurz zwar, doch immerhin. Wer aber seit den Tagen des Auletes in Wahrheit Ägypten beherrscht, ist der römische Senat. Ihm hast du doch keinen Eid geschworen?»