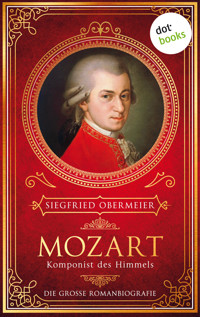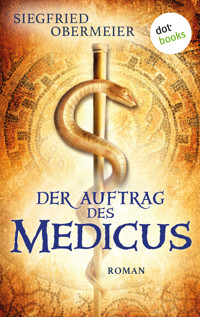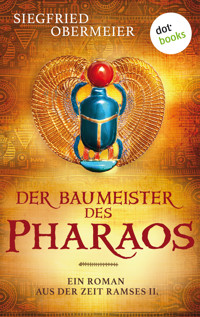5,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ihr bleibt nur die Flucht nach vorn: Der fesselnde historische Roman »Die Hexenwaage« von Siegfried Obermeier jetzt als eBook bei dotbooks. München im 17. Jahrhundert: Der Hexenwahn grassiert in der Stadt. Als die fromme Bürgerstochter Anna ablehnt, einen reichen Kaufmann zu heiraten, wird sie plötzlich beschuldigt, eine Hexe zu sein. Verzweifelt versucht sie, ihre Unschuld zu beweisen – doch das von Missgunst und Mordlust angestachelte Gericht will keine Gnade für sie zeigen. In ihrer Not wendet sich Anna an den einzigen Vertrauten, der sie jetzt noch retten kann: den rechtschaffenen Offizianten Jan Vandorff. An seine Seite wagt sie die lebensgefährliche Flucht in die fernen Niederlande, nach Oudewater, wo die berühmte Hexenwaage Annas letzte Rettung sein könnte. Doch ihre Häscher haben bereits die Verfolgung aufgenommen … und sie haben nicht vor, Anna entkommen zu lassen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der aufwühlende Historienroman »Die Hexenwaage« von Siegfried Obermeier – spannende historische Unterhaltung für alle Fans der Bestseller von Oliver Pötzsch und Sabine Ebert. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Ähnliche
Über dieses Buch:
München im 17. Jahrhundert: Der Hexenwahn grassiert in der Stadt. Als die fromme Bürgerstochter Anna ablehnt, einen reichen Kaufmann zu heiraten, wird sie plötzlich beschuldigt, eine Hexe zu sein. Verzweifelt versucht sie, ihre Unschuld zu beweisen – doch das von Missgunst und Mordlust angestachelte Gericht will keine Gnade für sie zeigen. In ihrer Not wendet sich Anna an den einzigen Vertrauten, der sie jetzt noch retten kann: den rechtschaffenen Offizianten Jan Vandorff. An seine Seite wagt sie die lebensgefährliche Flucht in die fernen Niederlande, nach Oudewater, wo die berühmte Hexenwaage Annas letzte Rettung sein könnte. Doch ihre Häscher haben bereits die Verfolgung aufgenommen … und sie haben nicht vor, Anna entkommen zu lassen!
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba«, »Das Spiel der Kurtisanen«, »Der Auftrag des Medicus« und »Sizilien« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit«, »Mozart, Komponist des Himmels« und »Judas – Der letzte Apostel«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Econ Verlag GmbH, Düsseldorf und München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/faestock und eines Gemäldes von Willen Koekoek „A canal in Oudewater“
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-633-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Hexenwaage«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Die Hexenwaage
Historischer Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Es war nun schon zum fünften Mal, daß Anna am Allerseelentag zum St. Peter-Friedhof hinauf stieg, hinter ihr die Magd mit dem herbstlichen Blumengebinde für das Grab der Eltern und des Bruders. Es waren vom Getreidemarkt durch das Schleckergässl nur ein paar Schritte, aber jedesmal war es ein schwerer Weg für die junge Frau und noch immer haderte sie mit Gott, daß ER ihr in jenem Pestjahr alles genommen hatte. Doch als brave und fromme römisch-katholische Christin beichtete sie diesen unheiligen Zorn gegen den himmlischen Vater gleich bei nächster Gelegenheit.
Fünfzehn Jahre alt war sie damals gewesen, als man am Ende heftig darüber stritt, wer die Pest wieder einmal in die Stadt geschleppt hatte. Das konnte nur von draußen kommen, von den marodierenden Soldaten des Großen Krieges, der damals schon ins zweite Jahrzehnt ging, von dem fahrenden Volk, den Gauklern und Vaganten oder den durchs ausgeblutete Land strömenden Bettlerhorden. Auch Zauberei und Teufelswerk könnten dabei im Spiel sein, munkelte man da und dort. Seine Gnaden, der Kurfürst, verfuhr zwar recht rigoros mit dem lichtscheuen Gesindel, und die Galgen vor der Stadt wurden genausowenig leer wie die Kerker und Arbeitshäuser. Doch seine hochfürstliche Gnaden hielten recht wenig von der Gefängnisstrafe, weil man da die Leute nur durchfütterte und sie zuviel kosteten. So gab es im wesentlichen vier Möglichkeiten, mit dem Gesindel aufzuräumen: Galgen, Galeere, Verbannung oder Arbeitshaus. Den Zauberern, Hexen, Nekromanten und Teufelsbeschwörern drohte freilich der Scheiterhaufen, aber die waren meist zu klug, um sich erwischen zu lassen. Eine weitere Möglichkeit war früher genützt, dann aber aufgegeben worden, nämlich die männlichen Vaganten in den Soldatendienst zu pressen. Die hauten jedoch entweder bei nächster Gelegenheit ab oder stellten sich so ungeschickt an, daß man sie davonjagen mußte.
Woher Anna Kistler, ein ehrbares Bürgermädchen, um diese Dinge wußte? Nun, sie hielt Augen und Ohren offen, außerdem wohnte in ihrem Haus, ganz oben in der Dachstube, der kurfürstliche Feldwaibel Vandorff, ein Militär zwar, aber ein gescheiter umgänglicher junger Mann, der aus den Niederlanden kam und früher Jan van Dorp geheißen hatte. Er war ihr stets ehrbar und achtbar begegnet und erzählte oft in seinem höchst kuriosen Deutsch von seiner Heimat, die er wegen der Freiheitskriege hatte verlassen müssen.
Anna seufzte und schob ihre dunkle Haube zurecht, die immer gerne verrutschte, wenn sie schnell ging.
»Jetzt regnet’s auch noch!« quengelte Liesl, die alte Magd. »Das merk’ ich selber!« gab Anna patzig zurück, auch wenn sie es nicht gemerkt hatte, weil sie so tief in Gedanken gewesen war.
Liesl streckte das Blumengebinde von sich. »Denen tut der Regen nur gut«, sagte sie einlenkend und grinste.
Anna nickte. »Und uns bringt er auch nicht um, wir sind ja nicht aus Zucker!«
»Hab’ nie im Leben welchen gekostet!«
»Ich schon – einmal. Das war, als der Franz mir zur Verlobung ein Zuckerhütl aus dem Laden schenkte. Aber am Ende ist der Honig doch besser, wenn man was Süßes naschen möchte.«
»Der arme Franzi«, sagte Liesl weinerlich, und da von ihm jetzt schon die Rede war, traten sie gleich an sein Grab, das am Ostrand des Friedhofs lag. Hier konnte man vom Petersbergl weit über die Stadt schauen, wenn auch heute das Isartor wegen des diesigen Wetters nicht zu sehen war.
Freilich hätte es sich gehört, zuerst die Gräber der Familie zu besuchen, aber jetzt stand sie schon beim Franzi und sprach das Gebet für verstorbene Verwandte, auch wenn er eigentlich keiner war, aber doch ihr Eheherr hätte werden sollen.
Sie schaute hinauf, wo der Franz gewiß im Himmel die Herrlichkeit Gottes genoß, denn er hatte gebeichtet und kommuniziert, und alles, was ihm hätte zustoßen können, war ein bisserl Fegefeuer.
Anna faltete die Hände und flüsterte:
»Gott, du schenkst Verzeihung und wünschest das Heil der Menschen, darum flehe ich zu Deiner Milde, laß den Franzi, der aus dem zeitlichen Leben hinüber gegangen ist, auf die Fürbitte der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria und aller Deiner Heiligen zur Teilnahme an der ewigen Seligkeit gelangen. Amen.«
Dem fügte sie noch fünf Ave Maria und fünf Paternoster an, die auch Liesl laut mitbetete. Dann gingen sie hinüber zum Familiengrab, das nahe der Kirchennordwand lag.
Johannes Kistler † im 43ten Jahr seines Lebens
Katharina Kistler † im 39ten Jahr ihres Lebens
Matthes Kistler † im 18ten Jahr seines Lebens
REQUIESCAT IN PACE
Die Tränen liefen Anna übers Gesicht. Zuerst hatte es die Mutter getroffen, die sowieso immer anfällig war für alle Gebresten und keinen Wehdam ausließ, ob das nun Husten, Schnupfen oder ein Dreitagesfieber war. Es war auch ganz schnell mit ihr gegangen, weil sie nichts zuzusetzen hatte. Die Ärzte – ja, die Arzte Hefen geschäftig mit ihren essiggetränkten Schnabelmasken herum, aber gegen die Pestilenz konnte keiner etwas ausrichten. Der Vater hatte um sein Eheweib nicht lange trauern müssen, elf Tage später folgte er ihr ins Grab. Die Kinder hatten sie zuvor auf das Landgut hinausgeschickt, das bei Wessling in der Ammerseegegend lag und der Familie fast alles lieferte, was man für die Küche brauchte.
Bei Matthes hatte es leider nichts genutzt, weil er den Keim der Pestilenz schon in sich trug, aber die braven Gütlersleut hatten streng darauf geachtet, daß Anna mit ihrem Bruder nicht in Berührung kam.
Im Spätherbst erlosch die Seuche, und noch vor Weihnachten ging Anna nach München zurück, damit sie das Christfest wenigstens mit der Familie ihres Künftigen feiern konnte. Sie kam in ein Trauerhaus. Franz, ihr Verlobter, war gestorben und das zu einer Zeit, da sich die Seuche schon aus der Stadt fortgeschlichen hatte, um anderswo ihr Unwesen zu treiben. Er war ihr letztes Opfer gewesen und die in allen Kirchen gefeierten Dankmessen waren für ihn zum Requiem geworden.
Der Friedhof belebte sich, denn zum Zwölfuhrleuten sollte der Stadtpfarrer erscheinen und die Gräber, wie auch die trauernden Hinterbliebenen segnen.
Wer hier als Opfer der Pest seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, gehörte zu den Leuten, die in München das Sagen hatten. Das waren jedoch nur wenige. Die meisten aber, die Taglöhner, Kuchelmenschen, Dienstmägde, Gehilfen, Hausknechte und was sonst an kleinen Leuten in der Stadt lebte, waren als namenlose Pestopfer hinausgekarrt worden vor die Stadt, wo ein angsterfüllter Priester hastig ein paar saure Wiesen segnete und sie so in einen christkatholischen Friedhof verwandelte. Da wurden diese Menschen dann verscharrt, und das für sie alle aufgestellte Holzkreuz hatte schon drei Wochen später ein Landfahrer gestohlen, der es klein schlug und ein Feuer damit machte, auf dem er ein gewildertes Kaninchen briet.
Davon wußte natürlich die Tochter eines angesehenen Handelsmannes nichts, der jetzt auf dem Petersfriedhof mit Frau und Sohn unter der Erde lag und einstmals das schöne Kornmesserhaus am Getreidemarkt besessen hatte – ein Haus, das nun diesem einzig verbliebenen Kind gehörte, der Anna Kistler.
Sie nahm der Liesl das Blumengebinde ab und legte es behutsam auf das Grab. Die Leute vor den Nachbarsgräbern schauten zu, und es war so mancher scheele Blick dabei, der sagte:
Ja, die junge Kistlerin kann es sich leisten, ein Gesteck für zwei oder drei Gulden aufs Grab zu legen! Da sitzt sie als Erbin im Kornmesserhaus und hat nichts zu tun, als den fetten Mietzins einzusackeln. Der kommt’s auf ein paar Silberstücke mehr oder weniger wahrlich nicht an. Wer die einmal kriegt, der darf zehn Dankmessen lesen lassen und dazu eine Armenspeisung stiften.
Anna schaute nicht links und nicht rechts, sondern senkte den Kopf, faltete die Hände und betete für ihre tote Familie. Doch heute fiel es ihr schwer, den Sinn ganz auf die Zwiesprache mit Gott zu richten, weil sich immer wieder andere Gedanken dazwischenstahlen und sich nicht verscheuchen ließen, wie lästige Fliegen an einem gewittrigen Tag. Die konnte man noch so oft verjagen, sie kamen immer wieder – immer wieder. Was Anna bewegte, war vor allem der Gedanke an ihre Zukunft. Soviel sie wußte, gab es in München keine näheren Verwandten mehr, aber die Alten hatten manchmal von irgendwelchen auswärtigen Vettern und Basen gesprochen. Die schielten vielleicht auf den schönen Besitz und manch einer mochte den heimlichen Wunsch hegen, der im Dienste der Pest stehende Sensenmann hätte auch diesen letzten Halm der Familie Kistler noch abschneiden können, damit das fette Erbe in andere, in die richtigen Hände kam. Warum heiratete das Mädchen nicht? Dann bräuchte man sich keine Gedanken mehr zu machen, dann war das Sach’ weg für immer, aber alles hätte seine Ordnung.
Nein, an Bewerbern um ihre Hand hatte es der Anna wahrhaftig nicht gefehlt. Es war ja nicht so, daß die Pest eine Stadt wie München hätte entvölkern können. Auch wenn manchmal ganze Häuser ausstarben. Aber dann kam irgendwer vom Land, kleine Adelsfamilien, die sich in diesen kriegerischen Zeiten in München ankauften, weil sie sich hinter Stadtmauern sicherer fühlten. Da mußten sie nicht fürchten, beim nächsten Überfall marodierender Landsknechte um Haus, Hof und vielleicht noch ums Leben gebracht zu werden.
Aus diesen Kreisen hatte es auch schon Anfragen gegeben, weil sich diese zugezogenen kleinen Adelsleute gerne mit angesehenen städtischen Familien verschwägert hätten. Da wäre Anna dann zu einem »von« vor dem Namen gekommen, aber darum ging es ihr nicht, weil sie einfach keine Lust aufs Heiraten hatte. Ganz im Inneren beunruhigte sie der Gedanke an eine Familie, die bei der nächsten Pestilenz in die Grube fahren mußte. Diese Vorstellung ließ sich nur schwer verdrängen, es war wie eine entzündete Wunde, die sich nicht schließen will und die man immer und immer wieder berührt, auch wenn es wehtut. Anna hatte die Sache zu Ende gedacht, um sie los zu sein, aber sie hatte sich eingebrannt ins Hirn, wie das Zeichen, mit dem der Henker die Diebe brandmarkte. Wenn ich jetzt heirate, so dachte sie, dann kommen die Künder, eins – zwei, drei oder fünf in den nächsten zehn Jahren. Und dann kommt die Pest, wie sie immer gekommen ist, auch wenn sie der Stadt schon Ruhepausen von zwanzig oder dreißig Jahren gegönnt hatte. Und wieder erscheint der düstere Sensenmann und ihrer Familie würde es wie den Eltern und dem Bruder ergehen. Das muß nicht sein, aber es kann sein und sie weiß von Familien in der Stadt, die vordem vielköpfig blühten und von denen nach Zeiten der Pest nicht einer, nicht ein einziger übrig blieb. Das war Gottes Wille – gewiß, aber warum sollte man seinen Zorn auf sich lenken?
Endlich kam der Pfarrer mit den weihrauchschwenkenden Ministranten und hastete von Grab zu Grab. Voriges Jahr hatte Anna einmal bei ihm gebeichtet, aber dieser hagere geistliche Herr gefiel ihr gar nicht. Nach der Lossprechung hatte er seinen Mund ihrem Ohr genähert und sie war langsam zurückgewichen vor dem faulig-säuerlichen Atem, der nach Wein und toten Zähnen stank. Er hatte zischend und speichelsprühend und gar nicht leise geflüstert, so daß es schon kein Flüstern mehr war: »Hüte dich vor der Verlockung des Satans, meine Tochter. Damit meine ich nicht nur die jungen Mannsbilder und die Sünde der Unzucht – nein, ich denke eher an den Teufelspakt und seine Folgen. Da wird dir von den Dämonen so manches versprochen: Macht über die Menschen, die Fähigkeit zu höllischem Zauberwerk, auch Reichtum und langes glückliches Leben. Aber was ist der Preis?«
Der Pfarrer schrie es fast heraus und Anna lupfte schnell den Vorhang, ob draußen keiner zuhörte. Aber es war niemand da an diesem sonnigen Vormittag als ein paar alte Weiber, die in den Bänken saßen und ihre Rosenkränze durch die gichtigen Finger gleiten ließen. Schnell kam die Antwort auf die rhetorische Frage.
»Der Preis, meine Tochter, ist deine unsterbliche Seele! Ein hoher Preis fürwahr! Satan tut nichts umsonst, das merke dir! Er macht dich zu seiner Buhle und läßt dich plötzlich sterben, ohne Beichte, ohne Reue, damit er deiner Seele habhaftig wird!«
»Aber Hochwürden, nur Gott kann doch die letzte Stunde eines Menschen bestimmen …«
»Grundsätzlich schon, aber Satan hat große Macht, ist verlogen, tückisch, kennt allerlei Finten …«
Und so war es noch eine Weile fortgegangen, aber Anna hatte nur immer »ja, Hochwürden« oder »gewiß, Hochwürden« gesagt, um seinen heiligen Zorn nicht weiter herauszufordern.
Sie schlug ein Kreuz und kniete nieder, während der dürre Stadtpfarrer sie und das Grab mit finsterem Gesicht segnete und dann schnell weiterging.
Danach zerstreuten sich die Besucher, gingen heim oder in einen Bräu, um die lieben Toten mit einem Gedächtnismahl zu ehren.
Plötzlich spürte Anna, daß jemand hinter ihr stand. Sie hatte keine Schritte gehört, aber sie spürte es.
Natürlich platzte die vorlaute Liesl gleich heraus: »Jungfer Anna, Euer Oheim ist gekommen …«
Anna zwang sich zu einem freundlichen Gesicht und wandte sich langsam um.
Da stand er, wie immer dunkel gekleidet, den Bart – genauso wie der Kurfürst ihn trug – sorgsam gestutzt, den weiten, dunklen Mantel hochgeknöpft, ohne den üblichen Spitzenkragen – und fast so lang wie eine Soutane. Ja, Annas Oheim und Vormund Pankraz Hueber gab sich gerne priesterlich und galt weithin als frommer und wohltätiger Mann. In seinem bleichen, etwas dicklichen Gesicht stand wie aufgeprägt ein mildes süßliches Lächeln, als wollte er jedermann kundgeben, daß er Verständnis und Mitleid für die sündige Menschheit hege. Sein Aussehen und Auftreten war gewiß auch berufsbedingt und kam den Geschäften zugute.
Pankraz Hueber nämlich handelte mit Devotionalien und besaß einen Laden in der Sporergasse, nur wenige Schritte vom Dom entfernt. Er war Mitglied zahlreicher frommer Bruderschaften, von denen nur die Rosenkranzbruderschaft, die Bennobruderschaft und die Erzbruderschaft aller christgläubigen Seelen zu nennen wären – nicht zu vergessen, die marianische Kongregation, denn Kurfürst Maximilian hatte geruht, beim Beginn seiner Herrschaft die Gottesmutter Maria zur Königin von Bayern als Patrona Bavariae zu propagieren. Die von ihm errichtete Mariensäule auf dem Platz war sichtbarer Ausdruck davon.
Pankraz Huebers Lächeln verstärkte sich, als er auf sein Mündel zutrat und es väterlich auf beide Wangen küßte. Sie waren nicht blutsverwandt, denn Hueber hatte die jüngste Schwester des Vaters geheiratet, die dann im ersten Kindbett gestorben war. Seither war er ledig geblieben und ließ gerne durchblicken, daß er seine Keuschheit der aller seligsten Jungfrau weihe und darbringe.
»Hätt’ was mit dir zu bereden, Anna. Kommst halt morgen oder übermorgen zu mir in den Laden – grad wie’s dir paßt.«
Anna zeigte keine Neugierde, denn der Oheim machte sich gerne über die Schwächen der Frauen lustig, und diese Freude wollte sie ihm nicht gönnen.
Kapitel 2
Grad wie’s dir paßt, hatte der Oheim gesagt und das klang recht umgänglich, so als nähme er es nicht genau mit solchen Vereinbarungen. Anna aber kannte ihn – sie kannte ihn seit fünf Jahren und wußte, daß er damit den nächsten Tag meinte, und zwar so früh wie möglich, auch wenn er »oder übermorgen« hinzugefügt hatte.
Aber sie regte sich nicht besonders darüber auf, der Oheim war ein Wichtigtuer und ein Pedant dazu, auch rechthaberisch, störrisch, aber das verdeckte er mit seiner falschen Milde, und nicht wenige gingen ihm dabei auf den Leim.
Doch sie dachte nicht daran, sich von ihm schurigeln zu lassen – jetzt nicht mehr, da sie fast zwanzig war. Früher hatte er es oft genug versucht, manchmal so, daß sie heulen mußte vor Zorn und Hilflosigkeit. Etwa, wenn er darauf bestand, daß sie einmal wöchentlich beichten und kommunizieren und wenigstens jeden zweiten Tag das Engelamt besuchen sollte. Das Engelamt wurde bei Sonnenaufgang gelesen und diente alten Weibern, die nicht mehr schlafen konnten, zum Zeitvertreib – so hatte es Jan – also der Feldwaibel Vandorff einmal recht spöttisch ausgedrückt. Schließlich war sie keine Nonne, sondern ein gesundes, junges Mädchen, das seinen Schlaf brauchte. Eine Zeitlang hatte sie es hingenommen, dann aber hatte sie eine Bestätigung ihres alten, milden Beichtvaters aus der Heiliggeistkirche im Tal gebracht, daß solche Frühmessen für ihr Seelenheil nicht unbedingt nötig seien. Anna blickte durch das Stubenfenster hinaus auf den Platz und sah drüben beim Rathaus die Besenweiber an der großen Stiege ihre Tische aufbauen. Es hatte leicht zu schneien begonnen und das war für Anfang November recht früh im Jahr. Das Fenster beschlug sich mit ihrem Atem und sie zog fröstelnd das Fürtuch um ihre Schultern. Da mußte sie heute ihre Lodenkotzen umtun, wenn sie hinüber in die Sporergasse ging.
Sie seufzte und blickte auf die leise tickende Stutzuhr, die dem Fenster gegenüber neben der hohen eichenen Truhe stand. Da polterte die Liesl herein, den Arm voll Feuerholz, halblaut vor sich hinschimpfend, daß man um diese Jahreszeit schon heizen müsse, und wie teuer das alles sei. Anna lächelte.
»Brauchst es ja nicht selber zahlen, Liesl. Gibt also keinen Grund, in aller Herrgottsfrühe herumzuschimpfen. Außerdem gehe ich jetzt weg, hättest also mit dem Feuermachen noch warten können.«
»Weg …?«
Die Liesl blickte sie so blöde an, wie nur sie es konnte. »Hast es wohl vergessen? Ich muß zum Oheim hinüber, weil er mit mir was zu bereden hat.«
Die Magd verzog ihr faltiges Gesicht und es sah nicht danach aus, als hege sie für Pankraz Hueber großen Respekt.
»Was kann der mit dir schon zu bereden haben? Da kommt eh nichts Gescheites heraus. Soll ich dich begleiten?« Anna schüttelte den Kopf, daß ihre beiden Zöpfe flogen. »Nein, die paar Schritte kann ich auch alleine tun.«
»Aber der Herr Oheim sieht’s gar nicht gern, wenn du …«
»Dann sieht er es halt nicht gern!« sagte Anna kratzbürstig. »Steck’ mir Heber die Zöpfe auf!«
Da wußte die Liesl nichts mehr zu sagen und machte sich brummelnd an die Arbeit.
In ihren Lodenmantel gewickelt, öffnete Anna gerade die Haustür, als sie hinter sich feste, polternde Schritte vernahm. Das konnte nur einer sein und sie fühlte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie wartete und hielt die Tür offen. »Ah – guten Morgen, Jungfer Anna! So früh schon aus dem Haus? So soldatisch früh?«
Er lachte übers ganze Gesicht und bückte sie mit seinen lichtblauen Augen freundlich an. Anna fühlte, wie sie rot wurde, was sie nicht wollte und, weil sie es nicht wollte, schoß ihr noch mehr Blut ins Gesicht. Sie duckte sich in den Mantelkragen und sagte mit gespielter Munterkeit: »So früh ist es ja auch wieder nicht … Für einen Offizier eher ein bisserl spät – oder?«
»Leider immer noch Feldwaibel! Mit den Beförderungen läßt man sich Zeit, dafür habe ich schon einen Sack voll Versprechungen, die immer gleich lauten: Beim nächsten Mal, Herr Feldwaibel, seid Ihr dran! Hoffentlich erlebe ich es noch, dieses nächste Mal. Wo darf ich Euch hinbegleiten, Jungfer Anna?«
»Ihr müßt doch zur Neuen Residenz und ich will hinüber ins Sporergäßl, das sind ja nur ein paar Schritte …«
Jan Vandorff lachte fröhlich.
»Wohl zum Herrn Oheim? Da haben wir ja den gleichen Weg.«
Sie traten hinaus und er bot ihr seinen Arm. Vor der Tür wartete schon frierend sein Bursche und feixte übers ganze Gesicht.
»Brauchst nicht zu grinsen, alter Falott! Lauf zur Residenz und melde dort, ich käme ein paar Minuten später. Ab mit dir!«
»Ich glaube, der Herr Oheim siehts nicht gern, wenn ein junger Mann – ich meine …«
Vandorff winkte ab.
»Ich setz’ Euch an der Ecke ab, und Ihr geht allein ins Sporergäßl.«
Arm in Arm gingen sie über den Eiermarkt und bogen rechts in die Weinstraße ab. Anna löste sich sacht aus Vandorffs Arm.
»Ist besser so, ich will den Herrn Oheim nicht unnötig erzürnen.«
Vandorff blickte überrascht.
»Ihr werdet den alten Bigotter doch nicht fürchten?« Anna blickte sich um.
»Nicht so laut! Hier kennt mich doch jeder, und ich möchte nicht ins Gerede kommen.«
»Zu Befehl, Jungfer Anna!«
Lachend trat Vandorff einige Schritte zur Seite. Anna lächelte zurück und verschwand schnell im Laubengang, der nach wenigen Schritten an der Sporergasse endete. Bog man dort ein, war der Dom Unserer Lieben Frau zu sehen, der wie eine Riesenglucke inmitten der noblen Bürgerhäuser hockte. Die Gegend um den Dom galt als ein vornehmes Viertel, wo hauptsächlich Prälaten, Doktoren und reiche Handelsherren wohnten.
Der Devotionalienladen des Oheims war eng und finster, erstreckte sich aber weit nach hinten, wo sich die beiden Wohnräume und ein kleines Warenlager befanden. Hier gab es alles zu kaufen, wonach ein frommer Sinn stand: Gebetbücher, Heiligenlegenden, Rosenkränze, Skapuliere, Fatschenkinder, Ketten mit Kreuzen, Madonnen- und Heiligenbilder, Maria-Ecker-Pfennige, Schabemadonnen, kleine Hausaltäre, Weihwasserbecken, Jordanwasser in winzigen Flaschen, Kerzen, Wachsstücke – und Reliquien aller Art, aber nur für besondere Kunden, denn der Handel mit diesen hochheiligen Dingen war eine heikle Sache. Jede Reliquie mußte mit einer vom Bischof gesiegelten Urkunde approbiert sein, aber es gab eben auch solche, die nur ein kleiner Klosterprior bestätigt und gesiegelt hatte oder irgendein Prälat, der vielleicht schon verstorben war und nicht mehr befragt werden konnte. Das Wort Fälschung wurde dabei tunlichst vermieden, aber im Preis drückte sich aus, wie einwandfrei die Provenienz der entsprechenden Reliquie war.
»Da bist du ja«, begrüßte sie der Oheim und schaute durch die geöffnete Tür nach draußen. »Wenigstens schneit es nicht mehr, aber kalt ist es geworden.«
Anna nickte und schälte sich aus ihrem Mantel, den Hueber ihr gleich abnahm und neben den Ofen hängte. Anna hatte beschlossen, jede Neugier zu unterdrücken und einfach abzuwarten, bis der Oheim selber mit der Sache herausrückte. Daß es nichts Alltägliches, ja wahrscheinlich etwas Heikles war, erkannte sie daran, daß Hueber mit einem ganz anderen Thema anfing. Er tat geheimnisvoll, rieb sich die Hände und lächelte unentwegt auf seine falsche und scheinheilige Art – so jedenfalls empfand es Anna. Dann sagte er flüsternd, als verrate er ein Geheimnis:
»Recht besehen, müßten wir beide jetzt niederknieen und ein Dankgebet sprechen …«
»So – warum?«
Der Oheim wies mit einem vor Ehrfurcht leicht gekrümmten Zeigefinger auf die Tür zu seinen Wohnräumen.
»Ich hab’s in den Herrgottswinkel gelegt, weil es der einzig angemessene Ort ist für ein Heiligtum, ein so kostbares – ja, einmaliges!«
Die Begeisterung war echt, die kleinen dunklen Augen des Vormunds blitzten und er rang die Hände vor innerer Ergriffenheit.
»Deshalb habt Ihr mich herkommen lassen?«
Diese trockene, etwas spöttische Frage entfachte in Pankraz Hueber einen – so wenigstens empfand er es – heiligen Zorn.
»Deshalb nicht, Anna! Aber ich habe mir gedacht – ja, mich verpflichtet gefühlt, dich als mein Mündel, als Bruderskind meiner in Gott seligen Frau, an der Freude teilhaben zu lassen, die – die …«
Anna wollte ihn nicht weiter erzürnen und fragte in gespielter Neugier:
»Aber das freut mich doch, Herr Oheim! Jetzt spannt mich nicht weiter auf die Folter und sagt mir …«
Genau das hatte er hören wollen und nahm ihre Worte mit einer verzeihenden Geste hin. Dann ging er langsam und feierlich zur Tür, öffnete sie behutsam wie ein Kirchenportal und verschwand in seinen Wohnräumen. Anna hatte schon mehrmals ähnliche Szenen erlebt und war nur mäßig neugierig. Sie gähnte ausgiebig und klappte schnell den Mund wieder zu, als der Oheim mit einer kleinen Monstranz erschien, die er vor sich hertrug wie ein Bischof bei der Fronleichnamsprozession. Er stellte das Reliquiengefäß auf den Tisch und kniete davor nieder.
Anna wußte, daß er Gleiches von ihr erwartete und kniete sich neben ihn.
»Wir sprechen jetzt ein stilles Gebet.«
Anna sprach ein Ave Maria und wartete, bis der Oheim aufstand. Dann erhob sie sich und wartete auf seine Erklärung.
»Das da ist ein Fingernagel des heiligen Laurentius, Märtyrer und Glaubenszeuge.«
Da fiel Anna gleich ein, daß dieser Heilige ja den Feuertod gestorben war und sie wunderte sich, warum dann ein Fingernagel unversehrt blieb, aber sie unterdrückte eine voreilige Bemerkung. Jetzt wurde der Oheim eifrig. Er holte aus dem Schrank eine altertümliche, abgeschabte und fleckige Ledermappe, öffnete sie und zog mit spitzen Fingern Blatt um Blatt heraus.
»Da – schau her! Hier eine gesiegelte Bestätigung eines Notars Seiner Heiligkeit Papst Clemens VIII. und hier eine Approbation des Bischofs von Regensburg, hier noch –« Anna hörte nicht mehr hin, unterdrückte ein zweites Gähnen und wartete geduldig, bis der Oheim ans Ende seiner höchst beeindruckenden Liste gelangt war. Dann räumte Hueber seine Dokumente weg und trug die Monstranz wieder hinaus.
»Der Domprobst Ligsalz hat übrigens schon Interesse gezeigt. Er ist ja ein frommer Herr und ein großer Reliquiensammler. Unter anderem besitzt er einen Fingerknochen der heiligen Agnes, ein Stück vom Tischtuch des letzten Abendmahls, dann ein paar Fäden aus der Windel unseres Herrn Jesus Christus …«
Anna begann so laut zu seufzen, daß Hueber seine Suada unterbrach.
»Was hast du – langweilst dich?«
»Nein, aber Ihr habt mich doch nicht herkommen lassen, um – um mir einen Vortrag über Reliquien zu halten. Oder doch?«
Sein Gesicht verzerrte sich für einen Augenblick zu einer wütenden Fratze.
»Sei nicht so frech, du vorlautes Ding!«
Doch gleich hatte er sich wieder in der Gewalt und setzte sein süßliches Lächeln auf.
»Ja, du hast schon recht, ich habe dich her gebeten, um dir etwas Wichtiges zu sagen. Komm, setz dich wieder. Willst etwas trinken? Der Ziegenhirt hat vorhin eine frische Milch vorbeigebracht – magst du einen Becher?« Anna nickte, und der Oheim holte den Krug. Während er einschenkte, begann er stockend zu sprechen.
»Weißt, ich hab’ mir gedacht, jetzt wird das Madl nächsthin einundzwanzig, steht dann ganz allein auf der Welt – ja, ganz allein, und ich mein’ halt –«
Er verlor den Faden und trank einen Schluck Milch. Dann blickte er sie verlegen an.
»Weißt, was ich mein’?«
»Nein, Herr Oheim.«
»Daß du heiraten solltest, mein’ ich, und hab’ mir überlegt, damit das ganze schöne Sach’ nicht in fremde Hände kommt … Also, es gäb’ schon einen Weg, es in der Familie zu lassen – wir könnten quasi zwei Vermögen Zusammenlegen, deins und meins …«
Anna erschrak. Was redete der Oheim da? Sie schüttelte verwirrt den Kopf.
»Heißt das, Ihr wollt mich als Erbe einsetzen, wenn ich nicht heirate oder heißt das, Ihr wollt – Ihr wollt …«
»Ja, Anna, ich tät’ dich dann heiraten, wenn du willst. Ich bin Witwer, wir sind nicht blutsverwandt und wenn wir einen Dispens vom Bischof benötigen, dann habe ich da so gute Verbindungen …«
»Aber Herr Oheim, was redet Ihr da? Ich kann Euch doch nicht heiraten! Über all die Jahre seid Ihr für mich wie ein Vater gewesen – ja, es ist, als müßte ich meinen eigenen Vater heiraten!«
»Du mußt gar nichts! Aber laß dir meinen Vorschlag durch den Kopf gehen, so schlecht ist er nicht. Schließlich bist du fast zwanzig Jahre jünger als ich, kannst also damit rechnen, daß ich dir und den Kindern ein schönes Erbe hinterlasse.«
»Kindern? Welchen Kindern?«
Hueber schnaufte ungeduldig.
»Natürlich denen, die wir mit Gottes Hilfe gemeinsam zeugen werden.«
Anna stand auf.
»Nein, Herr Oheim, daraus wird nichts – nie und nimmer!«
Als sie das sagte, fiel ihr der Feldwaibel Vandorff ein und sie verglich ihn mit dem Oheim. Wieder sah sie, daß sein Gesicht einen gemeinen, bösartigen Zug bekam, und sie versuchte ihn zu beschwichtigen.
»So ist’s nicht gemeint, Herr Oheim, aber Ihr müßt auch mich verstehen. Ich bin noch jung und wenn ich ans Heiraten denk’, dann an einen Burschen meines Alters oder ein paar Jahre älter. Ich versprech’ Euch in die Hand, daß ich zuvor Euren Rat einhole, auch wenn ich dann volljährig bin.«
»So, meinen Rat, da muß ich mich noch schön bedanken, oder? Nein, nein, ich steh’ zu meinem Vorschlag und wenn du ihn in aller Ruhe durchdenkst, dann wird er dir recht vernünftig erscheinen. Sag’ jetzt nichts, laß es dir durch den Kopf gehen, die Sache hat noch viel Zeit.« Anna spürte, daß es nichts mehr zu bereden gab und reichte dem Oheim die Hand.
»Dann sag’ ich vergelt’s Gott für die Milch, und – und ich werde mir Euren Vorschlag überlegen.«
Seine fette, weiche Hand lag schlaff in der ihren, sie fühlte kaum einen Druck.
»Gott segne dich, mein Kind.«
Dann stand sie draußen auf der Straße und atmete tief die kühle, frühwinterliche Luft. Die dünne Schneeschicht hatte sich in einen sulzigen Matsch verwandelt und eine fahle, kraftlose Sonne brach durch die jagenden Wolken, um gleich darauf wieder zu verschwinden.
Tief in Gedanken ging Anna am Eiermarkt vorbei und konnte nur den Kopf schütteln über das seltsame Ansinnen des Oheims. Freilich hatte sie ein wenig geschwindelt, als sie sagte, sie sehe ihn wie einen Vater, aber als Vormund und Oheim hatte er diese Rolle übernommen, und wie sehr sich Anna auch bemühte, es wollte ihr nicht gelingen, sich Pankraz Hueber als ihren Bräutigam vorzustellen.
Kapitel 3
Seine hochfürstliche Gnaden, Kurfürst Maximilian I. von Bayern regierte sein Land wie ein gestrenger Hausvater. Seit er als Vierundzwanzigjähriger die hochverschuldete Mißwirtschaft seines Vaters Wilhelm übernommen und mühsam saniert hatte, hagelte es aus seiner Kanzlei in ununterbrochener Reihenfolge Mandate, Befehle, Verfügungen, Anordnungen und vor allem Verbote, Verbote, Verbote. Alles war bis ins Kleinste geregelt und hochgelehrte Juristen sorgten in drei landesherrlichen Kanzleien für einen reibungslosen Ablauf. Da gab es die Geheime Kanzlei in der Neuen Veste, dazu eine Hofkammerkanzlei und eine Hofratskanzlei im Alten Hof, wo vordem die bayerischen Monarchen residiert hatten.
Das soll aber nicht heißen, daß der Kurfürst das Rechtswesen und seine Ausübung den Beamten überließ – nein, er selber überprüfte jeden Schriftsatz, jede Verfügung und wehe, sie gab nicht haargenau seinen Willen und seine Absichten wieder! Da flog so mancher Jurist, der sich in Amt und Würden sicher wähnte, auf die Straße oder mußte – und da durfte er noch dankbar sein – Strafgelder und Lohnabzüge hinnehmen. Damit nun keiner dieser Herren schludern, faulenzen oder sonst eine Mißwirtschaft treiben konnte, gab es ein dichtes Netz von Überwachungen mit einem Heer von Spitzeln und Aufpassern, die nach einem kaum durchschaubaren System sich gegenseitig kontrollierten. Ein Geheimer Rat hatte die Aufsicht über die Zentralbehörden, während diese den unteren Beamten auf die Finger sahen.
Der Kurfürst war sehr stolz auf dieses von ihm geschaffene Werk und nicht weniger stolz durfte er auf die Staatskasse sein, in der nicht nur die vom Vater hinterlassenen Schulden getilgt waren, sondern in der sich – trotz des geld- und kräftezehrenden Großen Krieges – beachtliche Reserven angesammelt hatten. Diese stammten zu einem nicht geringen Teil aus den erhobenen Strafgeldern für Verstöße gegen die Kleiderordnung, aus Bußgeldern wegen Unsittlichkeit, Trunkenheit, Nichteinhalten von Fasten- und Feiertags geboten und was es da sonst noch an großen und kleinen Vergehen gab. Schon wenn ein Bursche beim Tanz ein Mädchen zu fest an sich drückte und dabei beobachtet wurde, mußte er zahlen. Ebenso gab es Bußgelder für das in Bayern landesübliche Fensterln, für unangemessene Kleidung, Verstöße gegen die Beichtordnung oder den versäumten Kirchenbesuch an Sonn- und Feiertagen. Jeder im Dienst des Kurfürsten stehende Beamte, vom Tür Steher bis hinauf zum Hofkammerpräsidenten mußte einmal pro Woche zur Beichte gehen und dies anhand eines vom Pfarrer unterschriebenen Zettels belegen.
Da das Fleisch allzeit schwach und der Mensch fehlbar ist, summierten sich diese Buß- und Strafgelder alljährlich zu einer Höhe, welche etwa die Einkünfte der staatlichen Land- und Forstwirtschaft beträchtlich überstiegen. Eines aber lag dem Kurfürsten schwer auf dem Herzen und er ruhte nicht, seine Beamten ständig daran zu erinnern: die Verfolgung und Bestrafung von Aberglauben, Gotteslästerung, Zauberei, Hexerei und anderen Teufelskünsten. Sein gegen all dies erlassene »Landgebot« mußte zweimal jährlich – an Weihnachten und an Pfingsten – von den Kirchenkanzeln verlesen werden.
Obwohl dies geschah, war der Kurfürst nicht zufrieden und als er am zweiten Sonntag im Advent aus der Hofkapelle kam, gingen ihm die Probleme unentwegt im Kopf herum. Gerade in den letzten Monaten hatten ihn Klagen erreicht über Kornfäule, Mäuse- und Rattenplage sowie eine Anhäufung von Totgeburten. Auch der Hagelschlag hatte in den heurigen Erntemonaten auf ungewöhnliche Weise im Land gewütet. Hätte es sich nur um eines oder zwei dieser Übel gehandelt, so war dies vielleicht ein Zeichen von Gottes Zorn gewesen, doch diese seltsame Anhäufung ließ auf Hexerei und Teufelswerk schließen. So bestellte der Kurfürst auf Montagmorgen eine Ratsversammlung ein, zu der auch zwei geistliche Berater geladen waren – Dominikaner natürlich, deren Orden von der Kirche schon seit Jahrhunderten mit inquisitorischen Aufgaben betraut war, vor allem mit der Verfolgung von Zauberei und Hexerei.
Hätte Anna Kistler von dieser anberaumten Versammlung gewußt, so hätte sie gesagt: Was geht mich das an, das betrifft mich nicht. Und doch – obwohl ihr Name nicht fiel und keiner der Herren von ihrer Existenz wußte – entschied sich an diesem Montag nach dem zweiten Advent ihr weiteres Schicksal, und ihr Leben nahm fortan einen Verlauf, der ihr später wie ein langer, schrecklicher Alptraum erschien.
Der Kurfürst saß an der Stirnseite des langen Tisches und hörte, wie es seine Art war, den Räten, Beamten und geistlichen Herren erst einmal zu – schweigend, ohne ein Wort dazwischenzureden, ohne Zustimmung oder Ablehnung. Alles an seinem ernsten, etwas düsteren Gesicht schien in die Länge gezogen: der schmale Kopf mit der hohen, beinahe kahlen Stirn, die lange, leicht gekrümmte Nase, die schon fast den aufgezwirbelten Schnurrbart berührte. Der bis auf den Spitzenkragen reichende, zu einem länglichen Dreieck geformte Spitzbart zog dieses schmale Antlitz noch mehr auseinander. Die Augen spielten dabei keine große Rolle, waren meist halb geschlossen oder gesenkt und blickten bei einem Gespräch das Gegenüber nur kurz und prüfend an, um sich dann wieder zu senken oder halb zu schließen.
Thema und Fragestellung der heutigen Rats Versammlung waren gewesen, ob von seiten der Obrigkeit genügend getan werde, um Gotteslästerer, Hexen, Zauberer, Wahrsager, Handleser, Dämonen- und Teufelsbeschwörer aufzuspüren und ihnen mit den dafür vorgesehenen Strafen zu begegnen. Jeder hatte dazu einen längeren oder kürzeren Kommentar abgegeben, die meisten voll Eifer, manche beschwörend und gestenreich. Nur einer der beiden Inquisitoren, ein hagerer, alterslos wirkender Dominikaner, hatte kurz und trocken bemerkt:
»Euer Gnaden, es ist festzustellen, daß die Bestrafungen für die erwähnten Verbrechen in den letzten Jahren nachgelassen haben, was aber nicht heißen soll, daß solche Delikte weniger geworden sind. Ich sehe darin die Wirkung des 1631 erlassenen Hexenmandats, an dem der in Gott selige und hochwürdige Herr Adam Tanner gewiß seinen Anteil hatte.«
Der Kurfürst hatte diesen gelehrten Jesuiten sehr verehrt und zu einem engen, geistlichen Berater gemacht. Da nun dessen Name fiel, blickte Maximilian kurz auf.
»Wie soll ich das verstehen, Hochwürden?«
»Damit ist der Passus gemeint, daß der Hexerei und Zauberei Verdächtige, wenn sie sich reumütig selber anzeigen und zu ihrer Schuld bekennen, begnadigt werden sollen. Das kann aber auch bedeuten, daß eine Hexe jahrelang ihr schändliches Wesen treibt, Hagel sendet, das Korn faulen und das Vieh verenden läßt, und sobald sie sich ertappt und erkannt sieht, die Reumütige spielt und straflos davonkommt.«
Der Kurfürst senkte den Kopf und verfiel in Nachdenken. Dann sagte er: »Da scheint mir die Milde zu weit getrieben. Ich will diesen Passus nicht streichen, aber man soll künftig alles in allem härter verfahren, schon um dem Volk ein heilsames Exempel zu geben.«
Der Dominikaner nickte.
»Und man sollte auch den Blick auf jene richten, die durch teuflischen Pakt zwar ihre Seele verloren, sich aber irdischen Reichtum erschlichen haben. Ein Unrechtes Gut, das in die Obhut von Staat und Kirche zurückkehren muß.«
Der Kurfürst blickte in seine Ratsrunde.
»Ich nehme an, daß die Herren dem vorbehaltslos zustimmen.«
Das tat ein jeder und in den nächsten Tagen gingen die entsprechenden Direktiven an die Unterbeamten, die Spitzel, die Aufpasser, die bezahlten Denunzianten.
In diesen Kreisen war oft darüber diskutiert worden, wo die Grenze zu ziehen sei zwischen einem harmlosen Kräuterweib, das Mittel gegen allerlei Wehdam verkaufte und einer Hexe, die aus Krötenaugen, Schlangenköpfen und noch Schlimmerem schändliche Teufelsgifte zusammenbraute. War ein lustiger Wahrsager zu bestrafen, der auf Jahrmärkten ein paar dumme Bauern hinters Licht führte, oder sollte die Strenge des Gesetzes nur jene treffen, die nach Anrufung höllischer Dämonen düstere Prophezeiungen verkündeten oder Orte nannten, wo angeblich vergrabene Schätze ruhten? Das eine war strafbar, das andere nicht, aber wo endete der harmlose Unfug und wo begann das strafwürdige Verbrechen?
Die Witwe Therese Strobl aus der Fischergasse gleich hinter der Heiliggeistkirche war so ein Fall.
Jeder im Viertel kannte die alte Theres und jeder wußte, wozu sie gut war. Zu ihr ging man nicht geradewegs, sondern eher bei Nacht und Nebel oder wenn sich an kalten und regnerischen Tagen nur wenig Leute auf den Straßen aufhielten. Aber warum so heimlich, weshalb diese Vorsicht? Die Theres verhökerte doch nur Pulver, Essenzen und Tropfen gegen Husten, Fieber, Kopf- und Bauchweh, Gliederschmerzen, Gallenstau, Magendrücken und anderen Wehdam. Freilich, das auch, aber wer es drauf anlegte, dem half die Theres noch anderweitig. Da gab es Mittel gegen die Treulosigkeit des Mannsvolkes und auch solche gegen ungewollte Schwangerschaften. Die Theres war bei Gott keine Engelmacherin und schickte Weibsleute mit dicken Bäuchen gleich wieder weg. Aber wenn eine rechtzeitig kam, der konnte mit Essenzen aus Mutterkorn, Wacholder oder einer Dosis Phosphor schon geholfen werden – freilich unter allerlei Beschwerden und zuweilen schlimmen Folgen. Manchmal soll sogar wer gestorben sein, aber darüber wurde nicht geredet. Niemand wollte der alten Theres schaden, weil man sie brauchte, immer wieder brauchte. Auch die im Heiliggeistviertel tätigen Spitzel hätten sie in Ruhe gelassen, wäre nicht schon länger das Gerücht umgegangen, die Theres sei durch ihre Tätigkeit reich, sogar schwerreich geworden.
Nachdem ihr Mann gestorben und die Kinder weggezogen waren, hatte sie sich am Platz im Kornmesserhaus eingemietet, ganz oben, in einer kleinen Dachkammer. Vor gut drei Jahren konnte sie dann das Haus in der Fischergasse erwerben und sie legte den Kaufpreis bar auf den Tisch. Sie sagte, ihr hochseliger Mann habe ihr das Geld vererbt, obwohl doch jeder wußte, daß er nur ein kleiner Taglöhner gewesen war und oft die zwei Kreuzer für eine Maß Bier beim Wirt schuldig bleiben mußte.
Einem der Spitzel gelang es dann recht schnell, die Theres einer Straftat zu überführen. Er arbeitete als Hilfsschreiber in einer der kurfürstlichen Kanzleien und jammerte ihr vor, er sei nun schon zum zweiten Mal bei einer Beförderung übergangen worden. Das läge nur an seinem Vorgesetzten, der ihn nicht mochte, weil er nicht dauernd schöntue und buckle, wie die anderen. Da verkaufte Theres ihm ein Amulett, das sollte er seinem Vorgesetzten irgendwie in die Kleidung schmuggeln und der Mann werde ihn bald mit anderen Augen betrachten. Zudem schwätzte sie ihm noch einen Schlangenstein auf, den müsse er stets in der Tasche tragen, das schütze ihn vor böser Nachrede und bringe Glück.
Dieser Handel brachte den Fall ins Rollen und ein paar Tage später holten zwei Männer der Stadtpolizei die alte Theres zur Vernehmung.
Zuerst war das recht gemütlich. Da saß der Herr Hofrat mit zwei Beisitzern, am Fenster stand der Schreiber vor einem Pult und ordnete seine Federn und Tintenfässer. Die Theres blickte noch recht verschreckt, denn daß die Polizei sie am helllichten Tag aus dem Haus geholt hatte, war ihr doch in die Glieder gefahren. Der Hofrat lachte behaglich.