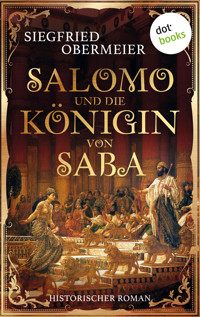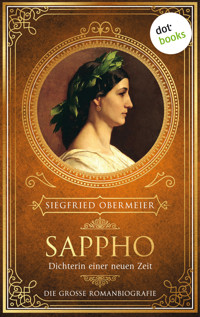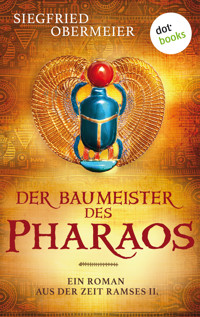Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er sah den Auf- und Niedergang eines ganzen Reiches: Das historische Epos »Der Botschafter des Kaisers« von Siegfried Obermeier als eBook bei dotbooks. Das Frankenreich im 8. Jahrhundert nach Christus: Gerold von Regensburger wächst im Schatten des größten Herrschers seiner Zeit auf – als Sohn eines Herzogs wird er zum Vasallen des herausragenden Karl dem Großen, der unerschütterlich die Wiedervereinigung des Reiches vorantreibt. In seinem Auftrag bereist er als Königsbote das Land – eine gefährliche Aufgabe, denn es herrscht Krieg, und der Überbringer schlechter Nachrichten riskiert nicht selten sein Leben. Seine abenteuerlichen Reisen führen Gerold von Verden nach Konstantinopel, von Córdoba nach Bagdad. Er schlägt große Schlachten, verstrickt sich in Liebesaffären und begegnet legendären Gestalten: Ein Leben voller Leidenschaft und Ruhm – aber auch eines voll tödlicher Gefahren … Ein dramatisches Historienepos für alle Fans von Bernard Cornwell: »Siegfried Obermeier versteht es, den Leser seines historischen Romans durch seine farbige Prosa zu fesseln«, urteilt die Bücherschau. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der opulente historische Roman »Der Botschafter des Kaisers« von Siegfried Obermeier über einen der größten Herrscher aller Zeiten – und ein Europa im Umbruch! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1314
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Frankenreich im 8. Jahrhundert nach Christus: Gerold von Regensburger wächst im Schatten des größten Herrschers seiner Zeit auf – als Sohn eines Herzogs wird er zum Vasallen des herausragenden Karl dem Großen, der unerschütterlich die Wiedervereinigung des Reiches vorantreibt. In seinem Auftrag bereist er als Königsbote das Land – eine gefährliche Aufgabe, denn es herrscht Krieg, und der Überbringer schlechter Nachrichten riskiert nicht selten sein Leben. Seine abenteuerlichen Reisen führen Gerold von Verden nach Konstantinopel, von Córdoba nach Bagdad. Er schlägt große Schlachten, verstrickt sich in Liebesaffären und begegnet legendären Gestalten: Ein Leben voller Leidenschaft und Ruhm – aber auch eines voll tödlicher Gefahren …
»Siegfried Obermeier versteht es, den Leser seines historischen Romans durch seine farbige Prosa zu fesseln.« Bücherschau
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba« und »Das Spiel der Kurtisanen« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Dieses Buch erschien bereits 1986 unter dem Titel »Mein Kaiser – Mein Herr« bei edition meyster.
Copyright © der Originalausgabe 1986 edition meyster in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/michelanbryphoto, Istry Istry
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-712-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Botschafter des Kaisers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Der Botschafter des Kaisers
Ein Roman aus der Zeit Karls des Großen
dotbooks.
Littera scripta manet
Meiner lieben Frau gewidmet
Prolog
In der Nacht vom Stephans- auf den Johannistag hatte das Wetter umgeschlagen, und von Süden, über die Donau hinweg, fauchte ein lauer Wind, der die dünne Schneedecke auftaute und wegtrocknete. Nur im Nordschatten von Hügeln und Wäldern hielten sich noch spärliche weiße Reste – die ersten Zeichen des kommenden Winters. Der heftige Wind hatte auch den Himmel blankgeputzt, nur dann und wann jagte ein kleiner grauweißer Wolkenfetzen über die großen Wälder hin nach Norden.
Meine alten Knochen, dankbar für jeden warmen Tag, tauten etwas auf und die Lust kam mich an, in Sonne und Wind hinauszureiten und den falschen Frühlingstag zu genießen. Ich zögerte noch, da meine Freya seit einigen Wochen etwas lahmt und – wie Poppo, mein alter Pferdeknecht meint – noch einige Tage geschont werden mußte. Ich ließ mir dann den Wallach satteln, einen von Freyas Söhnen, der viele ihrer guten Eigenschaften geerbt hat. Ein braves Pferd, durchaus geeignet für einen alten Mann, wenn auch manchmal ein wenig schreckhaft.
So ritt ich langsam hinunter zur Donau, über sumpfige Wiesen und schlammige Wege, spürte die schwache Wintersonne im Gesicht und ließ mir den Wind um die Ohren streichen. Ob ich nicht einen Knecht mitnehmen wolle, hatte Poppo gefragt. Ich lachte.
»Nein, mein Alter, wegen ein paar Stunden lohnt es sich nicht.«
Poppo fürchtet stets um meine Gesundheit, denn er ist noch einige Jahre älter als ich und kennt die Schwächen eines Greisenkörpers. Wie immer während der letzten Jahre hatte ich mich auch heuer gefragt, ob dies nicht mein letztes Weihnachtsfest sei, denn im Februar vollende ich mein siebenundsechzigstes Lebensjahr. In diesem Alter lebt man sein Leben anders als mit dreißig, da man bei jeder Gelegenheit daran denken muß: Dies könnte dein letzter Becher Wein sein, dieser Besuch eines Freundes könnte der letzte sein, und dies – so dachte ich jetzt – könnte dein letzter Ritt sein. Ein paar Augenblicke später glitt mein Pferd auf dem sumpfigen Boden aus, jagte dadurch einige Vögel hoch und erschrak so sehr, daß es scheute und mich abwarf. Ich fiel mit dem Rücken auf einen morschen Ast, während mein Kopf gegen einen gefrorenen Erdklumpen prallte, der im Schatten den warmen Wind überdauert hatte. Das geprellte Rückgrat würgte mir den Atem ab und lähmte mich, während mich der Aufschlag meines Kopfes für kurze Zeit bewußtlos werden ließ. Als ich erwachte, konnte ich mich nicht bewegen und kämpfte keuchend um jeden Atemzug.
Das ist nun das Ende, dachte ich, ein jämmerliches Ende für einen Mann, der die halbe Welt durchquert hat und dann vom Pferd fällt wie eine faule Frucht.
So nach und nach ging es mit dem Atmen leichter, doch ich war noch immer zu keiner Bewegung fähig und mein Kopf dröhnte wie ein erzenes Becken. Jäh überfielen mich die Gedanken.
Du hinterläßt weder Frau noch Sohn – es ist, als hättest du nicht gelebt.
»Nicht gelebt?« flüsterte es kichernd an meinem Ohr, »und ob du gelebt hast!«
Als hätte ein Zauberer gesprochen, der seine Worte mit Blendwerk unterstreicht, gaukelte mir mein Zustand bunte Bilder vor.
Das gute Gesicht meiner Mutter beugte sich über mich und ich hörte ihre Stimme:
»Gerold, was machst du da? Bist schon von der Reise zurück? Wie ist es dir ergangen?«
Das Antlitz meiner Mutter wandelte sich und Wala, die sächsische Priesterin, schaute auf mich herab.
»Wirst bald gesund … wirst bald gesund …«
Ihre Stimme verklang, und ein Reigen nackter, draller Buben tanzte um mich herum und sang ein arabisches Lied von Abu Nuwas, dem Dichter des Kalifen. Dann stand Omar vor mir, sein hübsches mädchenhaftes Gesicht strahlte, er hielt die Jüdin Mirjam an den Haaren und zerrte sie hinter sich her. Doch es war nicht die junge Jüdin, es war Adula, die männerfressende, und dann war es Helena, die auf Omar deutete.
»Schau Gerold, ich habe was für dich!«
Er grinste lüstern, riß dem Mädchen die Kleider vom Leib und stieß es zu Boden.
»Da, bedien dich! Das ist dein gutes Recht, schließlich haben wir Krieg!«
Aus Helena wurde der bucklige Pippin, Kaiser Karls erstgeborener Sohn, der blutend am Boden lag und mir die rechte Hand entgegenstreckte. Da ich wußte, was diese Hand enthielt, wandte ich mich schaudernd ab. Ich sah meinen Vater demütig vor dem König knien, während ein Knecht mit einer riesigen Schere sein Haar stutzte, sah, wie der Mörder sich über Giselas geschändeten Leib beugte und ihr den Dolch in die Brust stieß, wieder und wieder, und ich schrie und konnte ihr nicht helfen in meiner Unbeweglichkeit.
Immer schneller wechselten die Bilder. Abd-er-Rahmans Palast in Corduba, das Haus der Claudia Baleria auf Sicilia, der Giftbecher, den sie mir an die Lippen preßten, das in Trümmern liegende lasterhafte Rom, die rollenden Köpfe im Kalifenpalast, meine Flucht mit Pica, die Gefangenschaft in Aquisgranum, meine Auspeitschung – Frauen, Männer, Tiere, die auf mir herumtrampelten. Da packte Omar mich am Penis und hob mich hoch wie eine Feder, doch das war schon ein Teil der Wirklichkeit, denn meine Knechte hatten mich abends gefunden und legten mich auf eine Bahre.
Langsam, Tag um Tag, schwand die Lähmung, ich konnte meine Glieder wieder bewegen, die Beule am Hinterkopf schwoll ab. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, noch vor meinem Geburtstag, am fünfzehnten Tag des Hornung, wieder auf den Beinen zu sein. Es fiel mir nicht leicht, doch ich zwang mich dazu und so gelang es mir, wenn auch langsam und wackelig, einmal hin, einmal zurück, meine Kammer abzuschreiten.
»Es hätte dein Tod sein können!« sagte der alte Poppo vorwurfsvoll.
Vielleicht war dieser Sturz eine Warnung, ein Hinweis – eine Aufforderung?
So habe ich mich nach meiner völligen Genesung entschlossen, vor mir selbst, vielleicht vor Gott, nicht jedoch vor den Menschen Rechnung abzulegen, denn wer aus jener Zeit noch lebt, ist alt wie ich und muß – wie ich – mit sich selber ins reine kommen.
Erstes Buch
Kapitel 1
Eines vor allem hat mich bis jetzt treu durchs Leben begleitet: Eine immer wache, nie gesättigte Neugierde, die mir zwar schon manche Schwierigkeiten bereitet, aber auch mein Leben abenteuerlich und kurzweilig gestaltet hat. Ich muß allerdings auch zugeben, daß meine Neugierde jetzt, im Alter, andere näher liegende und überschaubare Ziele hat. War sie früher mehr in die Ferne auf fremde Länder, fremde Menschen, fremde Sitten gerichtet, so muß sie sich jetzt mit dem begnügen, was Gott mir im Alter zugeteilt hat. Wie wird der Roggen gedeihen? Ob der Wein wieder so sauer wird? Gibt es heuer ein gutes Bienenjahr? Werden alle Kälber überleben? Wie lange werde ich selber noch leben, ich, Gerold, Besitzer eines Königsgutes an der Donau?
In diesem Jahr erreiche ich mein 68. Lebensjahr und ich muß gestehen, daß ich bis vor kurzem niemals die Absicht hatte, zur Feder zu greifen, um mein Leben niederzuschreiben. Ich war nie ein Mann des geschriebenen, dafür um so mehr des gesprochenen Wortes. Wenn man am Karlshof aus den Heldenliedern unserer Völker vorlas und alles gebannt lauschte, wurde ich ungeduldig. Mich langweilten diese papierenen Legenden, ich wollte selber hinaus, selber erleben, selber sehen, schmecken, riechen, fühlen. Wenn es etwa im Lied von Hildebrand und Hadubrand hieß, daß Hildebrand mit König Dietrich fortzog und für dreißig Jahre außer Landes ging, dann war es gerade diese Zeit, die mich neugierig machte. Was hat er da gesehen und erlebt? Welche Länder hat er bereist, welche Völker kennengelernt? Wenn aber dann ausführlich geschildert wird, wie Hildebrand auf einen lächerlichen Streit hin von seinem Sohn Hadubrand – beide erkennen sich nicht – zum Zweikampf gefordert wird, so hatte ich dafür nur noch ein Gähnen.
Was ich sagen will ist dies: Ich wollte diese Welt erleben und nicht erlesen. Freilich, unser gnädiger König Karl hatte für die alten Heldenlieder viel übrig und ließ eine große Sammlung davon anlegen. Man konnte ihm keine größere Freude bereiten, als ihm ein solches Heldengedicht für seine Bibliothek zu verehren. Ich erinnere mich des Tages, als Gerbrand, ein sehr fähiger, viel umherreisender Königsbote, irgendwo in Britannia das Lied vom Gotenhelden Beowulf aufstöberte und Karl überreichte. Der erhabene König war so erfreut, daß er Gerbrand eine kleine Abtei schenkte. Nun muß man aber eines bedenken: Solange Karl selber ein Held war, selber die Länder auf seinen Feldzügen vom Ebrus bis zum Tiber durchmaß, als er tat, was die Helden in ihren Liedern tun, da mußte niemand ihm aus Büchern vorlesen. Als aber die Pfalz zu Aquisgranum erbaut war und Karl die heißen Bäder brauchte, um seine gichtigen Glieder geschmeidig zu erhalten, als er kaum noch die Kraft hatte, einen Eber zu stechen, da gewann er Geschmack am Geschriebenen, da lebte er in den Heldenliedern sein eigenes Leben nach.
Nun bin ich schon da angelangt, wo ich eigentlich noch nicht hinwollte, beim Kaiser Karl, dem Weltenbeweger, der – für Gott handelnd – unser aller Schicksal gestaltet hat. Das ist nun einmal so bei Menschen meines Alters: Beginnt man von den alten Zeiten zu reden, dann mündet das Gespräch – manchmal früher, manchmal später – beim großen Karl, und wer mag dann noch ein Ende finden?
Ich sprach davon, daß ich bis vor kurzem nicht die Absicht hatte, mein Leben in raschelndes Papier zu verwandeln. Durch meinen schlimmen Sturz vom Pferd aber wurde ich anderen Sinnes. Zudem übersandte mir Meister Eginhart vor einigen Tagen seine Vita Karoli Magni. Mein gelehrter und auch treuer Freund aus den Tagen von Aquisgranum lebt jetzt mit seiner Frau im Kloster Seligenstadt, das er vor einigen Jahren gegründet hat und für das er mit großen Kosten die Gebeine der Märtyrer Marcellinus und Petrus erwarb. Aus unserer gelegentlichen Korrespondenz wußte ich, daß er mit dem Plan einer Biographie unseres großen Königs umging, doch es überraschte mich, daß er sie so schnell vollenden konnte.
Eginhart war immer ein frommer Mann und er ist ein Mann der Schrift. Er war mit den literarischen Studien unseres erhabenen Königs betraut und hatte später auch die Aufsicht über die Bauten von Aquisgranum. Daß ihn ersteres ungleich mehr Kraft kostete, hat er unter seinen engsten Freunden gelegentlich verschämt gestanden. Es muß schon ein schweres Stück Arbeit sein, jemanden in die Literatur einzuführen, der selber nicht schreiben und lesen kann. Daß König Karl diesen Mangel tief bedauerte und keineswegs verschwieg, ist ja hinreichend bekannt geworden. In seiner mönchischen, manchmal etwas aufdringlichen Bescheidenheit gibt Eginhart in seinem Prologus zur Vita Karoli Magni bekannt, was ihn bewogen hat, dieses Werk zu verfassen: »Ich habe mir vorgenommen, so kurz wie möglich über das private und öffentliche Leben und vor allem auch über die Taten meines Herrn und Gönners, des trefflichen und hochberühmten Königs Karl zu berichten. Dabei gab ich mir Mühe, nichts wegzulassen, was ich in Erfahrung bringen konnte, und auch nicht durch Weitschweifigkeit solche Leser abzuschrecken, die an allem Modernen etwas auszusetzen haben …«
Später heißt es dann: »Gleichwohl hindern mich alle diese Gründe keineswegs, mit meinem Werk zu beginnen, da ich sicher bin, daß außer mir niemand die Ereignisse genauer schildern kann, die sich quasi vor meinen eigenen Augen zugetragen haben und deren Wahrhaftigkeit ich bezeugen kann.«
Das klingt alles recht vernünftig und bescheiden, einem frommen Klosterstifter und Beinahe-Mönch durchaus angemessen. Als ich den Prologus ein zweites Mal las, wurde ich bei einem Satz stutzig. Da schreibt Eginhart:
»… da ich sicher bin, daß außer mir niemand die Ereignisse genauer schildern kann …«
Lebte Eginhart denn allein am Karlshof? War er der einzige, der mit dem Kaiser verkehrte, der einzige, der mit ihm befreundet war, der einzige, mit dem der erhabene Karl speiste, auf die Jagd ritt oder in die heißen Quellen stieg? Wenn ich so zurückdenke, kann ich mich nicht erinnern, Eginhart jemals in den Bädern gesehen zu haben. Auch als Jäger ist er mir nicht in Erinnerung. Schreibt Eginhart doch selbst:
»Er lud nicht nur seine Söhne, sondern auch Adelige und Fremde, manchmal sogar sein Gefolge und seine Leibwache zum Baden ein. Oft badeten mehr als hundert Leute mit ihm.«
Vielleicht schämte Eginhart sich, da er nur knapp fünf Fuß groß war und von den Hofleuten – wenn auch mit Respekt – Homuncio genannt wurde. Wie dem auch sei, unser König zeigte gerade beim Baden, wenn Körper und Geist sich entspannten, eine große Redelust und war dann trotz lästiger Altersbeschwerden so fröhlich und aufgeschlossen wie in früheren Zeiten. Ich will damit nur sagen, daß Eginhart in knapper Form viel Wesentliches berichtet und vielleicht mit Absicht nichts ausgelassen hat. Doch er erzählt bei weitem nicht alles, und das wäre auch – selbst wenn er es gewollt hätte – gar nicht möglich gewesen. Und zwar aus zwei Gründen: Eginhart kam erst zu einer Zeit an den Karlshof, als ich schon fünfzehn Jahre dort war. Zum zweiten hat er wegen seiner kleinen Gestalt keinen Feldzug unseres Königs selber mitgemacht. Während ich mit dem Frankenheer nach Spanien zog, war Eginhart noch ein Knabe, und so wundert es mich nicht, daß er diesen Feldzug mit ein paar Sätzen abtut. Als Eginhart an den Karlshof kam, war Widukind schon getauft und der Sachsenkrieg, wenn auch nicht zu Ende, so doch entschieden. Wer aber unseren verewigten König nicht auf seinen Feldzügen erlebt hat, kennt nur einen Teil von ihm, mein verehrter und neunmalkluger Meister Eginhart, dem ich ein geruhsames Alter wünsche.
Nun bin ich schon ein zweites Mal bei unserem König angelangt, aber das läßt sich wohl nicht vermeiden.
Nachdem ich also Eginharts Werk mehrere Male sorgfältig durchgelesen hatte, beschloß ich, selber zur Feder zu greifen und in diesem Bericht Rechenschaft abzulegen über Ereignisse, die Eginhart verschwiegen, vergessen oder ganz einfach nicht gewußt hat, wie auch über alles, was ich selber erlebt und erlitten habe. Ich tue dies nicht für die Öffentlichkeit – da mag Meister Eginharts Werk genügen –, ich tue es für mich und aus Neugierde. Neugierde? Warum nicht? Vieles, was die Zahl der Jahre mit Vergessen bedeckte, aber doch im Gedächtnis ruht, wird zu meinem Vergnügen, Erstaunen oder Schrecken wieder ans Licht kommen, und ich werde dieses Leben ein zweites Mal leben, werde in die Vergangenheit hinabtauchen, wie ins heiße Wasser zu Aquisgranum und, wie bei diesem, Entspannung und Kurzweil finden. Reue? – höre ich ein Stimmchen flüstern. Davor fürchte ich mich nicht. Ich bereue nichts, weil jede, auch die schrecklichste Tat, nicht von unserem Leben, von unserer Vergangenheit zu trennen ist. Man kann beichten, ja, Klöster und Kirchen stiften, nichts macht sie ungeschehen, die bösen wie die guten Werke. Und wenn etwa Eginhart in seiner Vita Karoli Magni diesen einen schrecklichen Tag in Ferdi an der Aller mit Schweigen übergeht, so hat er doch stattgefunden und ich, der ich Augenzeuge war, werde ihn nicht unterschlagen.
Kapitel 2
Eigentlich wollte ich bei diesen Aufzeichnungen die Gegenwart aussparen, wollte ganz in den Tiefen der Vergangenheit untertauchen und der Gegenwart nur geben, was sie von einem Bauern eben fordert: daß er ein Auge hat auf Mensch, Tier und Pflanze. Doch es geht nicht. Mein Name ist nicht vergessen, ich gehöre zu den wenigen noch Lebenden, die dem großen Karl dienen durften. Freilich, ich bin nur noch ein Landmann, und Einfluß auf die Staatsgeschäfte habe ich nie gehabt – aber wer hatte den schon? König Karl hat alles Wesentliche selber gemacht und er hat selten, sehr selten Rat gesucht. Sein Ratgeber war Gott allein, und mit Gottes Hilfe hat er aus den deutschen Stämmen ein Reich geschmiedet, wie man es sich vorher nicht einmal hätte erträumen können. Aber wer hat denn eigentlich davon geträumt? Die Baiern? Die Sachsen? Die Alemannen? Die Langobarden oder sogar das Volk der Franken? Ich habe alle diese Stämme kennengelernt, beherrsche ihre Sprachen und weiß viel von ihren Bräuchen. Hat irgendein Baier, Franke, Alemanne, Sachse mehr sein wollen als ein Angehöriger seines Stammes? Ich kann diese Fragen aus meiner langen Erfahrung mit Sicherheit verneinen. Die Baiern wollten keinen Frankenkönig über sich, die Sachsen nicht und nicht die Langobarden. Der große Karl hatte sich dieses Ziel ganz allein in den Kopf gesetzt, er hatte, wie er sagte, den Auftrag von Gott, die deutschen Stämme zu einen – um jeden Preis. Der Preis war, wie wir jetzt wissen, hoch, sehr hoch. Ein Meer von Blut und Tränen, ein Wall von Schmerzen und viel Totengebein, viele, viele Ochsenfuhren voll Totengebein – das war der Preis. Ihm, dem Erhabenen, war er nicht zu hoch. Die ihn bezahlen mußten, hat niemand gefragt. Und nun bin ich schon wieder bei Karl und wollte doch zur Gegenwart, die an das eben Gesagte anknüpft. Was ist jetzt, fünfzehn Jahre nach dem Tod des Kaisers und Königs, was ist von diesem Reich der Deutschen geblieben?
Schon als Karl noch lebte, haben kluge Leute prophezeit: Mit seinem Tod fällt auch das Reich. Freilich, das war nicht schwer vorauszusagen: denn er selber hatte es schon zu Lebzeiten unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Aber dann hatte Gott wohl andere Pläne als sein Diener Karl und schickte die zwei fähigsten Söhne, Karl und Pippin, noch vor dem Vater ins Grab. Gott ließ den übrig, der ihm wohl am besten diente, Ludwig, den Pfaffenknecht. So war es wieder greifbar geworden, dieses Reich der Deutschen – ein Erbe, ein Reich. Als Ludwig, der nur zum König von Aquitanien bestimmt war, an jenem Septembertag des Jahres 813 in der Marienkirche zu Aquisgranum sich selbst die Kaiserkrone aufs Haupt setzte, da schien das Werk des Vaters gerettet: Ein Fürst – ein Reich.
Wer wie ich diesen Ludwig von Angesicht zu Angesicht kannte, wer ihn gesehen hat, wie er mit niedergeschlagenen Augen, von einem Rudel Mönche umgeben, von Kirche zu Kirche und von Kloster zu Kloster pilgerte und das Reichsvermögen an die Pfaffen verschenkte, der mußte doch einige Zweifel anmelden, ob einer, den seine Priester »den Frommen« nannten, dieses Riesenreich mit starker Hand regieren konnte. Jetzt, nach fünfzehn Jahren, ist es kein Geheimnis – man darf es nur nicht laut sagen –, er konnte es nicht. Was ist geschehen? Es war die Rede davon, daß Ludwig sich die Krone selber aufs Haupt setzte, weil – wie jedermann sich denken konnte – es sein Vater so wollte. Der große Karl nämlich lebte und starb in dem Bewußtsein, daß Gott ihm diese Krone verliehen hatte und nicht der Papst in Rom. Ludwig, diese faule Frucht aus gesundem Stamm, Ludwig aber, der Mönch hätte werden sollen und nicht Kaiser, wand sich in Gewissensqualen. Als Papst Leo III., dieser zähe und schlaue Fuchs, dessen Untaten aufzuspüren mich König Karl seinerzeit nach Rom schickte, als dieser Leo also seinen geliebten Stuhl Petri – vermutlich nur ungern – mit den himmlischen Gefilden vertauschte, da folgte ihm Papst Stephan IV., der, wie Ludwig, eine andere Vorstellung von der Kaiserwürde hatte, wie er auch sein eigenes Amt in einem anderen Licht sah. Und Fortuna wollte es, daß die beiden Herren der Welt auf wunderbare Weise zusammenfanden. Am Karlshof aber begann man Hoffnung zu schöpfen, denn der neue Papst reiste dem König Ludwig entgegen und man sah dies in jeder Weise als Entgegenkommen. In Remi trafen sich Kaiser und Papst, und nun zeigte es sich, daß Ludwig, dieser verkommene Sproß des erhabenen Karl, nicht mit seinem Amt gewachsen, sondern geschrumpft war zu einem willfährigen Zwerg, der sich vor Papst Stephan dreimal in den Staub warf und sich am nächsten Tag demütig die Krone aufsetzen ließ. Als ich damals von diesen Vorgängen erfuhr, glaubte ich aus dem Karlsgrab zu Aquisgranum ein zorniges Grollen zu vernehmen.
Wenig später geschah dann, was der Tod von zwei Karlssöhnen damals noch verhindert hatte, nämlich die Teilung des Reiches durch Kaiser Ludwig den Frommen. Jeder wußte, daß dies eines Tages so kommen mußte, doch daß Ludwig die Reichsteilung schon als Vierzigjähriger vornahm, das war nicht nur höchst unklug, es war gefährlich.
Lothar, sein Erstgeborener, sollte den Kaisertitel und die Mitregentschaft erhalten, Pippin Aquitanien und Ludwig, der Jüngste, Baiern, das größte Land im Karlsreich. Alles übrige fiel Lothar, dem Mitkaiser, zu, der auch die Oberlehnsherrschaft über seine Brüder erhalten sollte, die ihm Kriegsfolge leisten, seine Reichstage besuchen und ihn bei Verehelichung um Erlaubnis fragen mußten. Zähneknirschend beschworen Pippin und Ludwig diese Vereinbarungen, die jedes Herkommen verletzten und die jüngeren Brüder zu rechtlosen Mündeln Lothars herabwürdigten. Aber nicht das war der eigentliche Anlaß zu einer blutigen Familienfehde, sondern der Umstand, daß man einen nicht zu jenem Reichstag geladen hatte und nicht in die Vereinbarungen miteinbezog. Ich spreche von Bernhard, dem König von Italien, Nachfolger seines Vaters Pippin, Karls zweitgeborenem Sohn. Er lehnte sich gegen die über seinen Kopf hinweg getroffenen Abmachungen auf und besetzte vorsorglich die Alpenpässe. Kaiser Ludwig, der erst mühsam ein Heer sammeln mußte, das aber wegen des nahenden Winters nicht mehr zum Einsatz kam, wählte einen anderen Weg, einen Weg, der eher zu seinem schwachen, verschlagenen Charakter paßte. Bernhard wurde eine Nachricht des Kaisers überbracht, daß die Familie geneigt sei, alles zu vergessen, wenn er nach Catalaunum komme und demütig um Verzeihung bitte. Mein Land Italien ist mir das Niederknien wert, dachte Bernhard und fiel auf die List herein. Nachdem er um Verzeihung gebeten hatte, warf man ihn ins Gefängnis und ließ ihn von einem, aus königlichen Vasallen gebildeten, Gericht wegen Hochverrats zum Tod verurteilen. Wie vielfältig brauchbar ist doch der Begriff des Hochverrats und wie viele hat er schon den Kopf gekostet. Kaiser Ludwig bekam dann doch Bedenken, seinen Neffen einfach nur deshalb hinrichten zu lassen, weil er seine Söhne störte und wandelte das Urteil in Blendung um. Blendung! Grausames und beliebtes Mittel, sich eines Menschen zu entledigen, ohne die empfindsame Seele mit einem Mord zu belasten. Diese Methode wurde aus Ostrom übernommen und wird seitdem im ganzen Reich fleißig geübt. Nun kann man einen Menschen auf die verschiedenste Weise blenden. Die herkömmlichste Art ist es, ein weißglühend gemachtes Schwert oder Metallstück dem Verurteilten solange vor die gewaltsam geöffneten Augen zu halten, bis die Sehkraft, aber nicht das Auge selbst, zerstört ist. Man kann aber die Augäpfel durch Zerstechen, Ausbrennen oder Ausreißen auch zerstören, was in vielen Fällen einem Todesurteil gleichkommt. Bei Bernhard wurden die Henker angewiesen, die Augen herauszureißen. Drei Tage später war der König von Italien tot. Bei dieser Gelegenheit räumte man auch gleich mit den drei noch übrigen Söhnen des großen Karl auf. Söhne, die ihm von seinen Konkubinen Regina und Adelinde geboren worden waren. Drogo, Hugo und Theoderich lebten bei Bernhard in Italien und waren unvorsichtigerweise mit ihm nach Catalaunum gekommen. Sie wurden geschoren und in ferne Klöster verbannt.
Wer ein wenig geschichtskundig ist, fühlt sich bei diesem Vorgehen an die finsteren Zeiten der Merowinger-Könige erinnert, die es beim Verwandtenmord zu hoher Übung gebracht hatten. Ich habe mich nun bemüht, diese traurigen Ereignisse von einer anderen Warte zu sehen. Was wäre geschehen, wenn Bernhard sich nicht hätte täuschen lassen und sich in Italien mit seinem Heer verschanzt hätte? Im nächsten Frühjahr wären Kaiser Ludwigs Söhne über die Alpen gezogen und es hätte Krieg gegeben. Einen langen, erbitterten und grausamen Krieg. Habe ich gesagt »grausam«? Nun, das war überflüssig, denn Kriege sind immer grausam. Es gibt keine milden Kriege. Und dieser Krieg wäre, wie jeder Bruderkrieg, lange und verbissen ausgefochten worden und am Ende hätten sich die Könige geeinigt. Am Ende dieses Krieges wären aber auch Tausende von Menschen getötet und verwundet gewesen, Hunderte von Städten und Dörfern verbrannt, Ernten vernichtet, Weinberge zerstört und vielleicht das Schlimmste: die vielen geschändeten, gequälten und ermordeten Frauen; denn sie tragen keine Schuld an diesen Kriegen, sie können sich nicht wehren und sind nur immer dazu verurteilt, die Schuld ihrer Väter, Söhne und Brüder zu bezahlen. Warum ich mich gerade der Frauen so annehme? War es denn nicht immer so, und wer vermag es zu ändern? Ich weiß, daß man es nicht ändern kann, solange es Kriege gibt – und Kriege wird es immer geben, bis ans Ende aller Tage. Doch ich habe meinen ganz besonderen Grund, der Frauen zu gedenken. Es ist aber noch nicht an der Zeit, davon zu reden.
Was also mag schwerer wiegen in den Augen des Schöpfers: ein toter König oder viele tausende Hingemordete aus dem niederen Volk? Doch mit der Ermordung Bernhards war die Sache noch nicht ausgestanden. Als im selben Jahr Ludwigs Gemahlin Irmgard starb, hielt er das für eine Strafe Gottes wegen der Freveltat an seinem Neffen. In der Reichsversammlung von Attiniacum gab er zu erkennen, daß er sich schuldig fühle wegen Bernhard und seiner Halbbrüder, die er ins Kloster verbannt hatte. Er ließ sich von den anwesenden Bischöfen eine Kirchenbuße auferlegen, und ich sehe sie grinsen und ihre Hände reiben, die ganze Pfaffenversammlung. Das war ein König, den konnten sie formen und biegen, wie es ihnen paßte. Ach, wenn ich nur daran denke, wie es Karl mit seinen Bischöfen hielt! Vom Papst bis hinunter zum kleinen Mönch mußten sie vor ihm fleißig Kniefälle üben und zeitlebens hat er ihnen scharf auf die Finger geschaut. Er besteuerte ihre Einkünfte wie die der weltlichen Herren und setzte sie ab, wenn ihm ihr Lebenswandel nicht einem Priester gemäß erschien. Mir klingen selber noch die Worte im Ohr, als der erhabene Karl sich wieder einmal über die Habgier einiger Bischöfe geärgert hatte:
»Den Armen und Christus in ihnen solltet ihr dienen und nicht nach eitlen Dingen trachten. Nun aber verkehrt ihr alles ins Gegenteil und ergebt euch leerer Habsucht und Eitelkeit, mehr als alle anderen Sterblichen.«
Da duckten sich die Köpfe der Pfaffenschar. Ja, so war es unter dem großen Karl, doch jetzt brauchen sie ihre Köpfe nicht mehr zu ducken, jetzt tragen sie ihr Haupt höher als alle anderen.
Um Kaiser Ludwig, der schon davon sprach, ins Kloster zu gehen, wieder an irdische Dinge zu fesseln, führte man ihm eine Reihe von Bräuten vor, und er wählte Jutta, eine Tochter des bairischen Grafen Welf. Damit war der Boden für neues Unheil bereitet. Da es nun einmal so ist, daß Frauen Kinder bekommen und auch der fromme Ludwig nicht weltabgewandt genug war, um nicht mit Vergnügen solche zu zeugen und Jutta zudem ehrgeizig, ränkesüchtig und willensstark war, blieb es nicht aus, daß sie für ihren Erstgeborenen Karl Pläne hegte, die natürlich auf den Widerstand der drei Irmgard-Söhne stießen.
Meister Eginhart, mit dem ich gelegentlich korrespondiere – wir sind weniger Freunde aus Zuneigung als wegen der Erinnerung an die gemeinsame Zeit in Aquisgranum –, Meister Eginhart also, der, weil er selber so fromm ist, auch viel vom frommen Ludwig hält, besuchte mich vor einigen Jahren und berichtete, er habe die neue Kaiserin persönlich gesehen. Hier muß ich allerdings einschieben, daß Eginhart – er war eine Zeitlang Ludwigs Geheimsekretär – im Kaiser eher den frommen Mann schätzt, vom Staatsmann aber keine allzu hohe Meinung hat.
»Ja, mein lieber Gerold«, sagte Eginhart, als er mir gegenüber saß, »was ich dir jetzt erzähle, hätte ich dir nicht schreiben können. So etwas läßt sich nur unter vier Augen sagen.«
Eginhart, selber mit der sanften Imma verheiratet, war entsetzt, als er dem hohen Paar in Mettis begegnete.
»Dieser Mann«, sagte er und meinte den Kaiser, »dieser fromme Mann ist dieser Hexe völlig verfallen. Ja, ich nenne sie bewußt und mit Überlegung eine Hexe. Sie umgirrt und umschmeichelt ihn, sie schaut ihn an mit ihren grünen Nixenaugen und Ludwig vergißt, was er früher gesagt und versprochen hat, bricht Verträge und Abmachungen und sagt ja zu allem, was sie fordert. Man müßte dieses Weib wegen Zauberei vor Gericht bringen. Mit ihr kommt Unheil über Volk und Reich, glaube mir, Gerold, das gibt einen Zwist, der diesmal nicht in der Familie bleibt.«
Und Eginhart, in politischen Dingen wohl erfahren, behielt recht. Jutta brachte ihren Gemahl so weit, daß er ihren fünfjährigen Sohn Karl zum König von Rhätien, Alemannien und einem Teil Burgunds machte. Wie dieser Entschluß auf seine drei älteren Söhne wirkte, mag man sich denken. Noch ist nichts entschieden, noch hat keiner ein Heer gesammelt, noch ist es friedlich im Reich, und hier in Baiern wird es wohl auch friedlich bleiben. Unser neuer König Ludwig – er nennt sich König von Baiern und der angrenzenden Gebiete – ist erst vierzehn Jahre alt, und beim bairischen Adel wurde diese Tatsache nicht gerade wohlwollend aufgenommen. Sind wir Säuglinge, daß man uns ein Kind als Herrscher zuteilt? So wird gefragt, aber in wenigen Jahren ist aus dem Kind ein junger Mann geworden und die Leute werden sich daran gewöhnt haben. Falls sein frommer Vater es inzwischen nicht anders verfügt … Unser neuer König soll sich mit Vorliebe in der Königspfalz zu Autingas aufhalten, gelegentlich auch in Ratisbona. Soviel zur Gegenwart.
Kapitel 3
Meine Mutter hieß Gertrud und war eine Hörige am Hof der Agilolfinger zu Ratisbona. Mein Vater war Herzog Tassilo, der dritte seines Namens, inzwischen vermutlich gestorben als einfacher Mönch in einem unbekannten Kloster. Wäre ich nicht der Kegel des letzten bairischen Herzogs gewesen, sondern in kirchlich gesegneter Ehe geboren, so hätte man mir dasselbe Schicksal bereitet wie meinen Halbgeschwistern Theodo, Cotadeo, Cotari und Rotrud. Auch sie verschwanden in fernen Klöstern; ich weiß nicht, wo sie sind und wer von ihnen noch lebt. Ich muß freilich zugeben, daß ich es gar nicht wissen möchte. Die Neugierde, mein altes Laster, erstreckt sich nicht auf diese Halbgeschwister, wie auch sie mich aus ihrem Leben ausschlossen, als sie noch Herzogskinder waren. Meinen Vater nehme ich davon aus; denn er hat – wenn auch meist aus der Ferne – an meinem Leben Anteil genommen, so lange es ihm möglich war.
Meine Mutter lebte am Hof des Herzogs Tassilo in Ratisbona, hatte rote Haare, graugrüne Augen und muß für Männer jeden Alters ein erfreulicher Anblick gewesen sein. Ihre Eltern waren früh gestorben; auch sie und meine Urgroßeltern und vermutlich deren Eltern waren Hörige der Agilolfinger und wurden, wie das bei den Unfreien so ist, mit Häusern, Land und Vieh weitervererbt. Sie kannten es nicht anders, sie waren’s zufrieden. Natürlich machte es einen Unterschied, ob man ein Höriger am Hof des Herzogs war, oder bei einem freien Bauern, wo man vielleicht schlimmer behandelt wurde als das Vieh und sich fast zu Tode schinden mußte. Meine Mutter hat mir später erzählt, wie es dazu kam, daß Herzog Tassilo mit ihr einen Sohn zeugte. Sie tat es allerdings nicht freiwillig, sondern wollte nach Frauenart solche Dinge bei sich behalten, doch meine Neugierde war so groß, daß ich sie immer wieder bedrängte und ihr klarzumachen versuchte, daß wir ja nun ein freies Geschlecht seien und ich der Sohn des Herzogs. Als sie sich dann entschloß, es mir zu erzählen, tat sie es nach ihrer Art sehr umständlich und voller Abschweifungen, die ins Bodenlose geführt hätten, wäre sie von mir nicht immer wieder an den eigentlichen Gegenstand ihres Berichts erinnert worden.
Gertrud, meine Mutter, kam nicht in Ratisbona zur Welt, sondern auf einem der herzoglichen Hofgüter in der Nähe von Strupinga. In jener Zeit begann Herzog Odilo – als Feldherr nicht sehr erfolgreich – seine Residenz in Ratisbona auszubauen und zu erweitern. Der Vater meiner Mutter soll sehr kräftig gewesen sein und wurde für die Bauarbeiten eingesetzt, wo er es sogar bis zum Vorarbeiter brachte. Die Großmutter fand am Hof Arbeit und hier wuchs auch Gertrud, meine Mutter, heran. Nach ihrer Erinnerung muß sie zehn oder elf Jahre gewesen sein, als sie mit ihren Eltern nach Ratisbona umsiedelte. Da sie sich sehr geschickt im Nähen und Sticken zeigte, kam sie in die herzogliche Kleiderkammer.
Schon als sie vierzehn war, begannen ihr die Männer nachzulaufen und mit fünfzehn erhielt sie mehrere Heiratsanträge. Doch die Unfreien können nur mit Erlaubnis ihrer Herrschaft heiraten, und diese hat in der Regel ein Auge darauf, daß nicht ein alter, verwitweter Stallknecht so ohne weiteres an ein junges Mädchen kommt – es sei denn, sie ist schwanger und wünscht es. Als sie sechzehn wurde, fragten einige junge Männer beim Majordomus an, ob sie um Gertrud werben dürften. Der Majordomus sagte, sie dürften, doch müsse auch Gertrud einverstanden sein. Sie war es nicht, es gefiel ihr auch so auf der Welt. Dann kam jener Schicksalstag, als Gertrud mit der Vorsteherin der Kleiderkammer in irgendeiner Sache zur »Tante« gerufen wurde. Diese Tante – ihr Name ist mir entfallen – spielte für kurze Zeit die Rolle der ersten Dame am Herzogshof, da Tassilo noch nicht verheiratet und seine Mutter vor einigen Jahren gestorben war. Diese Tante wurde »Frau Herzogin« angeredet; denn sie war sehr adelsstolz und achtete genau auf die Würde ihres Hauses, obwohl sie nur durch Heirat einer Nebenlinie der Agilolfinger angehörte. Nun aber war sie Witwe und hatte mit Stolz und Freude ihr jetziges Amt übernommen.
Die Frau Herzogin wollte an einem Kleid etwas gerichtet haben. Während Gertrud der Vorsteherin zur Hand ging, trat Tassilo herein.
»Komm etwas später, mein Sohn«, bat ihn die Tante, doch des jungen Herzogs Augen ruhten schon auf Gertruds gebeugtem Kopf und ihrem rotschimmernden Haar.
»Wer ist denn dieser Rotschopf?« fragte er die Vorsteherin.
»Das ist Gertrud, Herr, sie arbeitet bei mir in der Kleiderkammer.«
Es wäre für den Herzog unschicklich gewesen, sich weiter nach einer Hörigen zu erkundigen; denn der Abstand, wie jeder weiß, zwischen einem Herzog und einer Unfreien ist schier unüberbrückbar. Wenn der Hörige aber jung und weiblich ist, dann findet sich immer ein Weg.
Tassilo war damals achtzehn und galt allgemein als ein eher schüchterner Mensch mit weichen und empfindsamen Zügen. Jedenfalls war er nicht ein Mann, der seinem Leibdiener befahl: »Leg mir heute nacht die junge Gertrud ins Bett; das ist die Rothaarige aus der Kleiderkammer.« Er scheute die Gewalt und soll auch seine spätere Frau, die Langobardin Luitberga, sehr zart und nachsichtig behandelt haben. Umgekehrt war das leider nicht der Fall, wie sich später erwies. Jedenfalls fand der junge Tassilo Mittel und Wege, sich Gertrud zu nähern. Zuerst befahl er dem Majordomus, jeden, der um Gertrud warb, zu ihm selber zu schicken. Der ganze Hof staunte über diese Vorgänge. Freilich lag die letzte Entscheidung über die Heirat eines Unfreien bei seinem Herrn, doch Herzöge pflegen sich in der Regel um dergleichen nicht zu kümmern. Natürlich blieben die Bewerber aus, als sich herumsprach, daß der Herzog selbst sich um das Mädchen kümmerte. Sehr lange scheint das Verhältnis nicht gedauert zu haben. Meine Mutter wurde schwanger und im Februar des Jahres 762 kam ich zur Welt. Ob sie die erste Geliebte des Herzogs gewesen ist, wußte sie nicht, jedenfalls war ich sein erstes Kind. Der Herzog soll sich sehr über die Schwangerschaft gefreut und oft über das zu erwartende Kind gesprochen haben. Er sprach so oft davon, daß die Tante entsprechende Maßnahmen ergriff. Als Tassilo einmal länger abwesend war, ließ sie meine Mutter rufen. Sie begegnete ihr freundlich und verständnisvoll. Man munkelte, daß sie in ihrer Jugend recht heißblütig gewesen und in mancherlei Liebesgeschichten verwickelt war. Sie schien erleichtert, daß Tassilo endlich einmal das Bett eines Mädchens, anstatt nur Klöster und Kirchen aufgesucht hatte. Doch gab sie meiner Mutter deutlich zu verstehen, daß dieses Liebesverhältnis mit der Schwangerschaft beendet sein müsse. Ansonsten sei sie befugt, im Namen des Herzogs folgendes anzuordnen: Frau Gertrud werde in den Stand der Freien versetzt, ebenso ihre nächsten Verwandten. Es gehe nicht an, daß das Kind des bairischen Herzogs aus einer unfreien Sippe komme. Des weiteren werde Frau Gertrud namens ihres Kindes zur Verwalterin eines herzoglichen Gutshofs bestellt, der dem Kind nach seiner Geburt als Lehen zu übertragen sei. Falls das Kind sterbe, falle das Lehen der Frau Gertrud und ihrem Mann zu. Da wagte meine Mutter zu fragen:
»Welchem Mann, gnädige Frau?«
Die Herzogin lächelte streng.
»Mein liebes Rotschöpfchen, du wirst doch nicht im Ernst gedacht haben, wir lassen dein Kind ohne Vater aufwachsen? Nein, nein – die Dinge müssen schon ihre Ordnung haben. Das ist nun einmal so bei uns Frauen, ob hoch oder niedrig, ohne Mann sind wir nichts oder nicht viel. Auch eine so hochgeborene Frau wie ich – was wäre ich gewesen ohne meinen Gemahl? Ich hätte wohl ins Kloster gehen müssen. So aber wurde ich zur ersten Dame dieses Hofes berufen; denn die Dinge innerhalb des Hauses kann man den Männern allein nicht überlassen. Du bist zur Verwalterin eines Herzoghofes bestellt, weißt du, was das heißt? Das heißt, regieren über ein paar Dutzend Hörige, Männer, Frauen und Kinder, über Vieh, Land, Wald und Weinberge. Traust du dir das zu? Verstehst du etwas davon?«
Da konnte meine Mutter nur stumm den Kopf schütteln.
»Siehst du«, sagte die Herzogin, »deshalb haben wir einen Mann für dich gefunden.«
Als die Tante bemerkte, daß meine Mutter mit gesenktem Kopf leise weinte, sagte sie:
»Ich weiß, Gertrud, du weinst um Tassilo. Aber wie hätte es denn weitergehen sollen? Heiraten könnt ihr nicht und sobald Tassilo eine Ehe eingeht, schickt es sich nicht mehr, daß er mit dir verkehrt.«
Nach diesen verständnisvollen und mütterlichen Worten war Gertrud entlassen. Im Grunde sah sie es ein, es gab keine andere Lösung. Nun darf man aber nicht glauben, jeder ledige Mann sei erbaut gewesen, die Geliebte seines Herzogs zu heiraten. Die Freien, und gar, wenn sie hochgeboren waren, hatten auch ihren Stolz. Zudem gab es noch eine Erinnerung an die alten Stammesbräuche. Was war denn früher ein Herzog schon? Einer, den die Adeligen unter sich erwählten und den sie davonjagten, wenn er nichts taugte als Heerführer und in Staatsgeschäften. Nun war das Herrscheramt zwar erblich geworden, doch das tat dem Stolz der anderen großen Adelsfamilien keinen Abbruch. Die Huosi, Fagana, Drozza, Hahilinga und Anniona empfanden sich den Agilolfingern als durchaus ebenbürtig und ließen sich in ihre Angelegenheiten nichts hineinreden. Nun gab es am Hof zu Ratisbona einen freien Jäger namens Grifo, dessen Eltern durch Unglück und Mißwirtschaft ihre Güter verloren hatten. Dem Grifo war dann auch noch seine junge Frau an einer Fehlgeburt gestorben und so war er verbittert und ein wenig seltsam geworden. Er erklärte sich sofort bereit, meine Mutter zu heiraten, weil ihm wohl beides gefiel: das rothaarige Mädchen und die Aussicht, wieder zu Grund und Boden zu kommen. Grifo – etwa zwanzig Jahre älter als meine Mutter – war so ganz ein Mann vom alten Schlag. Die Frauen galten ihm nicht viel. Sie waren eine angenehme Zutat des Lebens, das von Gott – einem Mann – für Männer gemacht war. Vielleicht ist es wirklich so, auch wenn ich es selber nicht glaube, doch das kommt auf die Auslegung an. Grifo, ein hagerer zäher Mann, dessen Haar sich schon lichtete und dessen uralte Lederkleidung immer ein wenig unordentlich war, Grifo jedenfalls mußte in seiner Ehe lernen, daß die Welt nicht nur für Männer und deren Bequemlichkeit gemacht war.
Meine Mutter hat mir einmal erzählt, daß die Unterredung mit der herzoglichen Tante sie sehr beeindruckt habe. Als diese damals sagte: »Das ist nun einmal so bei uns Frauen«, und damit meine Mutter schwesterlich miteinbezog, war sie bereit, ihr Schicksal anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Auch wollte sie nicht ins Kloster, sondern weiter am Leben teilhaben und wenn nun einmal ein Mann dabei sein mußte, um dies zu ermöglichen – in Gottes Namen!
Zwei Dinge vor allem mußte Grifo lernen, so schwer es ihm auch fiel: Das Gut gehörte ihm nur zur Nutzung und er war zusammen mit Gertrud zum Verwalter bestellt. Zum anderen aber durfte er nie vergessen, wessen Kind Gertrud trug. Als ich geboren war und er es manchmal doch vergaß, war es meine Mutter, die ihn mit Nachdruck daran erinnerte. Meine Mutter hat ihm noch zwei eigene Kinder geboren, was ihm – wenigstens in den ersten Jahren – gewiß ein Trost war. Ich vermute, daß Grifo seine verstorbene Frau niemals vergessen konnte, auch wenn er nie davon sprach. Trotzdem hat er mit meiner Mutter keine schlechte Ehe geführt, und insgeheim mochte er sie bewundert, vielleicht sogar ein wenig geliebt haben.
Kapitel 4
Nun gehört es sich wohl auch, daß ich meines Vaters gedenke, der – über die bloße Zeugung hinaus – doch mein und meiner Mutter Schicksal in eine andere und, wie ich glaube, bessere Richtung gelenkt hat, als es uns durch Stand und Herkommen beschieden gewesen wäre.
Jeder, der früher in Baiern schreiben und lesen lernte, machte irgendwann mit dem Lex Baiuvariorum Bekanntschaft. Dieses Gesetzbuch haben die Franken den Baiern »geschenkt«, damit für ewige Zeiten schwarz auf weiß festgehalten werde, was hierzulande Brauch und Sitte ist. Ehe Baiern ein Vasallenstaat der Franken wurde, ging es freilich auch ohne das geschriebene Gesetz, dem anzumerken ist, daß es unter fränkischer Aufsicht entstand. Ein inzwischen getilgter Passus in diesem Gesetzbuch lautete:
»Der Herzog aber, der dem Volk vorsteht, war seit je aus dem Geschlecht der Agilolfinger und soll es weiterhin sein. Denn so haben es unsere Vorfahren, die Könige, jenen zugestanden, daß sie zum Herzog einsetzten, wer klug und treu zum König hielt.«
Gemeint ist natürlich jeweils der fränkische König. Wenn dieser Passus unter Odilo noch galt, für seinen Sohn Tassilo galt er nicht mehr. Er war dem Frankenkönig nicht treu und wohl auch nicht klug genug. Mein Vater war, ich sage es noch deutlicher, unter dem großen Karl einfach überflüssig geworden, ebenso wie die Herrscher der Langobarden, Sachsen und Awaren. Wenn es um große Staatsangelegenheiten ging, dann spielten bei Karl auch verwandtschaftliche Bande keine Rolle mehr. Immerhin hatten sie gemeinsame Großeltern und nannten sich Vettern. Übrigens habe ich es dem König zu verdanken, daß ich die Geschichte meiner väterlichen Vorfahren wenigstens in großen Zügen kenne. Als mein Vater mit Frau und Kindern hinter Klostermauern verschwunden war, bat ich König Karl um Einsicht in die im Herzogspalast zu Ratisbona aufbewahrten Urkunden. Er gewährte mir die Bitte unter der Bedingung, ich müsse dann auch die Geschichte meines Volkes schreiben, wie es Paulus Diaconus, der Langobarde, damals tat. Und er setzte noch hinzu. »Du darfst an dich nehmen, was für deine Arbeit von Nutzen ist.«
Ich gab eine ausweichende Antwort, doch dachte ich nicht daran, die Geschichte der Baiern zu schreiben, denn ich war noch jung und hatte andere Pläne. Die in Ratisbona vorhandenen Urkunden hätten dazu vermutlich auch nicht ausgereicht. So viel nämlich am Hof des großen Karl von Dutzenden von Sekretären, Schreibern und Kopisten nahezu Tag und Nacht niedergeschrieben wurde, so wenig scheinen meine Vorfahren die Schreibkunst geschätzt zu haben. Mit anderen Worten: Ich fand nichts von Belang. Hochachtung erfüllte mich vor diesen Ahnen, die ihr Leben nicht in Papier verwandelten, denen das gesprochene Wort genügte. So kann ich in wenige Sätze fassen, was meine Vorfahren, Baierns Herzöge, betrifft.
Vor etwa zweihundertfünfzig Jahren begann die Geschichte unseres Herzoghauses mit einem Garibald, der nicht einmal aus Baiern stammte, sondern Franke oder Burgunder war. Er heiratete die fränkische Königswitwe Waldrada und regierte mit ihr ein Land, das schon Jahrzehnte zuvor von den Franken erobert worden war. Es scheint, daß Garibald sich allmählich als Baier fühlte und mit den Franken nichts mehr zu tun haben wollte. Er mußte mehrmals außer Landes fliehen, scheint sich aber mit seinen Lehnsherrn doch immer wieder vertragen zu haben. Um gegen die Franken Verbündete zu gewinnen, verheiratete Garibald seine Tochter Theodelinde mit dem Langobardenkönig Authari, dem diese Verbindung sehr willkommen war; denn auch er lag mit den Franken im Streit.
Was ich jetzt erzählen werde, stammt nicht aus dem Archiv von Ratisbona, sondern aus dem Mund meiner Mutter. Diese Geschichte war damals allen Baiern so vertraut, daß wohl viele Mütter sie an ihre Kinder weitergegeben haben. Ob sie aber der geschichtlichen Wahrheit entspricht, weiß ich nicht.
König Authari sandte als Brautwerber einen würdigen alten Hofmann und ging selber inkognito als junger, einfach gekleideter Begleiter mit. Nachdem die Werbung vorgetragen war und Garibald zugestimmt hatte, sagte Authari, er solle sich für seinen König die Braut ansehen, ob sie körperlich ohne Fehl und Tadel sei. Garibald rief seine Tochter und der junge Mann zeigte sich sehr zufrieden. Er wandte sich an den Herzog, lobte Schönheit und Anmut des Mädchens und fragte:
»Könnte deine Tochter uns etwas zu trinken geben?«
Theodelinde holte einen Pokal mit Wein, gab zuerst ihren Eltern und dem Brautwerber zu trinken und reichte den Pokal dann ihrem zukünftigen Mann, den hier am Hof niemand erkannte.
Authari trank, gab den Pokal zurück und tätschelte dabei Theodelindes Wange, doch so, daß es niemand bemerkte. Die Prinzessin berichtete später ihrer Erzieherin von der Frechheit des jungen Mannes. Diese aber meinte:
»Das hätte bei Gott keiner wagen dürfen, es sei denn, er wäre dein künftiger Gemahl. Ich kann’s mir nicht anders erklären – es muß Authari selber gewesen sein.«
Als die Langobarden von den Baiern bis zur Grenze ein Ehrengeleit erhielten, drängte der Fürstenstolz den Authari, sich nun doch erkennen zu geben. Er zog seine Streitaxt und hieb sie in den nächsten Baum, so daß niemand imstande war, sie herauszuziehen. »Solche Hiebe führt König Authari!« sagte der Langobardenfürst und blickte stolz in die Runde. Ich hoffe, die Baiern werden seine Kraftprobe angemessen bewundert haben. Schon nach über einem Jahr starb der starke Authari an Gift, doch man fand keinen Schuldigen. Die schöne Theodelinde war nun Witwe, aber sie hatte sich bei ihrem Volk so beliebt gemacht, daß man ihr vorschlug: »Heirate, wen du willst und wir werden ihn als unseren König anerkennen.«
Sie wählte den Thüringerherzog Agilulf.
Doch zurück zu den Baiern und meinem Urahn Garibald. Der ewige Streit mit den Franken nahm kein Ende, und nach dreißigjähriger Regierung verlor der Frankenkönig Childebert die Geduld mit seinem bairischen Vasallen. Garibald verschwand, und niemand weiß bis heute, wohin. Steckten die Franken ihre Gegner schon damals in Klöster? Ich glaube eher, daß Garibald in aller Stille umgebracht wurde. Auch seine übrige Familie ging im Dunkel der Geschichte unter. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, im fränkischen Reichsarchiv nachzuforschen, doch es war nichts herauszufinden. König Childebert setzte im Jahre 591 Tassilo, einen entfernten Verwandten Garibalds, als Herzog in Baiern ein, der aber schon bald in einem seiner Kriegszüge gegen die Slawen fiel. Nicht viel besser erging es seinem Sohn und Nachfolger Garibald II., der auch häufig seine Grenzen gegen Slawen und Awaren verteidigen mußte. Seine Abhängigkeit von den Franken trieb ihn später zu einer Tat, die sich heute nur schwer erklären läßt. Damals führten die Bulgaren mit den Awaren Krieg um Pannonien. Die Awaren siegten und machten etwa neuntausend Gefangene. Das waren nicht nur Krieger, sondern auch alte Menschen, Frauen und Kinder, die man aus ihren Dörfern vertrieben hatte. Diese Menschen wurden, vermutlich auf Betreiben der Franken, nach Baiern gebracht und sollten dort noch vor Winterbeginn in den umliegenden Dörfern untergebracht werden. Plötzlich überlegte es sich der Frankenkönig anders und erteilte den Befehl, die Bulgaren allesamt umzubringen. Garibald gehorchte und in einer schrecklichen Mordnacht wurden diese Menschen abgeschlachtet wie Vieh. Siebenhundert konnten entkommen und flohen in die windische Mark. Ich bin kein Geschichtsschreiber und will nun nicht versuchen, dafür eine Erklärung zu finden. Geschichte wurde und wird mit Blut geschrieben, und es ist müßig, nach Schuld zu forschen. Diese Bluttat des Jahres 631 überlebte Garibald noch um dreißig Jahre und es scheint, daß er den Franken ein gehorsamer Vasall war, da aus seiner Regierungszeit nichts weiter zu berichten ist.
Ihm folgte sein Sohn Theodo, von dem wir etwas mehr wissen, weil Bischof Arbeo von Freising ihn in seiner Vita et passio Sancti Emmerami Martyris erwähnt. Dieses Buch gehörte zu den bevorzugten Lesestoffen unserer Lehrer in Altach. Es erzählt die Leidensgeschichte des Missionars und Predigers Emmeram und einige meiner Vorfahren spielen darin eine unrühmliche Rolle. Solch alten Geschichten gegenüber bin ich etwas mißtrauisch, denn Emmeram starb vor fast zweihundert Jahren und Arbeo kann seinen Bericht auch nur aus zweiter oder dritter Hand haben. Er spiegelt auf lehrreiche Weise die Gefahren wider, denen christliche Prediger damals noch ausgesetzt waren. Es ist ein frommes Märchen, zu behaupten, die Baiern seien unter Herzog Theodo alle schon christianisiert gewesen. Schreibt nicht Arbeo in einer seiner Erbauungsschriften, daß der aus dem Rheinland kommende Predigermönch Rupertus in Ratisbona von Herzog Theodo zwar freundlich aufgenommen wurde, während der übrige bairische Adel dem Gottesmann mit finsterer Miene begegnete. Da wird man sich fragen müssen: War denn nur der Herzog Christ, während das übrige Land im Heidentum verharrte? Oder mochten die Adeligen es nur nicht, daß am Hof zu Ratisbona dauernd Pfaffen aus- und eingingen? Als ich diese Fragen an Herrn Urolf, den ehrwürdigen Abt von Altach richtete, schüttelte er unwillig sein Gelehrtenhaupt.
»Aber Gerold, warum mußt du immer gleich das Schlimmste denken? Nach allem, was wir wissen, waren unsere Vorfahren schon unter Herzog Theodo gläubige Christen. Doch die meisten hingen noch dem arianischen Irrglauben an, während der Herzog sich schon zur einzig wahren Lehre bekannte. Daher also die finsteren Mienen, als Rupertus erschien.«
Freilich, so mag es gewesen sein. Doch wenn ich mich an die Geschichten meiner Mutter erinnere, die – obwohl Christin – mir während meiner Kindheit von wilden Männern und Frauen, von Zwergen, Kobolden, Elfen, Nixen, Wassermännern, Kornweibern und Perchten erzählte und fest an diese Feld-, Wald- und Wassergeister glaubte, dann scheint es mir doch möglich, daß das Volk vor zweihundert Jahren noch nicht sehr fest im christlichen Glauben stand.
Kapitel 5
Als ich vor einigen Tagen dabei war, die Geschichte des Märtyrers Emmeram zu erzählen, verging mir plötzlich die Lust, weiterzuschreiben. Daran ist freilich nicht dieser verdienstvolle Heilige schuld, sondern mir taten vom langen Sitzen alle Glieder weh, mein Auge schmerzte und die Finger verkrampften sich vom langen Schreiben. Zwar besitze ich noch beide Augen, doch eines ist inzwischen fast blind geworden, woran vermutlich der Hieb schuld ist, den mir ein Sachse mit seiner Streitaxt auf den Kopf versetzte. An der linken Hand fehlen mir drei Finger, welche die sächsische Erde am Süntelgebirge düngen. Dort erhielt ich auch die tiefe Stichwunde am rechten Schenkel, die damals nur schwer verheilte und an der ich gestorben wäre, hätte die sächsische Priesterin Wala mich nicht gerettet. Seit dieser Zeit hinke ich leicht, doch im Alter scheint es sich wieder zu verschlimmern.
Ja, ich verdanke den Sachsen viel – im Guten, wie im Bösen. König Karl hat das Wunder vollbracht, auch diesen deutschen Stamm seinem Reich einzugliedern und so starrköpfig dieses Volk damals am alten Glauben hing, so eifrig erweist es sich jetzt im Christentum.
Als ich vor vier Tagen lustlos die Feder weglegte, kam mich das Bedürfnis an, meinem alten Körper Bewegung zu verschaffen, denn wie die Sachsen zu sagen pflegten: Ein Schwert, das rastet, rostet. Lange genug ließen sie ihre Schwerter weder rasten noch rosten, doch es hat ihnen kein Glück gebracht. Davon wird noch viel zu berichten sein. Ich sagte, ich legte die Feder weg, doch das stimmt nicht; denn an jenem Morgen nahm ich sie gar nicht auf. Die Tage zuvor hatte der Ostermonat sich noch mit heftigen Regengüssen ausgetobt, doch an diesem Morgen schien endlich die Sonne von einem blankgewaschenen Himmel, und mir verging augenblicklich die Lust aufs Schreiben. Ich ging in den Stall, und schon wieherte sie mir leise entgegen, meine brave Rappenstute. Die alte Freya trägt nun schon seit über zehn Jahren meinen immer schwerer und ungelenker werdenden Körper, doch wir haben uns aneinander gewöhnt. Sie rieb ihren Kopf an meiner Schulter und blickte mich recht wach und munter mit ihren dunklen Augen an. Ich denke, auch sie spürte den Frühling und hätte sich heute etwas Besseres gewünscht, als im feuchten Stall herumzustehen.
»Nun, mein altes Mädchen«, sprach ich sie an, »ich glaube, du möchtest hinaus in die Sonne? Da sind wir heute einer Meinung …«
Ich rief Poppo, meinen alten Stallknecht und befahl ihm, Freya im Hof ein wenig herumzuführen und sie dann zu satteln.
»Du reitest aus, Herr?« Der alte Mann blickte mich sorgenvoll an. Er ist um die fünfundsiebzig und hat mich schon als kleines Kind gekannt.
»Ja, ich reite aus, sonst vermodere ich noch in meiner Schreibstube. Möchtest du mich begleiten?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, Herr. Nimm dir lieber einen jungen Knecht mit, der dir auch helfen kann, wenn … ich meine, wenn etwas wäre.«
»Ja, Poppo, alt sind wir beide geworden, alt und klapprig. Da zählt man nicht mehr die Jahre und Monate, nur noch die Tage …«
Ich ging ins Haus, zog meinen verschlissenen Lederwams und feste Schuhe an und ließ einen Krug meines besten Hausweines – es ist der des Jahres 823 – heraufholen. Den schätzt mein Freund Arbo noch am ehesten, denn sonst mag er nur die italischen Weine. Ihn nämlich wollte ich heute besuchen, drüben in Osterhofen, wo er seit über einem Jahrzehnt als Judex und Pfalzgraf im Amt ist. Die unter meinen Vorfahren noch gelegentlich benutzte herzogliche Pfalz Osterhofen ist, seit sie königlich wurde, so gut wie vergessen. Arbo, der schlaue Fuchs, tut alles, damit das auch so bleibt. Wir beide sind Jugendfreunde, hatten uns aber seit der Klosterschule aus den Augen verloren. Als ich dann vor Jahren dem neuen Amtmann – der ja eigentlich mein Vorgesetzter ist – einen Höflichkeitsbesuch abstattete, spielte sich das Folgende ab.
»Gott zum Gruße, gnädiger Herr. Ich heiße Gerold und bewirtschafte ein Hofgut drei Reitstunden von hier, das seine Gnaden, unser seliger König und Kaiser Karl mir für treue Dienste persönlich übereignet hat.«
Daß der Hof schon ein Geschenk meines Vaters war, dessen Besitz der König mir nur bestätigte, erwähnte ich nicht. Ich entrollte die Urkunde und legte sie auf den Tisch. Der neue Amtmann setzte sich an den Tisch, um die Urkunde zu prüfen. Sein Kopf war fast kahl, sein Gesicht gebräunt und mit mehreren kleinen und großen Narben bedeckt. Doch sie entstellten ihn nicht, sondern verliehen ihm einen verwegenen Gesichtsausdruck.
Ich dachte, der sieht aus wie ein altgedienter Krieger, den man mit einer guten Pfründe belohnt hat. Mir war dieser Arbo gleich so vertraut, als kenne ich ihn schon seit langem. Er blickte auf. Seine schiefergrauen Augen sahen mich wachsam und mißtrauisch an.
»So, für treue Dienste persönlich verliehen? Worin bestanden deine Dienste für den seligen König? Stallknecht? Hundeführer? Leibjäger?« Breitbeinig stand er da, lächelte spöttisch und wollte mich offenbar reizen.
»Ja«, sagte ich, »von allem etwas. Auch Sekretär, Dolmetscher, Königsbote. Ich hatte sehr viel persönlichen Umgang mit dem seligen König.«
Arbo grinste noch immer, doch der Spott war verschwunden. »Viel Umgang, so so. Wie ein Graf oder Bischof oder gar ein Kanzler? Euer Vater hieß Tassilo, steht hier. Mit den Agilolfingern verwandt?«
Jetzt war es an mir, höhnisch zu grinsen.
»Verwandt? Ich bin ein Agilolfinger! Mein Vater war der letzte Herzog von Baiern.«
In Arbos narbenbedecktem Gesicht begann es zu arbeiten. Sein Grinsen zersplitterte, die Stirn furchte sich im intensiven Nachdenken.
»Gerold, Sohn des Tassilo, warst du unter Abt Wolfbert Schüler im Kloster Altach?«
»Ja …«, sagte ich verwirrt und wußte im nächsten Augenblick, daß ich den Mann kannte. Arbo war aufgestanden, und ich legte ihm meine Hände auf die Schultern.
»Arbo Fagana, auch wenn es ein halbes Jahrhundert her ist – wer könnte dich vergessen?«
Da zog es wie Sonnenschein über das gegerbte und zerfurchte Gesicht, die grauen Augen strahlten. Er erstickte mich fast unter einer langen und heftigen Umarmung.
»Gerold, der Tassilokegel! Ich habe manchmal an dich gedacht und war überzeugt, daß man dich auch zwangsweise zum Mönch gemacht hätte, wie deinen armen Vater. Da siehst du, daß eine Geburt außerhalb der Ehe auch ihr Gutes haben kann. Mein Gott, habe ich dir viel zu erzählen!«
Ja, da hatte er wohl recht und wir sind bis heute damit nicht fertig geworden.
Wer Arbo nicht gut kennt, wird schwerlich aus ihm klug werden. Dieser Mann besteht aus Widersprüchen, mit denen er schon als Junge seine Umwelt vor den Kopf gestoßen hatte. Von Arbo wird im Laufe dieses Berichts noch öfter die Rede sein. Mein Gut liegt im Hügelland am Rande des Nordwaldes hoch über der Donau, nicht weit von Strupinga entfernt und grenzt an die weitverstreuten Ländereien des Klosters Metema. Reitet man von hier nach Osterhofen, so muß die Donau überquert werden und man kann dies sowohl bei Metema wie auch bei Altach tun; denn beide Klöster unterhalten Fährleute. Benützt man die Fähre bei Metema, so hat es den Nachteil, daß wenig später auch noch die Isar zu passieren ist, und zwar bei dem kleinen Dorf Pledeling. Das läßt sich leicht vermeiden, setzt man bei Altach über, doch das hat für mich den Nachteil, daß meistens einer der Mönche mich erkennt und auf einen Trunk ins Kloster einlädt. Dies wiederum bedeutet, daß Abt Gozbald von meinem Besuch in Kenntnis gesetzt wird, und mit ihm habe ich eines gemeinsam: die Neugierde. Der hochwürdige Herr Abt weiß über mich genau Bescheid. Er weiß, wessen Sohn ich bin, daß ich hier Schüler war und vor allem weiß er, daß ich mich einst zum engeren Freundeskreis des seligen Kaisers zählen durfte. So hagelt es dann Fragen über Fragen, dem Trunk folgt ein Imbiß, dem Imbiß eine Einladung zum Nachtmahl, und dann heißt es: »Gerold, Ihr seid in einem Alter, daß Euch der Heimritt bei Nacht und Nebel nicht mehr zuzumuten ist.« Ich schlafe dann im Kloster und der Tag ist vertan. Ich aber muß haushalten mit meinen Tagen. Solchen Verpflichtungen wollte ich heute entgehen, und so nahm ich den Weg über Metema und Pledeling.
Jeder weiß, daß die Donau auch bei Hochwasser ein ruhiger Fluß ist, während die Isar dann schäumt und strudelt, daß einem der Entschluß schwer fällt, das Übersetzen zu wagen. Zum Glück ist inzwischen der halbtaube und schon ziemlich schwache Fährmann durch einen jungen und kräftigen abgelöst worden, so daß wir schnell und zügig hinüberkamen. Die alte Freya schätzt solche Bootsfahrten gar nicht und besteigt keine Fähre, ohne sich zu sträuben und empört zu wiehern. Sie gibt dann doch nach, weil sie weiß, daß es nichts nützt, doch ich spüre deutlich, daß sie jedesmal über diese Zumutung beleidigt ist. Von da an sind es nur noch ein paar Meilen über flaches Land zur königlichen Pfalz Osterhofen.