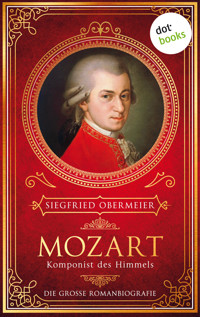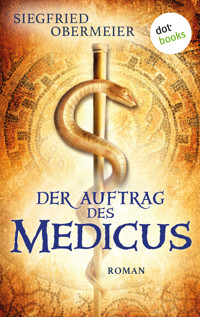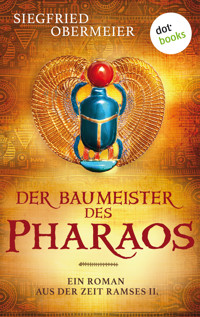6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Als Spanien die Welt eroberte: Das historische Epos »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert« von Siegfried Obermeier jetzt als eBook bei dotbooks. Das ausgehende 15. Jahrhundert. Während sich in Italien die Borgias in blutigen Machtkämpfen zerfleischen, schwingt sich in Spanien eine neue Macht zu voller Größe auf: In jungen Jahren zur Herrscherin aufgestiegen, vereint die eiskalt kalkulierende Isabella von Kastilien durch geschicktes Taktieren bald die größten Königreiche der Iberischen Halbinsel. Die glühende Katholikin hat nur ein Ziel: Den Einfluss der spanischen Krone zu vergrößern, koste es, was es wolle. Da ersucht sie der aufstrebende Seefahrer Columbus um ihre Unterstützung für sein visionäres wie wahnwitziges Vorhaben – die Eroberung Indiens über den Seeweg nach Westen. Isabella wittert ihre Chance auf unsterblichen Ruhm … denn so kann Spanien endgültig zur größten Macht der Welt aufsteigen! Opulent, fesselnd und farbenprächtig erzählt Siegfried Obermeier von einer Zeit, in der das unbarmherzige Streben großer Persönlichkeiten die Geschicke der gesamten Welt bestimmte – und in der einfache Menschen den Preis dafür bezahlten: »Ein lebendiges und kulturgeschichtlich interessantes Zeitbild.« Observer Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der mitreißende historische Roman »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert« von Siegfried Obermeier ist ein Lesevergnügen für alle Fans von Robert Fabbri und Hilary Mantel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1073
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das ausgehende 15. Jahrhundert. Während sich in Italien die Borgias in blutigen Machtkämpfen zerfleischen, schwingt sich in Spanien eine neue Macht zu voller Größe auf: In jungen Jahren zur Herrscherin aufgestiegen, vereint die eiskalt kalkulierende Isabella von Kastilien durch geschicktes Taktieren bald die größten Königreiche der Iberischen Halbinsel. Die glühende Katholikin hat nur ein Ziel: Den Einfluss der spanischen Krone zu vergrößern, koste es, was es wolle. Da ersucht sie der aufstrebende Seefahrer Columbus um ihre Unterstützung für sein visionäres wie wahnwitziges Vorhaben – die Eroberung Indiens über den Seeweg nach Westen. Isabella wittert ihre Chance auf unsterblichen Ruhm … denn so kann Spanien endgültig zur größten Macht der Welt aufsteigen!
Opulent, fesselnd und farbenprächtig erzählt Siegfried Obermeier von einer Zeit, in der das unbarmherzige Streben großer Persönlichkeiten die Geschicke der gesamten Welt bestimmte – und in der einfache Menschen den Preis dafür bezahlten: »Ein lebendiges und kulturgeschichtlich interessantes Zeitbild.« Observer
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Die freien Söhne Roms«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba« und »Das Spiel der Kurtisanen« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Dieses Buch erschien bereits 1992 unter dem Titel »Torquemada« bei edition meyster / nymphenburger.
Copyright © der Originalausgabe 1992 by edition meyster / nymphenburger in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Diego Velázques
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-713-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Blut und Gloria« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Blut und GloriaDas spanische Jahrhundert
Historischer Roman
dotbooks.
Prolog
Der Traum des Columbus
»Dies wird unsäglich viel Mühe kosten.«Aus dem Bordbuch des Columbus.
Er stand neben dem Steuermann, als die ›Roxana‹ durch die Meerenge von Messina kreuzte.
»Scylla und Charybdis scheinen heute friedlich«, murmelte er, und blickte nach Süden, wo sich die hellen Häuserkuben der uralten Stadt am Ufer drängten.
»Habt Ihr etwas gesagt, Messer Colombo?«
»Das war nicht für Euch bestimmt, timoniero, ich habe nur laut gedacht.«
Das breite, braune, stoppelbärtige Gesicht des Steuermanns blieb unbewegt, nur in den schmalen dunklen Augen blitzte es spöttisch. Ohne den Blick zu wenden, sagte er: »Ich glaubte, irgendwelche Namen zu hören, Messer Colombo.«
»Ich dachte an die Odyssee des Homer.«
»Aha!«
Breitbeinig stand der Seemann vor seinem Steuerruder und gab nicht zu erkennen, ob er von Homer und seiner Dichtung etwas wußte. Columbus setzte sich auf eine feuchte Taurolle im Schatten des Großsegels und schaute nach Süden auf die weite Fläche des Ionischen Meeres, das die Nachmittagssonne mit gleißenden Goldflecken übersprühte.
Die ›Roxana‹ fuhr im Auftrag der Großreederei Spinola zur Insel Chios, dem einzigen größeren Handelsplatz, der nach dem Fall von Konstantinopel den Christen geblieben war.
»Messer Colombo! Messer Colombo!«
Der Kapitän berührte ihn am Arm.
»Seid Ihr eingeschlafen?«
Wie immer, wenn es um persönliche Dinge ging, verschloß sich das Gesicht des jungen Genuesen.
»Kann sein. Was gibt’s?«
»Kommt hinüber nach Steuerbord, da werde ich Euch etwas zeigen.«
Columbus zögerte, er haßte es, gegen seinen Willen herumdirigiert zu werden. Der Kapitän grinste.
»Nun kommt schon, Signorino, Ihr seid doch ein neugieriger Mensch.«
Ja, das war er schon, der zwanzigjährige Genuese, der im Auftrag seines Vaters, des Tuchwebers Domenico Colombo, Waren nach Chios begleitete. Seine Neugierde galt nicht den Menschen, sie war in die Ferne gerichtet, auf Unbekanntes, Neues, Unentdecktes, und so gehörte es zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, Land- und Seekarten zu studieren und seinen Geist in ferne Länder schweifen zu lassen. Bis jetzt hatte er die Gestade des Mittelmeeres noch nie verlassen, war auf kleinen Seglern vor der ligurischen Küste herumgekreuzt, Handel treibend, kleines Geld verdienend, um die Familie zu unterstützen. Ja, er hatte die Tuchweberei erlernt, auf Wunsch des Herrn Vaters, aber daß er nicht als Handwerker sein Leben beschließen wollte, wußte schon der zwölfjährige Klosterschüler, als er mit offenem Mund auf die Weltkarte des Ptolemäus starrte, die der Pater an die Wand geheftet hatte. Noch jetzt, zehn Jahre danach, hatte er Wort für Wort der Ausführungen des Geographielehrers behalten, der mit dem Zeigestock auf der Karte herumfuhr.
»Diese senkrecht verlaufenden Linien, discipuli, nennt man die Meridiane, und ihre Abstände zueinander sind in Grade eingeteilt. Die waagrecht angesetzten Breitengrade verlaufen parallel zum Äquator, und mit ihm endet die uns bekannte Welt.«
Der Zeigestock fuhr zurück.
»Wandern wir jetzt einmal von Nord nach Süd. Ganz oben sehen wir Thule, die nördlichste Insel unserer Welt, dann die kalten skandinavischen Länder, im äußersten Westen liegt Britannien, weiter südlich die Iberische Halbinsel, daneben Gallien und die germanischen Länder, hier unser italischer Stiefel, darunter Sizilien, im Osten Hellas, Kleinasien, dann das Land der Skythen, noch weiter östlich das gewaltige Indien mit den Flüssen Indus und Ganges, daneben Kathai, von dem Ptolemäus noch nichts wußte und das der Venezianer Marco Polo angeblich vor zweihundert Jahren bereist hat. Aber das ist lange her, und jeder weiß, daß die Venezianer gerne flunkern.«
Ein dankbares Lachen belohnte den Spott über den alten, gehaßten, gefürchteten, beneideten Gegner, die See- und Handelsrepublik Venedig, seit Jahrhunderten von Genua mit Argwohn betrachteter Konkurrent.
Der Kapitän faßte ihn am Arm und wies nach Südwesten.
»Seht Ihr ihn qualmen, den alten Ätna? Von Zeit zu Zeit wird er munterer und spuckt feurigen Schleim aus. Aber das ist lange her, und niemand weiß, ob er morgen wieder ausbricht oder erst in fünfzig Jahren.«
»Werden wir noch näher herankommen?«
»Leider nicht, Signorino, weil wir jetzt den Kurs nach Osten nehmen. Oder möchtet Ihr bei den Mamelucken landen anstatt auf Chios? Die sind ganz scharf auf christliche Sklaven, das werdet Ihr ja wissen.«
Columbus wandte sich mit einem kurzen Dank ab. Er hatte keine Lust auf ein weiteres Gespräch, und die Mamelucken scherten ihn wenig. Auch Chios erregte kaum seine Neugierde, denn er hatte diese kleinen Geschäfte längst satt, und das Mittelmeer erschien ihm wie ein Käfig, auch wenn dieser Teil jetzt das Ionische hieß. Er wollte heraus aus dieser Enge, doch er wußte nicht wie. Neuland betreten oder zumindest an die Grenzen jener Landkarte gelangen, die der Pater Geographielehrer vor seinen Schülern entfaltete.
Columbus ließ sich wieder auf die feuchte Taurolle fallen. Ja, sie hatten über Marco Polo gelacht, die ganze Klasse, er natürlich auch, aber so ganz wohl war ihm nicht dabei. Und wenn nun doch alles stimmte? Wenn Polo tatsächlich jene fernen Länder bereist hatte, Gefahr und Tod nicht achtend, dann gebührte ihm aller Respekt, dann mußte man ihn doch eher als Vorbild sehen? Aber der Pater war noch nicht am Ende, er war bei guter Laune und setzte noch eines drauf: »Übrigens hat dieser Polo es Genua zu verdanken, daß er seine Erlebnisse – ob wahr oder nicht – überhaupt zu Papier bringen konnte. Weiß einer etwas darüber?«
Die Klasse gebärdete sich ganz aufgeregt, denn solange der Pater nicht zu seinem Stoff zurückkehrte, konnte er nicht abfragen, blieb die Rute hinter dem Katheder. Keiner schien etwas zu wissen, und wer die Geschichte dennoch kannte, verschwieg es lieber, um den Lehrer nicht abzulenken.
»Erzählt es uns, verehrter Magister, bitte erzählt weiter!«
Der Pater schmunzelte und nahm den Faden wieder auf.
»Also gut, schließlich ist das auch so etwas wie ein Lehrstoff. Ein Viertel Saeculum, also rund fünfundzwanzig Jahre, soll Marco Polo auf Reisen verbracht haben, anfangs zusammen mit seinem Vater und einem Onkel. Zuletzt soll er sogar beim Kaiser von Kathai ein hohes Amt versehen haben. Nach seiner Rückkehr entbrannte ein Krieg zwischen Genua und Venedig, das heißt, ein alter Zwist wurde fortgesetzt, der begonnen hatte, als Byzanz unserer Republik eine weitaus größere Handelsfreiheit einräumte, als Venedig sie je besessen hatte. Die Gründe könnt ihr von eurem Geschichtslehrer erfahren. Nun gut, Venedig zog wieder einmal den kürzeren, und Polo, der ein Kriegsschiff kommandierte, geriet in Gefangenschaft. Ja, discipuli, er saß hier in unserer Stadt in einem Kerker, vier Jahre lang, zusammen mit einem fahrenden Sänger. Da es den Herren langweilig wurde, erzählte Marco Polo von seinen Reisen, und der schreibgewandte Poet zeichnete alles auf. Was er an eigenem hinzufügte, steht auf einem anderen Blatt. Nun, unser Abenteurer kam frei, und sein Buch wurde gedruckt. Und wie hieß es? Na? Es hieß: ›Il Milione‹. Wie ist das zu verstehen, discipuli?«
Pietro, der Sohn eines reichen Bäckers, gab mit seiner schnellen gewandten Zunge die Antwort.
»Das soll heißen: Millionen von Lügen!«
Der Pater schmunzelte gnädig: »Wie immer eine gute Antwort, Pietro. Ja, Cristoforo?«
»Ich glaube, Marco Polo hat damit sagen wollen, daß er dem Leser Millionen Abenteuer erzählen will. Und wenn manche davon übertrieben oder erfunden sind, so ist gewiß jener Dichter und Sänger daran schuld.«
Er hatte dies mit trotzigem Ernst hervorgebracht, der den Pater erheiterte.
»Es ist das Vorrecht der Jugend, für Abenteurer eine Lanze zu brechen. Marco Polo ist tot, und wir werden die ganze Wahrheit niemals erfahren.«
»Aber das Land Kathai existiert doch?«
Der Pater nickte.
»Ihr könnt seine Erzeugnisse sogar hier in Genua finden – vor allem Seide und Porzellan.«
»Dann kann Polo auch dort gewesen sein.«
»Sei nicht so störrisch, Cristoforo. Aber jetzt raus mit euch in die Pause!«
Cristoforo wartete, bis die anderen draußen waren. Der Pater war gerade dabei, die Weltkarte einzurollen, da meldete er sich noch einmal.
»Pater Magister, ich hätte noch eine Frage.«
Den Pater verlangte es seit gut einer Stunde nach einem Glas Wein. Doch er war ein zu gewissenhafter Pädagoge, um der Frage eines Schülers auszuweichen. So seufzte er nur leise.
»Also Cristoforo, was gibt es noch?«
Der stand auf, trat vor die Karte und deutete auf Afrika.
»Hier, unterhalb der Nilquellen ist das Land einfach abgeschnitten, ebenso der Indische Ozean. Aber die Erde ist doch rund, Pater, nicht wahr, daran zweifelt doch heute niemand mehr?«
Der Pater nickte.
»So ist es, mein Junge.«
»Aber, wenn sie rund ist, muß es doch weitergehen mit Land und Meer, mit Afrika und dem Ozean. Was kommt danach?«
Der Pater setzte sich. In diesem Zwölfjährigen steckte doch mehr, als bei seinem sonst eher verschlossenen Wesen zu erwarten war.
»Also gut, Cristoforo, ich sage dir, was ich darüber weiß, aber ich mache es kurz.«
Der Pater dachte an das Glas Wein.
»Vor einigen Monaten ist Dom Henrique in Sagres gestorben, ein portugiesischer Prinz, der zeitlebens nur ein Ziel hatte: Er wollte wissen, wie es auf der Landkarte weiterging, genauso wie du. So rüstete er Schiffe aus und sandte sie nach Afrika, damit sie dort die Westküste nach Süden erkunden sollten, immer weiter, immer weiter. Er war nie zufrieden, genau wie du. Und so entdeckten seine Seeleute eine Reihe von Inseln, und wenn sie zurück waren, schickte er sie von neuem auf die Reise. Seine Kapitäne wandten ein, daß der Ozean in der Nähe des Äquators zu kochen beginne, daß gewaltige Seeungeheuer ein Durchkommen unmöglich machten, doch nichts davon geschah. Prinz Heinrich hatte nämlich den Ehrgeiz, seine Schiffe auf dem Weg über Afrika nach Osten, nach Indien zu schicken, weil das für den Handel seines Landes von großem Vorteil gewesen wäre. Als der Prinz vor kurzem starb, sagt man, er habe keinen roten Heller hinterlassen. Seine Erkundungsfahrten wurden eingestellt, und so kann ich dir leider noch immer nicht die Frage beantworten, wie es auf der Karte weitergeht. Dem Prinzen Heinrich aber hat man den ehrenvollen Titel El Navegador verliehen – der Seefahrer.«
Die Augen des Jungen leuchteten, sein Gesicht hatte sich vor Aufregung gerötet.
»War er – hat der Prinz an diesen Fahrten teilgenommen?«
Der Pater schüttelte den Kopf.
»Niemals, soviel ich weiß. Er hat zwar in Sagres eine Sternwarte und eine nautische Schule errichtet, hat alles Geld in seine Pläne gesteckt, aber als Seemann war er nur Theoretiker.«
»Ich an seiner Stelle wäre mitgefahren, immer wieder, so lange, bis man weiß, wie es hier weitergeht.«
Der Zwölfjährige fuhr mit seiner schmalen Bubenhand über die Fläche unterhalb der Karte, zaghaft, fast zärtlich, als wolle er es streicheln, dieses unbekannte Land, das es noch zu entdecken galt.
Energisch rollte der Pater die Karte zusammen.
»Ich glaub’s dir ja, mein Junge. Dann wirst du als Cristoforo il Scopritore in die Geschichte eingehen.«
Er lachte gutmütig, der Pater Georgraphielehrer, und dachte, das ist ein Vorrecht der Jugend, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, Phantasieschlösser zu bauen, sich in heroische Rollen hineinzuträumen, als Feldherr, als berühmter Gelehrter, als großer Entdecker.
»Warum nicht?« sagte Cristoforo Colombo, der Tuchmachersohn leise und fest. »Warum nicht!«
Mit Respekt und Bewunderung beobachtete Columbus den Steuermann, der ohne jedes Hilfsgerät, nur aufgrund seiner Erfahrung und seines Gespürs für Winde und Meeresströmungen seinen Kurs beibehielt und exakt im Hafen von Chios landete.
Per Dio, hier ging es ja fast so lebhaft zu wie im Hafen von Genua, nur alles war von kleinerer Dimension: Die Häuser, das Hafenbecken, die Lagerhallen, die Läden. Ein Gewirr von Sprachen schallte und hallte über Plätze, Straßen und Gassen, doch das Italienische herrschte vor. Und drüben, im Osten, nur wenige Seemeilen entfernt, erhoben sich die dunklen Berge der Halbinsel Karaburnu, schon ein Teil des Osmanischen Reichs, drohend, eine stetige Erinnerung an das Damoklesschwert, das über Chios schwebte, seit die Türken vor zwanzig Jahren das alte Byzanz erobert hatten und das tausendjährige christliche Reich Konstantins fest in ihren heidnischen Klauen hielten. Nun, sie waren tolerant, die Muslime, ließen den Christen ihren Glauben, ihre Kirchen und Klöster, aber sie wurden scharf besteuert, die Ungläubigen. Wer sich zum Propheten bekannte, erhielt eine Reihe von Vergünstigungen, aber nur wenige machten davon Gebrauch.
Columbus meldete sich beim Kontor der Familie Giustiniani, einer Genueser Sippe, die das Monopol auf den Mastixhandel besaß und faktisch die Herren der Insel waren. Er lieferte seine Waren ab, die Tuchballen wurden betrachtet, befühlt, gewogen und registriert, aber die gebotenen Preise waren so mäßig, daß Columbus protestierte. Ein etwa gleichaltriger junger Mann zog ihn hastig in einen Nebenraum.
»Kommt mit, Messer Cristoforo, ich muß Euch etwas dazu erklären, das nicht jeder hören soll.«
Er stellte sich als Paolo Giustiniani vor, einer der Söhne des Firmeninhabers.
»Ein offenes Wort, mein Lieber, von Genuese zu Genuese. Wenn wir Euch überhaupt noch die Ware abnehmen, dann nur aus landsmannschaftlicher Solidarität. Seit die Steuerschraube der Türken uns mehr und mehr die Luft abwürgt, ist es schwierig, manchmal unmöglich, die Geschäfte nach alter Art weiter zu betreiben. Auch die Türken liefern Tuch und nicht einmal schlechtes, und sie zwingen uns, damit zu handeln. Wäre nicht unser Mastixmonopol, hätten wir die Geschäfte längst aufgeben müssen. Aber selbst da zwingt uns der Sultan, ihm ein gewisses Kontingent zu überlassen – zu seinen Preisen! Nur noch etwa ein Drittel dürfen wir nach Westen verkaufen, und davon, nur davon, leben wir.«
Columbus hatte mit mäßigem Interesse zugehört. Dio mio, wie wenig berührten ihn diese Probleme. Dann dachte er an seine Familie und fragte: »Wozu ratet Ihr mir also, Messer Paolo? Soll ich das bißchen Geld einstreichen und von hier verschwinden, oder gibt es irgendeine andere Verdienstmöglichkeit?«
Der andere dachte nach.
»Erzählt niemandem, daß Euch ein Giustiniani diesen Rat gibt. Seht Euch hier um, versucht bei den Bauern kleine Mengen von Mastix aufzukaufen – darum kümmert sich kein Mensch – und verscherbelt das Zeug an Aufkäufer aus dem Westen. Das ist ein grauer Markt, der von uns geduldet wird, weil wir Christen zusammenhalten müssen.«
Columbus folgte dem Rat, aber die Gewinnspanne war klein, und es fehlte ihm auch die rechte Lust zu solchem Handel. Dieses Harz des Mastixbaumes war eine begehrte Ware und wurde für Firnisse, Klebstoffe oder medizinische Zwecke benötigt, aber Columbus betrieb seine Geschäfte nur halbherzig und wußte jetzt, daß er auch zum Kaufmannsberuf nicht taugte. Viel lieber schlenderte er durch die Gassen, lauschte dem Sprachengewirr aus Türkisch, Arabisch, Griechisch und Italienisch und spitzte die Ohren, wenn von der ›Seidenstraße‹ oder der ›Gewürzstraße‹ die Rede war. Diese sagenhaften Handelswege begannen irgendwo da drüben am osmanischen Ufer und führten durch Berge, Wälder, Steppen und Wüsten nach Indien und sogar nach Kathai, dem Land des Marco Polo, den sie Messer Milione nannten und der doch kein Lügner war.
In einer schmalen Gasse gleich hinter dem Hafen lag eine Bottega versteckt, deren niedriger Eingang leicht zu übersehen war. In den finsteren langgestreckten Gewölben gab es alles, was ein Seefahrer oder ein Fischer benötigte: vom riesigen Bleianker bis zum feingeknüpften Netz, vom Steuerruder aus Olivenholz bis zum eisernen Muschelkratzer, wenn ein Schiff aufgebockt und gesäubert wurde. Und es gab Karten. Seekarten, Landkarten, alte und neue, zerrissene und geklebte, exakte und phantastische.
Don Matteo, der Ladeninhaber, duldete den schweigsamen und wissensdurstigen jungen Mann, der selten etwas kaufte, dafür aber stundenlang stöberte. Auch Don Matteo jammerte über die schlechten Geschäfte.
»Jetzt haben uns die Türken den ganzen Indienhandel weggenommen, und bald werden Genua und Venedig auf Provinzniveau herabsinken. Selbst wenn eines Tages Afrika umschifft und Indien ohne türkische Behinderung erreicht werden, so dauert eine solche Reise viel zu lange, als daß sie Gewinn bringen könnte.« Er beugte sich vor und flüsterte: »Die christlichen Länder müßten sich zusammentun und gemeinsam die Türken ausräuchern. Sobald Kleinasien wieder christlich ist, öffnen sich die Tore nach Osten. Aber so …«
Er zuckte die Achseln und wandte sich ab.
Columbus dachte nach. Niemand wußte, wie groß Afrika war; die Karte des Ptolemäus brach am Äquator ab, die Erkundungsfahrten des Prinzen Heinrich hatte sein Tod beendet. Es war ja auch ein Unding: Zuerst Tausende von Meilen nach Süden segeln, um Afrika herum, dann Tausende von Meilen nach Norden, um endlich Indien zu erreichen. Die Westküste von Indien. Aber war die Erde nicht rund? Sie war doch rund! Die Erde, sagte der Pater Magister, die Erde, discipuli, ist eine Kugel. Gäbe es Afrika nicht, könnte man leicht entlang der Küste Kleinasiens nach Indien gelangen. An die Westküste von Indien natürlich. Aber die Erde ist doch rund! Wenn ich also Indien an seiner Ostküste erreichen will, dann schert mich kein Afrika, dann segle ich einfach über den Atlantik nach Westen. Columbus schlug sich an die Stirn. So einfach ist das! So einfach! Auf diese Idee müssen doch schon andere gekommen sein! Das ist so logisch, daß ein Sechsjähriger es begreift!
Am nächsten Tag sprach er davon zu Don Matteo. Der nickte gleichmütig.
»Das stimmt, Söhnchen, es ist logisch. Aber niemand hat’s probiert. Es käme auf einen Versuch an. So ganz neu ist die Idee auch nicht. Schon vor hundert Jahren hat Peter von Ailly die These aufgestellt, wer nach Westen fährt, müsse den Ostrand von Asien erreichen. Er stellte sich diese Gegend als Paradies vor …«
»Könnt Ihr mir dieses Buch leihen?«
»Das hat mir vor Jahren ein Kapitän geliehen. Vielleicht treibst du es in Genua auf, es heißt ›Imago Mundi‹.«
Don Matteo schmunzelte und schwieg eine Weile. Als Columbus nichts sagte, fuhr er fort: »Im übrigen hast du recht – die Erde ist rund und niemand kann dabei verlorengehen. Dein Schiff kann genausogut zwischen Genua und Korsika zugrunde gehen wie zwischen Portugal und der indischen Ostküste. Das kommt aufs gleiche hinaus, nicht wahr?«
Also hatten auch andere an diese Möglichkeit gedacht, aber keiner war imstande gewesen, die Probe aufs Exempel zu machen. Vielleicht hatte dieser Peter von Ailly sogar recht und dort lag tatsächlich so etwas wie ein Paradies mit reichen Städten, schönen braunen Menschen, fruchtbaren Feldern, lichten Wäldern mit exotischen Tieren und bunten Vögeln. Vielleicht gab es dort sogar Gold, Gold in Hülle und Fülle, und wer als erster dort erschien, den würden die fremden Menschen freundlich empfangen, ihn teilhaben lassen an ihrem Reichtum.
Das sind ja richtige Bubenträume, schalt er sich, unwürdig eines erwachsenen Mannes von einundzwanzig Jahren, der schon etliche Bücher gelesen und viele Karten studiert hat, der Bescheid weiß mit Handel und Wandel, dem keiner etwas vormachen kann. Doch der Gedanke war hartnäckig wie ein schlimmer Zahn, meldete sich immer wieder, und wenn Columbus ihn untertags verdrängte und beiseite schob, dann kam er des Nachts quasi durchs Hintertürchen und stahl sich in seine Träume in vielerlei Gestalt. Später erinnerte er sich nur an den einen.
Wieder einmal schlenderte er am Hafen herum und betrat die Bottega des Don Matteo. Der machte eine geheimnisvolle Miene, legte den Zeigefinger an seine Lippen und führte ihn durch endlose finstere Gänge in ein hellerleuchtetes Gemach. Dort war eine riesige Landkarte auf dem Boden ausgebreitet, eine, die nicht am Äquator aufhörte, sondern beide Erdhälften mit den Polen in Nord und Süd zeigte.
»Eccola!« Stolz wies Don Matteo auf die Karte. »Hier hast du sie, komplett von oben bis unten – nichts fehlt mehr.«
Doch die Karte war so groß, glitzerte und spiegelte im grellen Licht, und Columbus wagte nicht, sie zu betreten. Er versuchte, Afrika in seiner vollen Gestalt zu erkennen, doch es gelang ihm nicht.
Don Matteo rief: »Was zögerst du? Steig’ nur drauf, und sieh dir alles an.
Behutsam betrat Columbus die Karte, und da war Afrika vergessen; ihn verlangte nur noch danach, von Portugal, dem äußersten Westen Europas, eine Linie durch das Meer zu ziehen bis zu den weiten Gestaden Asiens, und nichts lag dazwischen, nichts – nichts – nichts, nur die weite glitzernde Fläche des Atlantik, der jetzt aussah wie lebendiges Wasser, und dann war da ein Schiff, er sah es nicht, fühlte nur das Schwanken unter seinen Füßen, und jemand rief: »Land!«, und eine prächtige Küste stieg vor seinen Augen auf: schlanke Palmen, die ihre gefiederten Kronen sanft im Wind schaukelten; hinter blühenden Sträuchern und üppigen Bäumen mit bunten schwellenden Früchten verbargen sich schimmernde Paläste mit goldenen Dächern und Menschen traten ans Ufer, mit brauner Haut und schwarzen Haaren, und sie breiteten ihre Arme aus, lächelten, lächelten …
Columbus behielt diesen Traum für sich, verbarg ihn wie einen Schatz, ließ keinen daran teilhaben, vergaß auch niemals, daß es ein Traum war. Aber zugleich wußte er, daß sich dahinter nachweisbare Fakten verbargen – denn: Die Erde ist eine Kugel, etwa drei Viertel davon sind mit Wasser bedeckt. Europa und Asien sind nach Osten hin durch eine Landbrücke getrennt, im Süden sperrt Afrika wie ein riesiger Block die Durchfahrt. Der Weg nach Westen jedoch steht offen, noch niemals ist ein Seefahrer in dieser Richtung auf Land gestoßen. Also ist der Weg nach Westen zur asiatischen Ostküste frei. Man muß ihn nur gehen. Man muß es nur wagen. Es ist kein Traum. Die Erde ist rund. Der Weg ist frei. Ich muß es wagen. Ich werde es wagen.
Der Traum Isabellas
Prinzessin Isabella von Kastilien war drei Jahre alt, als ihr Vater starb und seinem Sohn Heinrich den Thron überließ. Dieser Heinrich war ihr Halbbruder aus der ersten Ehe des Königs, und Isabellas früheste Erinnerung an ihn war so seltsam, daß sie nicht wußte, ob sie weinen oder lachen sollte. Da saß ihr eine lange dürre Gestalt gegenüber mit roten Haaren und blauen Augen, die er immer halb geschlossen hielt, aber manchmal plötzlich weit aufriß und mit den Lidern zuckte wie ein geköpfter Hahn. Er stotterte nicht beim Reden, machte aber manchmal Pausen, wo sie nicht hingehörten.
»Nun, Isabella, wie … geht es dir?«
Er küßte die Fünfjährige auf beide Wangen. Das waren sehr feuchte Küsse, und sie wischte sofort heftig darüber.
»Aber Kind …«, sagte die Mama tadelnd, doch der König lachte nur, riß die Augen auf, seine Lider flatterten, und er lachte laut und mißtönend.
»Sie ist … wenigstens ehrlich, hat noch nicht gelernt, sich zu … verstellen.«
Die seltsamen Pausen bewirkten, daß alle dem König auf den Mund starrten, neugierig, welches Wort Seine Majestät wählen würde. Dann wurde Isabella älter, und sie lernte, sich zu verstellen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als es zu lernen. Sie beobachtete ihre Umgebung genau, und was sie sah, gefiel ihr gar nicht. Heinrich von Kastilien war ein friedlicher Monarch, ein zögerlicher Mensch, der vor harten Entscheidungen zurückscheute, wie ein Gaul vor einem Hindernis. So reckte der kastilische Adel mächtig sein Haupt, stellte Forderungen, erhob Ansprüche, denen der König immer wieder mit Zugeständnissen begegnete. Er wollte keinen Streit. Er wollte friedlich dahinleben, liebte die Jagd und lange einsame Waldspaziergänge. Vor Frauen scheute er zurück, und als er auf Drängen des Adels Blanche von Navarra heiratete, mied er konsequent ihr Bett. Nach zwölfjähriger Ehe war Blanche so jungfräulich wie bei ihrer Geburt – eine Hebamme bestätigte es. Die Ehe wurde annulliert, und Heinrich atmete auf. Doch man ließ ihm keine Ruhe, bis er Johanna von Portugal heiratete. Er ließ sich dazu zwingen, aber niemand konnte ihn bewegen, die Ehe zu vollziehen. Es dauerte sieben Jahre, bis Johanna ein Töchterchen gebar, und da war Isabella zwölf und durfte sich Tante nennen. Aber es entging ihr nicht, welche Gerüchte am Hof kursierten. Johanna, so munkelte man, sei ihres leeren Ehebettes überdrüssig geworden und habe sich Beltran de la Cueva als Liebhaber erwählt. Er und kein anderer sei der Vater der kleinen Prinzessin. Sie wurde nach ihrer Mutter Johanna getauft, aber alle Welt nannte sie die Beltraneja. Man schimpfte König Heinrich einen Hahnrei, aber das kümmerte ihn wenig. Er war ganz froh, daß Beltran de la Cueva ihm nicht nur die ehelichen Pflichten abnahm, sondern auch mit Geschick die Regierungsgeschäfte erledigte. So konnte Heinrich ungestört auf die Jagd gehen und einsame Spaziergänge unternehmen. Doch wieder erhob der stolze Adel sein Haupt und verlangte, die Beltraneja zu enterben. Heinrich tat es, da er seine Ruhe wollte, doch er beharrte weiterhin darauf, daß die kleine Johanna seine Tochter sei. Zum Thronerben wurde Isabellas jüngerer Bruder Alfons ernannt, der aber erst elf Jahre alt war und wenig später an der Pest starb. Niemand brauchte die inzwischen siebzehnjährige Isabella daran zu erinnern, daß nun sie die Thronerbin sei. Das wußte sie längst, doch sie war ein kluges und beherrschtes Mädchen, hielt den Mund und wartete ab.
König Heinrich aber zauderte. Was sollte er tun? Der Bischof von Cuenca versuchte, ihn aufzurütteln: »Ihr werdet als der meistverspottete König in die Geschichte eingehen und es bedauern, Sire, doch dann ist es zu spät.«
Das nahm Heinrich in Kauf, wenn man ihn nur in Ruhe ließ. Und so tat er, wozu man ihn drängte: Von neuem schloß er die Beltraneja als Thronerbin aus und bestätigte Isabella als seine Nachfolgerin. Isabella bedankte sich artig, doch sie lebte weiter wie bisher, ohne ihren neuen Rang herauszukehren. Erst als man sie mit dem König von Portugal verheiraten wollte, einem Witwer von sechsundreißig Jahren, ließ sie erkennen, daß sie andere Pläne hege. Sie rief ihre Vertrauten zusammen und verkündete: »Meine Herren, schaut auf die Landkarte und entscheidet selbst was für Kastilien nützlicher ist: eine Verbindung mit Portugal oder eine mit Aragonien. Und vergeßt nicht, daß Sardinien und Sizilien weitere Perlen in der aragonesischen Krone sind. So werde ich den Prinzen Ferdinand von Aragonien ehelichen, der«, und da lächelte Isabella, »auch seinem Alter nach besser zu mir paßt.«
Die Herren erwiderten ihr Lächeln, manche wagten es sogar leise, aber vernehmlich zu lachen. Nun, Prinz Ferdinand war sogar ein Jahr jünger als Isabella, und die meisten billigten die Verbindung. Wer dagegen war, ließ nichts verlauten, denn selbst der einfältigste Adelige erkannte in der hellblonden, hellhäutigen und etwas dicklichen Prinzessin die künftige Königin von Kastilien. Man mußte ihr nur in die harten grauen Augen schauen, die bläulich blitzten wie Toledostahl, wenn sie ihren Willen verkündete.
König Heinrich war gegen die Verbindung mit Aragon, doch niemand hatte ihn gefragt. Schließlich gelang es seinen Ratgebern, ihn gegen Isabella aufzuhetzen, und sie rechtfertigte sich in einem langen respektvollen Brief. Sie vergab sich nichts und vermied jede Kritik an ihrem älteren Bruder. Doch bat sie ihren Bräutigam, auf schnellstem Weg nach Kastilien zu kommen, möglichst heimlich, denn sie wollte die Welt vor vollendete Tatsachen stellen.
Prinz Ferdinand ließ am Hof zu Zaragoza verlauten, er wolle eine Inspektionsreise nach Katalonien unternehmen, um schwebende Rechtsfälle zu klären – nichts Ungewöhnliches, seit er als Mitregent seines Vaters königliche Macht ausübte.
So zog er Anfang Oktober in angemessener Begleitung nach Osten. Etwa fünf Meilen ritten sie den Ebro entlang, dann blickte einer seiner Begleiter zum Himmel.
»Es ist Zeit, Majestät!«
Der achtzehnjährige Prinz lächelte, nickte und sprang mit einem Satz vom Pferd. Er und sechs seiner Begleiter legten einfache Reisekleider an und plötzlich sah Ferdinand gar nicht mehr königlich aus. Mit seiner schlanken, mittelgroßen Gestalt, den kurzen dunklen Haaren und dem frechen durchschnittlichen Gesicht eines aufgeweckten jungen Mannes sah er aus wie der Gehilfe eines reisenden Händlers, und genau dieser Eindruck war beabsichtigt.
Die kleine Reisegruppe wandte sich jetzt nach Westen, denn Isabella erwartete ihren Bräutigam in Valladolid.
»Ihr seht verdammt echt aus, Majestät!«
Ferdinand runzelte die Brauen.
»So soll es auch sein und deshalb Schluß mit der Majestät. Ich heiße Paco und bin der Diener ehrbarer Kaufleute.«
Ihm machte diese Rolle ungeheueren Spaß, und als sie am Abend in einer Herberge ihr Nachtlager bereiteten, ging Ferdinand hinaus in den Stall und striegelte die Pferde. Im Laufe dieser Reise kam es sogar vor, daß man sie für Landfahrer hielt und mit Steinen verjagte. Ein paar Meilen vor Zaragoza, in der kleinen Stadt Duena, traf der Prinz sich mit seinem Gefolge und verwandelte sich sehr schnell wieder in eine Majestät.
»Die Rolle hat mir Spaß gemacht, ich hätte sie gerne noch eine Weile gespielt.«
Unterdessen bereitete Alonso Carillo, der Erzbischof von Toledo, die Hochzeit in aller Stille, doch in großer Eile vor. Der alte Kirchenfürst sah in Isabella die Zukunft und setzte alles daran, ihre Pläne voranzutreiben. Ihre Pläne waren seine Pläne. Das Erzbistum von Toledo war das ertragreichste in ganz Spanien und brachte jährlich zwischen sechzig- und achtzigtausend Dukaten. Diese nette Pfründe wollte Carillo nicht verlieren. Und nun hatte er um Audienz bei Ihrer Königlichen Hoheit gebeten.
Isabella deutete einen Knicks an und küßte den Bischofsring. Sie war ungeduldig.
»Nun, Exzellenz, wie weit sind Eure Vorbereitungen gediehen?«
Über das schlaue wache Gesicht des alten Kirchenfürsten flog ein leises Lächeln.
»Drückt Euch die Jungfernschaft so sehr, Hoheit?«
»Ihr seid frech, Carillo. Vergeßt nicht, daß in Kastilien der König die Kandidaten für ein Bistum auswählt. Der Papst darf sie nur noch bestätigen.«
Carillo zeigte sich keineswegs eingeschüchtert.
»Verzeiht, Hoheit, ein Scherz unter Vertrauten, es soll nicht wieder vorkommen.«
Isabella wandte sich ab, denn sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Der gute Carillo hatte zwar ein loses Maul und nahm es mit dem Zölibat nicht sehr genau – er hatte ein halbes Dutzend Kinder zu versorgen –, doch sie schätzte den alten Fuchs.
»Ist der Dispens Seiner Heiligkeit endlich eingetroffen?«
»Leider nicht, Hoheit, Rom ist weit. Aber ich habe ein Schriftstück vorbereitet und werde es verlesen.« Carillo wischte ihren Einwand weg. »Ein Provisorium. Das Original wird in Bälde eintreffen.«
»Ob Gott es uns verzeiht?«
»Meine Tochter, nirgends in der Heiligen Schrift ist die Rede davon, daß eine Jungfrau ihren Vetter nicht heiraten darf, noch dazu einen zweiten Grades. Aber es ist nun einmal Tradition, daß der Papst dazu seinen Segen gibt. Übrigens ein nicht unbedeutender Nebenerwerb des Heiligen Stuhls – nun, sei’s drum, wir behelfen uns vorerst auf diese Weise.«
»Ihr habt Euch Verdienste um die Krone erworben. Exzellenz.«
Carillo hob die Hände.
»Ich möchte Euch bald als Königin sehen, Hoheit.«
»Und ich möchte – ich möchte …«
»Hab’s nicht vergessen, meine Tochter. Heute um Mitternacht, im Haus des Grafen Vivero.«
So war es besprochen, so war es ausgemacht. Drei Tage vor der Hochzeit sollten Braut und Bräutigam sich kennenlernen. Die meisten Mädchen hätten sich für diese Stunde besonders herausgeputzt, doch Isabella bemerkte zu ihrer Zofe: »Ich möchte aussehen wie immer. Ferdinand soll mich sehen, wie ich im Alltag bin, denn eine Ehe ist Alltag. So erspart er sich eine Enttäuschung.«
Der Plan eines Treffens um Mitternacht stammte von Carillo, er wollte dieser ersten Zusammenkunft eine Aura des Geheimnisvollen und Romantischen verleihen. Doch es hätte dieser Geste nicht bedurft. Isabella und Ferdinand traten aufeinander zu, jeder sah im Auge des anderen die Kerzenlichter tanzen, sie senkte nicht den Blick, und er ließ den seinen über ihre Gestalt wandern.
Ganz ungeniert, dachte Isabella, wie ein Roßkäufer, doch sie verübelte es ihm nicht.
Ferdinand küßte seine Braut auf beide Wangen.
»Ihr gefallt mir, Doña Isabella, wir geben ein schönes Paar.«
»Auch meine Mitgift ist nicht schlecht, Don Ferdinand, die Krone von Kastilien.«
»Ich hätte Euch auch mit weniger genommen«, sagte der Bräutigam galant.
Die Trauung fand fast heimlich mit nur wenigen Zeugen in einer Kapelle statt. Erzbischof Carillo verlas den falschen päpstlichen Dispens, und es klang sehr überzeugend. Nicht ohne Rührung sprach er die Worte des Introitus: »Deus Israel conjungat vos: et ipse sit vobiscum« (Der Gott Israels verbinde euch; er selber sei mit euch).
Dann kam die Hochzeitsnacht, und Isabella dachte daran, daß dieser achtzehnjährige Bursche schon zwei Kinder mit Mätressen gezeugt hatte, aber – so hatte man ihr berichtet – er war ansonsten ein höflicher und umgänglicher Mann, mäßig im Essen und Trinken und nahm seine Aufgabe als Mitregent sehr ernst.
Erfahren und lustvoll vollzog Ferdinand das Beilager gegen seine Gewohnheit sanft und fast feierlich, denn er lag einer königlichen Prinzessin bei und fühlte, wie Gottes Segen dem fleischlichen Akt eine höhere Weihe verlieh.
Isabella, die Jungfrau, nahm ihren Mann hin, wie die alte und vertraute Amme es ihr geraten hatte: »Sperre dich nicht gegen seine Wünsche, mein Täubchen, sei locker und fröhlich, auch wenn’s weh tut und vorerst keine Lust bereitet. Lust und Liebe stellen sich mit der Zeit von selbst ein. Don Ferdinand soll ja nicht unerfahren sein.«
Nein, das war er nicht, und schon nach wenigen Wochen sehnte Isabella sich nach seinen Umarmungen. Sie fanden zueinander, aber leicht hatten sie es in Kastilien nicht.
König Heinrich hatte sich wieder einmal gegen seine Schwester aufhetzen lassen, ein Teil des Adels nahm Partei für seine Tochter Johanna, die Beltraneja, weil sie wußten, daß sie mit ihr ein leichteres Spiel haben würden. Und alle versuchten, dem jungen Paar dreinzureden. Erzbischof Carillo, der sich nun als enger Vertrauter der beiden fühlte, lag Ferdinand dauernd mit ungebetenen Ratschlägen in den Ohren, und als der junge Prinz endlich die Geduld verlor und ihn zurechtwies, zog Carillo sich gekränkt zurück und fragte sich, ob er nicht doch aufs falsche Pferd gesetzt hatte.
Isabella aber verlor weder ihre Geduld noch ihre Zuversicht. So wie jede Messe mit dem Kyrie beginnt und mit dem Amen endet, so sicher wußte sie, daß sie bald mit Ferdinand auf dem Thron der Vereinigten Königreiche Aragonien und Kastilien sitzen würde.
»Hättest du doch nach Portugal geheiratet, wäre alles viel einfacher«, jammerte die Mutter.
Isabella lächelte nur nachsichtig. Wir werden uns auch Portugals noch annehmen, dachte sie, aber zuerst muß Granada fallen, denn sie und Ferdinand würden keine Ungläubigen in ihrem Reich dulden.
Ferdinand, das spürte sie bald, war nicht sehr fromm. Nach außen erfüllte er seine Pflichten, doch mit dem Herzen war er nicht dabei.
Das genügt nicht, dachte Isabella, denn wir brauchen Gott und seine Heiligen auf unserer Seite. Sie sagte es ihm.
»Ich werde mich bessern«, versprach er leichthin, »aber zunächst müssen wir die wichtigsten Adelsfamilien auf unsere Seite ziehen. Zum Beispiel die Mendozas. Sie haben großen Einfluß in Kastilien und glauben noch immer an die Zukunft der Beltraneja. Nur weil Carillo mit ihnen verfeindet ist, müssen wir es nicht sein.«
»Pedro de Mendoza will Kardinal werden«, gab Isabella zu bedenken.
»Und nicht nur das, er schielt nach dem Erzbischofstuhl von Toledo.« Isabella nickte.
»Und Carillo weiß das.«
»Carillo ist alt, er wird einen Nachfolger brauchen.«
»Mendoza ist jung.«
»Und ehrgeizig.«
Isabella legte eine Hand auf den Arm ihres Gemahls.
»Sind wir das nicht auch?«
»Wir tragen eine große Verantwortung. Übrigens wird im Februar der Legat des neuen Papstes eintreffen, Kardinal Rodrigo Borgia, seine Familie stammt aus Valencia, hieß früher Borja.«
»Also einer deiner Untertanen.«
Ferdinand schob seine dicke Unterlippe vor.
»Wie man’s nimmt. Ich werde es ihn nicht merken lassen.«
Anfang Februar reisten Ferdinand und Isabella nach Alcalá de Henares, wo sie im erzbischöflichen Palast den päpstlichen Legaten empfingen. Rodrigo Borgia gewann sofort ihre Herzen. Ein Mann nach ihrem Geschmack: fröhlich, gewinnend, offen, optimistisch, kompromißbereit und von vollendeten Manieren. Dazu war er ein stattlicher, gutaussehender Mann – groß, kräftig, mit einer kühn vorspringenden Nase und klugen lebhaften Augen, deren fester freundlicher Blick jeden gefangennahm.
»Könnt Ihr uns etwas über Seine Heiligkeit berichten, soweit es Eure Loyalität nicht verletzt?«
Der Legat wandte sich zu Isabella, und sein Blick war nicht der eines geistlichen Vaters zu seiner Tochter, sondern der eines Mannes zur künftigen Geliebten – aber nur für einen Moment, dann neigte er leicht sein Haupt und sagte mit lächelnder Verbindlichkeit: »Seine Heiligkeit ist kein Spanier.«
Ferdinand räusperte sich.
»Ein wenig dürftig, nicht wahr? Aber, wenn es nichts weiter zu sagen gibt …«
Rodrigo Borgia hob mit einer anmutigen Geste beide Hände.
»Nun, Seine Heiligkeit hat geruht, fünf seiner Neffen zu Kardinälen zu ernennen.«
»Interessant. Dann werdet Ihr ihn sicher dazu überreden können, auch Unseren geliebten Untertan, Don Pedro Gonzales de Mendoza, den Erzbischof von Siguenza, zum Kardinal zu ernennen.«
Der Legat verneigte sich.
»Ich werde mein Möglichstes tun.«
Mendoza wurde Kardinal, seine ganze einflußreiche Familie schwenkte zu Isabella über, und nicht wenige taten es ihr nach. König Heinrich und seine umstrittene Tochter, die Beltraneja, begannen zu vereinsamen.
»Wir werden ihm einen Besuch abstatten«, schlug Isabella vor, und ihr Vorschlag klang sehr bestimmt.
»Wenn du es für richtig hältst …«
»Ich bin seine Schwester und nicht seine Feindin.«
Der fünfzigjährige Monarch residierte damals im Alcazar von Segovia und freute sich kindlich über den Besuch seiner Schwester. Er hatte die ganzen Umtriebe satt. Jeder seiner Ratgeber blies ihm etwas anderes ins Ohr, und er wollte doch nur seine Ruhe haben. Er ließ seiner Schwester ein Festmahl bereiten, zeigte sich mit ihr in der Stadt und brachte seine Untertanen in Verlegenheit, weil sie nicht wußten, ob sie nun jubeln oder schweigen sollten, wo doch jedermann wußte, wie tödlich verfeindet die beiden waren. Als sie dann Arm in Arm zur Weihnachtsmesse die Kirche betraten, jubelte das Volk schon aus Erleichterung, denn ein Zwist der Mächtigen wird immer auf den Schultern der Untertanen ausgetragen. Auch als Ferdinand am 1. Januar dazukam, hielt die gute Stimmung an. Heinrich schien wieder geneigt, Isabella als Erbin anzuerkennen, für die Beltraneja würde sich schon ein Prinz von Geblüt finden.
»Wenn er sich nur einmal entschließen könnte! Nicht ja und nicht nein, das ist zum Verrücktwerden!«
Ferdinand hatte sich in Zorn geredet. Isabella legte ihren Arm um seine Hüfte.
»Beruhige dich. Wir dürfen ihn nicht drängen. Es wird sich alles regeln.«
Und so war es auch. Ein Jahr später, am 11. Dezember 1474, starb König Heinrich von Kastilien in Madrid. Zwei Tage später ließ Isabella sich in Segovia zur Königin ausrufen. Es gab keine Schwierigkeiten, doch Ferdinand war etwas befremdet, daß er nur die Rolle des Prinzgemahls spielen sollte. Denn die Herolde hatten verkündet: »Isabella, Königin von Kastilien und Ferdinand, ihr rechtmäßiger Gemahl.«
Er stellte seine Frau zur Rede. Ruhig und freundlich erklärte ihm Isabella: »Das mag in Aragonien wichtig sein, wo es keine weibliche Erbfolge gibt, aber hier ist das anders: Ich bin die Erbin, nur ich kann Königin sein.«
Doch Ferdinand war gekränkt, und Isabella fand einen Ausweg. Ihr Gemahl dürfe den Königstitel tragen, aber sie, und nur sie, war die ›Besitzerin‹ von Kastilien. Alle offiziellen Dokumente sollten von nun an gemeinsam unterzeichnet werden. Ferdinand war zufrieden, er kannte seine Frau und wußte, daß er nicht mehr verlangen durfte. Im Bett der Königin von Kastilien durfte er unumschränkt herrschen, da unterwarf sie sich in allem, nicht jedoch in ihrem Land – da herrschte sie und nur sie.
Mendoza, der frischgebackene Kardinal wurde bald zum engsten Ratgeber der Könige, der alte Carillo, sein Feind und Konkurrent, zog sich schmollend zurück. Zu seinem Sekretär bemerkte er bitter: »Als ich sie bei der Hand nahm, war sie ein kleines Mädchen, mit Spinnen beschäftigt, nun sehe ich sie an ihrem eigenen Spinnrad.«
Isabella hatte inzwischen eine Tochter geboren, und Ferdinand erinnerte sie nicht ohne Spott: »Eine Erbin Kastiliens – recht schön, aber wenn es mit Aragonien zu einem Königreich werden soll, dann brauchen wir einen Sohn.«
Isabella, keineswegs beleidigt, erwiderte: »Du kriegst deinen Sohn, warte nur ab. Wer ernten will, muß recht fleißig seinen Acker bestellen.«
Ferdinand verstand den Wink und besuchte häufiger das eheliche Bett. Nach einer besonders leidenschaftlichen Umarmung setzte Isabella sich auf und begann wie in Trance zu reden.
»Ich sehe Spaniens Zukunft vor meinen Augen, als hätte Gott mir die Gabe der Prophetie verliehen. Aber Gott fordert seinen Preis: Er wünscht sich ein christliches Spanien, frei von Mauren, Juden, Ketzern und falschen Bekehrten. Er wird uns einen Erben schenken, wenn wir ein Spanien schaffen – rein im christlichen Glauben wie ein Kristall, den das göttliche Licht zum Strahlen bringt. Daß hierzulande die Häresie zunimmt, wird mir von allen Seiten berichtet. Gott wird uns strafen, wenn wir nichts unternehmen. Der Papst muß für unsere Länder Inquisitoren ernennen. Und wir, die weltliche Macht, tun das unsere dazu, wenn wir die letzten Mauren verjagen. Granada muß christlich werden! Unser Sohn wird über ein christliches Spanien herrschen, er wird König von Kastilien, Aragonien, Granada, Sardinien und Sizilien sein.«
Ferdinand unterbrach sie und fragte mit leisem Spott: »Was ist mit Navarra oder mit Portugal?«
»Navarra zählt nicht, es wird uns eines Tages von selbst in den Schoß fallen. Und Portugal? König Alfonso ist Witwer und kinderlos. Wer weiß?«
»Also gut, Isabellita, gehen deine Prophezeiungen noch weiter?«
»Spotte nicht! Wenn wir alles haben, was Gott uns zuteilen will, so bleibt noch das Meer. Schau’ nicht so ungläubig! Prinz Heinrich der Seefahrer hat uns gezeigt, daß Afrika ein Land voll von Geheimnissen ist. Wir in Spanien werden seine Unternehmungen fortsetzen, unsere Schiffe werden Gold und Gewürze ins Land bringen, wir werden reich sein und mächtig und in unseren Kindern und Kindeskindern unsterblich.«
Ferdinand gähnte.
»Manches davon werden wir verwirklichen, so nach und nach …«
Er gähnte ein zweitesmal und drehte sich um. Isabella aber lag noch lange wach, und vor ihren Augen zogen die Bilder einer goldenen Zukunft vorüber, an die sie glaubte, weil sie Gott an ihrer Seite wußte. Aber der HERR würde es nicht umsonst tun, auch das wußte sie.
Der Traum des Rodrigo Borgia
Der Palast des Kardinals stand im römischen Ponte-Viertel in der Nähe der Piazza Pizzo di Merlo. Der kleine gepflegte Garten grenzte an den des Nachbarhauses, das Vanozza de Cattaneis bewohnte, die Mätresse von Rodrigo Borgia. Der zweiundfünfzigjährige stattliche Mann besaß auch noch andere Geliebte und hatte mit ihnen Nachkommen gezeugt, aber Vanozza stand seinem Herzen am nächsten, ihre Kinder betrachtete er quasi als seine legitimen und den jetzt siebenjährigen Cesare als seinen Erstgeborenen. Er hätte zufrieden sein können, der Kardinal Borgia, wäre nicht sein brennender Ehrgeiz gewesen, auf den päpstlichen Stuhl zu gelangen, doch den hatte Seine Heiligkeit Sixtus IV. inne, ein kranker schwacher Mensch, der nur Sinn für seine Familie besaß und den schamlosesten Nepotismus betrieb, den Rom je gesehen hatte. Zwei Brüder und vier Schwestern stattete er reichlich mit Pfründen und Titeln aus, fünf seiner Neffen wurden zu Kardinälen ernannt.
Ich hätte es nicht anders gemacht, dachte Rodrigo Borgia, wenn auch vielleicht ein wenig unauffälliger und geschickter. Es hätte ihn auch nicht weiter gestört, wären diese fünf neuen Kardinäle harmlose Esel gewesen, die nicht weiter störten. Bei dreien traf das auch zu, und mit einem, dem lebenslustigen Prasser Pietro Riario, war er sogar befreundet gewesen. Die Rolle eines Lieblingsneffen des Papstes nutzte Pietro weder zu Intrigen noch zur Stärkung seiner Macht – nein, er gestaltete sein Dasein zu einem immerwährenden Fest. Das römische Volk vergötterte ihn, und wenn er in seinem Purpurmantel durch die Straßen ritt, jubelten die Leute ihm zu. Doch seine Lebenskraft hielt diesem Leben nur drei Jahre stand, und er sank als Achtundzwanzigjähriger ins Grab.
Der Kardinal seufzte, wenn er daran dachte. Unter den vier verbliebenen Neffen gab es nun diesen Giuliano della Rovere, ein Mann hart wie Stahl, klug, beherrscht, rücksichtslos, ohne Mätressen, ohne Laster, nur mit einer gewissen Neigung zu Kunst und Künstlern. Daß auch er nach der Tiara strebte, lag auf der Hand, und eine Reihe jener Kardinäle, die mehr zur Askese und Frömmigkeit neigten, würde ihn bei der nächsten Wahl bevorzugen.
Nun hatte Seine Heiligkeit ein Konsistorium einberufen; angeblich ging es um ein spanisches Problem. Da spitzte Borgia gleich die Ohren, denn schließlich war er unter anderem Bischof von Valencia und hatte auch sonst noch einige Interessen in Aragonien, der Heimat seiner Vorfahren.
»Exzellenz, wir sind da.«
Die Worte des Sänftenträgers rissen ihn aus seinen Betrachtungen. Er raffte seinen Purpurmantel und stieg langsam die Treppe hinauf. Die Herren Kollegen hatten sich schon fast alle eingefunden, ihre gedämpften Gespräche füllten den Raum mit einem auf- und abschwellenden Summen.
Wie ein Bienenschwarm, der auf die Königin wartet, dachte Borgia und hielt Ausschau nach seinem Erzfeind. Ah, da drüben stand er ja, der bärtige Giuliano della Rovere, aufrecht, schlank, und richtete sein grimmiges Gesicht auf die kleine Tür neben der päpstlichen Sedia.
Wenig später humpelte er herein, Seine Heiligkeit Sixtus IV. , und ließ sich, von Dienern gestützt, in den Sessel sinken. Da hockte er nun, klein, gekrümmt, mit seiner schmalen, scharf vorspringenden Nase, den dünnen verkniffenen Lippen und den wieselflinken mißtrauischen Augen.
Wie ein verdrossener Geldwechsler sieht er aus, dachte Kardinal Borgia und versuchte, ein Gähnen zu unterdrücken. Wenn ich einmal da oben sitze, werde ich ein schöneres Bild abgeben, und ich hoffe, es wird bald sein – ich hoffe zu Gott, er wird seinen krummen altersmüden Diener bald zu sich rufen.
Inzwischen hatte der Papst zu reden begonnen, leise, mit hoher schnarrender Greisenstimme, die aber gut zu verstehen war. Es ging um die spanische Inquisition.
Borgia hielt nichts davon. Häretiker sollte man einfach nicht beachten, und wenn sie zu aufsässig wurden, mit Geldstrafen so lange schröpfen, bis ihnen die Luft ausging. An Hexen und Zauberer glaubte Borgia nicht, er zweifelte überhaupt an den sogenannten überirdischen Dingen. Freilich, irgendwo da oben gab es einen Gott, aber der war fern und schien sich wenig um die Angelegenheiten dieser Erde zu kümmern. Wäre sonst dieser Mensch da oben Papst geworden, Stellvertreter Christi auf Erden? Halt – was war das?
»… wünschen die Könige von Kastilien und Aragon, daß Wir den Dominikanerprior Tomas de Torquemada zum Generalinquisitor aller spanischen Länder ernennen. Liebe Brüder in Christo, Ihr wißt, wie sehr Wir es bedauert haben, auf welche Weise die Inquisition in Spanien ihre Macht miß- äh anwendet. Wir haben Ihre Majestäten auch deswegen schon ermahnt, aber …«
Rodrigo Borgia schüttelte unmerklich den Kopf. Bei allen Heiligen, da redet er um den Brei herum, und jeder weiß, daß er doch wieder nachgibt, weil der Peterspfennig so reichlich und stetig in seine Kassen fließt. Ich werde es anders machen! Schafe soll man scheren, solange ihr Fell nachwächst, aber nicht schlachten. Freilich, Sixtus war Wachs in den Händen seiner Neffen, und wenn die es wünschten, dann würde er auch den siebenjährigen Cesare zum Großinquisitor machen. Apostolischer Protonotar, Kanoniker von Valencia, Erzdiakon von Jativa und Rektor von Gandia war der kleine Kerl schon, der mit den Straßenjungen des Viertels im Dreck spielte und sich keinen Deut um seine geistlichen Würden scherte. Zärtlich dachte Borgia an seinen Erstgeborenen, den er für die geistliche Laufbahn bestimmt hatte.
Der Papst war mit seiner Rede am Ende angelangt. Eine leise, erregte Diskussion begann, aber Spanien war fern und das Gold aus den Kassen Kastiliens und Aragoniens eine Realität.
»Vielleicht gibt es dort tatsächlich mehr Ketzer und Häretiker als in Italien. Die Kirche muß sich wehren – zur höheren Ehre Gottes!«
Das war der Savelli, dieser Speichellecker. Rodrigo Borgia ärgerte sich so, daß er rief: »In Rom brennen auch keine Scheiterhaufen, und es schadet der Kirche nicht. Man soll nicht übertreiben!«
Da ertönte ganz von hinten ein greisenhaftes Meckern. Es kam von Maffeo Gherardo, dem sechsundachtzigjährigen Patriarchen von Venedig. Der rief nun mit dünner brüchiger Stimme: »Weil es bei uns keine Ketzer gibt! In Venedig nicht, auch nicht in Mailand, Pisa oder Rom.«
»Dafür gibt es um so mehr Prasser und Wüstlinge, die ihr Einkommen versaufen, verfressen und verhuren!«
Das kam natürlich von Giuliano della Rovere und galt all jenen, die nicht so anspruchslos lebten, wie dieser ehemalige Franziskanermönch.
Und im besonderen gilt es mir, dachte Rodrigo Borgia, aber er war dem anderen nicht böse. Sein fröhliches und optimistisches Wesen setzte sich über dergleichen hinweg. Du wirst den kürzeren ziehen, Mönchlein, dachte er, wenn diese Heiligkeit da oben in den Himmel fährt. Sie fürchten dich, Giuliano della Rovere, weil du nie lächelst und weil du keine Schwächen hast. Mich finden sie harmlos, umgänglich und ohne besonderen Ehrgeiz. Und das ist gut so.
»Wir werden also Tomas de Torquemada zum Generalinquisitor von Kastilien und Aragon ernennen. Möge Gott ihm bei seiner schweren Aufgabe beistehen.«
»Amen«, murmelten die Kardinäle, warteten kaum noch den Segen des Papstes ab und gingen zurück an ihre Geschäfte, zu ihren Mätressen und Kindern, an ihre reichgedeckten Tische.
Rodrigo Borgia bestieg seine mit dem Stierwappen geschmückte Sänfte. Er hätte die beiden für vernünftiger gehalten, Ferdinand und Isabella. Der König von Aragon war nicht gerade ein Schwachkopf, aber ihr, der Kastilierin, war er weit unterlegen. Borgia war ein Spanier, und es bereitete ihm Unbehagen, wenn eine Frau die Hosen anhatte. Und doch war es so. Was nun die Inquisition in Spanien betraf: Es gab sie ja längst; schon 1462 hatte Pius II. vier Inquisitoren nach Kastilien geschickt, aber das waren zum Teil Landfremde oder Kreaturen des Papstes. Isabella aber wollte diese Leute selbst auswählen, und so sandte Papst Sixtus IV. vor vier Jahren die Bulle ›Exigit sincerae devotionis‹ nach Spanien mit der Erlaubnis, für die Könige in Aragon und Kastilien Inquisitoren zu ernennen. Und schon brannten überall die Scheiterhaufen, eine Massenflucht der Conversos (getaufte Juden) setzte ein, und man bestürmte den Papst, ein Machtwort zu sprechen.
Kardinal Borgia lachte leise in sich hinein. Dieser Papst ein Machtwort! Immerhin, er nahm die Bulle von 1478 zurück, doch Ferdinand und Isabella ignorierten es einfach. Das wäre mir nicht passiert, dachte Rodrigo Borgia, weil ich Spanier bin und weiß, wie man Spanier behandeln muß.
Und wieder gab Sixtus nach, wie er immer nachgegeben hatte, so auch jetzt, als er diesen Torquemada zum Groß- oder Generalinquisitor ernannte.
Nomen est omen, dachte der Kardinal, als er den Namen des neuen Großinquisitors langsam vor sich hinsprach. Das leitet sich von torre cremata her, und das heißt ›verbrannter Turm‹. Ein Scheiterhaufen ist ja auch so etwas wie ein Turm aus Holz, ein brennender Turm … Kindereien, schallt er sich. Als ob es nichts Wichtigeres gäbe!
In meinen Augen, dachte Borgia, heißt das, die Kirche schwächen. Alles muß von Rom ausgehen, Sonderrechte, wie diesen Spaniern, dürfen niemals eingeräumt werden. Das Schwanken der Sänfte hatte den Kardinal schläfrig gemacht, und er nickte ein. Und da war er Papst, nannte sich Alexander, weil er wie ein Feldherr zurückerobern wollte, was schwache Päpste vor ihm vertan hatten – die Adriastädte und vor allem Sizilien, das schließlich ein päpstliches Lehen war, auch wenn es diesen Ferdinand nicht kümmerte. Juan, sein Zweitgeborener, fungierte als weltlicher Arm, als das Schwert der Kirche und César – er gebrauchte stets die spanische Version des Namens – stand ihm als Kardinal zur Seite. Lucrezia, die einzige Tochter der Vanozza, wird mit dem mächtigsten Fürsten Italiens verheiratet, vielleicht mit einem Sforza oder einem Medici. Macht – Macht – Macht – das ist es! Natürlich zur höheren Ehre Gottes und seiner Heiligen, denn der Papst ist ja schließlich Stellvertreter Christi auf Erden.
Er erwachte, gähnte, und schaute hinaus auf das Treiben in den Straßen, wo gefeilscht und geschrien, gelacht und gestohlen, getratscht und gerauft wurde. Borgia fühlte sich nach wie vor als Spanier, aber er mochte die lebenstüchtige, nüchterne, unsentimentale Art der Römer.
Hier werden keine Scheiterhaufen brennen, liebe Kinder, das verspreche ich euch. Und wenn es die Spanier zu arg treiben, dann werde ich die Tore Roms öffnen und sie willkommen heißen, die reichen Conversos mit ihrem Geld, und ich werde sie scheren, diese Schäflein. Ich, Rodrigo Borgia, ich, der Papst. Er lehnte sich zurück, dachte an den müden krummen Greis und betete zu Gott um ein seliges Ende für Papst Sixtus – um ein seliges und auch schnelles Ende.
Der Traum des Isak Marco
Toledo hatte sich herausgeputzt, als gelte es, einen König zu empfangen. Doch es wurde kein König erwartet. Vielleicht galten die Fahnen und das Glockengeläut, die festlich gekleideten Menschen und der feierliche Gesang dem ersten Sonntag nach Pfingsten, dem Tag der Allerheiligsten Dreifaltigkeit? Heute war dieser Tag, aber er wurde sonst nicht so festlich begangen, und wer einen Blick auf die prächtigen, mit Goldfransen geschmückten Banner warf, der wußte gleich, wem dieser festliche Aufwand galt. Es war die Fahne der Inquisition mit dem grünen Kreuz zwischen Schwert und Ölzweig und dem Spruch aus dem 23. Psalm: Exurge Domine Et Judica Causam Tuam.
Und da nahte schon die feierliche Prozession, geführt vom amtierenden Inquisitor. Ihm folgte ein Knabenchor, der schön und vielstimmig sang: Miserere mei, Domine …
Dahinter schritt der Provinzial der Dominikaner, begleitet von drei Mönchen, deren mittlerer ein schwarzverhangenes grünes Kreuz trug. Ihnen folgten die gelehrten Herren der Universität, die Rectores und Professores, dann die Stadtältesten, die Vorsteher der Zünfte und des Adels. Dann kamen die Abordnungen der wichtigsten Mönchsorden: Dominikaner, Franziskaner, Augustiner und Karmeliter. Sie waren von Dienern des Heiligen Offiziums begleitet, die brennende Kerzen trugen. Hinter ihnen schritten zwei kräftige Laienmönche, die das gewaltige hochaufragende Banner der Inquisition schleppten. Den Abschluß des Zuges bildeten Waisenkinder und Klosterschüler mit ihren Lehrern, zuletzt Armenhäusler, Bettler und Krüppel.
Vor der Kathedrale machte die Prozession halt und bildete einen Halbkreis. In diesen wurden die zweiundzwanzig Verurteilten geführt, gekleidet in den sambenito, das Büßergewand; auf ihren Köpfen saß die caroza, eine hohe spitze Papiermütze, grell bemalt mit Flammen, Teufeln und Höllendämonen. Dahinter rumpelte ein Ochsenkarren mit übereinandergestapelten Särgen und Holzkisten, von Stricken zusammengehalten. Sie enthielten Gebeine von Ketzern, deren Verbrechen erst nach ihrem Tod ans Licht gekommen waren. An den Särgen lehnten sechs Bildnisse von Verurteilten, die sich dem strafenden Arm der Heiligen Inquisition durch Flucht entzogen hatten. Sie sollten in effigie, also nur im Bildnis verbrannt werden.
Draußen vor der Stadt, bei der Porta Vieja, war auf einer Rampe der große Holzstoß errichtet worden, der brasero, und dort herrschte schon ein fröhliches festliches Treiben. Fliegende Händler versorgten die wartende Menge mit Wein, Bratwürsten, Brot und Obst, ein Sesamkringelverkäufer schrie sich die Seele aus dem Leib und lief wie ein Gehetzter von Gruppe zu Gruppe. Die Stadtmiliz mußte schon die ersten Betrunkenen fortschaffen, denn sie hätten das zu erwartende festliche Ereignis stören können. Hinter einer Absperrung unterhalb der hölzernen Tribüne saßen die geladenen Gäste. So hieß es offiziell; in Wirklichkeit waren es Zwangsgeladene, nämlich Verwandte und Freunde der Verurteilten, denen dieses Autodafé zum warnenden Beispiel dienen sollte.
Hier warteten auch, dicht aneinandergedrängt, die Mitglieder der Judenfamilie Marco, herbeigeführt aus der Juderia im Westen der Stadt. Isak mit seinen Söhnen David, Jakob und Joseph standen wie ein Schutzwall, hinter dem sich Ruth und ihre Tochter Susanna verbargen. Abraham Marco, Isaks Bruder, sollte heute zur Hinrichtung geführt werden; ein anonymer Denunziant hatte ihn angezeigt, und nach mehrfacher Folterung war er als rückfälliger Converso entlarvt worden, der jeden Freitagabend heimlich den Sabbat feierte, ein Scheinchrist also, ein Marane, und dieses Wort bedeutete – ein Schwein. Spitzel der Inquisition hatten herausgefunden, daß aus dem Schornstein seines Hauses am Samstag kein Rauch aufstieg, ein sicherer Hinweis auf sein heimliches Judentum, denn nach dem Gesetz Mose durfte am heiligen Sabbat keine Arbeit getan, also auch nicht gekocht werden.
Da ertönte schon von der Puerta Vieja her der Trauergesang des Miserere, begleitet von dumpfen Trommelschlägen und grellen Fanfarentönen, die an das Jüngste Gericht erinnern sollten. Nun hatte sich der Zug verändert. An seiner Spitze schritten im Dienst der Inquisition stehende Dominikaner, flankiert von berittenen Soldaten der ›Santa Hermandad‹, dann zwölf Priester in weißen Chorhemden. Hinter ihnen rumpelte und knarrte der Ochsenwagen mit den Ketzergebeinen und den Bildern der Entflohenen.
Dann kamen die Sünder, die Ketzer und Häretiker, die falschen Christen, die Gotteslästerer, der Auswurf der Menschheit, von dem der Evangelist Johannes geschrieben hatte: ›Verdorrte Reben sind vom Weinstock Jesu zu entfernen und zu verbrennen.‹ Das nahm man wörtlich, der brasero wartete, die Fackeln der Bütteln waren schon entzündet. Von den zweiundzwanzig Verurteilten hatten sieben – zwei Frauen und fünf Männer – in letzter Sekunde bereut. Sie gingen voraus und ihnen folgten die Verstockten, zum Teil geknebelt, alle mit gefesselten Händen. Nur wenige von ihnen konnten noch aufrecht gehen; die meisten humpelten, und vier mußten auf niedrigen Karren zum Richtplatz gefahren werden, denn die Feuerfolter hatte ihre Füße in brandige Fleischklumpen verwandelt. Unter ihnen befand sich Abraham Marco, der einfach nicht gestehen hatte wollen und so immer und immer wieder peinlich befragt worden war.
Entsetzt starrte Isak Marco seinen Bruder an. War das der immer so fröhliche Abraham, der sich stets schützend vor den Jüngeren gestellt hatte, der sanft und fröhlich war und sich mit jedermann gut verstand. Er hatte eine getaufte Jüdin geheiratet, hatte ihr zuliebe den Glauben gewechselt und sich in einen Juan verwandelt. In der Familie aber blieb er der alte Abraham. Die grausame Folter hatte seine Sinne verwirrt, er grinste, brabbelte vor sich hin, sang dazwischen Fetzen eines Psalms auf hebräisch, und Isak erkannte schaudernd, daß es der Kaddisch war, das Totengebet, das der Verwirrte sprach. Ein Glück, mein armer Bruder, daß deine Frau im Kindbett gestorben ist und den heutigen Tag nicht erleben muß.
Das Inquisitionstribunal bildete den Schluß des Zuges, ihm voran schwankte die Standarte des Glaubensgerichts mit dem grünen Kreuz zwischen Schwert und Ölzweig. Der Generalinquisitor von Toledo begab sich unter den Thronhimmel auf der Tribüne, ließ sich dort mit den Pontifikalgewändern bekleiden und ging zu dem seitlich der Tribüne errichteten Altar. Er zelebrierte eine kurze Messe, und ein Dominikaner predigte über das Thema: ›Erhebe dich, o Herr, und zerstreue deine Feinde.‹
Dann wurden die Urteile verlesen und jeder der siebzehn Verstockten auf den brasero geführt oder gehoben und dort am Pfahl festgebunden. Die sieben Reuigen wurden zu je hundert Peitschenhieben und lebenslanger Einsperrung verurteilt. An den Rand des Scheiterhaufens wurden die Särge mit den Ketzergebeinen gestellt, an sie die Bilder der in effigie zu Verbrennenden gelehnt.
Der Generalinquisitor von Toledo hatte auf seinem Thronsessel Platz genommen. Er war ein feister gemütlicher Prälat, der ohne Begeisterung tat, was er tun mußte, und sich schon auf das Mittagessen freute. Zur Feier des Tages sollte es gebratene Gans mit glasierten Kastanien geben. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Doch schnell besann er sich auf seine Pflicht und hob die rechte Hand. Die Knechte der ›Santa Hermandad‹ schleuderten ihre Fackeln auf den brasero und im selben Augenblick rief einer der Verurteilten: »Ich bereue! Gott, vergib mir, ich bereue!«