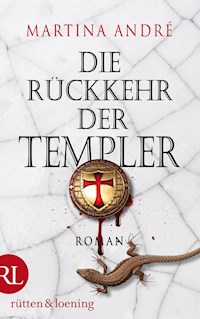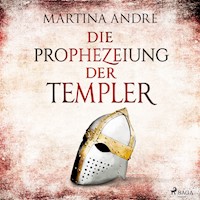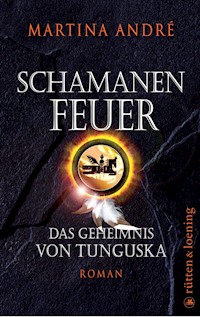
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Himmel in Flammen.
Sommer 2008. Hundert Jahre sind vergangen, seit am sibirischen Fluss Tunguska eine gigantische Explosion stattgefunden hat. Die Wissenschaftlerin Viktoria Vanderberg will das Rätsel der Detonation endlich lösen. Als sie beinahe tödlich verunglückt, rettet sie ein Mann, in den sie sich sofort verliebt: Leonid, Nachfahre eines Schamanen. Obwohl ihn seine Großmutter warnt, Nachforschungen anzustellen, will er Viktoria nicht im Stich lassen – vor allem nicht, als rätselhafte Morde geschehen ...
Ein spannender Roman über eines der größten Rätsel der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Martina André
Martina André, Jahrgang 1961, lebt mir ihrer Familie bei Koblenz. Im Aufbau Taschenbuch Verlag erschien von ihr der Bestseller »Die Gegenpäpstin«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Schamanenfeuer - Das Geheimnis von Tunguska« (Verlag Rütten & Loening).
Informationen zum Buch
Mysteriös Und Atemberaubend
Sommer 2008. Hundert Jahre sind vergangen, seit am sibirischen Fluss Tunguska eine gigantische Explosion stattgefunden hat. Die Wissenschaftlerin Viktoria Vanderberg will das Rätsel endlich lösen. Als sie beinahe tödlich verunglückt, rettet sie ein Mann, in den sie sich sofort verliebt: Leonid, Nachfahre eines Schamanen. Obwohl ihn seine Großmutter warnt, Nachforschungen anzustellen, will er Viktoria nicht im Stich lassen – vor allem nicht, als rätselhafte Morde geschehen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina André
Schamanenfeuer
Das Geheimnis von Tunguska
Roman
Inhaltsübersicht
Über Martina André
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Personenverzeichnis
Begriffserklärung
Nachwort – Danksagung
Impressum
Für Viktoria
Am frühen Morgen des 30. Juni 1908 ereignete sich in Sibirien im Gebiet der Steinigen Tunguska eine verheerende Explosion, deren Auswirkungen in halb Europa zu spüren waren und deren genaue Ursache bis heute nicht geklärt werden konnte. Hunderte von Theorien wurden in der Folgezeit entwickelt, und zahlreiche Wissenschaftler kamen zu den verschiedensten Auffassungen über den tatsächlichen Grund des Unglücks. Bis heute bleibt Raum für die unterschiedlichsten Spekulationen, und es ist fraglich, ob man jemals die ganze Wahrheit erfahren wird …
Prolog
»Einen ungläubigen Menschen von einem Wunder zu überzeugen, ist immer eine schwierige Sache. Es gehört zu seiner Natur, dass er es selbst erlebt haben muss, bevor er es glauben kann.«
(Aslan Kondrashov, Physiker 1905)
Am frühen Morgen des 30. Juni 1908 strich ein laues Lüftchen um meine Nase. Es roch nach Sommer und Frieden, und nichts deutete auf jene Katastrophe hin, die uns schon bald darauf heimsuchen sollte.
Für einen Moment ließen mich die warmen Strahlen der aufgehenden Sonne vergessen, dass ich nicht in Sankt Petersburg, sondern inmitten der sibirischen Taiga saß. Bereits früh um fünf kletterte ich auf den gut zwanzig Meter hohen Antennenmast, um die Sicht und die Wetterverhältnisse zu prüfen. Der Himmel zeigte sich in reinstem Blau, und der Funkkontakt zum Luftschiff und zu meinen Kameraden in der Basisstation am Fuße des Turms verlief entsprechend einwandfrei. Aslan, der unsere Mission zusammen mit Pjotr überwachte, hatte mir mehrfach bestätigt, dass unser Experiment keinerlei Kurskorrektur bedurfte, um die Versuchsstrecke von sechshundert Werst in einem Rutsch zu bewältigen. Also stimmten meine Berechnungen, und dem zeitgerechten Empfang des silbernen Boliden würde nichts mehr entgegenstehen.
Das Szenario, das folgen sollte, war bis ins kleinste Detail geplant.
Vor der Detonation blieb für alle Beteiligten genug Zeit, um den Schutzraum auf dem Aussichtshügel aufzusuchen. Ich sollte den weiteren Ablauf des Experiments unterhalb davon im Bunker koordinieren.
Suchend blickte ich in die Ferne und stellte mir die Ankunft des geflügelten Feuerpferdes vor – wie Maganhir, der Schamane, unsere waghalsige Konstruktion getauft hatte. Es sei ein Symbol der Kraft und werde den Schutz der Geister beschwören, verkündete er uns mit sonorer Stimme. Welche Geister das waren, verriet er uns nicht, und dass wir nicht danach fragten, sollte sich schon bald als nicht wiedergutzumachender Fehler erweisen …
(Nachtrag aus dem Tagebuch des Leonard Schenkendorff, Mai 1909)
1
22. Januar 1905, Sankt Petersburg – Blutsonntag
Ein rhythmisches Kratzen weckte Leonard Schenkendorff unsanft aus einem traumlosen Schlaf. Blinzelnd kam er zu sich. Der Blick zum vergitterten Fenster schmerzte in seinen Augen, trotz der Eisblumen auf der Scheibe, die das fahle Winterlicht dämpften. Jakov Eisenstein, ein alter Jude, dem das Haus gehörte, in dessen winziger Kellerwohnung Leonard nicht nur wohnte, sondern auch experimentierte, befreite den Eingang wie beinahe jeden Morgen mit einem Reisigbesen vom frisch gefallenen Schnee.
Die Spiralfedern des Sofas ächzten, als Leonard sich streckte, und dabei dröhnte sein Schädel so arg, als ob er soeben einen Zusammenstoß mit einer dreispännigen Troika überstanden hätte. Schnaubend sog er die kalte Zimmerluft ein. Es stank nach abgestandenem Rauch und nach einer ganzen Wagenladung Wodka. Ein Betrunkener hatte ihm in der Nacht zuvor auf dem Nachhauseweg von einem der finstersten Viertel Sankt Petersburgs eine halbe Flasche des traditionellen Gesöffs über seinen guten Wollmantel gekippt.
Jekatherina Alexejewa Davydova hatte keine Ruhe gegeben und ihn am Abend gegen seinen Willen in das Hinterzimmer einer schummerigen Hafenkneipe geschleppt – unten an der kleinen Newa und damit viel zu weit weg von Bohrmann und Conradi, den vornehmen Cafés am Newskji-Prospekt, wo man nur französisch sprach und die meist adligen Studienkollegen seiner Verbindung mit den feinen Damen der Petersburger Gesellschaft bei einer Tasse Schokolade flirteten.
Katja, wie er seine grazile, aber zugleich dickköpfige Freundin liebevoll nannte, zählte nicht zu dieser Sorte von Frauen. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen; ihre Familie beherbergte mit einer ganzen Schar von politisch aufgeheizten Verwandten ein regelrechtes Rebellennest. Leonard sah es nur als eine Frage der Zeit, bis man den ersten ihrer zahlreichen Brüder an die Wand stellen würde.
Die Zeiten waren gefährlich; am Tag zuvor hatte eine Protestkundgebung der aufständischen Arbeiter die andere gejagt. Bis in die späten Abendstunden hinein hatte die Umgebung von Sankt Petersburg regelrecht unter dem Ansturm marodierender Demonstranten gekocht. Polizisten und Kosaken streiften unablässig durch die Viertel, und obwohl soweit alles ohne größere Vorkommnisse zu verlaufen schien, war es hier und da zu Zusammenstößen und Verhaftungen gekommen. Es hieß, wegen des andauernden Generalstreiks hätten bis zu einhundertfünfzigtausend Menschen ihre Arbeit niedergelegt. Der Russisch-Japanische Krieg, der seit 1904 wütete, bürdete den Arbeitern immer weitere Belastungen auf – was nicht ohne Wirkung geblieben war.
Leonard hatte als Angehöriger einer deutschen Minderheit und angesehener Student am Polytechnischen Institut der Universität von Sankt Petersburg kaum etwas mit den Arbeiteraufständen zu tun, dennoch war er Katja in der schützenden Dunkelheit zu einer heimlichen Versammlung der Bolschewiki in dieses verlauste Kellerloch gefolgt.
Ihr Aussehen trug Schuld daran, dass er allem Anschein nach seinen Verstand verloren hatte, als er ihr vor Monaten zum ersten Mal begegnet war. Bei einer der üblichen, unangekündigten Passkontrollen vor dem Gostinnyj Dwor, dem größten Handelskontor von Sankt Petersburg, hatte sie sich vergeblich gegenüber einem finster dreinblickenden Polizisten auszuweisen versucht. Als feststand, dass sie ohne Papiere unterwegs war, hatte Leonard sie kurzerhand als seine Ehefrau ausgegeben, bevor der Uniformierte sie zur Personenfeststellung ins nächstbeste Reviergefängnis schleppen konnte. Seitdem hatte Katja ihn als ihren Schutzengel engagiert, und das schien auch nötig, sympathisierte sie doch mit einem Verein revolutionierender Bolschewiki, deren Anführer, ihr ältester Bruder Alexej Alexejewitsch Davydov, vor keiner Provokation zurückschreckte. Im Gegensatz zu seiner zierlichen Schwester war er ein Mann von grobem Wuchs, der seine mitunter gewalttätige Abneigung gegen das Zarenreich bei jeder sich bietenden Gelegenheit kundtat, etwas, das ihn nicht nur seine Freiheit kosten konnte. Schließlich weilten seine eigentlichen Vorbilder nicht ohne Grund im sicheren Schweizer Exil.
Leonards Angst, dass seiner zarten Freundin im Gemenge all jener aufbrausenden Männer etwas zustoßen könne, war fortan zu groß, als dass er sie allein umherlaufen ließ. Zumal ihr stets betrunkener Bruder und seine nicht weniger fragwürdigen Kumpane keinen guten Einfluss auf sie ausübten.
Kaum jemand aus Leonards Kollegenkreis wusste von dieser Liaison, geschweige denn seine Eltern in Königsberg, die ihm nach wie vor nicht nur das Studium, sondern auch den Lebensunterhalt finanzierten und ihn selbstverständlich auf dem Pfad der Tugend wähnten.
Ein leiser Seufzer und eine zarte Regung unter der verschlissenen Daunendecke riefen ihm ins Bewusstsein, dass ihm das Bett an diesem Morgen nicht allein gehörte.
Langsam wie eine Schlange bahnte sich Katjas kleine, geschickte Hand einen Weg zu seinem besten Stück und erweckte den in sich zurückgezogenen Geist zu neuem Leben. Ein helles Kichern folgte, und das blühende, mit Sommersprossen übersäte Gesicht einer kaum zwanzigjährigen Schönheit mit großen dunklen Augen und langem, tizianrotem Haar streckte sich ihm fordernd aus einem Wust von Kissen entgegen.
»Küss mich, Leonard Michailowitsch Schenkendorff!« Ihr rosiger Mund wirkte unschuldig, während sie gleichzeitig sein anschwellendes Glied wie einen kampfbereiten Kosakensäbel umfasste. »Mir ist kalt, wärme mich«, bettelte sie mit ihrer weichen einschmeichelnden Stimme. Dabei schmiegte sie sich nackt, wie sie war, so fest an seinen harten Körper, dass ihm der Atem wegblieb. Für einen Moment zog er sie mit einem Arm zu sich heran und liebkoste mit der anderen Hand ihre festen Brüste, die ihn in Größe und Form an reife Zitronen erinnerten. Genüsslich neigte er seinen Kopf zu ihnen hinab und saugte an den aufragenden Spitzen. Bereitwillig spreizte sie ihre Schenkel und gab ihm damit zu verstehen, dass sie längst noch nicht genug von ihm hatte. Ein schneller Blick zur Kommode versicherte ihm, dass die dort liegende Schachtel mit den Zigaretten halb voll, die mit den teuren französischen Kondomen dagegen längst aufgebraucht war. Ihre Augen waren seinem Blick gefolgt, und ohne Kommentar zog sie ihn noch näher zu sich hin, bis sein Glied ihre Scham berührte.
»Wenn du mich schwängerst, wirst du mich endlich heiraten«, säuselte sie. »Dann werde ich später einmal eine Frau Doktor sein. Glaubst du, meine Mutter wäre stolz auf mich?« Seine Antwort wartete sie nicht ab. Ihr Mund nahm von seinem Besitz, und ihre kleine Zunge schob sich zielsicher zwischen seine Lippen. Sie küsste ihn so lange und genüsslich, bis sie endlich Luft holen musste. »Wenn sie wüsste, was für ein Schwiegersohn auf sie wartet …«, hauchte sie, und während sie sich ihm immer weiter entgegenpresste, vergaß er alle guten Vorsätze.
»Katjuscha …« Es war mehr ein verzweifeltes Flüstern als ernsthafte Gegenwehr, als er kraftvoll und gleichzeitig willenlos in sie eindrang. Zitternd fanden sie zu einem langsamen, aber stetigen Rhythmus, und Leonards ernsthaft gefasste Absicht, vorsichtig zu sein und sich rechtzeitig vom Ort des Geschehens zurückzuziehen, bevor ein Unglück geschah, schwand von Minute zu Minute. Trotz ihrer zierlichen Gestalt entwickelte Katja eine erstaunliche Kraft, wenn sie etwas wollte, und so hielt sie seine Lenden fest mit ihren schmalen Schenkeln umklammert, als sie spürte, dass er sich nicht länger beherrschen konnte. Laut stöhnend entlud er sich in ihr zuckendes Fleisch, während sie ihm den Rücken zerkratzte und ihn mit spitzen, schluchzenden Schreien anfeuerte.
Was ihm blieb, war neben einer tiefen Befriedigung ein schlechtes Gewissen und eine Ahnung von aufrichtiger Liebe, der ein krönender Abschluss durch den heiligen Bund der Ehe verwehrt bleiben würde, ganz gleich, was noch folgen sollte.
Während Leonard schwer atmend auf dem Rücken lag, erhob sich Katja mit Leichtigkeit und schlüpfte in seinen wärmenden Hausmantel. Mit der Eleganz einer großen Dame zündete sie sich wenig später eine Papirossa an, die sie gekonnt auf ein langes Elfenbeinmundstück aufsetzte. Danach befeuerte sie, die Zigarette im rechten Mundwinkel wippend, mit ein paar Handgriffen den Bollerofen mit Kohlestücken aus einem geflochtenen Weidenkorb – so lange bis ein wohliges Feuer prasselte. Wie selbstverständlich setzte sie den Suppenkessel darauf und legte zwei trockene Weizenkringel zum Rösten auf die gusseiserne Ofenplatte. Barfuß durchstreifte sie die kleine Studentenbude, die mit einem dicken, abgewetzten roten Teppich ausgelegt und vollgestopft war mit allerlei technischem Gerät, so dass kaum Platz zum Leben blieb. Neben dem Sofa und einem alten Nussbaumschrank mit zwei Türen nahm ein langer Tisch, der mitten im Zimmer stand, den meisten Platz in Anspruch. Auf dessen großzügiger Arbeitsfläche hielten sich unter einem schützenden Leinentuch allerlei seltsame Dinge verborgen. Oszillatoren, Transformatoren, dazwischen Stromkreisregler – verbunden mit einer metallischen Kupferleitung, die unter dem Laken verbotenerweise nach draußen führte. Durch ein geheimes Rohr in der Wand zapfte sie der noch jungfräulichen elektrischen Straßenbeleuchtung von Sankt Petersburg einen nicht unerheblichen Anteil von Strom ab.
»Nicht anfassen!«, rief Leonard beinahe panisch, als Katja sich anschickte, den Zipfel des Leinentuches an einer Ecke zu lüften, und Teile der Konstruktionen gefährlich ins Wanken gerieten.
Trotzig stieß sie den Rauch zwischen ihren vollen Lippen heraus und schüttelte verständnislos den Kopf. »Was soll das werden?«, fragte sie und lächelte provokativ. »Alexej hat mich gefragt, ob du uns mit deinem Wissen eine Bombe bauen könntest. Eine, die den ganzen Zarenpalast hinwegfegt und die Peter-und-Pauls-Festung noch dazu.« Wieder lachte sie, kehlig und noch lauter, als sie Leonards erschrockene Miene registrierte.
»Sprich nicht so«, schalt er sie. »Eines Tages wird es mit deinem feinen Bruder noch ein schlimmes Ende nehmen.«
»Die Bolschewiki werden den Zaren erst lehren, was es heißt, wenn man die Nöte des Volkes ignoriert, wenn man Pasteten frisst, während die Kinder auf der Straße ihre Hungerbäuche vor sich herschieben.« Ihr Blick war herausfordernd. »Meine Mutter ist aus ihrer Anstellung entlassen worden und Alexej auch. Wusstest du das schon?«
Wieder zog sie hastig an ihrer Zigarette, während sie eine Hand in die Taille stemmte und provokativ eine ihrer Hüften soweit vorschob, bis ein nacktes, makelloses Bein aus dem Schlitz des Hausmantels hervorlugte. »Ich werde noch meine Haut verkaufen müssen, damit meine Familie satt wird.« Lasziv legte sie die Zigarette zur Seite und streifte den Mantel ab. Ohne Hemmung präsentierte sie Leonard ihren elfenbeinfarbenen Körper und grinste frech, als sie sah, wie er auf ihr rötlich gelocktes Schamhaar starrte. In der Nähe des wärmenden Ofens nahm sie sich alle Zeit der Welt, um sich anzukleiden, und legte dabei einen gekonnten Striptease hin – wenn auch umgekehrt. Zuerst die dünnen, wollenen Strümpfe, die sie sorgfältig bis zu den Oberschenkeln aufrollte, dann das Korsett, bei dessen Schnürung sie Leonard anstandslos mit ihrer nackten, weißen Kehrseite um Hilfe bat. Erst danach stieg sie – mit einem Blick des Bedauerns – in ihre langen Unterhosen und schlüpfte anschließend in ihr grobes, geblümtes Wollkleid.
»Das werde ich nicht zulassen«, stieß Leonard beinahe atemlos hervor, während er, halb in die Daunendecke eingehüllt, auf dem Rand des Sofas kauerte und sie immer noch wie hypnotisiert anstarrte. Katja würde es kaum an williger Kundschaft mangeln, überlegte er aufgebracht. »Notfalls lasse ich mein Abschlusssemester sausen und verlege es aufs nächste Jahr. Mit dem gesparten Geld können wir eine Weile überleben.«
»Hast du wir gesagt?« Katja ließ die Hand, in der sie die Zigarette hielt, sinken und sah ihn ernst an. Dann drückte sie den Stummel in einem herumstehenden Unterteller aus. Es roch verbrannt. Rasch nahm sie die gerösteten Baranki, bevor sie vollends verkohlten, vom Ofen und legte das runde Gebäck mit spitzen Fingern in einen von jeweils zwei Suppentellern, die sie zuvor von einem Wandregal genommen hatte. Dann ergriff sie eine Kelle von einem Wandhaken und rührte solange in der Suppe herum, bis ein paar letzte, feste Brocken an die Oberfläche wirbelten.
Vorsichtig füllte sie die Teller mit dem dampfenden Sud und stellte sie zum Abkühlen auf der Kommode ab. Mit einem Seufzer setzte sie sich zu Leonard auf die knarrende Bettstatt.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie und nahm sein bärtiges Gesicht zwischen ihre warmen Hände. Sie küsste ihn zärtlich und fuhr danach mit ihren Lippen über seine hellblonden, akkurat getrimmten Kinnhaare. »Ach, Leo, du bist ein echter Nemez«, säuselte sie leise und lächelte verklärt. »Deutsch bis ins Mark. Groß, blond und blauäugig, und wer sich in Not befindet, kann sich hundertprozentig auf dich verlassen.«
Nach dem spärlichen Frühstück, das aus halb verkohlten Baranki und drei Tage alter Gemüsebrühe bestand, folgte Leonard nur widerwillig Katjas Aufforderung zum Aufbruch, indem er sich ebenfalls anzog.
»Wir müssen los«, drängte sie. »Alexej wartet auf mich.«
»Wir sollten hierbleiben und uns im Bett verkriechen, anstatt in diesen Wahnsinn hinauszuziehen«, erwiderte Leonard mit einem bitteren Zug um den Mund, während er seine winterliche Aufmachung mit Galoschen, Mütze und Schal komplettierte. Zögernd griff er nach seinem stinkenden Mantel. Auch schon egal, dachte er. Dort, wo sie hinwollten, war Alkoholgestank das geringste Übel.
Dann hielt er einen Moment inne, während er in Katjas erwartungsfrohes Gesicht blickte. Ihr weiches, langes Haar hatte sie zu einem Knoten aufgesteckt, und darüber trug sie einen modischen, schwarzen Wollhut, der wie eine längliche Pilzkappe ihr zartes Gesicht umrahmte. Ein Lächeln huschte über Leonards Lippen. Seine Augen glitten über ihre groben Handschuhe und den abgetragenen Pelzmantel. Zu gerne hätte er ihr einen neuen spendiert, doch dafür fehlte ihm leider das Geld.
»Beinahe hätte ich es vergessen«, sagte er und drehte sich zu seinem Kleiderschrank um. Als er sich ihr erneut zuwandte, hielt er ihr ein braunes, knisterndes Paket entgegen.
»Für mich?« Erstaunen lag in ihren braunen Augen. »Ich habe doch erst im März Geburtstag.«
»Ich weiß, solange wollte ich aber nicht warten. Bis dahin könnte es zu spät sein.«
»Wie meinst du das?« Mit einem verunsicherten Blick öffnete sie das Paket so vorsichtig, als befände sich ein gefährliches Tier darin. In einer Hinsicht behielt sie Recht. Es war ein Tier – doch es konnte sich nicht mehr regen.
»Ein Handwärmer aus schneeweißem Polarfuchs!« Zärtlich strich Katja über den kostbaren Pelz. Leonard half ihr die glänzende, gedrehte Kordel um den Hals zu legen, an dem der Muff aufgehängt nicht nur für warme Hände sorgte, sondern jedem noch so alten Überkleid eine gewisse Eleganz verlieh.
»Leonard!« Atemlos fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn stürmisch. Er räusperte sich gerührt und entzog sich sanft ihrer Umarmung. Ohne ein Wort wandte sie sich schließlich zur Tür. Ihre Wangen glühten rosig vor Stolz, als sie die engen Stiegen in den eiskalten Flur vorausging.
Leonard folgte ihr mit einem unguten Gefühl im Bauch. Pater Georgi Gapon, die Galionsfigur des augenblicklichen Widerstandes, hatte zu einer Kundgebung vor dem Winterpalast des Zaren aufgerufen, und so wie es hieß, würden ihm Tausende, wenn vielleicht Hunderttausende folgen. Und Jekatherina Davydova würde eine von ihnen sein. Mit einem leisen Seufzer begleitete Leonard sie nach draußen.
Vor der Haustür empfing sie eine lausige Kälte. Die Schneedecke war dagegen für diese Jahreszeit erstaunlich dünn. Ein undurchdringlicher Nebel zog von der Newa über die Stadt und machte es den Sonnenstrahlen unmöglich, den gefrorenen Boden aufzuweichen.
Jakov Eisenstein zog missbilligend eine seiner buschigen Brauen hoch, als er sah, dass Leonard in weiblicher Begleitung das dreistöckige Mietshaus verließ und sich anschickte, mit ihr die Sytninskaja Ulitsa hinunterzueilen. Mit einem Schnauben stellte er den Besen beiseite und rückte seinen Streimel, den obligatorischen pelzumrandeten Hut der orthodoxen Juden, zurecht, bevor er Leonards Ärmel zu fassen bekam und ihn zwang, stehen zu bleiben.
»Wissen Ihre Eltern eigentlich, was Sie in Petersburg treiben?« Seine Stimme war alt und krächzend – aber nicht weniger schneidend. »Ich dulde es nicht, wenn man in meinem Haus Damenbesuch empfängt und schon gar nicht unter solch unmoralischen Umständen.«
Jekatherina rümpfte ihr Näschen und ignorierte die Bemerkung des Alten geflissentlich. Leonard, an dessen Arm sie sich untergehakt hatte, war für einen Moment pflichtbewusst stehen geblieben. Dass ihn die Äußerungen des Alten peinlich berührten, konnte man ihm mühelos ansehen.
»Ich denke, über dieses Thema sollten wir heute Abend, wenn ich zurück bin, unter vier Augen reden«, antwortete er Eisenstein leise. »Vielleicht sind Sie mit einer kleinen Mieterhöhung einverstanden?«
Der Alte ließ von ihm ab und wandte sich zeternd um. Verstehen konnte man ihn nicht. Nur an seinem bebenden weißen Bart, der sich auf seiner Brust in zwei gespinstartige Spitzen teilte, war zu sehen, dass er kopfschüttelnd etwas in sich hineinmurmelte.
Es war erst Mittag; die Kundgebung sollte in den frühen Nachmittagsstunden auf dem weitläufigen Gelände vor dem Zarenpalast stattfinden.
Schon jetzt waren zahllose Menschen, junge und alte, auf den Beinen; Fahnen schwingend und mit Transparenten versehen; Mütter mit ihren Kindern, aber auch Väter, in deren Gesichtern sich eine Mischung aus Furcht, Hoffnung und Verzweiflung spiegelte. Dazwischen drängten sich Verkäufer, die mit ihren beheizbaren Bauchläden geröstete Sonnenblumenkerne verkauften, und ältere Frauen, die Baranki und Würste feilboten, dazu Kwass, den traditionellen Brottrunk, den sie aus abgescheuerten Holzkannen ausschenkten.
Überall lagen Flugblätter auf den Straßen, die eine Bittschrift enthielten, die Pater Gapon in Gegenwart des Zaren vorzubringen beabsichtigte: »Wir, die Arbeiter der Stadt Sankt Petersburg, unsere Frauen, Kinder und hilflosen alten Eltern, sind zu Dir, Herrscher, gekommen, um Gerechtigkeit und Schutz zu suchen. Wir sind verelendet, wir werden unterdrückt, über unsere Kraft mit Arbeit belastet, man verhöhnt uns, lässt uns nicht als Menschen gelten. Man behandelt uns wie Sklaven. Wir duldeten all dies, aber man stößt uns immer weiter und weiter in den Pfuhl der Armut, der Rechtlosigkeit und der Unwissenheit. Despotismus und Willkür würgen uns, und wir ersticken. Unsere Kräfte versagen, Herrscher, unsere Geduld ist erschöpft. Wir sind bei dem furchtbaren Augenblick angelangt, in dem der Tod willkommener ist als die Fortsetzung der unerträglichen Qualen …«
Angeblich sollte es eine friedliche Kundgebung werden, begleitet von frommen Gesängen und stetig dahin gemurmelten Gebeten. Für mehr Rechte für die Bauern und um die Abschaffung der heimlichen Leibeigenschaft wollte man bitten. Denn offiziell erfreuten sich die Menschen in Russland einer unumstößlichen Freiheit, doch in Wahrheit waren die meisten von ihnen geknechtete Kreaturen, die jeden Tag mit ihrer Hände Arbeit ums nackte Überleben kämpften.
Leonard ließ sich von Katja in die entgegengesetzte Richtung mitziehen. Offenbar wusste sie, wo sie hinwollte. An hohen Mietskasernen und unzähligen Teestuben vorbei ging es Richtung Wassiljewskij-Insel, dort, wo die alte Universität lag und die Straßen keine Namen hatten, sondern in Linien unterteilt waren. An berittenen Kosaken vorbei drängten sie sich über den Tutschkow-Most, eine verhältnismäßig breite Hebe-Brücke, die über die kleine Newa führte und die Petrograder Seite, auf der Leonard wohnte, mit der Universitätsinsel verband. Im Laufschritt eilten sie über den Malyj-Prospekt.
»Kannst du mir sagen, wo du hin willst?« Leonard fühlte sich unbehaglich. Etwas Bedrohliches lag in der Luft. Vielleicht war es der Hauch der Revolution, vielleicht aber waren es auch die Ausdünstungen von all den armen und heruntergekommenen Demonstranten, die sich ihnen abgemagert und zerlumpt entgegendrängten.
»Ich habe meinem Bruder versprochen, ihn am Friedhof hinter der Kirche der Heiligen Mutter zu treffen.«
»Sag mir, was er vorhat!« Leonard war stehen geblieben, seine Hände gruben sich in Katjas schmale Oberarme. Er war ein ganzes Stück größer als sie und beugte sich weit genug hinunter, bis sich ihre Atemwölkchen vermischten. Sein Blick war so konzentriert auf ihre dunklen Augen gerichtet, als ob er sie beschwören wollte.
»Lass mich los!«, giftete sie ihn wütend an. »Du tust mir weh. Und außerdem geht es dich nicht mehr an als eine Ladung Pferdemist, was Alexej mit mir ausmacht. Solange wir nicht verheiratet sind, gehörst du nicht zur Familie.«
Ihre Worte trafen ihn hart, und für einen Moment stellte sich Leonard die Frage, ob ihn diese Feststellung traurig oder zornig machte. Mit einem Seufzer setzte er ihre Begleitung fort, als Katja in ihrem flatternden Mantel regelrecht davonstob, die kleinen Füße in den groben Stiefeln, so schnell wie der Kleine Muck in Hauffs Märchen.
Doch es war keine Märchenwelt, in die sie sich hineinbegab. Das wurde Leonard spätestens klar, als sie ihr Ziel erreichten. Ein Mitglied der Davydov-Bande, wie Leonard Alexejs persönliche Schergen nannte, wartete bereits auf sie, genauer gesagt, auf Katja.
»Hast du die Pläne bei dir?«, fragte er.
Katja nickte kaum merklich und zog ein zerknittertes Stück Papier aus ihrer Manteltasche. Leonard schnappte nach Luft, als er sah, dass es sich um eine ziemlich genaue Beschreibung der einzigen hier befindlichen Waffenwerkstatt handelte. Die Firma Schaff war ein deutsches Traditionsunternehmen, das unter deutscher Leitung nicht nur exzellente Lang- und Faustfeuerwaffen herstellte, sondern sie auch wartete und reparierte. Verteilt auf mehrere Gebäude und Etagen gab es Lager- und Produktionshallen, alle umgeben von einer steinernen Mauer.
Eine kahle Platanenallee säumte den Weg vom Friedhof zur Fabrik, und im Schutz der riesigen Bäume entschwand der Mittelsmann mit dem hastig übergebenen Papier. Raben flogen krächzend auf und ließen sich schutzsuchend in einem weiter entfernten Baum nieder. »Sag nur, sie wollen in die Fabrik?« Leonard spürte, wie der Boden unter ihm wankte. War Katjas Bruder tatsächlich so verrückt, ein Waffenlager zu überfallen? Und wenn ja, warum? Angst wallte in ihm auf. Wenn Davydov und seine Anhänger zu Gewehren und Pistolen griffen, würde es eine Katastrophe geben. Leonard ahnte, dass die Dritte Abteilung, der berüchtigte Geheimdienst des Zaren und seine berittenen Kosaken bereits darauf warteten, dass auch nur einer von den Demonstranten die Nerven verlor. In den Gesichtern all jener bis an die Zähne bewaffneten Männer hatte er die Nervosität erkennen können, die ihnen innewohnte und die einen braven Familienvater ohne Probleme in einen bösartigen Dämon verwandeln konnte.
Im Nu würde es ein Blutbad geben. Dass sich in der Menge viele Kinder und alte Menschen befanden, hatte Leonard auf dem Weg hierher ausmachen können.
»Wir müssen zu deinem Bruder«, herrschte er Katja an und zog sie mit sich. »Ich werde ihm die Sache ausreden.«
»Er wird sich von dir nichts sagen lassen«, keuchte sie atemlos, während sie die Straße entlang hasteten.
»Wenn er tut, was ich vermute, wird er sterben! Und nicht nur er!« Leonards Stimme drückte seine ganze Verzweiflung aus. Nur noch ein paar Meter, und sie erreichten das hölzerne Tor, welches in den Innenhof der Fabrik führte. Leonard schrak jäh zurück. Der zuständige Wachmann, ein schmächtiger alter Kerl in einer verblichenen Uniform, der normalerweise den Eingang sicherte, lag tot oder besinnungslos in seinem Häuschen. Holz splitterte, und von weitem konnte Leonard erkennen, dass ein ganzer Trupp Männer mit einer Eisenbahnschwelle als Ramme das hölzerne Eingangstor zum Hauptlager eroberte.
»Alexej!«, brüllte Leonard so laut, dass ihm beinahe die Stimme versagte. Er ließ Katja stehen und rannte auf die Männer zu.
»Nicht! Leo! Bleib stehen!«, gellte es hinter ihm her, als er durch die hufeisenförmig angelegten Hallen wie durch einen Kessel lief.
Alexejs Leute, mindestens fünfzig Mann, kümmerten sich nicht um den brüllenden Deutschen und schon gar nicht um dessen Begleiterin. Zielstrebig, wie sie losstürmten, wussten sie genau, was sie wollten. Und so tauchten sie nur Minuten später aus dem zerstörten Eingang wieder auf – einer nach dem anderen, mit Gewehren und Pistolen in ihren schwieligen Arbeiterhänden. Die Mützen allesamt tief in die entschlossenen Gesichter gezogen, sahen sie aus wie Soldaten auf einem siegreichen Feldzug. Doch das gegnerische Heer ließ nicht lange auf sich warten. Berittene Polizisten, den Aufständischen an Zahl mindestens ebenbürtig, umkreisten die Waffenfabrik. Schneller als Leo sich orientieren konnte, eröffneten sie das Feuer. Sein einziger Gedanke galt Katja. Wie angewurzelt stand sie völlig frei in der Einfahrt des Hofes.
»Runter!«, schrie Leonard, doch seine Stimme war zu heiser, um noch eine Wirkung zu entfalten, und so blieben ihm nur seine vom vielen Laufen durchtrainierten Beine, um Katja rechtzeitig zu erreichen, bevor sie eine Kugel traf. Es zischte und krachte. Trommelfeuer ratterte über die leer gefegten Plätze.
Davydovs Männer bewegten sich wie flüchtende Ratten um Mauern und Ecken, während sie aus der Deckung heraus das Feuer der Polizisten erwiderten.
Leonards Herz klopfte zum Zerbersten, als er Katja endlich erreichte und sie zu Boden warf. Halb unter ihm begraben, lag sie wie hypnotisiert, unfähig sich zu bewegen.
»Komm! Wir müssen hier verschwinden«, zischte er und packte sie an der Kapuze ihres Mantels. Auf Knien rutschten sie zum nahe gelegenen Wachhäuschen, während ihnen die Geschosse nur so um die Ohren pfiffen. Erst im Schutz der Hütte kamen sie wieder zu Atem. Der Wächter war tatsächlich tot. Er stierte sie aus leeren Augen an. Seine Jacke war auf Höhe der Brust blutdurchtränkt.
Katja schluchzte auf und barg ihren Kopf an Leonards Schulter.
Unentwegt hallten Schüsse von den Mauern wider. Energische Männerstimmen brüllten Befehle, dazu das Wiehern der Pferde, deren Hufe in dumpfem Galopp über die verschneiten Straßen donnerten. Im Nu schien das ganze Gebäude umstellt zu sein.
»Verdammt!«, stieß er hervor. »Wir müssen hier raus!«
Plötzlich huschte ein Schatten zur Tür hinein. Es war Alexej Davydov. In seiner Hand lag ein schwerer Trommelrevolver und in der anderen ein Schnellfeuergewehr.
»Los, los«, keuchte er. »Ich zeige euch einen Fluchtweg. Folgt mir!«
Leonard war für einen Moment unsicher. Nichts rechtfertigte ein noch so geringes Maß an Vertrauen in diesen Taugenichts. Und doch blieb ihnen kaum etwas anderes übrig, um einen Ausweg aus diesem Chaos zu finden. Hinter einer dichten Hecke folgten sie Alexej in geducktem Laufschritt in Richtung Nebereznaya Ulitsa, um unbeschadet zum Friedhof zu gelangen. Vielleicht konnten sie sich dort in der Kirche verstecken, hinter dem Altar oder darunter, ganz gleich wo. Hauptsache, sie waren in Sicherheit. Doch als sie die Straße überqueren wollten, stellte sich ihnen ein älterer, fülliger Polizist in den Weg. Sekundenlang starrten sich Davydov und der alte Mann in die Augen, dann erhob der Polizist seine Waffe, um auf Katjas Bruder zu schießen. Ein Schuss krachte. Stöhnend brach der Uniformierte zusammen. Ein Bauchschuss hatte ihn niedergestreckt. Doch es war nicht Alexej, der geschossen hatte.
Katja hielt, weiß wie eine Wand, eine Pistole in Händen, wo auch immer sie diese hergeholt hatte. Für einen Moment stiegen kleine Rauchwölkchen aus der Mündung.
Im Nu waren Berittene im Anmarsch. Leonard dachte nicht nach und achtete auch nicht mehr auf Alexej, der sich ohnehin aus dem Staub gemacht hatte. Er zog das Mädchen von den Füßen und rannte mit ihr davon. Quer über den Friedhof, zwischen mannshohen Marmorengeln und uralten Bäumen konnten sie einen Vorsprung herauslaufen, doch ihre Verfolger blieben ihnen dicht auf den Fersen.
Sie liefen um ihr Leben. Die Kamskaya Ulitsa entlang, dann zwischen Häuserreihen, im Schutz von Ladeneingängen und deren Vorbauten erkämpften sie sich Meter um Meter. Kein Denken mehr daran, sich in irgendeiner Kirche zu verschanzen.
Einen Moment hielt Leonard inne. Das hechelnde Mädchen im Arm suchte er fieberhaft nach einem Ausweg, während er hinter einem Bretterverschlag hervorlugte. Nach Hause wollte er. Sie mussten es schaffen, unbemerkt zu seiner Wohnung zu gelangen. Im Keller des alten Eisenstein würde sie niemand vermuten – zumindest vorerst nicht.
Umgeben von einem Heer von Pilgern, die sich vor der Haseninsel, auf Höhe der Peter- und-Paul-Kathedrale versammeln wollten, schoben sie sich zurück über den Tutschkow-Most. Beinahe erleichtert erreichten sie das gegenüberliegende Ufer.
Doch sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Kosaken bahnten sich Säbel schwingend den Weg über die Brücke, und ihre unerschrockenen Rösser trampelten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Ein Teeverkäufer ging mit seinem Samowar zu Boden und schrie gellend auf, als ihn das überschwappende heiße Gebräu verbrühte. Frauen stießen hysterische Schreie aus. Männer fluchten, und Kinder begannen, lauthals zu weinen. Leonard trieb Katja abermals voran und mischte sich mit ihr unter eine Traube von flüchtenden Menschen, die geradewegs in die falsche Richtung über den breiten Bolschoi-Prospekt stürmten. Hastig bogen er und seine völlig erschöpfte Begleiterin in die Wedenskaya Ulitsa ab. Während die lauten Trillerpfeifen der Straßenpolizisten in einem Echo von den Häuserfassaden schrillten, erreichten Leonard und Katja mit hochroten Köpfen den Kronwerski-Prospekt. Nun waren es nur noch wenige Meter bis zu Leonards Wohnung. Er betete stumm, dass sie unerkannt im Haus verschwinden konnten. Doch auf der davor liegenden Kreuzung bot sich ihm ein abscheuliches Bild. Vier oder fünf Männer in heruntergekommenen Mänteln prügelten auf einen alten, ganz in Schwarz gekleideten Mann ein, der bereits wimmernd am Boden lag. Er hatte seinen Pelzhut verloren, und sein Gesicht war mit Blut besudelt. Der schmutzige, festgetretene Schnee unter seinem Kopf hatte sich rot gefärbt.
»Scheißjuden!«, brüllte einer der Angreifer und trat den Alten erbarmungslos in die Seite. Leonard vergaß für einen Moment seine Flucht. Zweifellos war es Jakov Eisenstein, der sich dort schwer verletzt im Schnee krümmte. Um ihn hatte sich ein Kreis von Schaulustigen gebildet. Mit einer wilden Entschlossenheit durchbrach Leonard den Ring, packte den ersten Kontrahenten an dessen Jacke und riss ihn herum. Mit einem Fausthieb schlug er dem stämmigen Mann die Nase blutig. Der Zweite, der wie die übrigen Kerle von Eisenstein abgelassen hatte, war aufgesprungen und riss Leonard am Kragen seines Mantels. Doch bevor er ihn treffen konnte, hatte Leonard erneut ausgeholt und den Mann mit einem Schwinger unter dem Kinn getroffen. Röchelnd ging der andere zu Boden. Jetzt machte es sich bezahlt, dass Leonard in seiner Studentenverbindung nicht nur den Säbel führte, sondern auch regelmäßig am Faustkampf teilnahm.
Gespannt wie eine Bogensehne stand er da und wartete auf weiteren Widerstand, doch seine Gegner hatten offenbar die Lust an ihrem Opfer verloren und zogen sich fluchend zurück. Leonard ging auf die Knie und packte seinen kauzigen Vermieter vorsichtig bei den Schultern. Eisenstein rührte sich kaum noch, als Leonard dessen Kopf anhob. Plötzlich spürte er die klebrige Nässe, die seine Lederhandschuhe durchtränkte. Der Schädel des Alten war am Hinterkopf zerschmettert.
Katja kauerte neben ihm. Ihr Atem ging stoßweise, und ihre Augen waren geweitet vor Entsetzen. Geistesgegenwärtig hatte sie sich ihres sibirischen Pelzmuffs entledigt und schob ihn dem schwer verletzten Juden unter den Kopf. Doch es nützte nichts mehr. Der weiße Pelz tränkte sich stetig mit Blut, und hilflos mussten Leonard und Katja mit ansehen, wie unter einem letzten, heiseren Flüstern der wasserblaue Blick des Jakov Eisenstein brach.
Mit einem Mal erhob sich eine laute, nach Atem ringende Männerstimme über ihnen.
»Waffen weg! Ihr Rebellenschweine!« Verwirrt schaute Leonard auf und sah, dass sie von Kosaken und Polizisten umstellt waren.
Die Peter-und-Paul-Festung war ein eindrucksvolles Bauwerk, breit wie mehrere Häuserblöcke, mit Mauern so dick, dass man glatt fünf Wände daraus hätte errichten können. Leonard kannte dieses monumentale Gebäude, das in seiner Gestalt einem unregelmäßigen Sechseck glich, nur von außen. Aus dessen Mitte ragte die russisch-orthodoxe Peter-und-Paul-Kathedrale hervor, deren schmaler Turm wie eine aufrecht stehende Nadel wirkte. Mit einem sieben Meter aufragenden Engel auf der Turmspitze war sie das höchste Gebäude von Sankt Petersburg, und bereits seit dem 18. Jahrhundert hatte man in ihrer Obhut die meisten Zaren begraben.
Eines Engels hätte es auch bedurft, als man Leonard zusammen mit Jekatherina in einem geschlossenen Gefangenentransporter in das berüchtigtste Gefängnis von ganz Russland verbrachte.
Die Trubezkoi-Bastion im Südwesten der Festung gehörte mit ihren 36 Einzelzellen auf zwei Etagen zu den meistgefürchteten Einrichtungen des Zarenreiches.
Katja hatte die ganze Zeit über nicht aufgehört zu weinen. Und nachdem man sie auf dem weitläufigen Innenhof von Leonard getrennt hatte, stieß sie einen markerschütternden Schrei aus, der in mehrfachem Echo von den Mauern widerhallte. Leonard musste mit ansehen, dass sie sich wie eine Wilde gebärdete. Ohnmächtig verfolgte er, wie die Gefängniswärter mit unkontrollierten Schlägen dem entwürdigenden Schauspiel ein jähes Ende bereiteten.
Er selbst landete – ohne die geringste Gelegenheit zur Verteidigung – im örtlichen Untersuchungsgefängnis, einem finsteren, feuchten Ort, der sich weitaus schlimmer gestaltete als jeder andere Platz auf dieser abgeschlossenen Newa-Insel, die nur durch eine schmale Brücke zu erreichen war.
Derbe Hände stießen ihn in das unwirtliche Loch und verfuhren mit ihm, wie es ihnen beliebte. Wie betäubt, an Händen und Füßen mit eisernen Ketten gefesselt, nahm er das Geräusch einer zuschlagenden Eisentür wahr.
Zitternd wartete er in der Düsternis zwischen kalten Steinen und schmutzigen Strohmatratzen auf sein weiteres Schicksal.
Die vergangenen Stunden erschienen ihm wie ein unwirklicher Alptraum. Er war nicht fähig, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn, eine Strategie zu entwickeln, wie er aus diesem Schlamassel wieder herauskommen sollte.
Man hatte die Waffe, mit der Katja den Polizisten erschossen hatte, in ihrer Manteltasche entdeckt. In all der Aufregung hatten sie vergessen, den Revolver in die Newa zu werfen. Man beschuldigte Leonard, den Juden erschlagen zu haben. Dabei hätten Dutzende von Zeugen belegen können, dass ihn keine Schuld traf. Doch sie waren alle geflohen, nachdem plötzlich Polizei und Militär aufgetaucht waren.
Stunden vergingen, in denen unzählige Schüsse die Luft zerrissen. Ahnungsvoll vernahm Leonard die Stimmen schreiender Menschen. Wie eine rasende, nicht aufzuhaltende Seuche hatte sich die Schießerei im Waffenlager offenbar über die ganze Stadt verbreitet. Draußen war es längst dunkel geworden. Und so wie es aussah, war er nicht der einzige Neuzugang an diesem Tag. Das Weinen, Zetern und Fluchen wiederholte sich mehrmals, bis es schließlich verebbte und es wieder so still wie in einer Grabkammer war.
Später wurde irgendwann die Tür zu seinem Gefängnis aufgerissen, und die beiden grobschlächtigen Gestalten, die ihn mit Knüppeln derb in die Rippen stießen, damit er sich in Bewegung setzte, waren noch weitaus weniger Vertrauen erweckend als die düstere Umgebung.
Sie trieben ihn, geduckt und viel zu schnell, in eine weitere unterirdische Zelle. Leonard wurde von der unseligen Gewissheit gepackt, dass es sich um so etwas wie eine Folterkammer handeln musste. Den Mantel hatte man ihm längst genommen, als man ihn nach Waffen durchsucht hatte, und nun forderte man ihn mit knappen Worten auf, die Hosen herunterzuziehen.
Als er nicht sofort reagierte, traf ihn ein Knüppelschlag zwischen die Schulterblätter, der ihm den Atem nahm. Keuchend stürzte er bäuchlings auf einen hüfthohen Tisch, an dessen Ende sich eine Aussparung in der Tischplatte befand, gerade so groß, dass sein Gesicht hineinpasste. Einer der Männer nutzte sein ungläubiges Erstaunen und zog ihm die zusammengeketteten Hände nach vorn, während er seine Arme mit dicken Lederriemen an der Platte fixierte. Der Zweite machte kein langes Federlesen und riss ihm die Hosen herunter, ohne Rücksicht darauf, dass Knöpfe absprangen. Den Gürtel hatte man ihm vorher bereits abgenommen. Zu oft kam es vor, dass sich verzweifelte Häftlinge daran erhängten.
Halb nackt bis zu den Waden, lag er auf dem eiskalten Tisch. Den Hintern entblößt, wie zuletzt vor beinahe fünfzehn Jahren, als sein Vater ihn das letzte Mal übers Knie gelegt hatte, um ihn mit bloßer Hand für einen gestohlenen Kuchen zu bestrafen. Doch diesmal ging es nicht um einen Kuchen, und es war auch keine Hand, die ihn schlug. Eine Weidenrute sauste auf ihn herab; der Schmerz war so grausam, dass Leonard das Atmen vergaß und sich die Unterlippe aufbiss. Tränen schossen ihm in die Augen, aber viel schlimmer erschienen ihm die Scham und das Gefühl der Unwirklichkeit, das ihn durchfuhr.
»Ich will einen Advokaten sprechen«, brüllte er wie besinnungslos. »Was ihr hier tut, widerspricht jeglichem Recht und Gesetz!«
Grölendes Gelächter folgte, und der rüde Kerkergeselle dachte nicht daran, Leonards Protest zu erhören.
»Euch Terroristengesindel werden wir das Morden und Bomben schon austreiben«, grunzte er selbstzufrieden.
Fünf, sechs … beim neunten Schlag hatte Leonard aufgehört zu zählen. Vor lauter Pein spürte er gar nichts mehr. Die Haut über seinem Gesäß war aufgeplatzt, und das Blut lief ihm die Hüften hinunter.
Hin und wieder machte sein Peiniger eine Pause und stellte Leonard eine Besserung seiner Lage in Aussicht, wenn er die Namen seiner Hintermänner verraten würde.
Doch was sollte Leonard sagen? Dass Alexej Davydov hinter all ihrem Unglück steckte? Dann hätte er Jekatherina samt ihrer Familie nur noch weiter in den Abgrund gerissen.
Die Tür wurde plötzlich geöffnet; ein bulliger Kerl in den Fünfzigern trat ein. Seine prachtvolle Uniform ließ auf einen Oberst der Zarenarmee schließen, und seine blutunterlaufenen Augen verrieten ein Zuwenig an Schlaf und ein Zuviel an Wodka.
Er trat an den Tisch heran, seine kräftigen Hände griffen in Leonards blonde Locken, wie in ein Schaffell, dessen Qualität er zu prüfen gedachte. Barsch riss er dem völlig erschöpften Deutschen den Kopf in den Nacken und überstreckte dessen Hals, bis der Adamsapfel unnatürlich hervortrat. Ungewollt entwich Leonard ein angstvolles Keuchen, dabei weiteten sich seine Augen wie bei einem Stier, der zur Schlachtbank geführt wird.
»Sieh an«, raunte der Offizier dunkel. »Ein deutscher Studiosus verbündet sich mit den Aufständischen. Wer hätte das gedacht?« Er ließ Leonards Kopf so schnell los, dass dessen Stirn auf die Tischplatte schlug. »Ich dachte immer, die Deutschen seien ein Vorbild an Moral und Ordnung? Sollte sich das vielleicht ändern? Nicht auszudenken, wenn die Zarin davon erfährt. Es würde ihr das Herz brechen.«
»Ich will sofort einen Advokaten sprechen«, stieß Leonard noch einmal verzweifelt hervor. »Mein Vater ist ein angesehener Ingenieur in Königsberg. Er arbeitet für die AEG. Und ich bin ein unbescholtener Student am Polytechnischen Institut von Sankt Petersburg. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ihr könnt mich nicht einfach festhalten und foltern. Das spricht gegen jegliches Recht!«
Die Lippen des Offiziers wurden von einem monströsen rötlichen Schnauzbart verdeckt, der bereits von Silberfäden durchzogen war. Nur an seinen erheiterten Gesichtszügen konnte Leonard erkennen, dass er sich über ihn lustig machte.
»Mein lieber Junge«, begann der Offizier süffisant. »Du hast auf offener Straße einen Juden erschlagen. Und deine kleine Freundin hat einen tapferen Kameraden des Polizeiregiments auf dem Gewissen. Glaubst du ernsthaft, dass deine Herkunft oder deine Verbindungen dir unter diesen Umständen noch etwas nützen? Dein Vater wird wünschen, dich niemals gezeugt zu haben, und deine Universität wird deinen Namen schneller aus den Büchern löschen, als du denken kannst.«
Leonard schloss verzweifelt die Augen, und während erneut Tränen darin aufstiegen, biss er die Zähne zusammen, um nicht aufzuschluchzen.
»In dieser Stadt hat es schon viel zu lange kein Todesurteil mehr gegeben«, bemerkte der Oberst kalt. »Und es wird Zeit, dass sich dieser Zustand grundlegend ändert. Ich frage mich fortwährend, in welchem Zustand sich unsere Justiz befindet, wenn Terroristinnen heimtückische Attentate auf Generäle verüben dürfen und dafür von einer völlig entarteten Gerichtsbarkeit freigesprochen werden. Es dauert nicht lange, dann haben wir Zustände wie zu Zeiten Alexander II. Fehlt nur noch, dass ihr einen Tunnel zum Palast des Zaren buddelt und Dynamit hineinsteckt. Großfürst Wladimir hatte Recht. Es war eine gute Entscheidung, den Zaren aus der Stadt in Sicherheit zu bringen.«
Leonard schluckte. Also war der Zar gar nicht anwesend, und die vielen Menschen, die er auf dem Weg zur Festung am Wegesrand gesehen hatte und die offenbar von übernervösen Militärs erschossen worden waren, hatten ganz umsonst ihr Leben gelassen.
»Der Generalgouverneur höchstselbst wird dafür sorgen, dass man an dir und deiner kleinen Freundin ein Exempel statuiert«, fuhr der Oberst fort. »Noch in dieser Woche wird ein Militärtribunal darüber entscheiden, was mit euch beiden zu geschehen hat. Und seid gewiss, wir werden in dieser Angelegenheit nichts dem Zufall überlassen. Die Bevölkerung und vor allem die Aufständischen werden erst von der Sache erfahren, wenn sie erledigt ist. Wenn ihr erst tot seid, werden sie schon merken, dass man sich nicht ohne Gefahr mit dem Zaren anlegt.«
Der Morgen war kalt und neblig, und die Verhandlung war schnell und ungerecht. Als gegen zwölf die donnernde Festungskanone den Mittag bezeugte, war das Urteil gesprochen. Tod durch Erschießen. Begründung: Terroristische Umtriebe gegen die Monarchie. Dazu heimtückischer Mord an einem Mitglied der Staatsgewalt und Tötung eines jüdischen Kaufmanns aus niederen Trieben.
Die Vollstreckung hatte unverzüglich zu erfolgen.
Leonards Augen füllten sich erneut mit Tränen, als ihm Jekatherina auf dem langen Gang nach draußen begegnete. Abgeführt in Ketten, gekleidet in einen grauen Gefängniskittel, bot sie ein Bild des Jammers. Man hatte ihr den Kopf geschoren, und nur noch ein rötlicher Flaum ließ die ehemals schönen tizianroten Haare erahnen. Ihre schmale Gestalt erschien ihm noch bleicher als je zuvor. Ihre Wangen waren eingefallen, Kinn und Stirn schimmerten dunkel, von blauen Flecken gezeichnet. Dabei wirkte ihr Blick so leer und hoffnungslos, dass es ihm wehtat. Und wenn er genauer hinsah, spiegelte sich darin einzig das Grauen, das sie in den letzten zwei Wochen hatte erdulden müssen. Für einen winzigen Moment kamen sie einander nahe genug, um dem anderen etwas sagen zu können.
»Ich liebe dich«, entfuhr es Leonard mit erstickter Stimme. »Ich werde dich heiraten, und wenn es im Himmel sein wird.«
»Ljubimyj«, flüsterte Katja. »Das wird nicht gehen. Es ist alles meine Schuld. Ich werde dafür in der Hölle schmoren.«
Noch bevor er ihr widersprechen konnte, zerrte man ihn nach draußen auf den Hof. An hastig aufgestellten Pfählen wurden sie angekettet, während annähernd zwanzig Soldaten bei dichtem Schneetreiben im Innenhof des Gefängnisgebäudes trotz dicker Mäntel frierend auf den Schießbefehl warteten.
Leonard trug nur ein dünnes Hemd und eine zerschlissene Anstaltshose. Doch die Kälte spürte er nicht mehr – erst recht nicht, als man ihm eine Augenbinde anlegte. Bis zuletzt hatte er Jekatherina angesehen. Dabei war ihm bewusst geworden, wie kostbar jeder einzelne Augenblick ihres Zusammenseins gewesen war. Nicht einmal an seine Mutter dachte er. Nur an dieses Mädchen.
»Achtung! Gewehr anlegen!«, brüllte eine befehlsgewohnte Stimme über den Hof. Das Knallen der Stiefelsohlen und das typische Durchladen der Karabiner hallten von den Mauern wider.
Leonards Gedanken überschlugen sich. Er sprach ein letztes, hastiges Gebet, obwohl er als Protestant in diesen Dingen nie besonders beflissen gewesen war.
Nichts geschah. Banges Warten. Vielleicht war er schon tot, und merkte es nicht?
Plötzlich hörte er Schritte. Jemand nahm ihm die Augenbinde ab.
Sein erster Gedanke galt Katja. Zusammengesunken hing sie am Pfahl, die Schultern schneebedeckt.
War sie tot? Doch er hatte keinen einzigen Schuss vernommen.
Ein groß gewachsener Mann stand vor ihm, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Er trug keine Uniform, sondern einen gepflegten, dunkelblauen Wollmantel, der seine breiten Schultern mit einer Passe betonte. Sein Haar und sein Schnurbart waren so schwarz wie seine Bärenfellmütze, und sein strenges Gesicht erschien nicht älter als vierzig.
»Leonard Michailowitsch Schenkendorff?«
»Ja«, antwortete Leonard zaghaft.
»Geheimrat Nikolaj Michajloff, Dritte Abteilung«, antwortete der Mann in akzentfreiem Deutsch. »Sie haben die Wahl. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, wandeln wir das Todesurteil in eine Deportation in die sibirische Taiga um.«
Leonard glaubte, sich verhört zu haben. Sein Blick wanderte abermals zu Katja, der man ebenfalls die Augenbinde abgenommen hatte und die seinen Blick auffing, als ob er aus einer anderen Welt stammte.
»Das gilt auch für das Mädchen«, antwortete Michajloff schneidig.
»Es liegt also an Ihnen, ob sie leben wird!«
2
Juni 2008, Berlin/Tunguska (Sibirien) – Aufbruch
Das Telefon dudelte unbarmherzig die »Internationale«. Viktoria Vanderberg war beinahe dankbar, dass sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde. Einen Moment lang hatte sie das Gefühl gehabt, ertrunken zu sein. Hustend schnappte sie nach Luft und schluckte noch einmal, bevor sie im spärlichen Licht des Displays die Taste ihres Mobiltelefons bediente.
»Hallo?« Ihre Stimme klang heiser.
»Na, meine Süße, freust du dich schon?«
Mühsam richtete Viktoria sich auf. Mit einer fahrigen Handbewegung strich sie sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schaltete die Nachttischbeleuchtung an.
»Sven? Sag bloß, ich habe verschlafen?« Ein rascher Blick auf den Funkwecker versicherte ihr, dass die angegebene Zeit auf ihrem Handy stimmte. »Was willst du von mir?«, zischte sie wütend. »Es ist erst halb zwei. Mir bleiben noch vier Stunden, bevor es losgeht!«
»Wunderbar«, bestätigte die flüsternde Männerstimme am anderen Ende der Leitung. »Ich kann es kaum erwarten. Wir beide acht Wochen in der sibirischen Taiga. Das ist wie eine Hochzeitsreise ohne Limit. Findest du nicht?«
»Schon vergessen? Du bist bereits verheiratet, und das nicht mit mir«, erwiderte Viktoria ärgerlich. »Und wenn du nicht sofort auflegst, werde ich deiner besseren Hälfte bei nächster Gelegenheit reinen Wein einschenken, welchen Fehlgriff sie vor fünfzehn Jahren getan hat!«
»Uh«, raunte der Anrufer spöttisch, »Frau Doktor spielt mal wieder den Moralapostel. Warte ab, wenn du zwischen Rentierherden, Mückenschwärmen und betrunkenen Russen der Einsamkeit verfällst, wirst du froh sein, wenn ich an deiner Zeltwand rüttele …«
Er lachte leise, und Viktoria betrachtete für einen Moment ungläubig ihr Mobiltelefon, bevor sie endgültig auflegte.
Sie beschloss, nicht weiter über den Anruf nachzudenken, und löschte das Licht, um sich die verbliebene, viel zu kurze Zeit abermals in die Kissen zu schmiegen.
Spätestens in sieben Stunden würde sie sich mit dem Problemfall Sven Theisen auseinandersetzen müssen, und zwar für ganze zwei Monate. Unglücklicherweise hatte sich Professor Doktor Gregor Rodius, der Leiter der geophysikalischen Fakultät der Universität Leipzig, nicht dazu überreden lassen, bei der bevorstehenden Expedition nach Sibirien auf Theisen zu verzichten. Als Spezialist auf dem Gebiet der elektromagnetischen Tiefenforschung war Sven bei der Untersuchung zum Niedergang eines gewaltigen Meteoriten vor ziemlich genau einhundert Jahren im Gebiet der steinigen Tunguska von großem Nutzen.
Dummerweise erschien Viktoria diese Expedition für ihre Karriere zu wichtig, um die Teilnahme allein wegen ihrer Abneigung gegenüber Theisen abzulehnen. Obwohl er angeblich glücklich verheiratet war, stellte er ihr seit Monaten nach; mehr als einmal hatte sie ihm gedroht, wegen seiner Unverschämtheiten bei Professor Rodius vorzusprechen. Doch Theisen hatte nur gelacht und ihr vorgehalten, sie verstehe keinen Spaß.
Bei ihrer Ankunft am Flughafen Berlin/Schönefeld am nächsten Morgen sollte sie eine Ahnung davon bekommen, wie aufsehenerregend die bevorstehende Expedition tatsächlich werden würde. Man schrieb den 22. Juni 2008; das Wetter an diesem Sonntag zeigte sich ausnahmsweise von seiner schönsten Seite.
Während etliche Pressefotografen vor dem Flughafengebäude in der gleißenden Sonne auf besondere Gäste warteten, schlich Vicky, wie ihre Freunde und Kollegen sie nannten, an ihnen vorbei, um wie verabredet gegen zehn Uhr zum Treffpunkt der deutschen Delegation zu gelangen. Einer kleinen Gruppe von drei Geophysikern, die mit einer russischen Delegation von mindestens zehn Wissenschaftlern und Studenten in der Steinigen Tunguska Sibiriens zusammentreffen sollten, um den Einschlagskrater eines bisher nicht eindeutig nachgewiesenen Meteors zu ermitteln.
Wie gewöhnlich wurde Viktoria von Professor Doktor Rodius, ihrem Mentor und Vertrauten, mit einer freundschaftlichen Umarmung begrüßt. Sie mochte den älteren, grauhaarigen Mann, den sie beim Vornamen ansprechen durfte, nicht nur wegen seines fundierten Wissens, sondern auch, weil er ihr außerhalb des Campus als väterlicher Freund zur Seite stand.
Der Taxifahrer trug Viktorias Gepäck, einen Koffer und eine Reisetasche, bis zum Abflugschalter. Nachdem sie die Rechnung bezahlt und sich ausufernd bedankt hatte, verabschiedete er sich mit einer Empfehlung und entschwand zwischen den Reihen wartender Menschen. Erst danach erspähte sie ihren Kollegen Sven Theisen, der groß, blond und mit schwindendem Haupthaar aus der Gruppe von Touristen wie ein Leuchtturm herausragte.
Theisen verabschiedete sich mit einem bühnenreifen Kuss von seiner hübschen, dunkelhaarigen Ehefrau und den drei quirligen Kindern. Gleichzeitig scannten seine blassblauen Augen Viktorias zierlichen Körper mit einem solch unverhohlenen Verlangen, dass sie sich in ihrer knappen Jeans und der ärmellosen Bluse plötzlich unwohl fühlte. Missmutig schüttelte sie ihre brünette, schulterlange Mähne und setzte sich wie zum Schutz eine Sonnenbrille auf, bevor sie sich entschlossen von ihm abwandte, um draußen vor der Abflughalle noch ein wenig frische Luft zu schnappen.
Blitzlichtgewitter brandete auf, als mehrere schwarze Limousinen vorfuhren und der Wissenschaftssenator der Stadt Berlin und der russische Botschafter beinahe gleichzeitig einem der glänzenden Wagen entstiegen. Sie waren gekommen, um Professor Rodius und seinem Team alles Gute für die bevorstehende Mission zu wünschen.
»Dies ist eine bedeutende Expedition, die für die gute Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und der Bundesrepublik Deutschland steht«, betonte der Wissenschaftssenator feierlich in eines der Mikrofone, die sich ihm zahlreich entgegenstreckten. Danach ging er auf den russischen Botschafter zu, der breitschultrig und gedrungen in einem korrekten dunkelblauen Anzug in die Menge lächelte.
Der deutsche Politiker durchbrach den Ring von vier hünenhaften russischen Bodyguards, die alle einen Kopf größer waren als er selbst und ausnahmslos nachtschwarze Sonnenbrillen trugen. Dann schüttelte er seinem glatzköpfigen russischen Gegenüber pressewirksam die behaarte Pranke.
»Unseren hervorragenden Beziehungen zum russischen Präsidenten und dem russischen Volk haben wir es zu verdanken«, führte er weiter aus, während er nicht daran dachte, die Hand des Russen loszulassen »dass man uns an der Auflösung eines der spannendsten Rätsel der Menschheit beteiligt und damit deutschen Wissenschaftlern das Vertrauen schenkt, das ihnen offenkundig gebührt.«
Vereinzelter Beifall war zu hören, und manche Journalisten zückten hastig ihre Diktiergeräte, um den darauf folgenden Dank und die Ansprache des Professors aufzuzeichnen.
»Über das Ereignis von Tunguska wurde in den vergangenen einhundert Jahren viel spekuliert«, hob Rodius mit seiner vortragsgeübten Stimme an, die gut zu seiner schlanken, grauhaarigen Erscheinung passte. Die getupfte Fliege, die statt einer Krawatte seinen Hemdskragen zierte, hüpfte jedes Mal, wenn sein Adamsapfel sich während des Sprechens bewegte. »Aber ich bin sicher, dass wir mit unseren abschließenden Untersuchungen dem vermeintlichen Geheimnis ein gutes Stück näher kommen und dabei den Beweis erbringen werden, dass es weder ein Angriff der Zylonen war.« Er lächelte beeindruckend jungenhaft und pausierte einen Moment in seiner Rede, bis alle Reporter seine witzig gemeinte Bemerkung zum Thema »Außerirdische« grinsend zu Kenntnis genommen hatten. »Noch, dass die verrückte Erfindung eines kroatischen Professors dahinter steckt, der zum vermeintlichen Zeitpunkt mit nicht näher nachweisbaren Todesstrahlen zu experimentieren pflegte. Mein Team und ich sind der festen Überzeugung, dass es uns gelingen wird, unsere russischen Freunde darin zu unterstützen, endlich einen seriösen Grund für die Katastrophe von Tunguska zu finden.«
Eine Flut von Fragen brach über Professor Rodius herein, an denen man ablesen konnte, dass seine Aussage die Meute der Sensationsjournalisten nicht zufriedenstellte.
»Was macht Sie so sicher, dass es keine Außerirdischen waren, die in Tunguska ein fehlgeleitetes Landemanöver versucht haben und dabei abgestürzt sind?«, hallte es durch die Abfertigungshalle.
»Wer sagt Ihnen denn, dass es nicht doch eine Art Spiegelmaterie aus einem anderen Universum sein könnte, die das Unglück verursacht hat?«, rief ein hagerer Reporter, der alle anderen Kollegen überragte.
Rodius hatte sich jedoch bereits zusammen mit seinen Begleitern und seinem Team in Richtung Abflugschalter in Bewegung gesetzt. Dabei wurden sie von den Bodyguards des Wissenschaftssenators und des russischen Botschafters abgeschirmt.
Der Professor hatte Viktoria Vanderberg und Sven Theisen persönlich mit einer letzten Überprüfung des technischen Equipments betraut, bevor Flughafenarbeiter die wertvollen Gerätschaften in bruchsichere Transportkisten verstauten, die sie – vom Zoll verplombt – bis nach Sibirien begleiten würden. Ultraschall, Magnetometer, ein komplettes Labor für chemische und physikalische Untersuchungen, eine tragbare Solaranlage zum Aufladen von Batterien und einiges andere galt es auf Vollständigkeit zu überprüfen, bevor alles in den Bauch eines Airbus A 320 der deutschen Lufthansa verladen werden konnte.
Während Viktoria dem für die Fracht verantwortlichen Team letzte Angaben machte, stand Theisen reichlich nutzlos herum und verbrachte seine Zeit damit, ihr viel zu nah auf die Pelle zu rücken und ab und an eine süffisante Bemerkung loszulassen.
Mitten in der Unterhaltung mit dem zuständigen Frachtmanager dudelte erneut Viktorias Mobiltelefon, doch diesmal war es nicht die »Internationale«, sondern ein kindlicher Sänger, der laut und eindringlich das Wort »Mama« trällerte – ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich um ihre verwitwete Mutter handelte, die ihr noch ein letztes Mal alles Gute zum Abschied wünschen wollte, ganz so, wie sie es nun schon die letzten fünf Abende zuvor getan hatte.
»Mutter!«, zischte Viktoria leise und wandte sich demonstrativ zu einem der vielen Gepäckwagen hin, die direkt unter den Tragflächen des Airbusses standen. »Ich bin dreißig Jahre alt und keine drei. Es ist gerade ganz schlecht. Wir sind in den Vorbereitungen zum Abflug.«
»Umso besser, Kindchen. Hinterher, wenn du erst in dieser Wildnis bist, kann ich dich doch nicht mehr erreichen. Ich wollte mich nur noch mal vergewissern, ob du auch deine warmen Pullover eingepackt hast und das Mückenschutzmittel, das dir Doktor Almuth empfohlen hat.«
»Ja, doch, Mutsch«, antwortete Viktoria ungehalten, während sie aus einem Augenwinkel heraus das unverschämte Grinsen ihres Kollegen streifte.
Wohnst du etwa noch bei Mutti? hatte Sven sie erst vor kurzem gefragt, nachdem ihre Mutter – wie beinahe jeden Tag – um die Mittagszeit angerufen hatte, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen und ihr die obligatorische Frage zu stellen, ob sie auch was Anständiges gegessen hatte. Schließlich litt die ältere Frau unter Einsamkeit, und ihre einzige Tochter war alles, was ihr geblieben war. Auch wenn es Viktoria zunehmend lästig erschien, plagte sie das schlechte Gewissen, wenn sie die viel zu häufigen Anrufe ihrer Mutter ignorierte.
»Ach, Vicky, Sibirien ist so unendlich weit weg«, jammerte ihre Mutter. »Freiwillig sollte man da schon gar nicht hingehen. Dein Großvater wurde 1945 dorthin deportiert. Zehn Jahre in Gefangenschaft – kannst du dir so etwas vorstellen? Er wäre beinahe daran gestorben. Wusstest du das?«
»Mutter!« Viktoria war reichlich entnervt. »Das ist eine wissenschaftliche Expedition und kein Archipel GULAG. In acht Wochen bin ich zurück.«
»Fahren wenigstens ein paar anständige Männer mit? Ich meine, passt da jemand auf dich auf?«
Viktorias Blick fiel auf Sven Theisen, der es offenbar nicht für nötig befand, die entsprechende Diskretion zu wahren und mit einem Dauergrinsen interessiert ihrem Telefonat folgte.
»Mach dir keine Sorgen«, erwiderte sie knapp. »Ich bin nicht allein. Schließlich begleite ich Professor Doktor Rodius.«
»Ist er verheiratet?« Die Frage klang provozierend und sollte wie immer darauf hinauslaufen, ob es vielleicht unter ihren Kollegen jemanden gab, der sie endlich zum Traualtar führte.
»Der Professor ist fünfundsechzig.« Ihre Worte klangen wie ein abschließendes Amen, das der peinlichen Befragung ein Ende setzen sollte.
»Vati wäre auch fünfundsechzig geworden in diesem Mai.«
»Ja, Mama. Ich muss los. Mach’s gut. Ich melde mich über Satellitentelefon, wenn es möglich ist.«
Hatte sie zum Beginn des Eincheckens noch geglaubt, Sven Theisen entfliehen zu können, so stellte sich nach der Sitzplatzverteilung heraus, dass er auf dem Flug bis Moskau direkt neben ihr saß.
Während er sich in einer unverschämten Selbstverständlichkeit in den benachbarten Sitz sinken ließ, stellte sich Viktoria zum x-ten Mal die Frage, wie sie es mit einem solchen Kollegen acht Wochen in der sibirischen Einöde aushalten sollte und ob es unter der gegebenen Situation überhaupt möglich war, auf eine gedeihliche Zusammenarbeit zu hoffen.
»Und was machen wir«, fragte er in zehntausend Meter Höhe, während er ihr eines der beiden Sektgläser in die Hand drückte, die er ohne Rückfrage beim Stewart bestellt hatte, »wenn es nun doch eine fliegende Untertasse war, die für die Katastrophe von Tunguska verantwortlich ist und wir deren Überreste finden?« Mit einem breiten Grinsen erhob Theisen sein Glas.
Viktoria schaute ihn für einen Moment fassungslos an. Doch dann besann sie sich und setzte ein süffisantes Grinsen auf.
»Das wäre ein ausgesprochener Glücksfall«, bemerkte sie und erhob gleichfalls ihr Glas, während sie ihm direkt in seine erwartungsfrohen Augen sah. »Dann würde ich höchstpersönlich dafür sorgen, dass man das Raumschiff repariert, damit man Leute wie dich ohne Probleme auf den Mond schießen kann. Na Sdorowje!«
Von Moskau aus ging es mit einer uralten Iljushin IL-20M nach Krasnojarsk. Nach etlichen Problemen bei der Abfertigung am dortigen Flughafen und einer wenig erholsamen Nacht in einem nicht unbedingt komfortablen Mittelklassehotel flog die dreiköpfige Gruppe am nächsten Morgen mit mehreren gecharterten MI-26 Helikoptern nach Vanavara, einer sumpfigen Kleinstadt mitten in der Steinigen Tunguska. Im Sommer versank man dort im Morast, und im Winter gefror alles zu Eis, was nicht über einen respektablen Ofen verfügte. Mit seinen 3 300 Einwohnern und einem einzigen Supermarkt, der in einer besseren Bretterbude untergebracht war, hatte der unwirtliche Ort den Namen Stadt eigentlich nicht verdient.
Noch in Krasnojarsk hatte Viktoria sich umgezogen und Jeans und Bluse gegen ein robustes Trekking-Outfit gewechselt. Nun saß sie bereits seit Stunden eingepfercht zwischen verschiedenen Gepäckstücken, Nase an Nase mit ihrem ungeliebten Kollegen und fünf russischen Studenten, die man ebenfalls an Bord genommen hatte und die noch müde von ihrer Anreise aus Moskau vor sich hin dämmerten. Nicht weniger erschöpft schaute Viktoria auf und warf einen Blick aus einem der runden Fenster des Helikopters hinaus auf die unter ihr liegende Taiga. Wie ein weiter dunkelgrüner Teppich erschienen ihr die endlosen Tannenwälder, unterbrochen von felsigen Abgründen und tiefblauen Flüssen. Der Anblick wiegte sie in eine Art Trance, während der Regen draußen gegen die Scheiben klatschte und der Rotor einen so ohrenbetäubenden Krach verursachte, dass das eigene Trommelfell spürbar vibrierte.
Nach der Landung auf dem provisorischen Flugplatz von Vanavara sprang sie aus dem Helikopter hinaus in die feuchte Luft und versank sogleich mit ihren wasserdichten Stiefeln knöcheltief im aufgeweichten Boden.
Trotz des sibirischen Sommers zeigte das Thermometer kaum über 15 Grad Celsius, und obwohl der Empfang mit einem Komitee der örtlichen Honoratioren im frisch herausgeputzten Rathaus geradezu pompös wirkte, glaubte Viktoria, nie einen trostloseren Ort gesehen zu haben. Daran konnte auch der höchst gewöhnungsbedürftige Cocktail aus zuckersüßem Birkensaft und Wodka nichts ändern, der, mit einer aufgespießten kandierten Kirsche versehen, von ein paar sichtlich ungeübten jugendlichen Kellnerinnen als Begrüßungstrunk serviert wurde.
Etwa vierzig Menschen bevölkerten den spartanisch eingerichteten Raum. Ein älterer Russe, füllig und mit einem grauen Bart, begrüßte Professor Rodius aufs Herzlichste. Bei näherem Hinhören stellte er sich als Professor Vladimir Olguth vor; er war der wissenschaftliche Leiter der Gesandtschaft der Universität Moskau, mit deren Mitarbeitern, bestehend aus fünf Wissenschaftlern und fünf Studenten, man in den nächsten Wochen eng zusammenarbeiten wollte. Darüber hinaus hatten sich auch einige Journalisten und gut zwanzig geladene Honoratioren der örtlichen Bevölkerung eingefunden.
Die eigentliche Ansprache hielt Uljan Uljanowitsch, der Bürgermeister von Vanavara. Von einem improvisierten Podium aus zwei hellen Lärchenholztischen, die man am Ende des Raumes aufgebaut hatte, sprach er viel zu hektisch zu den anwesenden Gästen, nur unterbrochen von einem nervösen Lächeln, das in einem eigentümlichen Kontrast zu seinen düsteren Brauen und seinen strengen Gesichtszügen stand. Vor ihm hatte man die russische, die deutsche und die blauweiß-blaue Flagge der Ewenken mit ihrer leuchtend roten Sonne aufgestellt – ausgerechnet in einer leeren Wodkaflasche. In einer kurzen Zwischenbemerkung bedauerte Uljanowitsch, der selbst russischer Abstammung war, dass der gewählte Stammesvertreter der hier lebenden ewenkischen Urbevölkerung leider verhindert sei.