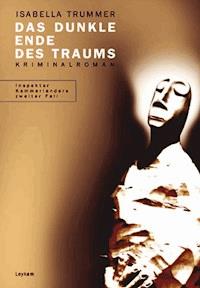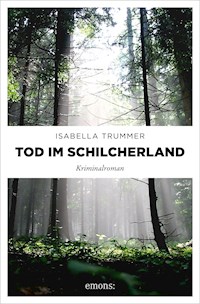10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein düsteres Versteckspiel in der Steiermark, das die Abgründe der menschlichen Seele offenbart. Das Leben ist ihm etwas schuldig. Davon ist Leopold Kranzelmeier tief überzeugt. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen im weststeirischen Teigitschgraben, nutzt er sein Umfeld rücksichtslos aus und gibt anderen die Schuld für sein Versagen. Spielschulden treiben ihn schließlich in die Kriminalität – und plötzlich müssen Menschen sterben. Als er ins Visier von Inspektor Kammerlander gerät, trifft er eine ungeheuerliche Entscheidung mit unabsehbaren Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Isabella Trummer wurde 1958 in Maria Lankowitz (Weststeiermark) geboren. In Graz absolvierte sie eine Ausbildung zur Diplompädagogin in Englisch und Bildnerischer Erziehung sowie zur Bildungs- und Schülerberaterin. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit schreibt sie Kriminalromane, die in der Weststeiermark angesiedelt sind, wo sie lebt und arbeitet.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Das Voitsberger Schloss Greißenegg befindet sich in Privatbesitz. Es beherbergt eine Weinschenke und historische Räumlichkeiten für festliche Anlässe.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Przemek Iciak
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-119-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Der niederträchtigste aller Schurkenist der Heuchler,der dafür sorgt,dass er in dem Augenblick,wo er sich am fiesesten benimmt,am tugendhaftesten auftritt.
Marcus Tullius Cicero
Rücksichtslosigkeitist die Brutalitätder Arroganz.
Gerhard Uhlenbruck
Prolog
Die Tür fiel mit einem Knall ins Schloss.
Sie zuckte zusammen, wagte es aber nicht, hochzusehen. Mit eingezogenem Kopf, die Arme schützend über ihren geschwollenen Leib gelegt, kauerte sie auf dem Bett. Das Klackern des Schlüssels beim Versperren der Tür beruhigte sie nicht. Schon einmal hatte sie gedacht, die Gefahr sei vorbei, ihr erleichtertes Aufatmen war sie teuer zu stehen gekommen. Der Schlüssel war von innen gedreht worden.
Sie bewegte sich nicht. Mit gesenktem Kopf wartete sie auf ein verräterisches Rascheln oder Atemzüge. Minutenlang horchte sie, wie ein Tier, das nicht wagte, aus seinem Bau an die Oberfläche zu kommen. Langsam hob sie den Kopf. Sie zwang sich, die Augen zu öffnen, ihr Blick flog in jeden Winkel.
Sie war allein.
Ihr Atem, den sie vor Anspannung angehalten hatte, entwich befreit. Gleichzeitig spürte sie die leichten Tritte und strich sanft über ihren Bauch. Ihr Wimmern ging in ein Summen über, ein Lied aus ihrer Kindheit. Sie wiegte sich im Rhythmus der Melodie vor und zurück. Wieder einmal dachte sie darüber nach, wie es so weit hatte kommen können.
Am Anfang war er so liebevoll mit ihr umgegangen. Doch nach der Heirat wurde er zunehmend ungehalten und rastete bei jeder Kleinigkeit aus. Sie durfte die Freunde nicht mehr sehen, die Landsleute sowieso nicht. Seine Eifersucht, seine ungerechtfertigten Vorhaltungen und sein Kontrollwahn endeten immer öfter in Tätlichkeiten. Als sie noch unter Leute ging, schlug er ihr nie ins Gesicht. Die Hämatome am übrigen Körper und die Würgemale verbarg sie unter ihrer Kleidung. Sie wagte nie, jemandem davon zu erzählen. Schon gar nicht, ihn zu verlassen. Sie war überzeugt, er hätte sie halb tot geprügelt.
Später verbot er ihr, aus dem Haus zu gehen. Anfangs durfte sie noch in den Garten, nach ein paar Monaten war auch das vorbei. Wenn er Besuch empfing, musste sie in ihrem Zimmer bleiben. Dabei wusste sie, wem sie das alles zu verdanken hatte. Wer ihrem Mann die Lügen über sie einimpfte, seine Seele vergiftete. Das hatte sie ihm auch gesagt. Doch er hatte ihr nicht geglaubt. Im Gegenteil. Wütend hatte er ihr verboten, integre Menschen zu verunglimpfen.
Dann wurde sie schwanger.
Zuerst entspannte sich die Situation, er schien sich zu freuen. Das war jedoch nur von kurzer Dauer. Die Bestie Eifersucht wurde wieder geweckt.
Einmal hörte sie ein Telefongespräch mit. Sie wollte mit ihm darüber reden, bekam aber keine Gelegenheit dazu. Sie musste einen Koffer packen und sich mitten in der Nacht ins Auto setzen. Sie wurde in ein Verlies gebracht, einen fensterlosen Raum mit nichts als dem Lebensnotwendigen. Ein Kellerloch, das feucht und muffig roch. Eine Frau versorgte sie mit Essen und untersuchte sie ab und zu. Sie hatte harte Gesichtszüge und sprach kaum ein Wort mit ihr.
Diese Frau war ihre einzige Hoffnung.
Stöhnend erhob sie sich vom Bett und wankte in das seitliche Gelass, wo sie sich notdürftig waschen konnte. Sie stützte sich am Waschbecken ab und begutachtete sich im halb blinden Spiegel. War sie das? Das bleiche Gesicht war ihr fremd geworden. Eine Lippe war aufgeplatzt. Sie hatte jeden Zeitbegriff verloren, aber ihr praller Bauch sagte ihr, dass die Entbindung in Kürze bevorstand.
Ein bohrender Schmerz fuhr durch ihren Körper. Sie unterdrückte einen Schrei und krümmte sich zusammen. Noch nicht. Oh bitte, noch nicht. Sie war noch nicht so weit.
Langsam verebbte der Schmerz. Sie musste die Panik niederkämpfen. Heftig atmend richtete sie sich wieder auf. Es blieb ihr nur mehr wenig Zeit. Deshalb musste sie die einzige Chance, die sie hatte, nutzen. Sobald die Geburt vorbei war, gab es keinen Grund mehr, sie am Leben zu lassen. Dann würde sie sterben. Das spürte sie.
September
1
Leopold Kranzelmeier sitzt mit verschränkten Armen auf einer Bank und schaut auf die Weinrieden vor sich. Dabei nimmt er seine Umgebung kaum wahr. Er sieht nicht die abfallenden Weinberge, die Streuobstwiesen und Felder im Tal. Sieht nicht die Üppigkeit der Natur an ihrem jährlichen Höhepunkt. Für das alles hat er keinen Blick. Er denkt wie so oft über sich und sein Leben nach. Und wie so oft ist er zutiefst unzufrieden.
Nichts ist so, wie er es sich vorstellt. Er hat so viele Wünsche, möchte etwas aus sich machen, Erfolg haben, jemand sein. Doch die Voraussetzungen dafür sind denkbar schlecht.
Das beginnt schon mit seinem Namen. Leopold – wer heißt heute noch Leopold? Er ist ja kein Habsburger aus der K.-u.-k.-Monarchie. Er weiß nicht, was seine Eltern sich dabei gedacht haben. Er hätte es noch verstanden, wenn er nach einem Großvater benannt worden wäre. Oder einem Onkel. Aber niemand in der Verwandtschaft heißt so. Er selbst stellt sich seit Jahren mit »Leo« vor. Leo geht gerade noch.
Und dann der Familienname. Kranzelmeier. Der Name atmet Bedeutungslosigkeit. Unterste Mittelschicht. Klein-klein eben.
Die Unzufriedenheit begann schon in der Kindheit. Er hat so vieles nicht gehabt, was für andere selbstverständlich war. Seine Eltern konnten sich keinen Luxus leisten. Er versuchte stets, es nicht zu zeigen, aber er beneidete viele seiner Klassenkameraden und Freunde glühend. Wurde er zum Spielen oder zu Geburtstagsfeiern eingeladen, stellte er sich oft vor, er würde in so einer großen Wohnung oder einem schönen Haus mit vielen teuren Spielsachen aufwachsen. Seine Mutter ermunterte ihn immer, doch auch zu seinem Geburtstag Freunde einzuladen, aber er lehnte jedes Mal ab. Er schämte sich für das kleine, alte Haus, dessen Zentralheizung noch mit Kohlen befeuert wurde und wo man die Klospülung mit einem Seil auslöste.
Er bemerkte schon früh die soziale Spaltung, die sich unmerklich entwickelte, je älter sie wurden. Es war keine Absicht dahinter, aber die Jugendlichen fanden in verschiedenen Sphären und Interessensgebieten zusammen. Die einen spielten Tennis oder versuchten sich im Golfsport, die anderen trafen sich am Fußballplatz. Die betuchten Eltern flogen mit ihrem Nachwuchs in Urlaub, bereisten ferne Länder, die anderen schickten ihre Kinder in ein Ferienlager der katholischen Kirche. Gesprächsthemen und Freundschaften zwischen den Gruppen wurden allmählich weniger. Sobald sein Bartwuchs das Flaumstadium hinter sich hatte, ließ er sich einen Vollbart wachsen, um sich und seine gefühlte Bedeutungslosigkeit dahinter zu verbergen. Er verfügte schon als Jugendlicher über eine besondere Anpassungsfähigkeit. Innerhalb kürzester Zeit erfasste er Stimmungen, Interessen und Intellekt und assimilierte sich in der jeweiligen Gruppe. Und er schwor sich damals schon: Eines Tages würde er bei den Gewinnern sein, würde dazugehören.
Er greift in die Brusttasche seiner Jacke, die er neben sich auf die Bank gelegt hat. In der zerknitterten Packung findet er noch zwei Zigaretten. Mit zitternden Fingern steckt er sich eine an. Er hätte gestern wohl doch nicht so viel trinken sollen. Nach dem ersten tiefen Zug werden seine Hände ruhiger.
Zum tausendsten Mal sagt er sich, dass er nicht in dieser Tristesse verharren wird. Er wird nicht irgendein unbedeutendes Dasein fristen. Nicht jeden Cent umdrehen müssen, bevor er ihn ausgibt. Aber er hat keine Eltern, die ihm den Weg ebnen, ihre Verbindungen spielen lassen oder ihn als Kronprinz im Familienbetrieb inthronisieren. Ihm bläst keiner Zucker in den Arsch.
Ihm fällt sein Vater Adrian ein. Der hat nie an ihn geglaubt. Das ging schon im Gymnasium los. Mit vierzehn stand seine Versetzung in die nächste Klasse auf der Kippe, und was machte sein Vater? Hatte der ihm etwa einen Nachhilfelehrer besorgt? No, Sir. Alles, was von ihm kam, war der Vorschlag, das Gymnasium zu verlassen, eine Lehre zu machen, am besten als Fleischer, wie Adrian selbst. Er demonstrierte ihm, wie man ein Schwein oder eine Kuh zerlegte, und erklärte, wie die einzelnen Fleischteile hießen. Aber er gab auf, als Leo nicht das mindeste Interesse daran zeigte.
Gut, er hatte sich in der Schule nicht überschlagen vor Eifer, aber er wusste: Er brauchte ein Studium, einen Titel, um die Armut und Bedeutungslosigkeit seines bisherigen Lebens hinter sich zu lassen. Er erkannte den Ernst der Lage, holte sich Rückendeckung bei der Mutter und arbeitete den Lernrückstand auf. Zusammen überzeugten sie Adrian, ihn nicht von der Schule zu nehmen. In weiterer Folge lavierte er sich Jahr für Jahr durch. Er hatte andere Interessen als das Übersetzen von »De bello Gallico« oder Integralrechnungen. Die Matura schaffte er mit Hängen und Würgen. Aber er hatte ja auch keine Unterstützung von daheim wie viele andere.
Überhaupt, seine Eltern. Wenn er sich ihr Leben vor Augen führt, kann er nur mit dem Kopf schütteln. Sie haben nichts erreicht, sind mit ihrer ärmlichen Situation anscheinend zufrieden. Sein Vater hat in der Oststeiermark eine Fleischerlehre gemacht und in einem Großbetrieb gearbeitet, bis sein Asthma immer schlimmer wurde und er mit fünfzig in den Vorruhestand gehen musste. Die Mutter hat zweimal die Woche in der Gemeinde geputzt. Gewohnt haben sie in einer Zwei-Zimmer-Mietwohnung. Was für ein schillerndes Dasein. Dann haben sie von einem Onkel ein kleines Haus in der Weststeiermark geerbt, erbaut in den fünfziger Jahren. In diesem Zustand befindet es sich heute noch. Und dann erst die Lage. Von Gaisfeld kommend – einem kleinen Kaff mit einem Kreisverkehr als einziger Attraktion – geht es ein Stück den Teigitschgraben hinein, an der ersten Abzweigung in eine Sackgasse, und an deren Ende steht dann das alte Haus. Keine Nachbarn, null Aussicht, eine Keusche in einem Graben eben.
Außerdem sind seine Eltern alt. Sie waren schon alt, als er zur Welt kam. Er kann es nicht mehr hören, wenn seine Mutter mit Tränen in der Stimme erzählt, dass sie den Wunsch nach einem Kind schon aufgegeben hatten und wie froh sie waren, als sie mit dreiundvierzig doch noch schwanger wurde. Was erwartet sie von ihm? Dankbarkeit? Dass er sie vor Rührung in die Arme nimmt?
Er hasst solche Gefühlsausbrüche. Überhaupt vermeidet er Liebesbezeugungen und körperliche Berührungen mit seinen Eltern, wo er kann. Besonders in den letzten Jahren. Das Wort Eltern-Kind-Bindung hat er nie verstanden. Er spürt keine besondere Bindung zu irgendjemandem, auch nicht zu seinen Eltern. Wenn er sie ansieht, kommen sie ihm manchmal wie Fremde vor. Er erkennt nichts von sich in ihnen wieder.
Nach der Matura hat sein Vater eine Lehre als Bankkaufmann vorgeschlagen. Das hat er sofort abgelehnt. No, Sir. Auf so niedrigem Niveau wollte er nicht verbleiben. Aber welche Richtung sollte er einschlagen? Medizin? Jus? Betriebswirtschaft?
Wie seine Eltern sein Studium finanziell stemmen würden, darüber hat er sich nie Gedanken gemacht. Es war schließlich sein gutes Recht, die beste Ausbildung zu bekommen.
Um ehrlich zu sein, zog es ihn in keine Richtung. Ihn interessierte nichts im Speziellen. Das einzig Wichtige für ihn war, einen akademischen Titel zu erwerben und viel Geld zu verdienen.
Er entschied sich für Medizin. Als Spezialisierung konnte er sich Zahnheilkunde vorstellen. Man brauchte sich ja nur die Häuser der Zahnärzte und deren Lebensstil anzusehen. Die ersoffen doch fast in Geld. Aber nach einem Jahr musste er feststellen, dass die Anforderungen sehr hoch waren. Und dann – Frösche sezieren! Pfui Teufel. Er durfte sich gar nicht vorstellen, dass er den Arm oder das Bein eines Menschen … Nein. Das war etwas anderes, als eine Sau zu zerlegen.
Er sattelte auf Jus um. Ihm schwebte vor, als Wirtschaftsjurist oder Rechtsanwalt das große Geld zu machen. Voller Energie stürzte er sich auf die neuen Aufgaben. Aber auch hier musste er erfahren, dass ein zügiges Studium nicht ohne erheblichen Einsatz seinerseits zu bewältigen war. Mit jedem Monat ging es schleppender voran. Er absolvierte ein paar Teilprüfungen, verlor immer mehr das Interesse und ließ es schleifen. Römisches Recht, Kirchenrecht – wer brauchte diesen ganzen Scheiß?
Pharmazie war noch eine Möglichkeit. Er dachte an den Apotheker, bei dem seine Mutter Medikamente kaufte: Wenn der das Studium geschafft hat, schafft das jeder. Außerdem hat er noch keinen armen Apotheker gesehen.
Aber auch diese Studienrichtung erfordert ein hohes Maß an Arbeitswillen. Wieder hat er große Defizite angehäuft. Doch statt Versäumtes nachzuholen, laviert er sich lieber so durch, verschiebt Pflichtklausuren nach hinten, verdrängt Einsichten und Wahrheiten. Über den Studienwechsel hat er seine Eltern nie aufgeklärt.
Er nimmt die letzte Zigarette aus der Packung und seufzt. Was für eine ausweglose Situation. Er kommt nicht vom Fleck. Aber das ist nicht seine Schuld. Wäre er in ein reiches Elternhaus hineingeboren, müsste er sich nicht so abstrampeln. Dann würde er nicht nebenbei Gelegenheitsjobs annehmen, um ein paar Kröten zu haben, wenn er mit seinen Kommilitonen die Grazer Innenstadt unsicher macht. Er würde mit dem eigenen Auto zur Uni fahren und nicht mit Bahn und Bus. Und zu allem Übel fragt sein Vater immer häufiger, wann er denn endlich fertig studiert habe, der zukünftige Herr Doktor. Er werde schließlich sechsundzwanzig. Danach sei Schluss mit der Studienbeihilfe.
Ihm ist, als zöge sich eine unsichtbare Schlinge um seinen Hals zusammen. Wenn es kein Studiengeld mehr gibt, muss er sich arbeitslos melden. Oder ein Schulungsprogramm in Anspruch nehmen. Dann ist er gescheitert. Weil niemand ihm unter die Arme greift.
Ihm ist auch schon in den Sinn gekommen, einen Titel zu kaufen, in Tschechien oder so. Davon hört man ja immer wieder. Dann würde er auf Nimmerwiedersehen ins Ausland gehen, weit weg, und sich dort eine Existenz aufbauen. Aber das kostet Geld. Viel Geld.
Das er nicht hat.
2
»Hallo, Leo! Ich hab mir schon gedacht, dass ich dich da find.«
Er zuckt zusammen.
»Oh, ich wollt dich nicht erschrecken.«
Die Weber Hannelore. Was will die jetzt? Er ist hierhergefahren, um seine Ruhe zu haben.
Die junge Frau lehnt ihr Fahrrad an Leos Moped und geht zur Vorderseite der Bank. Aufatmend setzt sie sich neben ihn. »Mein Gott, ist das schön. Nie hat der Himmel ein so strahlendes Blau wie an einem sonnigen Herbsttag.«
»Gibt es etwas Wichtiges?«, fragt er nicht besonders freundlich.
Sie streift ihn mit einem verunsicherten Blick. »Nein, eigentlich net … Glaub ich zumindest.«
»Also?«
»Jemand hat nach dir gfragt. In der Wirtschaft. Zwei Männer.«
Ihn beschleicht ein ungutes Gefühl. »Kennst du ihre Namen?«
»Nein. Ich hab die noch nie gsehen. Also beim Schusterwirt waren die noch nie. Die wären mir aufgfallen.«
»Ach ja?«
»Bestimmt. Das waren so merkwürdige Typen. Lederjacke, Goldkettchen … Einer hat eine Hasenscharte ghabt. Und der andere eine Glatze.«
Scheiße. Sie suchen schon nach ihm. Er bemüht sich, seine Nervosität nicht zu zeigen. »Was hast du ihnen gesagt?«
»Dass ich net weiß, wo du steckst.«
Braves Mädchen.
Er hat gedacht, er habe noch etwas Zeit. Sein chronischer Geldmangel hat ihn einen schlimmen Fehler machen lassen. Vor einigen Wochen ist er mit seinem Freund Manfred in einer Spelunke in Graz gelandet und hat sich im Hinterzimmer auf eine Pokerrunde eingelassen. Sein Freund hat ein paar Hunderter verloren und ist danach aufgebrochen. Er selbst aber hat eine Glückssträhne gehabt und ist geblieben. Einige Tausender sind schon vor ihm gelegen, und er hat gedacht, das sei die Nacht der Nächte, endlich kümmere sich Fortuna mal um ihn. Aber die Glückssträhne war nicht von Dauer. Am Ende schuldete er den Mitspielern zweiundzwanzigtausend Euro. Das schien auch kein Problem zu sein. Sie haben ihm auf die Schulter geklopft und eine Zahlungsfrist von einem Monat eingeräumt. Seither haben sie ihn schon zweimal angerufen und ihn eindringlich an seine Zahlungsverpflichtung erinnert. Woher haben die eigentlich seine Handynummer? Die Frist scheint jetzt jedenfalls abgelaufen zu sein.
»Was sind das für Leut?« Hannelore schaut ihn von der Seite an. »Was wollen die von dir?«
»Keine Ahnung. Die sind bestimmt schon wieder weg. Sag, hast du Zigaretten dabei?« Er zeigt ihr die leere Packung. »Hab vergessen, welche zu kaufen.«
»Freilich.«
Nachdem sie die Zigaretten halb aufgeraucht haben, sagt Hannelore beiläufig: »Vielleicht tauchen die zwei ja auch noch bei deinen Eltern auf.«
»Was?« Er ist alarmiert. »Woher wissen die …?«
»Ja. Das ist blöd glaufen. Der Ferdl ist mit ein paar Freunden am Nebentisch gsessen und hat ghört, dass die beiden dich suchen. Er hat ihnen gsagt, wo du wohnst.«
Der Ferdl, natürlich. Seit der mitgekriegt hat, dass zwischen seiner Schwester und ihm was läuft, hat sich ihr Verhältnis zusehends verschlechtert. Er spielt sich als Hannelores Beschützer auf. Einmal hat er zu Leo gesagt: »Du bist dir zu fein für anständige Arbeit. Dein sogenanntes Studium beeindruckt mich nicht. Du bist ein Windei. Und wenn du Hannelore unglücklich machst, kannst du was erleben.« Der hat bestimmt verstanden, dass der Besuch der beiden ihn in Schwierigkeiten bringt. Und war ihnen gern behilflich.
Hannelore legt ihre Hand auf seinen Oberschenkel und lehnt sich an ihn. Er muss sich sehr beherrschen, um sie nicht wegzustoßen. Er ist wütend. Eigentlich ist sie an dem Dilemma schuld. Ohne ihren Bruder wäre er jetzt nicht in dieser misslichen Lage. Vielleicht war es von Anfang an ein Fehler, was mit ihr anzufangen. Aber es ist so leicht gewesen. Er hat nicht um sie werben oder sie erobern müssen. Jeder hat gemerkt, dass sie in ihn verliebt war, da brauchte man kein Sigmund Freud zu sein. In Wahrheit hat es ihm auch geschmeichelt, so angehimmelt zu werden. Noch dazu von diesem hübschen Mädchen. Herzförmiges Gesicht, volle Lippen, lange dunkelbraune Haare, Rundungen dort, wo sie hingehören. So etwas würde kein Mann von der Bettkante stoßen. Aber je länger ihre Beziehung dauert, desto eingeengter fühlt er sich. Der Charme des Neuen ist verflogen, ihre Anhänglichkeit wird langsam lästig.
»Eine wunderbare Aussicht«, sagt sie träumerisch. »Bald ist Weinlese. Hilfst dieses Jahr wieder mit?«
»Hm, wahrscheinlich.«
»Der Hattenbauer sucht noch Helfer. Bei dem kannst sicher was dazuverdienen.«
»Mal sehen.«
Das interessiert ihn jetzt wenig. Er hat andere Sorgen. Er darf auf keinen Fall Hasenscharte und seinem Freund in die Arme laufen. Die sind bestimmt noch in der Gegend. Also ist das Wirtshaus keine Option. Zu seinen Eltern nach Hause kann er auch nicht. Die zwei Eintreiber warten dort vielleicht schon auf ihn. Außerdem hat er keine Lust, sich den misstrauischen Fragen seines Vaters zu stellen. Wenn er ein Auto hätte, würde er nach Graz fahren und versuchen, bei einem Kommilitonen unterzuschlüpfen. Sein Blick fällt auf das klapprige Moped, das der Vater ihm überlassen hat. Nicht einmal ein gebrauchtes Auto hat er ihm gekauft, dieser Geizkragen. Die desolate Möhre würde ihm auf halbem Weg verrecken.
Bleibt noch der alte »Bunker«. Für eine Nacht wird es schon gehen.
Bei einer seiner Radtouren ist er als Dreizehnjähriger von Krems aus die Untere Arnsteinstraße hinaufgefahren, dann die Höhenstraße entlang, bis er in den schmalen Jagerweg eingebogen ist. Dieser abschüssige Weg führt nur an zwei Gehöften vorbei und endet nach einer Kurve an einem verfallenen Bauernhaus. Die Bewohner müssen wohl vor vielen Jahrzehnten weggezogen sein. Leo hat diese halbe Ruine damals erkundet und festgestellt, dass ein Kellerraum noch intakt war. Und nicht nur das. An der hinteren Wand war eine Eisentür eingelassen. Dahinter war ein paar Meter weit ein Stollen in den Hang gegraben worden. Perfekte Voraussetzungen für einen halbwüchsigen Jungen, sich hier ein Versteck einzurichten. Mit Matratze, Decken, Kerzen und Vorratslager. Weil das Gelände steil zum Teigitschgraben hin abfällt, nannte er seinen Bunker damals »Adlerhorst«. Immer wenn er etwas ausgefressen hatte oder die anderen hinter ihm her waren, hat er sich hier verkrochen. Bis heute. Er ist ein erwachsener Mann und taucht noch immer in seinem Kinderversteck unter. Man müsste lachen, wenn es nicht so traurig wäre.
Hannelore schaut auf die Uhr und erschrickt. »Jesses, schon so spät. Ich muss in die Wirtschaft zurück. Der Schusterwirt wird sich bereits fragen, wo ich bleib.« Sie küsst ihn schnell auf die Wange und nimmt das Fahrrad. »Magst heut bei mir übernachten?«, fragt sie ihn neckisch und wird rot. »Es kann aber spät werden.«
Passt, denkt er und nickt. Allemal besser als der Bunker. Und langweilig wird ihm auch nicht werden ohne sie.
Er muss nachdenken.
3
Er steht spät auf und geht unter die Dusche. Hannelore ist schon weg, sie muss über die Mittagszeit beim Schusterwirt bedienen. Er duscht abwechselnd warm und kalt, das soll ja gesund sein. Dann prüft er sein Gesicht im Spiegel. Er muss dringend seine Haare kürzen lassen, sie sind schon viel zu lang. Gott sei Dank muss er sich nicht rasieren. Sein gekräuselter Vollbart erspart ihm viel Arbeit. Die Haare muss Hannelore ihm schneiden, die macht das gar nicht so schlecht. Für den Friseur hat er kein Geld.
Als er fertig angezogen ist, geht er in die kleine Küche. Eigentlich ist es eine Küchennische, in der nur Platz zum Kochen ist. Hannelore hat ihm wie immer Kaffee warm gestellt. Er schenkt sich eine Tasse ein und begibt sich zum Esstisch in ihrer Wohnküche. Der Kaffee ist nur mehr lauwarm, aber was will man machen? Das Leben ist kein Wunschkonzert, also runter mit der Pampe. Wenn er Hannelore das nächste Mal sieht, wird er ihr sagen, dass sie sich eine Espressomaschine anschaffen soll.
Er braucht eine Zigarette. Sein Blick irrt herum, er schaut unter die Zeitungen, öffnet die Schublade unter dem Tisch. Fehlanzeige. Hannelore hat ihm keine dagelassen. Verstimmt trinkt er noch einen Schluck, den Rest Kaffee kippt er in die Abwasch.
Er nimmt seine Jacke und sieht auf die Uhr. Halb zwölf. Perfektes Timing. Er wird zu seinen Eltern fahren. Da kommt er gerade richtig zum Mittagessen. Er macht die Tür hinter sich zu und geht leise die Stiege hinab ins Erdgeschoss. Glücklicherweise hat Hannelores kleine Wohnung einen eigenen Aufgang. Er hat keine Lust, ihren Eltern zu begegnen. Und Ferdl schon gar nicht.
Er startet das Moped. Mit Husten und Getöse springt es an, und er fährt mit lautem Geknatter vom Hof. Verflucht, er hat nicht daran gedacht, seinen fahrbaren Untersatz ein paar Meter zu schieben. Bei diesem Höllenlärm hängen jetzt bestimmt alle am Fenster und starren ihm nach.
Er hält beim nächsten Automaten und zieht eine Packung Zigaretten. Er muss jetzt eine rauchen. Nach ein paar tiefen Zügen ist er in der Lage nachzudenken.
Er hat sich gestern schon das Gehirn zermartert, als er auf Hannelore gewartet hat. Eine Lösung seines Problems ist ihm nicht eingefallen. Er sitzt in der Scheiße, so viel ist klar. Die Eintreiber wissen jetzt, wo er wohnt. Die lassen ihn nicht mehr vom Haken. Aber zweiundzwanzigtausend Euro – wo soll er die hernehmen? Das bisschen Lohn, das er mit Aushilfskellnern in Graz oder Erntearbeiten am Land verdient, braucht er selbst. Seit einem Jahr muss er auch bei seinen Eltern finanziell einen Beitrag leisten, nicht viel zwar, aber immerhin. »Du musst lernen, dass Verpflegung, Wäscheservice und ein Dach über dem Kopf nicht vom Himmel fallen«, hat sein Vater gesagt. Der geizige Korinthenkacker. Wenigstens steckt ihm die Mutter manchmal etwas zu, wenn der Alte es nicht sieht.
Zweiundzwanzigtausend Euro.
Vielleicht kann er etwas aushandeln. Ratenzahlungen zum Beispiel. Aber selbst dafür müsste er erst eine Teilsumme auf den Tisch legen. Einige Tausender mindestens. Die müsste er sich irgendwie organisieren. Damit er etwas Luft bekommt.
Adrian Kranzelmeier beobachtet, wie sein Sohn Gulaschsuppe löffelt, als hätte er seit Tagen nichts mehr zu essen gekriegt.
»Wie geht’s eigentlich mit dem Studium voran?«
»Mhm. Passt schon.«
Adrian runzelt die Stirn. »Geht’s etwas genauer?«
»Jetzt lass den Buben doch erst einmal essen«, meint die Mutter.
Adrian zuckt mit den Schultern, sagt aber nichts mehr. Schweigend beenden sie ihr Mahl.
»Wo warst denn gestern?«, setzt er wieder an.
»Zuerst in der Uni, dann bei der Hannelore.«
»Das ist wohl was Ernstes?«, fragt Therese lächelnd, als sie die Teller abräumt.
»Na ja, ist noch zu früh, um das zu sagen.«
Der Vater verschränkt die Hände vor dem Bauch und sieht Leo durchdringend an. »Hast Besuch ghabt gestern.«
Leo weicht seinem Blick aus. »So? Von wem denn?«
»Die Herren haben sich nicht vorgstellt. Aber sie wollten unbedingt mit dir reden. Über etwas Geschäftliches, haben sie gmeint.«
»Keine Ahnung, wer das war.«
»Ich beschreib sie dir. Vielleicht fällt dir ja dann was zu den Herrschaften ein.«
Scheiße. Die haben mit dem Vater geredet. So hat er sich das nicht vorgestellt. Das Gespräch entwickelt sich in die völlig falsche Richtung. Er hat vorgehabt, Adrian anzuzapfen. In dessen Metallkassette im Nachtschränkchen liegen sicher einige Tausender. Es soll ja nur ein Darlehen sein, für ein Auslandssemester, das er unbedingt machen muss. Damit er im Internationalen Rechtswesen nicht den Anschluss verliert. Das hätte Adrian vielleicht geschluckt.
Jetzt kann er das vergessen. Sein Vater ist nicht blöd.
»Angreist sind die Herren mit einem hellblauen Sportwagen. Ich sag dazu Zuhälterschüssel. Und so wie die ausgschaut haben, kennen die das Gefängnis auch von innen. Jetzt frag ich mich: Was wollen die von dir?«
Wieder weicht Leo dem Blick seines Vaters aus. »Ich hab echt keinen Schimmer. Eine Verwechslung vielleicht …«
Adrian schlägt mit der Faust auf den Tisch. »Ja, hältst du mich für deppert? Du weißt genau, wer die sind. Und sie wissen, wer du bist. Was hast du mit denen zu tun, ha? Von was für Geschäften reden die?«
Leo blickt hilfesuchend zur Mutter, die erschrocken in der Tür steht. Aber diesmal springt sie ihm nicht bei.
»In welchen Schwierigkeiten steckst du?«, fragt ihn der Vater jetzt etwas ruhiger.
Was soll er sagen? Die Wahrheit? Es bleibt ihm wohl nichts anderes übrig. Aber nicht in vollem Umfang. Das Wort »Spielschulden« darf nicht fallen. Dafür hat Adrian nicht das mindeste Verständnis, das weiß er.
»Ich hab Schulden.«
»Wie viel?«
»Fünftausend.«
»Und die zwei von gestern haben’s dir geliehen?«
»Ja.«
Eine Zeit lang sagt niemand ein Wort.
»Was hast mit dem Geld gmacht?«, fragt der Vater schließlich.
»Ich hab Bücher gebraucht, so dicke Gesetzesschmöker, du weißt schon. Die sind nicht billig. Und Lernmaterialien. Einen Laptop auch.«
»Das kostet keine fünftausend Euro.«
»Ja. Nein. Ich wollte damit auch ein Auslandssemester finanzieren …«
»Du bist aber nicht ins Ausland gfahren.«
»Äh, nein. Ich hab gedacht, ich krieg mein Studium auch so hin.«
»Dann gib den Kerlen das restliche Geld zurück.«
»Ich hab’s nicht mehr.« Verdammt. Das ist die reinste Inquisition. »Ich … hab mir in Graz für dreitausend Euro einen gebrauchten Kleinwagen gekauft.«
»Dann verkauf ihn wieder.«
»Das geht nicht. Ich hatte einen Unfall. Totalschaden.«
Adrian zieht tief die Luft ein. Thereses Erstarrung löst sich, sie sinkt auf einen Stuhl neben Leo.
»Warum bist wegen der Bücher nicht zu mir kommen?«, fragt der Vater.
»Ach, es ist doch nie genug Geld da.«
»Wie hast dir eigentlich die Rückzahlung vorgstellt? Hast eine Anstellung, von der ich nix weiß?«
Leo hasst diesen Sarkasmus auf seine Kosten. Der Vater scheint es zu genießen, dass er zu Kreuze kriechen muss.
»Nein, und das weißt du genau. Ich racker mich eh mit Aushilfsjobs ab. Neben dem Studium. Andere müssen das nicht. Die haben eine Wohnung in Graz, ein tolles Auto …«
»Kann schon sein. Da hast dir halt die falschen Eltern ausgsucht.«
»So viel steht fest.«
Er könnte sich auf die Zunge beißen, aber es ist zu spät. Was muss ihn der Alte auch immer so provozieren?
»Du undankbarer Nichtsnutz!« Adrian atmet schwer. »Da zieht man so ein Balg auf, ermöglicht ihm ein besseres Leben, und das ist der Dank!« Keuchend beugt er sich über den Tisch. »Fliegen dem armen Jungen keine gebratenen Tauben in den Mund? So was aber auch! Er soll auch noch Leistung bringen? Was für eine …« Er beginnt zu japsen, sein Gesicht nimmt eine Blaufärbung an. »… Ungerechtig…keit auf der … Welt …«
Therese reißt die Tischlade auf und holt die Asthmapumpe heraus. Sie stürzt zu Adrian.
»Beruhig dich! Da, dein Inhalator! Nicht aufregen …«
Leo sieht regungslos zu. Sein Blick ist verächtlich.
»Du gehst jetzt besser«, sagt seine Mutter.
Er steht auf und verlässt die Küche. Das hat er gründlich vermasselt.
4
Er hat sich vorgenommen, heute wieder zur Uni zu fahren.
Nach dem gestrigen Streit mit seinem Vater hat er einen Studienkollegen angerufen und erfahren, dass er zu einer wichtigen Vorlesung kommen muss. Davon ist die Zulassung zum nächsten Studienabschnitt abhängig. Er hat frische Klamotten aus dem Schrank geholt, seine Tasche gepackt und den Abend und die Nacht bei Hannelore verbracht. Sie hat ihm die Haare geschnitten, nicht so kurz wie das letzte Mal. »Deine dichten Haare müssen zur Geltung kommen«, meinte sie. Na ja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Beim Frühstück hat sie davon angefangen, dass heute beim Hattenbauern die Weinlese anfängt und sie ihn als Helfer gemeldet hat. Beim Nachbarn könne er sich etwas mit Kastanienklauben dazuverdienen. Und dass es langsam Zeit sei, ihn ihren Eltern vorzustellen. Die hätten natürlich mitgekriegt, dass zwischen ihnen etwas läuft, sie seien ja nicht blöd.
»Ein andermal«, hat er gemurmelt. Er müsse jetzt dringend in die Uni, die heutige Vorlesung dürfe er auf keinen Fall verpassen. Er sei ohnehin schon spät dran. Und weg war er.
Also sitzt er jetzt in einem Eisenbahnabteil und ist unterwegs Richtung Graz. Ein paar Monate noch, denkt er. Dann ist er zu alt für den Freifahrtausweis. Und dann? Selbst wenn es ihm gelingen sollte, mit Nebenjobs so viel zusammenzukratzen, dass er weiterstudieren kann, löst das noch nicht sein eigentliches Problem. Wie hat er nur so blöd sein können, sich auf eine Hinterzimmer-Zockerei einzulassen? Warum ist er nicht gegangen, nachdem er schon ein paar Tausender gewonnen hatte? So ein Fehler wird ihm nie mehr passieren. No, Sir.
Vielleicht sollte er sich das Angebot von seinem Freund Manfred noch mal überlegen. Der vertickt Pillen vor Schulen und Clubs oder im Park, nichts Aufregendes oder Kriminelles. Was ist schon dabei? Auf etwas wirklich Schlimmes würde er sich nie einlassen. Er ist schließlich kein Verbrecher. Aber auf diese Weise könnte er aus dem Schlamassel herauskommen. Und welche Alternative hat er schon?
Am Grazer Hauptbahnhof steigt er aus und nimmt die Straßenbahn. Er muss jetzt aufhören, sich Sorgen zu machen. Muss diese Probleme die nächsten paar Stunden hinter sich lassen. Muss sich auf das konzentrieren, was heute vor ihm liegt. Es geht schließlich um sein berufliches Fortkommen. Um seine Zukunft. Er wird seinem Tutor ein paar griffige Erklärungen für sein schleppendes Studium beibiegen müssen.
Fast hätte er seine Haltestelle verpasst. Er springt auf, hängt sich seine Tasche über die Schulter und steigt als Letzter aus. Mit forschen Schritten geht er bis zum Ende der Straße in Richtung des alten Universitätsgebäudes. Dann bleibt er abrupt stehen, wendet sich den geparkten Autos neben der Fahrbahn zu, und der Schweiß bricht ihm aus. Was hat sein Vater über das Auto der beiden gesagt, die ihn gesucht haben? Ein hellblauer Sportwagen, eine Zuhälterschüssel. Genau so ein Auto parkt am Straßenrand in der zweiten Reihe.
Er sieht sich hektisch um, kann aber nichts Verdächtiges entdecken. Langsam dreht er sich um und geht zurück. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Er biegt in eine Seitengasse ein und drückt sich hinter zwei Müllcontainer.
Die meinen es wirklich ernst. Wahrscheinlich warten sie in der Nähe der Eingänge, einer vorn, der andere hinten. So würde er es jedenfalls machen. Und dann schnappen sie sich ihn. So eine Scheiße!
Was jetzt?
In die Uni kann er nun nicht mehr. Verdammt! Das heißt, er verliert schon wieder ein Semester. In hilfloser Wut schlägt er mit der Faust auf den Deckel des Müllcontainers. Ein blecherner Knall ist die Folge. Erschrocken sieht er sich um, doch keiner der Passanten auf der Straße schaut in seine Richtung. Ruhig jetzt, er darf nicht die Nerven verlieren. Er muss überlegen, was als Nächstes zu tun ist.
Das kommende Semester kann er vergessen. Er könnte kotzen, aber damit muss er jetzt leben. Vielleicht gibt es noch einen Ersatztermin für die Zulassung. Er muss sich in erster Linie darum kümmern, seine Schuldenprobleme zu lösen. Vorher braucht er an sein Studium gar nicht mehr zu denken. Er kann nicht zwei Brände auf einmal löschen. Zuerst muss er weg von hier. Die zwei Eintreiber sind bestimmt ganz in der Nähe.
Er zieht sein Handy aus der Brusttasche und überlegt, wen er anrufen könnte. Er starrt auf seine Kontakte, und ihm wird bewusst, dass er im Studentenmilieu eigentlich niemanden hat, dem er vertrauen kann, der ihm helfen würde. Zumindest nicht in einer so heiklen Angelegenheit. Am Anfang war das anders, da war er in einer Clique, mit der er oft um die Häuser gezogen ist. Aber mit den Jahren haben ihn seine Kollegen, was den Studienerfolg betrifft, längst überholt. Manche stehen schon im Beruf.
Manfred.
Ja genau. Der kommt zwar aus der Unterschicht, aber auf den ist Verlass. Bei ihm kann er sicher eine Zeit lang unterschlüpfen. Bestimmt.
Es läutet endlos. Er befürchtet schon, dass sich die Mailbox einschaltet, aber er hat Glück.
»Holzer.«
»Hallo, Manfred. Leo hier.«
»Leo? Sag einmal, in welche Scheiße bist du getreten? Du wirst gesucht …«
»Ja, ich weiß. Deshalb ruf ich dich ja an. Ich –«
»Die zwei waren bei mir. Wollten unbedingt wissen, wo du dich rumtreibst.«
»Hast du ihnen den Tipp mit der Uni gegeben?«
»Worauf du einen lassen kannst. Die haben mir den Arm so auf den Rücken gedreht, ich hätte ihnen deinen Blutzuckerwert verraten, wenn ich ihn gewusst hätte. Sie haben gesagt, du schuldest ihnen einen Haufen Geld.«
»Ja, verflucht. Die Pokerrunde vor ein paar Wochen, du weißt schon …«
»Wie viel?«
»Zweiundzwanzig.«
»Tausend?«
»Ja.«
»Heilige Scheiße. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Die zwei Eintreiber sind nur die Vorhut. Hast du das Geld?«
»Nein.«
»Kannst du es auftreiben?«
»Wie denn? Deshalb muss ich mich verstecken. Kann ich bei dir …?«
»Vergiss es. Die kommen sicher wieder, so wie die drauf sind. Was willst du jetzt machen?«
»Weiß nicht. Ich lass mir was einfallen.«
»Hör zu. Ich kann versuchen, mit ihnen zu reden. Vielleicht kann ich was aushandeln. Ruf mich in ein paar Tagen wieder an. Okay?«
»Ja, mach ich.«
»Pass auf dich auf.«
Wie betäubt steckt er sein Handy wieder ein. Er muss zurück nach Gaisfeld. Auf dem schnellsten Weg. Bevor die Typen auf die Idee kommen, den Hauptbahnhof nach ihm abzusuchen.
Die werden ihn nicht kriegen. Zumindest nicht heute.
***
Er schaut hinauf in den Nachthimmel.
Es gibt keine Sterne hier. Fast keine. Höchstens drei, vier. Sie glimmen blass und lustlos und weit voneinander entfernt vor sich hin. Nicht wie zu Hause, wo der Himmel übersät ist mit Tausenden Lichtern, als hätte eine Riesenfaust sie nachlässig hingestreut und ihnen Glut und Leben eingehaucht. Ein immer wiederkehrendes Geschenk für die Menschen. Fast jede Nacht ist er auf dem schmalen Vorplatz vor seiner Kammer gelegen, mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, und hat sich in den Himmel hinaufgeträumt. Er ist eingetaucht in dieses Wunder aus Licht und Ewigkeit, bis ihm die Augen zugefallen sind.
Manchmal hat sich seine Mutter zu ihm gesetzt. Sie hat gesagt, dass eines der Lichter da oben sein Stern sei. Dass jeder Mensch am Himmel sein Licht habe, das nur für ihn leuchte.
»Welcher ist mein Stern?«, hat Adil gefragt.
»Wenn es an der Zeit ist, wirst du es wissen«, hat sie geantwortet.
Danach hat er versucht zu erraten, welcher Stern für ihn leuchtete. War es dieser kleine, der ruhig neben dem blinkenden sein Licht aussandte? Der rötliche vielleicht? Oder gar der große, der alle überstrahlte?
Dann ist der Krieg näher gekommen. Der nachtschwarze Himmel ist an den Rändern gelb und orange aufgeflammt. Die Sterne haben begonnen zu verblassen, im gleichen Ausmaß, wie das Donnern der Raketeneinschläge lauter geworden ist. Seine Leute sind zu langsam, der Feind zu schnell gewesen. Einen Tag bevor seine Familie fliehen wollte, wurde ihr Dorf angegriffen. Seine Eltern und die kleine Schwester hatten keine Chance, sie wurden unter den Trümmern des Hauses begraben. Das gleiche Schicksal hätte wohl auch ihn getroffen, wenn sein älterer Bruder und er nicht hinter dem Hügel die Ziegen zusammengetrieben hätten. Es ist ihnen geglückt, unentdeckt zu fliehen.
Sein Bruder Djamal hat sie über Wasser gehalten. Adil begriff wohl, dass Djamal ihr Überleben mit unlauteren Mitteln bewerkstelligt hat. Aber eines Tages hat der Bruder das Geld gehabt, um die Schlepper zu bezahlen. Die Wochen der Flucht waren eine Abfolge von Hunger, Durst und quälender Anstrengung, die Namen der Länder, die sie durchquerten, sind aufgeblitzt und nach kurzer Zeit verglüht wie Sternschnuppen. Weiter, immer weiter.
Kurz vor dem Ziel hatte Djamal einen heftigen Streit mit einem der Männer. Danach ist er verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Einer aus der Gruppe hat Adil das letzte Wegstück mitgezerrt, bis sie schließlich in einem Wald allein gelassen wurden, mit nichts als einer vagen Handbewegung für die grobe Richtung, die sie einschlagen sollten. Sie sind weitermarschiert, bis sie dieses alte, leere Haus gefunden haben. Dann ist ein Wagen mit Hilfsgütern gekommen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und ein Bett für die Nacht.
Das Haus dürfen sie nicht verlassen. Adil aber muss zurück, muss seinen Bruder suchen. Er hat sich mit einem alten Mann angefreundet, der versprochen hat, ihm zu helfen. Vielleicht ist er ja gar nicht so alt. Als die anderen eingeschlafen waren, hat er sich durch den Hinterausgang hinausgeschlichen und auf die Stufen gesetzt. Hier soll er auf den Mann warten.
Ist da nicht ein Geräusch? Adil lauscht angestrengt, aber es ist nur eine Katze, die vorbeihuscht und ihn argwöhnisch mustert. Er beginnt zu frieren. Wie spät es wohl sein mag? Sein Blick richtet sich wieder zum Himmel, doch er sieht keinen Mond und kaum Sterne.
Warum gibt es hier so wenige Sterne?
5
Das Haus seiner Eltern liegt ruhig in der Nachmittagssonne. Er sieht die Mutter hinter dem Küchenfenster hin und her gehen, sie bereitet wohl gerade das Abendessen zu. Er schaut durch das Fenster, vom Vater keine Spur. Das ist gut. Er betritt die Küche und setzt sich aufatmend an die Eckbank.
»Magst eine Gemüsesuppe? Ist noch was vom Mittagessen da. Du siehst ziemlich fertig aus.« Therese zieht ihr Gesicht in Sorgenfalten.
»Wo ist der Vater?«
»Der ist mit dem Taxi zum Arzt gfahren. Die monatliche Kontrolle, weißt eh.«
Leo nickt. Der Herr lässt sich also ein Taxi kommen und zum Arzt chauffieren. Dafür ist Geld da.
Er löffelt seine Suppe und hört mit halbem Ohr den Erzählungen seiner Mutter zu. Nichts, was er nicht schon dutzendmal gehört hätte. Als er den leeren Teller von sich wegschiebt, macht er einen Vorstoß.
»Ich hab mich heute für das neue Semester angemeldet. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Die haben mir für die Gebühren mein letztes Geld abgenommen. Ich hab jetzt nix mehr. Kannst du mir helfen? Du hast doch sicher was gespart.«
»Wart.« Therese geht zur Anrichte und öffnet eine Lade. Unter den Kochrezepten zieht sie eine bemalte Blechschachtel hervor. Leo hofft auf ein, zwei Tausender. Das wäre ein Anfang.
»Das ist mein Notgroschen. Der Vater weiß nix davon«, sagt sie mit Verschwörermiene. Sie verschließt die Blechdose wieder und legt sie auf den alten Platz zurück. Dann drückt sie ihm zwei Fünfzig-Euro-Scheine in die Hand.
Er muss an sich halten, um nicht loszulachen. Will sie ihn verscheißern?
Gott sei Dank läutet sein Handy.
In dem Moment, als er drangeht, weiß er, dass er einen Fehler gemacht hat.
»Na, da ist er ja, unser Freund«, schnarrt es in sein Ohr. »Wir haben schon gedacht, du versteckst dich vor uns.«
»Was …? Nein …«
»Dann ist es ja gut. Wir vermuten, du hast vergessen, dass wir einen Termin haben. Du bist überfällig.«
»Ja … Tut mir leid.«
»Davon haben wir nichts. Was uns aber weiterhilft, ist das Geld, das du uns schuldest. Wir sind in einer Stunde vorm Schusterwirt. Dahin kommst du. Mit dem Geld. Hast du das verstanden?«
»In einer –«
»Genau. Die Zeit läuft.«
Benommen steckt er das Handy ein. Wie soll er … in einer Stunde …? Ihm wird schlecht. Er zieht seine Geldbörse aus der Tasche und macht eine Bestandsaufnahme. Hundertzweiunddreißig Euro und fünfzig Cent. Er ist im Arsch. Definitiv.
Wieder läutet sein Handy. Diesmal schaut er auf die Nummer, bevor er das Gespräch annimmt. Hannelore. Was will die schon wieder?
»Hallo, Leo. Ich hab heut Abend frei, und meine Leute machen einen Verwandtenbesuch. Die kommen erst spät in der Nacht zurück. Sturmfreie Bude sozusagen.« Sie kichert. »Und da hab ich mir gedacht, ich koch uns was Schönes und wir machen es uns gemütlich. Was sagst?«
Er überlegt fieberhaft. Die zwei Grazer werden ihm bei den Eltern und beim Schusterwirt auflauern. Der Einzige, der weiß, dass er bei Hannelore sein könnte, ist der Ferdl. Und der ist heute nicht in der Wirtschaft, sondern bei Verwandten. Das könnte sich ausgehen.
»Ja, das klingt gut«, meint er. »Ich bin schon unterwegs.«
Er ruft einen Gruß in die Küche und holt das Moped aus dem Schuppen. Eile tut not. Tanken muss er auch noch. Dann wird er von der Bildfläche verschwinden. Zumindest für die nächsten Stunden.
Er ist überrascht, als er den schön gedeckten Tisch sieht.
»Ich hab doch nicht Geburtstag«, entfährt es ihm.
Scheiße, hoffentlich ist heute nicht Hannelores Geburtstag, er hat nichts für sie gekauft. Um die Wahrheit zu sagen, er hat sich nicht einmal ihren Geburtsmonat gemerkt.
»Nein, hast du nicht.« Sie lächelt. »Aber ich wollt dich trotzdem überraschen.«
Sie hat sich mit dem Essen Mühe gegeben, auch der Wein ist vorzüglich. Hannelore trinkt nur wenig, aber er lässt sich nicht bitten. Wäre er nicht so angespannt, könnte er den Abend richtig genießen. So aber hallen immer wieder die Worte des Eintreibers in seinem Kopf nach. Er quittiert Hannelores Geplapper nur mit »Aha« und »Mhm«, während ihm immer wieder das Wort »Henkersmahlzeit« durch den Kopf geht. Er hilft ihr beim Abräumen und stellt die Teller in die Spülmaschine. Hannelore holt eine zweite Flasche aus dem Kühlschrank. Sie sieht ihn auffordernd an.
Mit einem Plopp zieht er den Korken aus der Flasche und schenkt die Gläser voll.
»Es hat sehr gut geschmeckt«, sagt er, weil er denkt, sie wartet auf ein Kompliment. »Die Überraschung ist dir gelungen.«
»Danke«, erwidert sie, und er merkt, dass ihre Backen vor Aufregung glühen. »Ich hab aber noch eine Überraschung für dich.«
»Da bin ich jetzt aber gespannt.« Er lehnt sich bequem zurück und fischt eine Zigarette aus der Packung. Er bietet ihr auch eine an, aber sie schüttelt den Kopf.
»Ich muss damit aufhören.«
»Warum denn das?«, fragt er verwundert.
Sie holt tief Luft. »Tja, das steckt in der Überraschung mit drin. Ich würd die Zigarette net allein rauchen.«
Er braucht ein paar Sekunden, bis er versteht. »Soll das heißen … du bist … du …?«
Sie nickt und sieht ihn mit strahlenden Augen an. »Ja, wir bekommen ein Kind.«
Ihm ist, als hätte ihm jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Das darf doch nicht wahr sein! Das hat ihm gerade noch gefehlt. Das gibt’s doch nicht!
Er hat nie aufgepasst. Das brauche er nicht, hat sie gesagt. Sie kümmere sich um alles. Danach ist nie mehr davon gesprochen worden.
»Aber … Du nimmst doch die Pille? Du hast gesagt –«
»Ich hab vor ein paar Wochen Magen-Darm-Grippe ghabt, erinnerst du dich? Da muss es passiert sein.«
Am liebsten würde er ihr ins Gesicht schlagen. Jetzt wird ihm alles klar. Die Bemerkung, dass sie ihn ihren Eltern vorstellen möchte. Das aufwendige Essen mit Wein und Kerzen. Alles Inszenierung. Sie hat ihn reingelegt.
»Aber … das geht nicht. Ich will kein Kind. Du musst was unternehmen.«
Er sieht das Strahlen aus ihren Augen verschwinden. »Du willst, dass ich …?«
»Du kannst das Kind nicht kriegen! Das verstehst du doch. Das … Das ist unmöglich.«
Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Verdammte Scheiße. Jetzt geht das Geheule los. Er unterdrückt den Impuls, aus der Wohnung zu rennen und die Tür hinter sich zuzuknallen. Die Wahrheit ist, er kann nirgendwo hinrennen. Er muss jetzt taktisch vorgehen. Sich etwas Zeit verschaffen.
»Hannelore, überleg doch mal. Für ein Kind ist es zu früh. Ich bin mit dem Studium noch nicht fertig. Ich hab kein Einkommen. Wovon sollen wir denn leben?«
Sie wischt sich die Tränen von der Wange und nimmt seine Hand. »Das kriegen wir bestimmt hin. Ich hab ja die Anstellung beim Schusterwirt, damit kommen wir schon über die Runden. Und wohnen können wir ja hier. Und wenn du fertiger Herr Doktor bist, dann suchen wir uns was Eigenes.«
Das hat sie sich ja fein ausgedacht. Ihn mit einem Kind an sich binden, bevor eine andere ihr den Herrn Akademiker wegschnappt.
»Du kannst ganz normal weiterstudieren.« Hannelore klingt jetzt wieder gefasst. »Um das Kind kümmer ich mich. Du wirst keinen Unterschied merken.«
»Wissen es deine Eltern? Dein Bruder?«
Sie verneint. »Ich hab noch nichts gsagt. Weil … Ich wollte zuerst mit dir –«
»Das ist gut. Behalt es noch für dich. Ich … Ich muss das erst mal sacken lassen. Das geht im Moment nur uns was an.«
Sie schmiegt sich an ihn, ihr Blick ist unsicher. »Du stehst doch zu mir, gell? Wir ghören doch zusammen?«
»Ja … Ja freilich.«
Es kostet ihn viel Beherrschung, nicht die Hände um ihren Hals zu legen.
In dieser Nacht kriegt er kein Auge zu. Er hat weder vor, die nächsten Jahre in diesem Kabuff zu leben, noch, sich von Hannelore ihren Lebensplan aufdrücken zu lassen. Wenn er heiratet, dann sicher keine Kellnerin. Und dieses Kind will er schon gar nicht. No, Sir. Aber er muss Hannelore eine Weile hinhalten, damit er seine Ruhe hat. Er kann nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen.
Zuerst muss er das Problem mit den Spielschulden beseitigen. Die zwei Eintreiber wird er sonst nicht mehr los. Er braucht Geld, und zwar rasch. Auf dem Weg zum Weberhof, beim Tanken, ist eine Idee in ihm aufgeblitzt. Ein vager Gedanke, der sich nun wie ein Virus in ihm ausbreitet. Er dreht sich auf den Rücken und verschränkt die Arme hinter dem Kopf.
Ist es machbar? Kann er damit davonkommen?
Als die fahle Morgendämmerung durchs Zimmer kriecht, starrt er noch immer an die Decke und denkt nach.
6
Nach dem Frühstück ist er zum Haus seiner Eltern gefahren und hat sich dort ein paar Sachen zusammengesucht, die er heute noch brauchen wird. Dann hat er sich beim Hattenbauern zur Weinlese gemeldet. Das ist ihm vernünftig vorgekommen. Da kriegt er Geld und ein Mittagessen und ist außer Sichtweite. Die Eintreiber denken sicher nicht daran, den Dietenberg nach ihm abzusuchen.
Stunden später schickt er einen prüfenden Blick zum eisengrauen Himmel. Hoffentlich beginnt es nicht zu regnen. Das würde ihm sein Vorhaben erschweren.
Als die Dämmerung hereinbricht, tut ihm jeder Knochen weh. Die Weinhänge mögen ja schön aussehen, aber den ganzen Tag auf dem abschüssigen Gelände Trauben zu ernten ist nicht das Wahre für seine Wirbelsäule.
Er wartet, bis der letzte Helfer den Hof verlassen hat. Mit einem schnellen Blick sieht er, dass der Hattenbauer keine Armbanduhr trägt. Als er von ihm das Geld entgegennimmt, fasst er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Rücken.
»So«, sagt er. »Schon sieben. Jetzt eine heiße Dusche und ab ins Bett. Ich bin hundemüde.«
»Ja, ja«, grinst der Bauer. »Da merken auch die Herren Studenten, dass der Wein nicht von selber in die Flasche kommt.«
Dummschwätzer.
Als er mit dem Moped vom Hof fährt, hat er einen Knoten im Magen. Es ist kurz nach halb sieben. Er muss sein Vorhaben sofort durchführen, wenn die falsche Zeitangabe einen Sinn haben soll. Mit zusammengebissenen Zähnen braust er den Weg hinunter zur Krottendorfer Straße. Er weiß, er stellt jetzt eine Weiche in seinem Leben. Er schert ins Dunkel aus.
Nur dieses eine Mal, schwört er sich. Nur dieses eine Mal.
Die Tankstelle liegt ein wenig außerhalb von Ligist, kurz vor dem Ortsschild. Schräg gegenüber befindet sich der Fußballplatz, der um diese Uhrzeit verwaist ist. An dessen oberem Ende thront das Vereinshaus. Ein paar hundert Meter vor dem Ortsschild stellt er den Motor ab und lässt das Moped die leicht abschüssige Straße weiterrollen. Er biegt nach rechts in einen Weg ein, von dem er weiß, dass er an der Hinterseite der Tankstelle vorbeiführt. Vorn fällt das Licht vom Kassenraum auf die Zapfsäulen, dahinter ist es dunkel. Geräuschlos bleibt er stehen und lehnt das Moped an die Rückwand.
Er öffnet die Tasche auf dem Gepäckträger und nimmt einen Blaumann und ein Kissen heraus, das er sich mit einem Gürtel am Bauch befestigt. Dann schlüpft er in den blauen Arbeitsoverall. Mit fliegenden Fingern stülpt er sich eine schwarze Motorradhaube über, die nur die Augen frei lässt. Er zieht die Kapuze seines Pullis hinten hoch und bedeckt damit drei Viertel des Kopfes. Dunkle Lederhandschuhe vervollständigen seine Verkleidung. Als Letztes holt er eine Plastikpistole aus der Tasche, die einer echten täuschend ähnlich sieht, und steckt noch eine Spraydose und Kabelbinder ein.
Vorsichtig drückt er sich an der Seitenwand der Tankstelle entlang und lugt um die Ecke. Niemand da. An der Hauskante, einen halben Meter über seinem Kopf, ist eine Kamera montiert. Sie ist auf die Zapfsäulen ausgerichtet. Im Inneren des Kassenraumes gibt es eine zweite Videoüberwachung oberhalb der Eingangstür, das hat er gestern überprüft, als er seine Tankfüllung bezahlt hat.
Er zieht die Verschlusskappe ab und hält die Spraydose vor die Außenkamera. Dann drückt er auf den Sprühknopf, bis von der Linse rote Farbe tropft.
Er wartet zehn Sekunden, dann geht er los. Der alte Mann, der hier seine schmale Rente aufbessert, wendet ihm den Rücken zu. Leo öffnet leise die Tür, setzt auch die zweite Kamera außer Gefecht und steckt die Spraydose ein. Als der Mann sich umdreht, ist er nur mehr einen Meter von ihm entfernt.
»Kasse auf!«, zischt er und zieht die Waffe.
Der Alte reißt die Augen auf und starrt entsetzt in die Pistolenmündung.
»Los! Kasse auf!«
Zittrig befolgt der Mann den Befehl. Leo sieht, dass da nur ein paar kleine Scheine liegen.
»Wo ist der Rest?« Wegen des ständigen Zischens muss er einen heftigen Hustenreiz unterdrücken. Aber der Mann soll nicht seine Stimme identifizieren können, falls er jemals verdächtigt wird.
»Mehr is … net da … Die Leut zahlen meistens mit … mit Karte …«
Scheiße. Daran hätte er denken müssen.
Leo hält ihm seine Plastiktüte hin. »Alles hier rein!«
Der Alte tut, wie ihm geheißen, seine schmächtige Gestalt bebt heftig. Dann hält er ihm mit einer Hand die Tüte hin, während die andere nach einem metallenen Schraubenschlüssel greift. Leo krallt sich den Plastiksack und stößt den Mann heftig nach hinten. Der Alte schlägt mit dem Kopf auf ein Regalbrett und sinkt blutend nach unten.
Nichts wie raus hier.
Er stürmt aus dem Kassenraum und bemerkt, wie plötzlich ein Lichtschein vom Vereinshaus auf den Fußballplatz fällt und jemand aus der Tür tritt. Panisch rennt er um die Ecke ins rettende Dunkel. Mit zitternden Fingern wirft er den Nylonsack mit dem Geld und die Waffenattrappe in die Tasche. Dann reißt er sich Motorradhaube, Overall und Kissen vom Körper und zieht rasch den Reißverschluss zu. Er startet das Moped und fährt ohne Licht davon.
Fuck! Fuck! Fuck!
Ob die Gestalt aus dem Vereinshaus ihn gesehen hat? Und wenn schon, in diesem Aufzug kann sie ihn unmöglich erkannt haben. Wieso war überhaupt jemand dort? Ihm fällt ein, dass jeden zweiten Donnerstag eine Clubsitzung abgehalten wird. Daran hat er nicht gedacht, er ist schon seit Monaten nicht mehr hingegangen. Diese Nudeltruppe hat ihn nicht mehr interessiert.
Er biegt in den Wartensteinweg ein, jetzt kann er das Licht wieder einschalten. Er treibt das alte Moped das steile Sträßchen hoch. Knapp unter dem Wartenstein verläuft die schmale Straße fast eben an den Hügeln entlang. Kurze Zeit später taucht er in ein Wäldchen ein.
Schweiß brennt in seinen Augen, er wischt sich mit dem Jackenärmel über die Stirn. Es ist nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Die Ausbeute ist erbärmlich. Ein paar hundert Euro, wenn er Glück hat. Und dafür wollte der Opa ihm eine überbraten? Was war mit dem Alten los, verdammt? Hat der auf einem Tarzanheft geschlafen? Er hat ihm nicht wehtun, sondern ihn bloß fesseln und ins Klo einsperren wollen. Aber der musste ja den Helden spielen. Selbst schuld.
Er hat das Wäldchen hinter sich gelassen und zweigt beim Marienbildstock auf den Weg zum Weberhof ab. Zeitlich hat seine Planung gestimmt. Die ganze Aktion hat keine Viertelstunde gedauert. Er fährt jetzt auf direktem Weg zu Hannelore, dann ist alles in trockenen Tüchern. Nach einer engen Linkskurve muss er scharf bremsen. Der hellblaue Sportwagen steht quer über dem Weg.
Hasenscharte und sein kahler Begleiter kommen von zwei Seiten auf ihn zu.
»Du hast uns ganz schön auf Trab gehalten, mein Freund, das muss man dir lassen.«
Als sie mit ihm fertig sind, liegt er auf dem Boden und spuckt Blut.
Hasenscharte schüttelt den Kopf. »Leo, Leo, Leo. Was sollen wir bloß mit dir machen? Du nimmst uns anscheinend nicht ernst. Gut, du bist vom Land. Vielleicht hast du noch nichts von uns gehört. Ich stell uns jetzt mal vor.« Er zeigt auf den Glatzkopf. »Das ist mein Bruder Joe. Ich bin Jack. Wir suchen das Gespräch mit säumigen Schuldnern. Wir sind sozusagen Warner. Du kannst uns auch die Warner-Brothers nennen.« Er stößt ein meckerndes Lachen aus.
Leo sieht Joe zu seiner Tasche gehen und sie durchwühlen. Er kommt mit dem geöffneten Plastiksack wieder.
»Schau, schau«, schnarrt Jack. »Viel ist es ja nicht, aber wir wollen heute mal nicht kleinlich sein. Wir betrachten das hier als Ersatz für unsere Auslagen, die wir deinetwegen hatten. Die zweiundzwanzigtausend stehen noch offen.«
Leo steht schwankend auf.
»Morgen Punkt achtzehn Uhr beim Bildstock da vorne. Bei der Jungfrau Maria lässt du ein paar Tausender rüberwachsen.«
Plötzlich ist der Glatzkopf hinter Leo und hält ihn fest. Jack hat ein Messer in der Hand und schiebt Leos Jackenärmel hoch. Er zieht eine blutige Linie in den Unterarm.
»Damit du nicht wieder unsere Verabredung vergisst«, sagt er. »Du scheinst ja einer von der vergesslichen Sorte zu sein.«