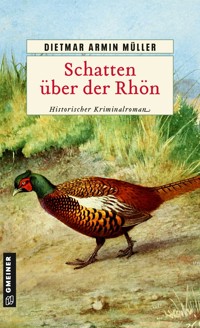
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Revierjäger Roderich Bonifatius Burgmüller
- Sprache: Deutsch
Die Jagd des Freiherrn von Waldenberg endet für über fünfzig Fasane und einen Grafen mit dem Tod. Der hinzugerufene Gendarm geht vom Freitod des Adligen aus, Revierjäger Bonifatius Burgmüller verdächtigt dagegen zwei Offiziere der kaiserlichen Armee. Entgegen der obrigkeitlichen Meinung glaubt er sehr wohl, dass diese zu einem solchen Verbrechen fähig sind. Als Burgmüllers Freund plötzlich wegen Mordes festgenommen wird, setzt er alles daran, den Täter zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dietmar Armin Müller
Schatten über der Rhön
Ein Fall für den Rhönjäger
Zum Buch
Abruptes Ende Freiherr von Waldenberg lädt einige honorige Gäste zur Fasanenjagd ein. Sein Revierjäger, Bonifatius „Boni“ Burgmüller, sorgt dafür, dass jeder bei den scheuen Vögeln Jagderfolge aufweisen kann. Doch nicht nur Tiere lassen Federn. Auch ein Graf kommt ums Leben. Mit einer Fasanenfeder im Rachen wird er tot im Moor aufgefunden. Der hinzugerufene Gendarm macht es sich einfach und stellt Selbstmord fest. Boni glaubt jedoch nicht an die Erklärung des Gesetzeshüters und ermittelt selbst. Er findet heraus, dass der Graf ein dunkles Geheimnis hatte, das zu seiner regelrechten Hinrichtung führte. Trotz aller Versuche den Täter zu fassen, bleibt dieser weiter im Schatten. Die Ermittlungen des Revierjägers stocken, als ihm die bezaubernde Tochter des Freiherrn den Kopf verdreht. Aber den braucht er mehr denn je, denn Bonis Freund Hermann wird verdächtigt und festgenommen. Wenn er nicht schnell den Fall aufklärt, dann endet das Leben seines Freundes mit dem Handbeil.
Dietmar Armin Müller, 1968 in Frankfurt am Main geboren, ist Naturliebhaber, Tierschützer und Jäger. Er absolvierte eine Banklehre und studierte BWL in Saarbrücken. Danach arbeitete er viele Jahre bei deutschen Großbanken als Pressesprecher. Seit 2010 führt er eine Kommunikationsagentur für Immobilien- und Finanzunternehmen. Mit seiner Familie lebt der Autor in einem kleinen Städtchen südöstlich von Frankfurt am Main.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pheasants_in_covert_and_aviary_(1912)_(14750192126).jpg
ISBN 978-3-8392-7488-0
Widmung
für Georg Friedrich MaximilianundViktoria Helene Isabella
Spruch
»Das ist des Jägers Ehrenschild,
daß er beschützt und hegt sein Wild,
waidmännisch jagt, wie sich’s gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.«
Kapitel 1 »Die Erlegung«
Das war so nicht zu erwarten gewesen, er hatte viel vorgehabt, auch wollte er noch einige Dinge regeln, von einem ordentlichen Abschied ganz zu schweigen. Nun war seine Zeit abgelaufen, und die letzten Sandkörner der Lebensuhr verrannen.
Aber was hätte er tun können? Der Mann kam überraschend, zögerte keine Sekunde, sagte nichts, wollte auch nicht sprechen. Hasserfüllte Augen blitzten aus einem kantigen Gesicht. Mit größter Profession und ohne Skrupel nahm der Unbekannte sein Ziel auf und drückte ab.
Der Schlag war gewaltig. Er wurde sofort umgerissen. Als der Schuss auftraf, blieb noch nicht einmal Zeit für einen Schmerzensruf oder eine sonstige Äußerung.
Nun lag er rücklings auf einer Moorwiese in der Rhön und stierte mit glasigem Blick zu den vorbeiziehenden Wolken empor.
Es war ganz anders, als er es vermutete. Die Glieder fühlte er schon nach wenigen Sekunden nicht mehr, als wären sie vereist. Nur noch Kälte kroch Zentimeter für Zentimeter hinauf. Gleichzeitig brannte seine Brust, höllische Feuer wüteten dort, und der Schmerz war unerträglich.
Schreien wollte er, die Qual gen Himmel stoßen, ein wütendes Gebrüll um sein Leben beginnen, doch es fehlte die Luft. Das Einzige, was er hervorbrachte, war ein Wimmern und Stöhnen. Luft, Luft, mehr Luft, aber es blieb dabei, Gevatter Tod schien auf Nummer sicher gehen zu wollen und ließ ihn nicht nur qualvoll verbluten, sondern versuchte ihn auch gleichzeitig zu ersticken.
Welch bitteres Schicksal war es, mitten auf dem Zenit seiner Mannes- und Schaffenskraft seiner Zukunft bestohlen zu werden. Mit Mitte vierzig war er noch weit von einem erfüllten Leben und der Genugtuung eines wohlverdienten Abganges entfernt. In der langen Linie seiner Vorfahren war selbst zu Kriegszeiten keiner so früh gegangen.
Er versuchte sich aufzurichten, allein, es wollte nicht gelingen, selbst seinen Kopf konnte er nicht bewegen. Dafür war er hellwach, hatte seine Sinne beisammen wie noch nie in seinem Leben. Welche bittere Ironie, jetzt war es zu spät, um mit dieser geistigen Energie irgendetwas anfangen zu können.
Er spürte, dass sein Todesknecht noch da war. Süßer Tabakduft war in der Luft. Oder irrte er sich und der Sensenmann kam Tabak rauchend, um ihn zu holen? Plötzlich stieg Wut in ihm auf. Sein Mörder sah nicht unwaidmännisch aus, und er hatte die Waffe gekonnt bedient. Nur der Schuss war so amateurhaft, so enorm schlecht gesetzt und das aus nicht einmal zehn Metern. Selbst mit Pfeil und Bogen hätte er auf diese Entfernung mitten ins Herz treffen müssen, dann hätte er es nach weniger als einer Minute hinter sich gehabt. Aber so verlängerte der Kerl sein Leiden.
Inzwischen hatte die Eiseskälte seinen Oberkörper erreicht und näherte sich den Schultern. Er flehte innerlich seinen Schöpfer an, Gnade walten zu lassen, seine Sünden – und davon hatte er kaum eine ausgelassen – würde er als Gegenleistung nie wieder begehen. Er schwor, sich zu bessern, im Leben alles wiedergutzumachen. Aber wie? Tote können keine guten Taten mehr vollbringen. Dieser Weg war ihm versperrt, und wie das Jenseits aussah, war ein großes Fragezeichen.
Endete alles im Nichts? Verlosch die Lebensflamme einfach, und das war es? Oder würde danach etwas auf ihn warten, ein Himmel? Traf er die Vorangegangenen, musste er sein Leben zur Strafe wieder und wieder durchleben, oder gab es sogar ein Zurück? Zumindest die Christenheit glaubte an die Wiederauferstehung.
Wundern musste er sich, als ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen. Es war nicht im Geringsten nachvollziehbar, dass er sich jetzt mit solchen eher philosophischen Dingen beschäftigte. Andererseits, warum nicht jetzt, die Umstände waren nicht nur bestens dazu angetan, sondern auch die immer schneller verrinnende Zeit im Diesseits drängte.
Er war sich sicher, es musste ein Lungenschuss sein. Bei den meisten Tieren der Wälder war das eine schnelle und saubere Sache. Die Lungenflügel kollabierten, der Unterdruck im Brustraum zur Erleichterung des Einatmens löste sich auf, die Lungenflügel sackten in sich zusammen, und es kam zur Unterversorgung mit Sauerstoff. Außerdem war der Ausschuss nicht selten handflächengroß. Das Tier verlor damit so viel Blut, dass es zügig zum Herzstillstand kam.
Es gab nur einen entscheidenden Unterschied zum Menschen: Beim Reh legte man als geübter Schütze der grünen Zunft auf das Schulterblatt oder kurz dahinter an und traf von der Seite kommend die Lunge komplett. Beim Menschen wurde meist nur ein Lungenflügel getroffen. Der intakte Lungenflügel dagegen konnte noch ziemlich lange eine notdürftige Arbeit verrichten.
Das war es, vielleicht war alles nur ein Missverständnis, ein Unfall, eine Verwechslung, vielleicht war der Schütze schon auf dem Weg und holte Hilfe.
Er wusste von seinem Vater, dass einige Grenadiere im Krieg gegen die Franzosen in den Jahren 1870 und 1871 auch einen Lungendurchschuss überlebt hatten, dank der raschen Hilfe eines kundigen Arztes, das Legen einer Drainage und das Zunähen durch einen Feldscher. Allerdings starben die meisten später an Wundbrand. Doch nun herrschte Frieden, und die Medizin hatte enorme Fortschritte gemacht, viel bessere antiseptische Mittel gab es jetzt im Jahr 1905 als früher. Bestimmt hatte er eine Chance.
Wenn doch dieser Kerl bald zurückkommen würde. Es war schließlich nicht weit von der Lichtung bis zur Stadtmitte. Und in der Gemeinde lebte bestimmt ein Arzt. Nur beeilen sollte er sich. Die Eiseskälte erreichte bereits den Feuerkranz in seiner Brust, ohne diesen auch nur ein wenig abzukühlen.
Inzwischen sammelte sich immer mehr Blut in seinem Rachen. Der wohlbekannte Geschmack nach Eisen legte sich über alles. Das Atmen wurde zusätzlich schwerer. Mehr und mehr fehlte ihm die Kraft. Selbst seine Augen begannen langsam ihre Arbeit einzustellen, er nahm nur noch weiße Punkte am blauen Himmel wahr und konnte nicht mehr erkennen, ob sie sich bewegten oder stillstanden.
Plötzlich stieg ihm wieder der unglaublich süßliche Tabakduft in die Nase. Ein wenig erleichtert war er darüber, machte doch zumindest sein Riechorgan noch die zugedachte Arbeit. Im selben Moment stieg Panik in ihm auf. Wenn er das roch, hieß es, der Mann war die ganze Zeit da gewesen. Er war nicht weggegangen, um Hilfe zu holen. Er war hiergeblieben, um ihn sterben zu sehen.
Auf einmal packten ihn zwei Hände mit einem harten Griff und rissen ihn abrupt auf die Seite. Wenn er hätte schreien können, hätte er seinen Schmerz bis ins Tal hinuntergeschrien. So kam nur ein lautes Stöhnen über seine Lippen. Das Nächste, was er spürte, war die blanke Waffe des Mannes, das Jagdmesser für Hirsche und Sauen. Die Klinge stieß durch das Herz bis hinauf in den unverletzten Lungenflügel.
Ihm war klar, das war das Abfangen, wie der Waidmann sagte, das Erlösen des kranken Stückes, der finale Todesstoß. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis er endlich seinen Frieden hatte und die unsäglichen Schmerzen ein Ende fanden.
Ein Atmen war nicht mehr möglich, das Herz versagte seine Arbeit, und nach wenigen Sekunden verschwanden die weißen Punkte vor seinen Augen, und es herrschte nur noch Schwärze. Das Letzte, was er mitbekam, war, dass er etwas in den Mund gesteckt bekam. Dann merkte er nichts mehr, und nach einem letzten Atemversuch blickten seine angsterfüllten Augen ohne Leben in den Himmel.
Kapitel 2 »Revierjäger in Buchonia«
Es war frisch an diesem Morgen im März des Jahres 1905. Obwohl die Sonnenstrahlen tagsüber bereits Kraft entwickelten und sich das erste zarte Grün an Büschen und Stauden zeigte, hatte es nachts noch Frost. So war es auch an diesem Tagesbeginn. Sein Blick raus aus den kleinen Fenstern der herrschaftlichen Jagdhütte des Freiherrn ließ Raureif auf allen Dingen der Natur erkennen, wie ein glitzernder weißer Eisatem hatte sich die Kälte über alles gelegt.
Er verweilte immer noch beim Betrachten der jungen Fichtenkultur direkt rechts vor dem Anwesen und schüttelte dabei innerlich den Kopf. Ja, die jungen Nadelbäumchen waren zwar recht hübsch anzusehen, doch sie gehörten einfach nicht hierher. Die Wälder der Rhön waren klassisches Buchenland mit einigen schönen Eichen, vereinzelten Tannen, ein paar Obstbäumen, der Haselnuss und dem Feldahorn als Saum.
Vor gut neunhundert Jahren, als die ersten christlichen Missionare in diesen Teil des noch heidnischen Germaniens kamen, war die Rhön fast in Reinkultur mit Buchen bewachsen, bis zu den Gipfeln. Und es waren diese Mönche, die das Land »Buchonia« nannten, und auch heute noch nahmen viele der Altvorderen diese Bezeichnung in den Mund, wenn sie von dem Altgau sprachen.
Ihm war klar, es ging wie nicht selten im Leben ums Geld. Die Fichten wuchsen fast doppelt so schnell und waren meist schon nach achtzig Jahren hiebreif. Die hiesigen Buchen, gerade die Bestände auf den Anhöhen im kühlen Wind und auf nicht immer reichen Böden, brauchten dagegen mindestens hundertvierzig Jahre, manches Mal hundertfünfzig Jahre, bis sie reif für die Ernte waren. Der Anblick auf die dicht bestandenen Fichtenkulturen, die kaum einen einzigen Lichtstrahl zum Waldboden durchließen, war deshalb für ihn kein Grund zur Freude.
Bodo stand plötzlich neben ihm, er forderte sein Recht auf freien Zugang zur Natur und morgendlichen Auslauf. Willkommen ließ er sich aus seinen Gedanken reißen und kraulte dem muskulösen Deutsch-Drahthaar den Kopf. Der Jäger goss frisches Wasser aus dem Krug in die Waschschüssel. Obwohl das Feuer im Kamin bereits erloschen war, blieb die Wärme recht lange in der Hütte, sodass das Wasser nicht gefroren war. Nach einer Katzenwäsche und einem kurzen Stutzen des Vollbartes schlüpfte er in seine grüne Jagdkleidung aus dichtem Lodenstoff. Die schweren Stiefel aus russischem Juchtenleder standen vor dem Kamin und waren fast noch handwarm.
Er nahm seinen grünen Jägerhut mit der auf beiden Seiten aufgeklappten Krempe. Die Mode kam vom Jagdhut des Kaisers, der selbst passionierter Jäger war. Imponierend sah er aus, und auf der Stirnseite des Jagdhutes trug er das fürstliche Wappen der Freiherrn von Waldenberg mit drei Buchen, deren Kronen ineinander verwachsen waren und auf einem Berg standen, alles eingefasst in einem Schild mit einem ritterlichen Helm an der Oberseite. Er schnallte sich den obligatorischen Hirschfänger um, warf den Lodenumhang über und ging mit Bodo hinaus.
Der Tag fing gut an, der Deutsch-Drahthaar war sofort in der Dickung verschwunden, und die Pfiffe des Jägers vermochten ihn nicht herauszulocken. Offenbar hatte sich eine Wildkatze den falschen Rückweg von der nächtlichen Jagd gesucht. Hörte der Vierbeiner sonst recht ordentlich, so setzte bei ihm alles aus, wenn eine Katze in fangbarer Nähe seinen Lebensraum kreuzte. Hier merkte man, dass der Rüde mit seinen knapp zwei Jahren recht jung war und die Ausbildung bei Weitem noch nicht abgeschlossen war. Andererseits war die Nase des kräftigen Hundes extrem fein, das Gehör phänomenal und seine Ausdauer höchst lobenswert. Den Namen Bodo von Bollenstein trug sein Gefährte deshalb zu Recht.
Die Deutsch-Drahthaar-Hunde waren eine recht neue Jagdhunderasse und erst seit wenigen Jahren in der Züchtung, immerhin seit drei Jahren offiziell anerkannt und bereits der aufgehende Stern am Jagdhundehimmel. Ihre Robustheit, die Kraft, vor allem aber ihre Vielseitigkeit machten die neue Rasse zum perfekten Jagdhund für fast alle Einsatzarten. Er hatte sich sofort beim Züchter in den jungen Welpen verguckt. Nun war der Gefährte in seiner Sturm- und Drangzeit, das war nicht immer einfach, aber als klassischer Vorstehhund, der schlagartig bei der Suche erstarrt und schlicht reglos stehen blieb, wenn er Wild wahrnahm, war er eine ernst zu nehmende Erscheinung. Mit seinem leicht struppigen Fell in Dunkelbraun, bis hin zu einem Grau und Schwarz, und den an einen Schnauzer erinnernden Fang mit den typisch langen Barthaaren und den buschigen Augenbrauen stellte er viele andere Jagdhunderassen in den Schatten, erst recht den auf manche etwas verwahrlost wirkenden Griffon oder den schwerfälligen Labrador.
Nun kam Bodo aus der Dickung heraus, die Katze war wohl schneller auf dem Baum, als es dem vierbeinigen Jagdgenossen recht war. Er nahm Bodo an die Leine und ging weiter den Engelsberg hinauf. Mit seinen siebenhundertdreißig Metern war er neben dem auf der westlichen Seite gelegenen Habelberg einer von zwei Hausbergen von Tann, und die Friedrichshof genannte Jagdhütte befand sich etwa auf halber Höhe des Berges. Man kam recht zügig zur Bergkuppe. Von hier oben hatte man einen geradezu atemberaubenden Blick auf die Landschaft und das bereits seit dem zwölften Jahrhundert existierende mittelalterliche Tann mit seinen vielen Fachwerkhäusern. Auch wenn die Waldwirtschaft neben einigen Handwerksbetrieben und der Landwirtschaft die Hauptertragsquellen der Region war, so lag der Waldanteil doch nur bei etwas über einem Drittel der Flächen. Der größte Teil waren Felder und vor allem Grünland mit Wiesen. Deshalb nannte man die Rhön auch das Mittelgebirge mit den offenen Weiten. Denn im Gegensatz zum nur unwesentlich höheren Schwarzwald konnte hier der Blick weit schweifen, und es sah hier vielleicht ein wenig so aus, wie Goethe in seiner »Italienischen Reise« von der Toskana schrieb: lieblich, herzöffnend und seelenberuhigend.
Der Jäger kam zurück und trat auf die hölzernen Bohlen vor der fürstlichen Jagdhütte. Dort fiel ihm der auf dem Boden liegende Brief auf. Gerhard, der Königlich-Preußische Postbote von Tann, musste ihn gestern auf der Holzbank abgelegt haben, als er mit den Fütterungen im Haselwald beschäftigt war.
Der Briefumschlag war an »Herrn Revierjäger Roderich Bonifatius Burgmüller« adressiert und gestempelt auf den 4. Februar 1905, Wilhelmsthal/Deutsch-Ostafrika. Er wusste sofort, wer der Absender war, und öffnete den Brief vorsichtig. Im Kuvert lag eine wunderbare und sogar kolorierte Ansichtskarte des Gebäudes der Forstverwaltung in Wilhelmsthal. Die kleine Neugründung war immerhin kaiserliches Bezirksamt und lag unweit der Usambara-Eisenbahnstrecke, die Tanga am Pazifischen Ozean über rund dreihundertfünfzig Kilometer mit Moshi im Landesinneren verband.
Er musste schmunzeln, sein alter Schulkamerad Hermann Wagner war schon immer ein verrückter Bursche gewesen. Sie hatten gemeinsam nach der Volksschule die Ausbildung zum Berufsjäger gemacht. Während er nach der Lehrzeit die Stelle des Revierjägers beim Freiherrn von Waldenberg angenommen hatte, stürmte sein Freund mit seiner Jagdbüchse in die neuen kaiserlichen Schutzgebiete in Afrika.
Nun war er also in Wilhelmsthal gelandet. Er stand dort als Stellvertreter der Forst- und Jagdverwaltung vor, wobei er sich mehr um die jagdlichen Angelegenheiten kümmerte.
Neben der Jagd und der Liebe zu den Wildtieren teilten sie das Sammeln von Ansichtskarten. Für den Revierjäger war es jedenfalls die kleine häusliche Zerstreuung und vor allem die Befriedigung seiner Sehnsucht nach der Fremde. Wie für alle Einwohner von Tann und dem Rest des Reiches war eine Auslandsreise undenkbar oder besser unbezahlbar. Es blieb das Privileg der Adligen sowie der reichen Industriellen, den eigenen Horizont im Ausland zu erweitern.
Die einfachen Leute, die sich aufmachten, waren meist dazu gezwungen. Es waren vor allem Jüngere, Bauern oder einfache Handwerker, die dem Hunger und dem Elend entfliehen wollten und anderswo ihr Glück suchten.
Allein in den letzten fünfzig Jahren hatte sich die Bevölkerung in Deutschland – ohne die Kolonien – mit inzwischen sechzig Millionen nahezu verdoppelt. In Europa gab es kein anderes Land, welches auch nur annähernd so stark wuchs und eine so junge Bevölkerung hatte.
Die Auswanderungswellen führten in einigen Regionen zu einer regelrechten Entvölkerung. Auch der Revierjäger kannte einige verlassene Weiler im Land der Buchen. Doch der große Auswandererzug ebbte nach der Reichsgründung bald ab. Denn eine bessere Zukunft versprach inzwischen auch eine Übersiedlung in die prosperierenden Städte des Kaiserreichs.
Der Wunsch vom sorglosen Leben in der Stadt blieb aber für viele reiner Traum. Hunger war zwar kein Thema mehr, doch das Leben war hart. Die Sechstagewoche mit sechzig bis siebzig Arbeitsstunden war normal, und die Wohnverhältnisse in den Mietkasernen der großen Städte waren nicht nur hygienisch eine Katastrophe.
Wer eine Ausbildung, beispielsweise als gefragter Mechaniker oder Maurer, vorzuweisen hatte, konnte sich allerdings durchaus ein klein wenig leisten. Ein zweites oder sogar drittes Zimmer, ein Fahrrad, einen regelmäßigen Gasthausbesuch am Sonntag oder auch einmal die Woche einen echten Braten.
Deutschland überschlug sich Jahr für Jahr mit einem gigantischen Wirtschaftswachstum. Man war kurz davor, das Britische Empire als Europas größte Wirtschaft vom Thron zu stoßen. Kurz, Deutschland brodelte und strotzte vor Kraft.
Doch die Neuerungen auf allen Gebieten ließen bei nicht wenigen eine Sehnsucht nach einem bekannten Halt in diesen tosenden Wogen der Zeit aufkommen. Genau dieser Halt war der Kaiser.
Tatsächlich hatte Wilhelm II. weniger Macht als beispielsweise der amerikanische Präsident, denn das Parlament hatte in der täglichen Politik das Sagen. Wobei das Drei-Klassen-Wahlrecht dafür sorgte, dass mehrheitlich Aristokraten und die sonstigen Eliten des Reiches im Parlament saßen.
Der Revierjäger war hingegen glücklich, sich nicht mit solch feinsinnigen Gedanken quälen zu müssen und fern der großen Moderne im eher beschaulichen Tann zu leben. Hier war die Welt übersichtlich, die Parteien-Zänkereien im Berliner Reichstag weit entfernt und vor allem seine geliebte Natur direkt vor der Tür – und nicht eingedrückt in einem Park für Großstädter.
Wie dem auch sei, er hatte jedenfalls damals nicht den Mut aufgebracht, nach Deutsch-Ostafrika mitzukommen, als Hermann ihm die Idee unterbreitet hatte. Es war verlockend gewesen, alles in dem beschaulichen Tann zurückzulassen und einmal den seit 1885 mit fast sechstausend Metern höchsten deutschen Berg zu sehen, den Kilimandscharo.
In stillen Momenten versuchte der Waidmann des Freiherrn seine geringe Abenteuerlust zu entschuldigen. Seine verwitwete Mutter brauchte ihn. Im Grunde war es aber so, sein Vater war bis zu seiner tödlichen Verwundung im Krieg gegen die Franzosen Ende 1870 Revierjäger beim Freiherrn gewesen und hatte dem kleinen Jungen bereits die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen mit auf den Weg gegeben. Damit war der berufliche Weg vorgezeichnet.
Einen Seitenhieb konnte sich sein neuafrikanischer Freund allerdings nicht verkneifen. Hermann hatte den Brief bewusst mit dem Vornamen »Roderich« versehen. Dabei wusste alle Welt, zumindest im Umkreis von Tann, dass der Revierjäger seinen ersten Vornamen mit größter Verachtung trug. Damit nicht genug, er fühlte geradezu einen inneren Hass gegen den Namen. Wie konnte man ausgerechnet ihm, mit seiner Liebe zum Wald und seinen Geschöpfen, einen Namen geben, der geradezu nach dem germanischen Gott der Waldvernichtung klang?
Er hatte sich jedenfalls schon früh entschieden, Bonifatius, seinen zweiten Vornamen, als Rufnamen zu verwenden. Mit der Abkürzung »Boni« wurde sogar ein recht erträglicher Name daraus.
Kapitel 3 »Heim, nur Du allein«
Der Samstag war für den Revierjäger arbeitsreich, und der freie Sonntag lockte. Doch vor den Schnaps hatte der liebe Gott die Mühsal gestellt, und so rackerte er sich beim Bau eines verschalten Erdsitzes am Luderplatz ab. Der Freiherr wünschte einen wetterfesten Unterstand zur Jagd auf Füchse und sonstiges Haarraubwild wie Marder und Iltisse. Zunächst galt es, für den Ansitz Erde auf einer Fläche von zwei mal zwei Metern aufzuhäufen, um eine Erhöhung für ein Eichenholzfundament zu schaffen. Am kommenden Montag sollte dann mit der Holzverschalung begonnen werden. Glücklicherweise waren solche Arbeiten selten. Denn im Revier ging man auf die Pirsch, die Jagd auf leisen Sohlen.
Die Idee hingegen, feste Ansitze mit überdachten Kanzeln zu bauen, fand zwar einige Nachahmer. Boni lehnte diese Art der Jagd aber strikt ab, wie fast alle Waidmänner. Wie in einem Hinterhalt auf das Wild zu warten, erhöht und mit fester Gewehrauflage, das war keine echte Jagd mehr, das war in seinen Augen Mord mit Ansage und hatte mit Waidgerechtigkeit und Chancengleichheit für die Wildtiere nichts mehr zu tun.
Natürlich war es bequem für die reichen Industriellen und wohlhabenden Männer von Stand, brauchte man doch nur noch rudimentäre Kenntnisse über Flora und Fauna. Einfach anlegen und abdrücken. Die Hege und Pflege, die Waidgerechtigkeit und die Liebe zur Natur kamen dabei eindeutig zu kurz.
Für den Bau des Erdsitzes bot sich der Luderplatz an. Hier wurden die nicht verzehrbaren Innereien sowie andere Reste des Aufbruches der erlegten Tiere für die Fleischfresser abgelegt. Das lockte vor allem Raubwild und auch Wildschweine an. Und so bekam man auch den Fuchs vor die Flinte, den man sonst oft nur vor seinem Bau erwischen konnte, wenn er ihn während der Geburt des Nachwuchses oder bei extrem schlechtem Wetter aufsuchte.
Zwar gingen inzwischen auch vermehrt Jäger mit Bauhunden wie dem deutschen Teckel – oder Dackel, wie ihn einige wenig respektvoll nannten – auf Raubzug im Bau. Doch die Baujagd war eine blutige Sache. Selten erlebten die Teckel ihren fünften Geburtstag, zu schwer waren die Wunden, die ihnen Fuchs oder Dachs im Bau zufügten, bei dem Versuch, sie vor die Flinte der Jäger zu treiben.
Dennoch, Boni fand die kleinen Teckel mit ihren kurzen Beinchen eher putzig. Er bevorzugte stabile Jagdhunde in respektabler Größe. Unschön war, dass der Teckel zum Modetier verkam. Plötzlich musste der Müller im Dorf einen haben, der Herr Apotheker und selbstverständlich auch der Bürgermeister. Manches Mal fragte er sich, wo die Flut an Teckel-Nachwuchs in Deutschland herkam. Aber der Kaiser lebte die Teckelliebe schließlich vor. Sein Lieblingsteckel Erdmann hatte 1901 das Zeitliche gesegnet, und er konnte es kaum fassen, der Hund hatte ein Grab samt Gedenkstein bekommen. »Andenken an meinen treuen Dachshund / Erdmann 1890-1901 / W. II.« stand auf dem Stein. Vielleicht war der Tod für Erdmann eine Erlösung gewesen, denn zeitlebens wurde er verhätschelt wie ein Schoßhund und hatte dem nicht nachgehen können, was seinem Naturell entsprach. Denn Teckel wurden ursprünglich als reine Jagdhunde mit extrem starkem Jagdtrieb gezüchtet. Der Hund musste in der Lage sein, in den Fuchs- oder Dachsbau, ins Dunkle, zu gehen, und dort wartete der Gegner, der alle Gänge kannte. Um das auszuhalten und noch so verrückt zu sein, immer wieder in diese Gefahr zu laufen, brauchte man nicht nur Charakterstärke, sondern auch eine gute Portion Sturheit und wahrscheinlich auch einen Tick.
Eben schippte er zum gefühlt tausendsten Mal mit dem Spaten Erde auf den inzwischen sichtlich wachsenden Hügel. Der Bau sollte am Rand einer kleinen Eschenkultur entstehen, nicht weit weg vom Bachlauf der Ulster, die östlich an Tann im Tal entlangfloss. Das Flüsschen hatte auch dem Tal den Namen gegeben und schlängelte sich eher gemächlich durch die sanften Hügel der Rhön.
Es war zwar erst Ende März und es hatte in der Nacht sogar wieder Frost gegeben, doch tagsüber gewann die Sonne immer mehr die Oberhand. Boni lief der Schweiß in Bächen den Nacken hinunter. Eine Pause gönnte er sich dennoch nicht. Er wollte früh zurück in der Jagdhütte sein.
Der Abend verhieß ein zünftiges Herrenprogramm. Gepökeltes Wildfleischgulasch in Rotwein mit Kartoffeln, Rotkraut und einem schäumenden Bier. Hätte er sich besser nicht so auf den Abend gefreut, das Wasser lief ihm im Munde zusammen und der Hunger wurde fast übermächtig.
Um drei Uhr nachmittags machte er Schluss und nahm Bodo an die Leine, der inzwischen ebenso missvergnügt dreinschaute wie sein Herr. Es waren nur knapp zweieinhalb Kilometer zurück bis zum Friedrichshof, der Jagdhütte des Freiherrn. Boni überquerte die dahinplätschernde Ulster an dem kleinen Steg, den alle in Tann benutzten, wenn sie über den Bach wollten. Sein Blick glitt aufs Nass: Eine Forelle wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, dachte er. Die Freiherrn von Waldenberg hatten in ihrem eigenen Besitz mit der Schneidmühle das wasserbetriebene Sägewerk, die Schlossbrauerei, mehrere Gutshöfe und die Mühle. Neuerdings wurde von ihnen noch die Gründung einer Fischzucht für die gerade in Mode gekommenen Regenbogenforellen gefördert. Der Fisch von dort war nicht schlecht, besser schmeckten Boni aber die frischen Rhöner Bachforellen aus der Ulster. Allerdings wurden sie immer seltener. Schwarzfischer und das in den Fluss geleitete Abwasser setzten den Fischen zu.
Die Stadtmauer kam nach fünf Minuten Fußmarsch in Sicht. Zu guten Teilen war sie bereits abgetragen, die Schutzfunktion von einst hatte sie seit Erfindung des Schwarzpulvers weitestgehend eingebüßt, und sie diente nur noch zur Kontrolle der Stadtbesucher und zum Ausschluss von vagabundierenden Diebesbanden. Die Stadtmauer hatte die wachsende Gemeinde eingeengt, und die Vorderstadt nach Norden dehnte sich ohnehin schon seit langer Zeit vor den Toren Tanns aus. Außerdem konnten die Bewohner die zurechtgehauenen Steine zum Bau neuer Häuser gut gebrauchen.
Etwas wehmütig ging Boni an der seit 1687 existierenden Krone vorbei, dem ältesten Gasthaus in Tann. Das einladende Gebäude war direkt am Marktplatz und schenkte das vorzügliche Bier der Schlossbrauerei von Tann aus. Seit 1692 braute man dort ein helles, würziges Bier nach fränkischer Brautradition. Genau nach Bonis Geschmack. Die Schlossbrauerei war am Gutshof des gelben Schlosses direkt neben dem Fruchthaus untergebracht. Es gab sogar einen unterirdischen Gang vom Brauhaus zum Fruchthaus. Von dort gelangte die eingelagerte Gerste zur Brauerei, und umgekehrt wurden die gefüllten Bierfässer im tiefen Keller des Fruchthauses mit dem im Winter geschlagenen Eis der Ulster kühl gelagert.
Zu allem Überdruss zogen nun auch noch Küchendüfte in seine Nase. Die deftige Späcksopp und das gebratene Ochsenherz mit Spatzeklöß standen quasi zum Mitessen bereits in der Luft. Boni legte einen Gang zu und zog den zunehmend Richtung Krone strebenden Deutsch-Drahthaar hinter sich her. Der Waidmann ging an der fürstlichen Forstverwaltung vorbei und über den Marktplatz hinauf zum östlichen Ortsausgang.
Auf einem kleinen Weg durch die ersten Buchenschläge kam er endlich an dem Jagdhaus an. Es lag direkt auf dem Engelsberg. Früher war der Friedrichshof ein reiner Gutshof des Freiherrn gewesen. Doch der Pächter zog es vor, in den Ort zu ziehen und von dort die Ländereien zu bewirtschaften. Kurzerhand erklärte Freiherr Friedrich Wilhelm von Waldenberg dann vor etwa zehn Jahren den Friedrichshof zur neuen fürstlichen Jagdhütte. Boni war es mehr als recht gewesen, denn so wie für den Friedrichshof der Begriff »Hütte« extrem stark untertrieben war, so war der Begriff »Hütte« für die alte Jagdbehausung weiter nördlich im Wald noch eine Übertreibung erster Güte.
Tatsächlich war die alte Hütte ein modriger Holzverschlag, der nur für einen Tisch, zwei Stühle und zwei Betten Platz bot. Waldenberg machte das wenig aus, schließlich schlief er nach der Jagd direkt im Schloss, war es doch nur einen Katzensprung entfernt. Gleiches galt für seine Gäste. Doch die Zeiten hatten sich gewandelt. Die Sehnsucht zur Natur mochte vielleicht mit der deutschen Romantik einen Anfangspunkt gehabt haben, zu Ende war die Entwicklung allerdings noch lange nicht.
Alle Welt strebte neuerdings ins Grüne. Das ging so weit, dass Boni bestimmt ein- oder zweimal die Woche tief im Wald Wanderer entdeckte und angesichts der Jagdbewirtschaftung der Wege verwies. Wo würde man hinkommen, würde das Wild am Ende noch Sonntagsspaziergänger oder gar Touristen ertragen müssen? Die laut tuckernden neumodischen Automobile genügten schon, um den einen oder anderen Herzkollaps bei einem braven Bürger zu verursachen. Boni reichte es bereits, dass der technikvernarrte Freiherr sein Knattergefährt dreimal die Woche anließ.
Jedenfalls war der Friedrichshof nun tatsächlich groß genug, um Jagdgästen auch eine adäquate naturnahe Übernachtung im Grünen zu bieten. Für Komfort war dennoch gesorgt. Im Erdgeschoss befand sich ein ausladender Kamin im großen Jagdzimmer. Ebenfalls im Erdgeschoss war eine rustikale Küche mit fließendem Wasser und einer gemütlichen Sitzecke untergebracht. Hinter der Küche verbargen sich der Vorratsraum und direkt daneben eine Toilette mit Wasserspülung. Das grenzte schon fast an überbordenden Komfort. Dieser Luxus wurde allerdings nur von einer Badewanne mit einem Warmwasserholzofen im nächsten Raum übertroffen. Neben dem Hauptraum im Erdgeschoss verfügte der Friedrichshof noch über zwei Gästezimmer, und das gedrungene Gebäude hatte im Obergeschoss, direkt unter dem Dach, drei weitere Schlafzimmer. Boni bewohnte das kleinste Zimmer davon. Glücklicherweise durfte er dort sein altes Bett aufstellen, denn der Revierjäger hatte preußisches Gardemaß und hätte sogar zu den Langen Kerls des Soldatenkönigs, des Vaters des Großen Königs Friedrich, gedurft.
Das Gebäude selbst stand auf einem Steinfundament mit gemauertem Sockel. Darüber begann die mit dunklem Holz verkleidete Fassade. Nach vorn hatte das Haus auf der linken Seite zwei große Sprossenfenster mit weißen Rahmen und grünen Fensterläden für das dahinterliegende Jagdzimmer.
Über dem Eingang des Gebäudes befand sich eine breite Gaube mit zwei Fenstern und natürlich dem obligatorischen Hirschgeweih. In diesem Fall der Kopfschmuck von einem sehr kapitalen Achtzehnender. Die Jagdgäste durften ruhig wissen, welche Prachtexemplare an Rothirschen das Revier des Fürsten beherbergte.
Neben dem mittig gelegenen Eingang waren rechts drei kleinere, enger beisammenstehende Fensterchen für die Küche, ebenfalls mit weißen Sprossen und grünen Läden. Der unweit gelegene Stall des ehemaligen Gutshofes wurde von Boni für die Futterlagerung genutzt, und dort stand auch der Jagdwagen von Waldenberg, eine zweispännige Pferdekutsche mit Gummi-Pneus. Der Freiherr hatte Boni als Teil seiner Entlohnung erlaubt, dauerhaft die Jagdhütte zu bewohnen. So kam es, dass der Waidmann beinahe fürstlich logierte.
Boni musste sich sputen, er ging in die Küche und bereitete sein berühmtes Wildgulasch vor. Dafür gönnte er sich einmal im Monat eine Flasche fränkischen Rotwein mit großem Duft und nicht ganz so erdigem Nachgang wie bei einem schweren Burgunder aus dem Franzosenland. Der Wein war dabei nicht für den Trank gedacht, sondern für die Soße. Nur seinen Gästen zuliebe behielt er für eine Probe ein paar wenige Schluck in der Flasche.
Er selbst mochte es deftig und gönnte sich lieber ein Bier zum Essen, welches er immer von der Krone holte und in Fünf-Liter-Steinkrügen im kühlen Keller vorrätig hatte. Er schaute auf die imposante Eichenstanduhr im Flur, es war bereits fünf Uhr nachmittags, Eile war geboten. Da klopfte es pünktlich an der Tür.
»Bertram, sei gegrüßt, schön, dass du da bist. Ist gerade etwas hektisch, die Kartoffeln sind fast fertig und das Rotkraut darf nicht anbrennen.«
»Guten Abend, darf ich denn reinkommen oder soll ich den künstlerischen Prozess meines Lieblingskoches besser nicht stören?«
»Quatsch nicht so viel, komm rein. Nimm dir ein Bier und gib mir fünf Minuten, dann bin ich entspannt«, entgegnete Boni auf dem Weg in Richtung Küche.
Bertram Kempf betrat die Jagdhütte. Er war seines Zeichens der evangelische Pfarrer von Tann und gleichzeitig der beste Freund des Revierjägers. Wie Boni hatte er vor nicht langer Zeit die vierzig Lenze gerissen. Vielleicht etwas früh waren ihm die meisten Haupthaare verlustig gegangen und nur ein schmucker Haarkranz übrig geblieben. Kempf war unverheiratet und hatte auch sonst wenig Bezug zum weiblichen Geschlecht. Insofern hätte er auch seinen Dienst bei den Tiefschwarzen verrichten können. Doch das war die Besonderheit in Tann. Die Stadt bildete im Meer der katholischen Gemeinden von Würzburg über Fulda bis in die nördliche Rhön fast die einzige evangelische Enklave, seit Johann von Waldenberg um 1530 die Reformation eingeführt hatte. Das hatte in der Vergangenheit stets Anlass zu handfesten Auseinandersetzungen mit den Äbten von Fulda gesorgt. Ihnen war das evangelische Tann ein Dorn im Auge und ein immerwährend Schmerz produzierender Stachel im Fleisch der reinen Lehre. Selbst Rom hatte sich schon zu dieser ungewöhnlichen Situation geäußert und Maßnahmen zur Eingemeindung in den Schoß der römisch-katholischen Kirche angemahnt. Doch die zu Bekehrenden wollten sich einfach nicht bekehren lassen. Ganz im Gegenteil. Die Industrialisierung seit Mitte des letzten Jahrhunderts kam einer Revolution gleich, zumindest gab es erhebliche Volksverschiebungen. Im Zuge der innerdeutschen Völkerwanderungen vom Land in die Städte, manches Mal quer durch das Reichsgebiet, fand eine immer größer werdende Vermischung der Glaubensrichtungen statt. Dank immer besser werdenden Zugverbindungen konnte es auch in ländlichen Regionen zu Wanderungen kommen, und es wurde nicht wie über Jahrhunderte üblich im Umkreis von fünf Kilometern geheiratet.
Aus dem Regal über der Sitzecke nahm sich Bertram seinen Tonkrug mit den schwarzen und weißen Streifen im Wappen der Fürsten zu Isenburg-Büdingen. Im Gegensatz zu Boni war er kein gebürtiger Tanner. Der Pfarrer kam aus Büdingen in der Wetterau, dem ausgesprochen fruchtbaren Landstrich zwischen Frankfurt und dem Vogelsberg. Die mittelalterliche Stadt war deutlich größer und für ihr ungewöhnliches Schloss bekannt, welches in Form einer Acht gestaltet war. Boni war einmal mit Bertram dort gewesen. Ihn hatten die kräftigen Stadtmauern beeindruckt, die bis heute unversehrt erhalten geblieben waren. Das dort ausgeschenkte Bier von der Fürstlichen Brauerei zu Wächtersbach hatte er auch noch in sehr guter Erinnerung. Die kleine Stadt war für eine Belieferung mit der Pferdekutsche zu weit weg, aber dank der Eisenbahn war das kein Problem mehr, und der Freiherr ließ sich zu hohen Festtagen gerne auch ein kleines Fass aus der Stadt am südlichen Rand des Vogelsberges kommen.
Als das kühle Bier aus dem großen Tonkrug in die kleineren Humpen floss, bildeten sich feine Wasserperlen auf dem Wappenschild von Isenburg-Büdingen und dem Tonkrug von Boni mit dem Wappen der Freiherrn von Waldenberg.
»Dem Herrn sei gedankt, ich habe einen völlig unchristlichen Kohldampf«, freute sich Bertram, als sein Freund das duftende Wildgulasch auftischte.
»Danke lieber meinen Kochkünsten und dem Geschöpf, das für unser leibliches Wohlergehen sein Leben gegeben hat«, erwiderte Boni. »Und nun lass es dir schmecken.«
Die beiden Freunde legten sich ins Zeug und ließen nicht einen Krümel auf den Tellern übrig, wobei Bertram noch zweimal einen Nachschlag bekommen hatte. Überhaupt sah man, dass der eine der beiden sich täglich in der Natur bewegte und mehrere Kilometer zu Fuß hinter sich brachte, während der andere seinen Beruf eher geistig oder besser geistlich ausübte. Nicht ganz überraschend hatte die Leibesmitte des Pfarrers stattliche Ausmaße.
Nachdem die Teller weggeräumt waren und der Abwasch erledigt war, folgte der gemütliche Teil. Da es inzwischen dämmrig wurde, zündete Boni die zwei Öllampen an der rustikalen Wandvertäfelung der Sitzecke an. Auf dem Tisch spendeten zwei größere Kerzenleuchter zusätzlich warmes Licht.
Der Jäger holte die geliebte Meerschaumpfeife seines Vaters heraus und stopfte sie mit seiner Spezialtabakmischung. Die Pfeife war eines der ganz wenigen Erbstücke, die er von seinem Vater hatte. Sie erinnerte ihn an früher, und bei jedem ersten Zug aus der Pfeife musste er an seine glücklichen Kindheitstage denken, wie er mit seinem Vater durch Feld und Flur, über die grünen Berge und durch die luftigen Wälder von Tanns Jagdrevieren gezogen war.
Sein Vater hatte ihn Schritt für Schritt an die Natur herangeführt. Er war für die strengen damaligen Verhältnisse ungewöhnlich mehr Freund als herrschendes Familienoberhaupt gewesen. Trauer überkam den Jäger immer noch an dunklen Tagen, weil der Vater im Krieg gefallen war, als Boni kaum acht Jahre alt war.
Bertram ließ ebenfalls eine gute Zigarre erglimmen und schaute sehnsuchtsvoll auf den schmucken Holzkasten auf dem Regal in der Ecke der Küche. Boni musste schmunzeln, denn beide teilten eine Leidenschaft: das Schachspiel. Nur waren die Gewinnverhältnisse völlig ungerecht verteilt. Der Jäger hatte einen sehr scharfen Verstand und gewann fast immer.
»Heute Abend bist du fällig. Viktoria ist mir hold. Ich spüre seit heute Morgen, dass es nun zur gerechten Revanche kommt.« Sie spielten über eine Stunde angestrengt und abgesehen vom Rauchen und einigen Schlucken Bier hochkonzentriert und nahezu wortlos. Viktoria, Nike, Sigyn und alle anderen infrage kommenden Siegesgöttinnen schienen sich wieder neuen Günstlingen zugewandt zu haben. Der Pfarrer hatte jedenfalls erneut das Nachsehen.
»Sei nicht brummelig. Das nächste Mal wirst du bestimmt gewinnen«, versuchte Boni seinen Freund aufzumuntern. »Erzähle mir lieber, was es Neues aus Tann gibt. Du weißt, ich lebe hier oben fast wie ein Eremit und bekomme ziemlich wenig von dem Klatsch und Tratsch mit. Wenn meine Mutter wegen der Wäsche nicht einmal die Woche hier hochkäme, könnte ich auch gleich die Jagdhütte mit der Insel von Robinson Crusoe tauschen.«
»Hm, lass mal überlegen. Du hast immer so große Erwartungen, vergisst aber dabei, dass ich nicht im Verein der reaktionären Zunft bin. Die römischen Kollegen erfahren natürlich dank Beichte noch ganz andere Dinge«, erklärte der Pfarrer etwas wehmütig. »Aber gut, das mit dem Metzger Freimann hast du erfahren?«
Boni schüttelte den Kopf.





























