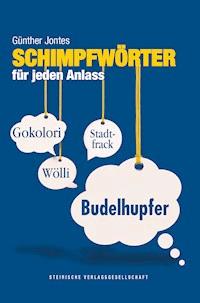
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie man in Österreich schimpft, spottet und beleidigt, hat Günther Jontes für Sie erkundet und aufgeschrieben – zum Nachlesen und Schmökern. Einige Begriffe werden Ihnen die Schamesröte ins Gesicht treiben, andere werden Sie zum Lachen bringen – ein Buch jedenfalls, das bewegt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelseite
Günther Jontes
Schimpfwörter für jeden Anlass
Steirische Verlagsgesellschaft
Vowort
Schon wieder ein Schimpfwörterbuch? Ja, und zwar ein ganz besonderes! Diesmal geht es um Hintergründe, welche unter diesen Außenseitern unserer schönen deutschen Muttersprache welchen menschlichen Charakteren zuzuordnen seien. Wann werden denn Schimpfwörter in größeren oder kleineren Dosen verabreicht? Gründe gibt es viele. Uns braucht nur etwas an unserem Gegenüber nicht zu passen und schon fällt uns etwas ein, das wir ihm unter die Nase reiben möchten. Ob wir es tun, ist wieder eine andere Sache, denn es liegt an unserem eigenen Temperament, ob es aus uns herausbricht oder ob wir es uns wegen gewisser Anstandsregeln oder auch aus Opportunismus, Furcht vor Konsequenzen verkneifen.
Dieses neue Schimpfwörterbuch soll auch mit offenem Gemüt und Humor gelesen werden. Für eine allfällige Verwendung dieser Malediktionen übernehmen Autor und Verlag natürlich keinerlei Verantwortung, aber das Buch sollte eigentlich auf jedem Tisch eines Richters oder Advokaten liegen. Auf Ihrem liegt es schon und nun haben Sie die Möglichkeit, sich daraus zu bedienen, so oft und so lang Sie wollen! Erfreuen Sie sich also an den mehr als 1000 Schimpfwörtern – oder ärgern Sie sich drüber. Erfahren Sie ihre Bedeutung und lesen Sie über Anekdoten und Gschichterln, die oft dahinter stecken.
Viel Vergnügen!
Ängstlichkeit und Feigheit
Angsthase m. (Aungsthos): Die Überlebensstrategie des Feldhasen besteht in seiner Unauffälligkeit, seiner Schnelligkeit beim Flüchten und seiner Fürsichtigkeit, die ihn Gefahr schnell erkennen lässt. Seine großen Ohren zeugen davon. Seine Vorsicht wird – typisch menschlich! – als Angst ausgelegt. Und so wird der Angsthas auch als Feigling verstanden.
Angstscheißer m.: Sich in die Hose machen, wenn vor Angst alle Schließmuskeln außer Kontrolle geraten, kann vorkommen – und damit ist schon das kräftigste aller Wörter für ängstliche Menschen geboren.
Federant m.: Federn haben bedeutet, es mit der Angst zu tun haben. Das hängt wohl mit dem anschaulichen Bild zusammen, wenn ein Vogel mit Mühe und Not einem Greifvogel entkommt und diesem nur einige Federn bleiben, die seine erhoffte Beute ihm gelassen haben. Das Schimpfwort kennzeichnet einen Feigling und ist wie ein lateinisches Fremdwort gebildet.
Federntandler m.: Ein >Tandler ist ein Trödler, der in diesem Falle mit der Angst zu tun hat. Und die Bedeutung zielt als Schimpfwort in dieselbe Richtung wie der Federant.
Feigerl s.: Ein Angsthase, Feigling, wird im Schimpfwort wie ein kleines Veilchen gesehen.
Hasenfuß m. (Hosnfuass): Was beim Angsthasn gesagt wurde, gilt auch hier, nur steht der zu schnellstem Lauf fähige Fuß für das gesamte Tier.
Lettfeige w. (Lettfeign): Mutlosigkeit, Memmenhaftigkeit ist unmännlich und zieht Spott und Hohn nach sich. Schon der große und humorvolle Barockprediger Abraham a Sancta Clara verwendete dieses Schimpfwort in seinem „Judas der Erzschelm“. Lett ist so viel wie Schmutz, Dreck und vergleicht sich auch mit mundartlich Letten für Lehm.
Muffengänger m.: Ein solcher ist ein eklatanter Feigling. Ihm geht die Muffe, womit wohl der Anus gemeint sein wird, der sich aus Angst in aufgeregter Bewegung befindet. Und Muffe könnte mit muffeln „stinken“ zusammenhängen.
Reisgänger m.: Ein Feigling, Angsthase wird als Reisgänger beschimpft. Das Getreide Reis spielt dabei gewiss keine Rolle. Man sagt auch, dass jemanden der Reis geht, Reisgang hat. Ob das Wort mit dem alten militärischen Begriff Reisgänger oder Reisläufer zu tun hat, das jemanden bezeichnete, der sich als Landsknecht verdingen möchte?
Reisriesler m.: Hier geht es um den Reis, und zwar um seine Körner. Wie Reisstreuer meint es einen Menschen, der zu einem gewissen Anlass Reiskörner ausstreut. Als in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts immer mehr Leute sich Griechenland als Ferienland erkoren, wurde man damals Zeuge, wie bei Hochzeiten dem neuvermählten Paar beim Verlassen der Kirche Reis als Zeichen der Fruchtbarkeit und Glückverheißung gestreut wurde. Eine nicht ungefährliche Sache, denn auf den glatten Steinfliesen konnte man leicht darauf ausgleiten und sich verletzen. Kann man daraus eine Verbindung zu Ängstlichkeit herstellen?
Scheißer m.: Bei großer Angst lassen manchmal die Schließmuskeln aus und das überwältigende Gefühl materialisiert sich in der Hose des Hosenscheißers, schlichtweg des Scheißers. Verkleinert in ein Scheißerl steht aber ein liebes kleines Kind schutzbedürftig vor einem. Exkremente als Scheiße hat sich heute genauso wie >Arsch längst in der Alltagssprache emanzipiert. Scheißer ist aber trotzdem ein höchst beleidigendes Schimpfwort geblieben, denn es bezeichnet einen Feigling, einen, der die Hosen voll oder wie man sagt Schiss hat. Die Verkleinerungsform Scheißerl ist ein echtes Kosewort für Kleinkinder, womit zum Ausdruck kommt, dass das Bauxerl unverschuldetermaßen noch nicht „stubenrein“ ist.
Traumichnicht m. (Trauminet): Ein schöner Satzname als Schimpf für einen ängstlichen Menschen, der jedem Risiko ausweicht, sich an nichts herantraut, das ein wenig Wagemut erfordert.
Alter
Altspatz m.: Das Wort hat etwas Begütigendes, aber doch Spöttisches an sich. Damit könnte man auch einen alten Menschen bezeichnen, der rüstig ist und dies besonders zur Schau stellt.
Grufti m.: Ein von Jugendlichen gebrauchtes Spottwort für die ältere Generation, von der man meint, sie stünde bereits am Rande des Grabes. Im Übrigen ein typisches Beispiel für die Primitivsprache, deren Begriffe auf -i enden. Vgl. >Ösi und dgl.
Knacker m.: Ein älterer Mann, ein alter Knacker, bei welchem die Arthrosen bereits seine Gelenke knacken lassen.
Krauterer m.: Wenn jemand ein rechter Zauderer ist, uneffektiv und langsam arbeitet, langweilige, kleinliche Charaktereigenschaften aufweist, dann ist er ein Krauterer. Hat er dazu auch schon ein gewisses Alter erreicht, dann ist er gar ein alter Krauterer. Möglicherweise zielte das Wort einst auf einen Kräutersammler oder -händler, der mit kleiner Ware umging, oder auf einen Handwerksmeister, der seinen Gesellen und Lehrlingen nur Kraut vorsetzte. Kraut, einst das Standardgemüse schlechthin, begegnet einem noch in weiteren Wörtern des Schimpfes und des Spottes.
Schabracke w. (Schabrackn): Ein älteres Frauenzimmer wird auch als alte Schabrackn verspottet. Wohl ein obszön gemeinter Zusammenhang mit einer abgerittenen Satteldecke. Von türkisch caprak „dasselbe“.
Schachtel w.: Sehr abschätzig für eine alte Frau. Wohl aus der Jägersprache, die damit eine bereits unfruchtbar gewordene alte Rehgeiß bezeichnet. Wird aber eher für eine abgenützte, kaum mehr verwendbare Kartonschachtel gehalten, die in einer Reihe von Schimpfwörtern steht, die aus Behältnissen gebildet werden, z. B. >Häferl.
Schlitten m.: Selbst Fahrzeuge und Möbel müssen im spöttischen Vergleich mit alten Menschen herhalten. Vgl. chaise französisch für Stuhl wird bei uns zur alten Tschessn. Und ein alter Schlitten ist keine gemütliche Rodel, sondern ein winterliches Gebrauchsfahrzeug für Menschen und Güter. Und auch dieses muss zur schimpflichen Benennung einer älteren Frau herhalten.
Sud m.: Sud kommt von „sieden“, nämlich Wasser bis zum Kochen erhitzen, um darin etwas zu garen. Ein alter Sud ist ein alter Mann und das erklärt sich wahrscheinlich daraus, dass damit die mehrmals gesottenen Teeblätter gemeint sind, die saft- und kraftlos geworden sind und keinen ordentlichen Tee mehr ergeben. Beleidigender noch ist die Rede vom alten und schiachn Sud.
Suppenhenne w. (Suppmhenn): Unter dem häuslichen Nutzfedervieh ist das Huhn der wichtigste Vertreter. Fleisch und Eier sind die begehrten Produkte. Wenn eine Henne schön brav jeden Tag ihr Ei legt, dann ist sie wohlgesonnen und entgeht dem Mittagstisch und der Speisekarte. Lässt sie aber einmal nach oder stellt die Eierproduktion gar ganz ein, dann wird sie zur alten Suppmhenn. Da auch ihr Fleisch nicht mehr gschmackig genug ist, taugt sie nur mehr dazu, dass aus ihr eine gehaltvolle Hühnersuppe (Hendlsuppm) gekocht wird, die man ja für gewisse Wehwehchen und Zustände geradezu als ein Heilmittel ansieht. Und das versöhnt wieder ein wenig damit, dass mit dem Begriff die Schmähung einer alten Dame verbunden wird.
Tatel m.: Ein alter Mann, der schon körperlich und geistig gebrechlich zu sein scheint, ist ein alter Tatel. Koseworte wie Tati, Tatta für „Vater“ weisen in diese Richtung. Im Jiddischen als altertümlicher deutscher Sondersprache wird der Vater allgemein als Tate bezeichnet.
Tatterer m.: Beim alten Tatterer werden das Zittern der Hände und das Wackeln des Kopfes zum Kennzeichen seines körperlichen und nervlichen Zustandes. Er ist der alte Mann schlechthin und muss sich trotzdem noch verspotten lassen.
Beamtentum
Aktenschmierer m.: Quod non est in actis, non est in mundo – „Was nicht in den Akten steht, existiert nicht“ heißt es im Lateinischen. Und Akten, Berge verstaubter Akten kennzeichnen den Beamten, der einst dieselben in schöner Handschrift mit Tinte und Feder anlegen und bearbeiten musste. Alle Schimpf- und Spottnamen für Beamte bewegen sich in diesem Milieu, wobei der Aktenschmierer bereits einer höheren Dienstklasse anzugehören scheint.
Beschwichtigungshofrat m.: Der famose Spötter Fritz Herzmanovsky-Orlando spricht einmal in einer seiner Satiren von den beiden Hofräten Rücksichtl und Nachsichtl und das führt auch zu diesen höchstrangigen Beamten, die von ihren Vorgesetzten dazu angehalten werden, schwierige Situationen durch Begütigen und Beschwichtigen einer Streitpartei zu Glätten und vielleicht gar zu lösen. Für unsere bundesdeutschen Leser: Seit 1918 gibt es in Österreich keinen kaiserlich-königlichen Hof mehr. Aber der Diensttitel Hofrat hat alle Fährnisse überlebt und so gibt es ihn noch heute, denn er ist ja sooo würdevoll. Nur den wirklichen Hofrat gibt es nicht mehr. Aber es hat ihn bis vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls noch gegeben.
Konfusionsrat m.: Im Krieg der Akten und Gesetze kommt es zu jeder Art von Chaos, Pallawatsch, und diese Konfusion geht oft von Juristen aus. Spöttisch wird ein solch mieser Rechtskundiger deshalb als Konfusionsrat bezeichnet. Ludwig Thoma, der selbst ein gstudierter Jurist war, sagt einmal in einer seiner Geschichten von einem solchen „Er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstande“.
Schreibtischhengst m.: Ein Beamter gleichsam als Beherrscher seiner Kanzlei, dessen Bühne gegenüber den Bittstellern sein Schreibtisch ist.
Sesselfurzer m.: Während der Sesselkleber sich mehr auf einen Politiker bezieht, der nicht von seiner Pfründe weichen will, so ist der Sesselfurzer eher ein Beamter, der weltfremd alles nur aus der Perspektive seines Schreibtisches kennt, beurteilt und nach dem Wort seiner Vurschriftn regelt. Er ist so an seinen Sessel gefesselt, dass er nicht einmal zum Furzen aufsteht, sondern dies im Sitzen erledigt, oft in der Meinung, dass man ihn dabei nicht hört. Das hängt natürlich auch von der Polsterung seines Thrones ab. Der Furz ist der in gehobener Konversation gerade noch tolerierte gasförmige Teil der Verdauung. Wer sich unter seinesgleichen kein Blatt vor den Mund nimmt, wird eher mit Schaas (städtisch!) oder Schoaß (ländlich!) aufwarten. Unser Schimpfwort hingegen ist Teil des Wortschatzes von Kritikern der Bürokratie und der Beamten an sich.
Ziffernspion m.: Steuerfahnder, die die Finanzbehörde ausschickt, um sich Kenntnisse über gewisse Zustände bei ihrer Klientel zu verschaffen, werden als Spione angesehen. Und das Material, nach welchem gefahndet wird, sind eben Ziffern, wenngleich man eigentlich von Zahlen sprechen sollte. Aber beim Schimpfwort nimmt man es eben nicht so genau.
Berufe und Tätigkeiten – ernsthaft und scherzhaft
Badwaschel m. (Bodwaschl): In der alten Badstuben des ausgehenden Mittelalters war der Badwaschel eine Hilfskraft, die Wasser schleppte, das Feuer bediente und mit einem Reibtuch, dem Waschel, die Badenden abfrottierte und massierte. Da er dies wegen des erhofften Effekts ziemlich heftig, ja unsanft machte, war er damit auch als >Grobian verschrien. Sein Ende kam, als die Badstubenzeit wegen der grassierenden Syphilis mit dem Beginn des 16. Jahrhunderts auslief. Aber noch heute muss sich der wichtige Bademeister in den öffentlichen Schwimmbädern dieses Wort gefallen lassen.
Baráber m. (Barába): Dieses Wort wertet einen Schwerarbeiter, Hilfsarbeiter ab, einen, der barabert. Es kam wahrscheinlich um 1900 aus Oberitalien, wo barabba einen Landstreicher, Taugenichts nach dem biblischen Barabbas bezeichnet. Als Fremdwort begleitete es die damals in großen Mengen nach Österreich flutenden Männer, die vor allem in Straßen- und Bahnbau Arbeit und Brot fanden.
Budelhupfer m. (Budlhupfa): Unter Budel versteht man den Verkaufstisch einer der heute im Aussterben begriffenen Kleinläden für Lebensmittel und Haushaltsbedarf, einer Greislerei. Hinter dieser Budel stand der Verkäufer, der seine klassische und hämische Charakterisierung durch Helmut Qualtingers Herrn Karl gefunden hat. Unter Hupfen ist hier das geschäftige, andienernde Benehmen eines solchen Commis zu verstehen.
Damenschneider m.: Scherzhaft für einen Gynäkologen, der auch operative Eingriffe an seinen Patientinnen vornimmt.
Dampfgscherter m. (Daumpfgscherta): Was ein >Gescherter ist, erhellt der entsprechende Eintrag. Unser Wort will wohl andeuten, dass ein Bauer auch dann ein Bauer bleibt, wenn er mit dem technischen Fortschritt, wie er vor hundert Jahren auch die Landwirtschaft erreichte, sich modernisierte.
Fetzenmufti m.: Im Österreichischen Bundesheer für die Verwaltungsunteroffiziere, denen die Bekleidungskammer einer militärischen Einheit untersteht. Der Begriff Mufti, der einen muslimischen Würdenträger meint, wurde im Bundesheer schon verwendet, als der Islam in Europa noch überhaupt keine Rolle spielte
Fetzentandler m. (Fetzntandla): Spöttisch für Trödler, auch Textilhändler. Frauen verwenden des Öfteren für ihre Garderobe den Ausdruck „Fetzen“.
Fleischhacker m. (Fleischhocka): Der Vergleich mit einem Fleischhacker für einen brutalen Arzt, vor allem Chirurgen, hinkt gar nicht so sehr. Denn auch dieser Gewerbetreibende muss über viele Kenntnisse, wenn auch der tierischen Anatomie, verfügen.
Furchenscheißer m.: Arbeitet der Landwirt auf dem Felde, so hat er wohl kaum Wille und Möglichkeit, sich nach Hause zu begeben, um dort aufs Häusl zu gehen, also die nämliche hölzerne bäuerliche Kleinarchitektur abseits des Hofes mit dem in die Türe eingeschnittenen Herz aufzusuchen. Die Furche tuts auch.
Gescherter m. (Gscherta): Das Recht, ungekürztes Haupthaar zu tragen, stand im Mittelalter nur dem Adeligen zu. Den Bauern als Untertanen, die im starren Gefüge der damaligen Gesellschaft die unterste, wenngleich zahlenmäßig größte Schicht bildeten, war dies verwehrt und sie mussten, auch zur äußeren Kenntlichmachung ihres Standes, geschorenen Hauptes als Gscherte einhergehen. Die Demütigung ist seit Jahrhunderten beseitigt, das Schimpfwort ist dem Bauern geblieben. Siehe auch >Dampfgscherter.
Gigerer m.: Speziell in Wien für den heute schon fast ausgestorbenen einstigen Pferdefleischhauer, der die armen Leute mit billigem Fleisch versorgte. Man sagt dazu auch >Pepihacker.
Glatzentischler m. (Glotzntischla): Wieder eines dieser spottenden Scherzworte für den Herrenfriseur, der aus einer schwindenden männlichen Haarpracht noch etwas Ansehnliches tischlern soll.
Hackler m.: In der Diskussion um Pensionsrechte der Arbeiter und Angestellten kam der Hackler wieder in aller Munde. Das ist ein schwer arbeitender Mensch, der in seinen Betrieb, seine Fabrik in die Hockn geht, wo er sein Werkzeug schwingt und diesen Namen eher abschätzig tragen muss.
Häuselräumer m. (-raama): In den Zeiten des Plumpsklos auch in den Häusern der Stadt war es für die Allgemeinheit ein Problem, sich der menschlichen Exkremente zu entledigen. Vor zwei Jahrhunderten gab man den damit Beschäftigten den beschönigenden Namen Nachtkönig, weil dieses anrüchige Geschäft im Schutze der Nacht geschah. Dem Häuselräumer war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein dieses Metier anheimgegeben. In den Häusern gab es meist stockweise die Aborte, von denen Keramikrohre in die Tiefe des Kellers führten und in ein großes Holzfass mündeten, das Abortfassl. Auf einer Fasslleiter zog man mit Stricken das Fass auf den Gehsteig des Hauses. Hier wartete ein Pferdegespann. Das Fass wurde damit an einen Ort außerhalb der Siedlung gebracht und meist ohne Scheu in ein fließendes Gewässer entleert. Die Häuslramer waren wilde Gesellen mit langen Lederschürzen und einer Laterne, denn es war ja Nacht, wenn sie tätig waren. Sie galten nicht nur wegen der Hygiene, sondern auch wegen ihrer Arbeit als verachtenswürdig. Und der Schimpfname, der sich von ihrer Arbeit ableitete, wurde auch ziemlich leichtfertig auf einen besonders ungepflegten und verwahrlosten Mann übertragen.
Holzwurm m. (Hulzwurm): Der Holzwurm ist gar kein Wurm, sondern die in altem Holz lebende Larve eines Insekts. Aber dieser Nichtwurm wird im Scherze auch zum Namensspender für einen Tischler.
Klapperschlange w. (Kloppaschlaungan): Nordamerikas gefährlichste Giftschlange in den Steppen und Wüsten des Südens der USA warnt ihre Feinde mithilfe einer hornigen Klapper, welche die Überreste der jährlichen Häutung darstellt. Eine Sekretärin mag ja auch zuweilen bissig sein, wenn sie den Weg zu ihrem Chef versperrt. Aber meist hört man von ihr nur das Klappern ihrer Schreibmaschine. Aber das ist ja auch schon durch mehr als zwei Jahrzehnte Vergangenheit, denn Schreibmaschinen werden nur mehr von alten Dichtern und anderen Spinnern bedient, weil der Anschlag am Keyboard nur ein sanftes, verhaltenes Geräusch ist.
Knieriem m. (Kniaream): Mit einem ledernen Knieriemen hält der Schuster, egal ob Flick- oder Maßschuster, sein Werkstück fest. Johann Nepomuk Nestroy hat in seiner unsterblichen Komödie „Lumpazivagabundus“ unter dem liederlichen Handwerkerkleeblatt den Schuster Knieriem unsterblich gemacht. Und der wurde sogar zum Spottwort für unseren biederen Gewerbetreibenden.
Küchendragoner m. (Kuchldragauna): Die Dragoner waren in der altösterreichischen Armee die am schwersten bewaffneten Reiter der Kavallerie. Am golden blitzenden Helm trugen sie einen Drachen, dem sie auch ihren Namen verdanken. Man kann sich aber vorstellen, dass ein Kuchldragoner kein geharnischter Mann, sondern eine resolute Köchin in einer Herrschaftsfamilie war, welche ihr Küchengesinde streng in Zucht und Ordnung hielt. Nur im Privathaushalt, denn in einem Restaurant gaben die Köche den Ton an.
Ladenschwengel m. (Lodnschwengl): Abfällige Bez. für Handelsangestellten, Verkäufer, Commis. Abwertend, ja beleidigend allerdings ist der >Schwengel, über den noch eine ganze Menge zu sagen sein wird.
Milchpritschler m. (Müch-): Offene Milch gibt es heute nur mehr, wenn man sie mit dem Milchkandl beim Bauern selber abholt. Alles andere erledigt die Lebensmittelindustrie und man staunt darüber, was uns in den Regalen der Supermärkte so an vielfältigsten Milchsorten hygienisch verpackt anblickt. Doch früher, als der Greisler die in großen Milchkannen von der Molkerei angelieferte Milch dem Kunden noch mit dem Messkandl die gewünschte Menge zuteilte, da mochte es wohl sein, dass der geschäftstüchtige Kaufmann seine Ware ein wenig streckte, um so zusätzlichen, aber unehrlichen Gewinn zu machen. Heute alles vorbei. Wirklich?
Pantscher m. (Pauntscha): Pantschen, also etwas Flüssiges mit etwas Billigerem in betrügerischer Weise strecken, kann man vieles: Milch, Wein, Säfte und dergleichen. Der Pantscher tut ein solches und bekommt dafür diesen Unehrennamen verliehen. Er macht ein Mischmasch, einen Pantsch.
Pappenschlosser m. (Pappm-): Zwei sehr gegensätzliche Begriffe treten da in eine spottende Verbindung. Und gemeint ist der Zahnarzt oder Dentist, von dem man als Patient hofft, dass bei ihm ein etwas feineres Werkzeug als Hammer, Meißel, Zange oder Schraubenzieher zum Einsatz kommt.
Pepihacker m. (-hocka): Der Wiener Pferdefleischhauer, dessen schon als >Gigerer gedacht wurde, führt diesen Scherznamen wahrscheinlich deshalb, weil einer der häufigsten Namen für einen Fiakergaul Pepi war. Dieses Gewerbe versorgte einst die ärmeren Volksschichten mit Fleisch. Die Hausfrau machte daraus ein Trab-Trab-Gulasch und im Scherze warnte man davor, beim Genusse nicht auf einen Hufnagel zu beißen. Heute schätzen Feinschmecker und Gesundheitsapostel noch immer diese Ware, denn von einer Pferdefleischleberkässemmel und von dem extrem mageren und cholesterinfreien Fleisch will man halt doch nicht lassen.
Pompfüneberer m. (Pompfinebera): Da schimmert in der Ursprünglichkeit der Wiener Mundart ein schönes französisches Wort durch: Entreprise des pompes funèbres „Bestattungsunternehmen“. Diese Privatunternehmen waren der Garant für die berühmt-berüchtigte sogenannte schöne Leich. Und alle, die in einer solchen Firma für die letzten Riten Hand anlegten, wurden eben, und zwar mehr oder weniger wertfrei, als Pompfüneberer bezeichnet. Das gilt auch für heute, ist aber hochsprachlich nicht gebräuchlich und nur auf die Sargbegleiter beschränkt.
Pudelscherer m. (Pudlschera): Der flinke, intelligente Pudel wurde und wird auf eine besondere Art so geschoren, dass er gleichsam eine lebende Hundeskulptur bildet. Dazu ist der Hundefriseur, der Pudelscherer eben, da. Und wenn wundert es da, wenn der Herrenfriseur auch scherzhaft in dieser Weise benannt wird.
Raundler m. (Raunla): Eine Raunl ist eine Ziehharmonika, vorzugsweise die steirische Harmonie. Und recht langweilig und fehlerhaft darauf herumfingern heißt mundartlich raunln. Und schon ist ein Schimpfwort für einen schlechten Volksmusikanten zur Hand.
Rechtsverdreher m. (-verdrahra): Ein Wortspiel mit dem Rechtsvertreter als Jurist, der bei Verteidigung und Anklage versucht, das geltende Recht zugunsten seines Klienten zu interpretieren, im schlimmsten Falle zu verdrehen. Man hüte sich, einen Advokaten womöglich öffentlich so zu bezeichnen, denn da hängt dann schon eine Beleidigungsklage in der Luft. Im Übrigen müsste dieses Schbimpfwörterbuch, in welchem sie gerade schmökern, im Regal jedes Rechtsverdreh… – pardon Rechtsvertreters stehen, um im Zweifelsfalle sich über den Klagwert bestimmter Wörter im Klaren zu sein.
Rübenzuzler m. (Ruabmzuzla): Schimpfwort für einen Dummkopf, Nichtskönner, Schwächling. Wörtlich einer, der Rüben aussaugt, zuzelt. Vgl. Zuzel „Kinderschnuller“. Das allgemeine Bild eines Menschen, der die fad schmeckenden Rüben aus Hunger oder auch Pedanterie noch aussaugt.
Rüsselputzer m. (Riasslputza): Der Rüssel ist im menschlichen Antlitz im scherzhaften Sprachgebrauch die ganze Partie um Mund und Nase. Der Rüsselputzer ist daher vor allem der Barbier, der heute im modern entwickelten Hilfsinstrumentarium des sich selber rasierenden Mannes kaum mehr einen Stellenwert hat. Wer es sich leisten konnte, hatte einst sogar ein Rasierabonnement, ließ sich im Salon bedienen oder gar zu Hause regelmäßig balbieren. Geblieben aber ist der Spitzname für einen Friseur.
Sackelpicker m. (Sacklpicka): Tüten pardon Sackln aus Papier zusammenzukleben, picken, ist eine geistlose Tätigkeit, vor der vergleichsweisen Luxushaft für Ganoven unseres heutigen Strafvollzuges wurde diese erwähnte Arbeit von Häftlingen als eine Art Beschäftigungstherapie ausgeführt. Deshalb wurde der Sacklpicker ein Synonym für einen Häftling.
Sonntagsjäger m. (-jaga): Jemand, der trotz Jagdberechtigung nur selten auf die Jagd geht und auch das nur, weil er vermeint, dies seinem gesellschaftlichen Rang schuldig zu sein. Das ist das typische Metier von Bankern, Versicherungsdirektoren oder Politikern, da kann man Begeisterung für Natur und Tierwelt zeigen, auch wenn sie nur gespielt, da ist man ganz unter sich.
Stadtfrack m. (Stoodfrack): Für das Landvolk war im 19. Jahrhundert der Frack das städtische Männergewand schlechthin, während den Bauern der Haftelrock und andere schöne Trachtenstücke zierte. Der fest in Tradition und Natur verwurzelte Landwirt sah den Stadtmenschen, der sich aufs Land und damit in seinen Wirkungskreis verirrte, immer schon ein wenig als dümmlich und naiv an, weil er nicht mit Gegebenheiten dieses Milieus zurechtkam. Und so ist der Stadtfrack bis heute die scherzende Zubuße für den Städter, der seinerseits auf das Mädchen vom Lande als Landpomerantschen schimpft.
Stift m.: Heute ist sogar der Lehrling im Schwinden und muss sprachlich einem Auszubildenden (Azubi) Platz machen. Aber der Stift für den jungen Burschen, der eben eine Lehrstelle bekommen hat, lebt noch. Die Herkunft dieses abschätzigen Wortes ist dunkel. Sollte es etwa mit der Redensart vom stiften gehen für flüchten, sich aus dem Staub machen zusammenhängen?
Versenkungsrat m. (-rot): Den >Pompfüneberer haben wir schon kennengelernt, das ist der Sargbegleiter, der in Ausübung seines Berufes niemals lachen darf. Der den Leichenzug dirigiert wird im Scherze wie ein höherer Beamter zum Rat der Sargversenkung tituliert. Auch der Totengräber kann so heißen, zumal er das Grab bei luftiger Arbeit unter freiem Himmel aushebt und in Shakespeares „Hamlet“ sogar einen überaus weisen literarischen Vertreter hat.
Viehbader m. (Viechboda): Was beim Menschen Recht ist, soll auch für das Vieh gelten und so hat die leidende ländliche Tierwelt eben wie der Mensch einen Bader.
Wurmbader m. (-boda): Dieser Bader hat nun mit dem Arzt überhaupt nichts zu tun. Denn das ist der Angelfischer, der den Wurm als Köder auf dem Haken ins Wasser hält, ihn sozusagen badet und hofft, dass etwas anbeißt. Ist er bei seinem Tun erfolglos, braucht er für Spott nicht zu sorgen und hat das originelle Wort schon eingeheimst.
Wurzelsepp m. (Wurzlsepp): Heute, wo der Fernhandel und die Plantagenzucht so manches an heilenden Wurzeln und Kräutern in die Drogerien für unseren Gebrauch liefert, wird es nur mehr wenige kundige Männer geben, die die Wälder durchstreifen, um uns diese Naturschätze zu verschaffen. Josef und damit Sepp war vor Zeiten der häufigste Männername, womit sich diese eher wohlmeinende Bezeichnung ergab.
Zahnbrecher m. (Zaunbreicha): Zahnweh (Zähntweh) gehört zu den am meisten peinigenden Schmerzen. Einst blieb dem Leidenden als einzige Möglichkeit nur, den Zahn reißen zu lassen. Wer es nicht selber schaffte, den oft verklemmt im Kiefer sitzenden Missetäter loszuwerden, musste sich einem Zahnbrecher anvertrauen. Das waren wandernde Heiler, die wie Jahrmarktsgaukler auftraten und mit großem Geschrei ihre Kunst lobten, wohl auch zur Werbung unzählige gerissene Zähne vor sich ausbreiteten. Die sprichwörtliche Redensart wie ein Zahnbrecher schreien erklärt sich daraus. Heute gilt das Spottwort auch dem fachkundigen Zahnarzt oder Dentisten.
Zeitungsschmierer m.: Journalisten hatten es mit ihrer erzwungenen Jagd auf Neuigkeiten, die man heute maulfaul und sprachverräterisch News nennt, nie leicht. Und hatten sie etwas erhascht, was heute durch Agenturen, „Sprecher“ von Polizei und Politik ausgebreitet wird, so müssen sie es einem vielfältigen Kanon von Wahrheit und Lüge, politischer Korrektheit und persönlicher Meinung zur Sache, Opportunismus und Gewissen unterwerfen, ehe ihre Meldung gedruckt erscheint. Es gibt echte Journalisten und solche, die im Volksmund die Journaille bilden. Und etwas fein zu schreiben oder nur hinzufetzen, zu schmieren, bildet den Unterschied und führt zum Schimpfwort vom Schmierer.
Zinsgeier m.: Die Tätigkeit, sich wie einer dieser aasfressenden Großvögel auf die Beute zu stürzen, wird hier auf die Geldgier gemünzt. Und es handelt sich nicht um die Zinsen eines Kapitals, sondern es geht hier um den Mietzins eines Zinshauses, den der Hausherr monatlich begehrt und dabei unerbittlich ist. Wer vor hundert Jahren solche Häuser besaß, konnte es sich leisten, davon zu leben, denn am Monatsersten tanzten die Mieter an und legten dem sie mit Käppchen, Schlafrock und langer Pfeife Erwartenden in barer Münze auf den Tisch. Peinlich wird es, wenn heute Politiker, die auf der einen Seite vorgeben, für Benachteiligte unserer Gesellschaft einzutreten, auf der anderen aber sich solche Spekulationsobjekte verschafft haben, nun selber zum Zinsgeier werden. Damit verdienen sie dieses Schimpfwort zu Recht.
Zottenklescher m. (Zoutnklescha): Etwas hinkleschen bedeutet, eine Sache jemandem als achtlos hinzuwerfen, damit dieser sie noch in irgendeiner Form weiterverwerten kann. Handelte es sich einst um Zotten, also Textillumpen, so konnte ein Zottenklescher ein Sammler sein, der die Papierfabriken belieferte, die noch nicht Holzschliff zur Erzeugung von Druck- und Schreibpapier verarbeiteten. Das Wort Fetzenbeiner zielt als Spottwort in dieselbe Richtung.
Bettler und Schnorrer – gewollt und ungewollt
Abstauber m. (Obstauba): Ein solcher ist jemand, welcher frech und ohne etwas mit einer Leistung zu erreichen, wohl auch durch Betteln, sich einen Anteil an einer Sache sichert, wenn bereits andere die Vorarbeiten dazu geleistet haben. Ihm gebührt dieses Schimpfwort, auch jenem, dem es gelingt, sich ein bestimmtes sexuelles Verhältnis mit einer bereits vergebenen Frauensperson zu erschleichen. Mit Staub hat das alles offensichtlich nichts zu tun.
Fechtbruder m. (-bruada): Das Fechten mit den Blankwaffen Schwert, Säbel oder Degen war einst eine lebenswichtige Kunst, von der im Gefecht von Mann zu Mann Wohl und Wehe der Kontrahenten abhing. Dieses körperliche und geistige Vermögen wurde auch in Schulen, ab dem 16. Jahrhundert sogar mittels illustrierter Bücher gelehrt, und wer in der Landsknecht- und Söldnerzeit einmal wegen ausgebrochenen Friedens „arbeitslos“ geworden war, der konnte auch als wandernder Fechtkünstler der Schaulust des Publikums dienen. Weil zu einem solchen Schaufechten immer mindestens zwei gehörten, fand man sich zu Gemeinschaften zusammen und nannte sich eben Fechtbruder. Da sie für ihre Leistungen natürlich auch Geld abkassierten, kamen sie auch in den Geruch von Bettlern. Und Betteln heißt bis heute auch fechten.
Mistkübelstierer m.: In den Zeiten vor der Mistgruabn, als Müll noch Mist hieß und es noch keine Mülltonnen gab, da war unter den Resten der Hauswirtschaft noch wenig zu holen. Erst mit dem wachsenden und dann überbordenden Konsum konnte für arme oder aber auch seltsam passionierte Zeitgenossen die Mülltonne zur Fundgrube werden, aus der selbst noch original verpackte Lebensmittel eingeheimst werden können. Und die um sich greifende Mülltrennung erleichtert es diesem Personenkreis, der mit dem Begriff Mist- oder Mistkübelstierer verhöhnt wird, den Zugriff auf Dinge vom Brot bis hin zur Delikatesse, von denen heute täglich tausende Tonnen einfach entsorgt werden. Stierln bedeutet suchend herumstochern.
Schlucker m.: Ein armer Schlucker ist ein mit diesem Begriff eher bemitleideter Mensch, der nichts zu essen oder zu trinken, eben zu schlucken, hat.
Schmalzbettler m. (Schmolzbettla): In der Redensart schwitzen wie ein Schmalzbettler noch erhalten geblieben. Einst hatten die Bettelorden wie Franziskaner, Kapuziner eigene Brüder, die um Nahrungsmittel für die Klostergemeinschaft und die Armen bettelnd umherzogen und vielfach nicht Geld, sondern Lebensmittel wie Brot, Fleisch, Butter oder Schmalz erhielten. War das im heißen Sommer, so kamen diese Bettelmönche natürlich ins Schwitzen und der Name war geboren, dem nichts Verächtliches anhaftet.
Schnallendrücker m. (Schnollndrucka): Mit der Türschnalle in der Hand verschafft man sich Zutritt zu einem Haus, gebeten oder ungebeten. Wer bettelnd von Haus zu Haus zieht, drückt viele Schnallen und verächtlich nennt man ihn dann eben umschreibend nach dem Start seiner Bettelbitten Schnallendrucker.
Schnorrer m.: Abfällig für einen Geizhals oder Bettler, der sich das Erheischen von kleineren Dingen oder Zuwendungen zur Gewohnheit gemacht, so etwa wie der Zigarettenschnorrer. Der einstige Betteljude war einer, der in der alten jüdischen Gesellschaft einen festen Platz hatte, denn den Juden gilt Almosengeben als eine hohe Tugend. Ein solcher Schnorrer suchte in regelmäßigen Abständen in einem genauer umschriebenen Revier jüdische Familien auf und schnorrte dort. Jüdische Anekdoten erzählen auch von der Frechheit von Schnorrern, die ihre Sammeltour mit dem Fiaker erledigten. Das Wort kommt wahrscheinlich von einem herumziehenden Bettelmusikanten, der mit einem besonderen Musikinstrument, der Schnurrpfeife unterwegs war.
Bildung eher der anderen Art
Blaustrumpf m.: Das Spottwort kennzeichnet ein, wie man 1900 sagte, gelehrtes Frauenzimmer. Klugheit, ja Gelehrtheit war bei den Frauen dieser Zeit eher Anlass für ungläubiges Staunen, ja auch Ablehnung. Erst vor einem Jahrhundert wurden die ersten Frauen an unseren Universitäten zu Doktoren promoviert. In England hatte man schon zuvor blue-stocking, in Frankreich bas-bleu





























