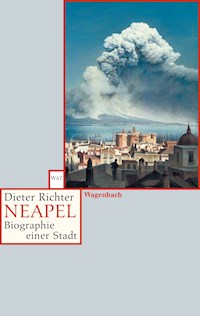14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Von Schlaraffenland wurde in vielen Formen erzählt: in Märchen und Liedern, in Reisebeschreibungen und Predigten, in Bildern und Sprichwörtern. Als »Andere Welt« trug Schlaraffenland zugleich die Konturen der sozialen Utopie und der Terra incognita auf einer Landkarte, die noch voller weißer Flecken war. Dieter Richter erkundet die Topographie dieses märchenhaften Landes, wie es sich in den europäischen Literaturen und in der Volkskultur seit dem ausgehenden Mittelalter entwickelt hat. Dem darstellenden Teil folgt als Anthologie eine thematisch gegliederte Auswahl aus der großen Zahl der überlieferten Schlaraffenland-Beschreibungen. Gesammelt und verzeichnet werden auch die bildlichen Darstellungen Schlaraffias. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Ähnliche
Dieter Richter
Schlaraffenland
Geschichte einer populären Utopie
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Von Schlaraffenland wurde in vielen Formen erzählt: in Märchen und Liedern, in Reisebeschreibungen und Predigten, in Bildern und Sprichwörtern. Die den Weg in dieses Land suchten, haben anderen davon berichtet – aber auch jene, die davor warnen wollten. Als »Andere Welt« trug Schlaraffenland zugleich die Konturen der sozialen Utopie und der terra incognita auf einer Landkarte, die noch voller weißer Flecken war. Dieses Buch will die historische Topographie dieses märchenhaften Landes erkunden, wie sie sich in den europäischen Literaturen und in der Volkskultur seit den Jahrhunderten des ausgehenden Mittelalters entwickelt hat. Dem darstellenden Teil folgt als Anthologie eine thematisch gegliederte Auswahl aus der großen Zahl der überlieferten Schlaraffenland-Beschreibungen. Gesammelt und verzeichnet habe ich auch die bildlichen Darstellungen Schlaraffias, zum überwiegenden Teil aus dem Bereich der populären Druckgraphik (›Bildersaal‹). Insgesamt sollten ›Erzählen‹ und ›Deuten‹ einander so ergänzen, daß die Sprache der alten Texte und Bilder von neuem verständlich werden kann. Methodisch gesehen geht es mir mit Schlaraffenland nicht um die Suche nach einem uralten Mythos, nicht um die Bestimmung eines »kollektiven Wunschtraums« der Menschheit und auch nicht um die Konstruktion eines Märchen-»Typus«. Zu leicht erscheinen bei einer solchen auf das Allgemeine gerichteten Betrachtungsweise die überlieferten Zeugnisse und ihre literarischen und sozialen Besonderheiten als bloße Varianten eines immer wiederkehrenden Typus. Ich gehe stattdessen von der Methode einer historischen Motivforschung aus, die den Wandlungen der Bilder in ihren kulturellen und sozialen Zusammenhängen nachspüren will. Einzelne Elemente von Schlaraffenland sind aus zum Teil sehr alten und ganz unterschiedlichen Traditionsströmen geflossen; sie verbinden sich im ausgehenden Mittelalter zur populären Utopie einer »Verkehrten Welt«, die deutlich ein Gegen-Bild der sich entwickelnden bürgerlichen Welt der Neuzeit ist. Als populäre ist diese Utopie weder Ausdruck naiven Volksglaubens, noch ist sie anders als in mancherlei Vermischungen mit Formen der hohen Kultur überliefert. Mit den Hoffnungsbildern des »Guten Lebens« verbanden sich schon sehr früh moralisierende Tendenzen; eine zunehmende Verengung des alten utopischen Horizonts bestimmt dann die weitere Entwicklung.
Wie jede Utopie zeichnet auch Schlaraffenland den Traum einer Welt, die der bestehenden nicht nur folgenlos entgegengesetzt ist, sondern sich in ihr zu verwirklichen trachtet, wenigstens in Ansätzen. Ich bin daher auch der Frage nachgegangen, wo und wie außerhalb der literarischen Bilder Schlaraffenland auf Erden gesucht wurde.
Zum Schluß habe ich vielen zu danken, die mir von Schlaraffenland erzählt haben oder sich darüber von mir erzählen ließen, die mir Hinweise auf Texte und Bilder gegeben haben oder mir bei Nachforschungen in Bibliotheken, Archiven und Museen behilflich waren. Ich denke dabei besonders an Pasquale Basile, Eric Hulsens, Hermann Lichtenberger und an Heiner Boehncke, den Freund und Reisegefährten.
Natürlich verfolgt eine deutende Neuausgabe alter Texte und Bilder romantische Intentionen. Das Bemühen, neu zu sammeln und durch kritische Edition wieder lebendig zu machen, was an Spuren einer vergangenen populären Kultur in Museen und Bibliotheken verschwunden ist, entsteht nicht zuletzt aus dem Bewußtsein eines historischen Zeitenbruchs, wo alte Stadtviertel, Tannenwälder, Blumenwiesen, Papiermühlen, vielleicht auch die Bücher, in ihrem Verschwinden zu erinnerten Zeichen einer neuen, ganz anderen Zukunft werden können.
Bremen, 24. November 1983
D.R.
Wünsche und Wirklichkeiten
Schluraffen narren: die inen kein ander end und selikeit setzen dan dise welt.
(Keiserspergs Narenschiff, so er gepredigt hat zu straßburg in der hohen stifft 1498, Straßburg 1520, S. CCXV)
Erffurt, vom 21. Julii …
Zu Löbichen bey Halle wird seither etlichen Tage aus einem Berge Mehl gegraben, welches, als ob es von einem Maulwurff herauß geworffen werde, anzusehen; da man es unter das Rocken-Mehl mischet, wird es sehr schön Brodt, und von vielen armen Leuten mit Freuden genossen, und auch hinzu gefüget, daß es denen wolhabenden und Reichen nicht geriehte. Man hat von dem Brodt, so daraus gebacken worden, so wol anhero als [nach] Leipzig und andere benachbarte Oerter geschickt, so daß an dessen Warheit nicht zu zweiffeln, dennoch ist gleichwohl schwer, ein beständiges Judicium darüber zu fällen.
(Relations-Courier, Hamburg 1684, Nr. 62, S. 7)
Und selbst wo Revolutionen gelungen waren, zeigten sich in der Regel die Bedrücker mehr ausgewechselt als abgeschafft. Ein Ende der Not: das klang durch unwahrscheinlich lange Zeit gar nicht normal, sondern war ein Märchen; nur als Wachtraum trat es in den Gesichtskreis.
(Ernst Bloch: Freiheit und Ordnung, Abriß der Sozial-Utopien, Berlin 1947, S. 13.)
1. Cucania, Schlauraffenland. Die Sprache der Namen
Daß einem die gebratenen Tauben nicht in den Mund fliegen, ist sprichwörtlich verbreitete Redensart in ganz Europa.[1] Was so laut beschrieen wird, scheint nicht selbstverständlich zu sein: Die Volksweisheit moralisiert gegen jene, die seit alters von Reisen in ein Land erzählen, wo es anders zugeht und wo auch wer nicht arbeitet doch essen soll: Schlaraffenland.
Daß dieses ein Land sei, wo üppig getafelt und reichlich gebechert wird: diese Vorstellung hat sich bis heute am ehesten erhalten. Dabei hat Schlaraffenland, verstanden als Schlemmer-Paradies, schon wesentliche Dimensionen verloren: Zum Beispiel daß Essen und Trinken in schlaraffischer Landschaft als öffentliche Ereignisse stattfanden und daß es die Hungerleider waren und nicht nur die Reichen, die hier satt werden konnten. Daneben ist Schlaraffenland in der älteren volksliterarischen Überlieferung Europas nicht nur das »nahrhafteste Märchen des Volkes« (Ernst Bloch)[2]; es ist, weit über das Land des freien Essens und Trinkens hinaus, radikales Wunschbild einer den bestehenden Zuständen entgegengesetzten Welt. Hier herrschen ein neues Verhältnis zur Natur, eine neue Ökonomie, eine neue Moral; und auch der Lebensquell fließt in Schlaraffenland.
Bevor wir die Topographie dieses Landes vom Guten Leben (so nennt es ein italienisches Bänkellied aus dem frühen 16. Jahrhundert[3]) näher betrachten, seien zunächst seine Namen vorgestellt; sie erzählen, wie viele geographische Namen, bereits ein Stück von der Geschichte der Entdeckung dieses Landes. Die romanischen Bezeichnungen des Wunschlandes: französisch Coquaigne oder Cocagne, italienisch Cuccagna etc., verweisen auf ein mittellateinisches *Cucania, das, von der Wortendung her, sich deutlich als fabulöser Ländername zu erkennen gibt (in Analogie zu Germania etc. gebildet). Was er indes wortgeschichtlich bedeutet, bleibt rätselhaft, ist zumindest nicht mit Eindeutigkeit zu klären.[4] Seit den Brüdern Grimm wird das Wort am häufigsten von einem Stamm abgeleitet, der in verschiedenen Sprachen als Bezeichnung für ein Süßgebäck weiterlebte.[5]Cucania wäre danach also das Kuchen- oder das süße Land. Andere Autoren bringen das Wort mit französisch coquin »Narr« zusammen[6], Cucania hieße dann also soviel wie Narrenland. Darüber hinaus berührt sich das Wort lautlich mit coquina, »Küche«, so daß sich im Sprachgebrauch auch Assoziationen zu diesem Bereich einstellen mochten. Das lateinisch-deutsche Trinklied der Carmina Burana aus dem Kreis der gelehrten fahrenden Gesellen setzt das Wort schon als bekannt voraus.[7] Die älteste Beschreibung des Landes finden wir im altfranzösischen Fabliau de Coquaigne.[8]
Die Vermutung liegt nahe, daß mit dem Wort[9] auch die Sache meridionalen – französischen oder italienischen – Ursprungs ist. Dafür spricht auch, daß sich romanische Wortformen für das populäre Utopia zunächst auch in germanischen Sprachen finden, bevor sie dort von lokalen Bezeichnungen verdrängt werden. So erzählt der altenglische Text des 14. Jahrhunderts vom land of Cokaygne[10], – erst später tritt im Englischen Lubberland an die Stelle[11] – und ein mittelniederländisches Gedicht des 15. Jahrhunderts berichtet vom lant van Cockaengen oder Cockanyen[12] – später setzt sich dagegen Luilekkerland als niederländischer Terminus durch. Zur Vermutung des mittelmeerischen Ursprungs der Cucania-Utopie würde auch passen, daß die Geschichte vieler Bildmotive hierher weist (griechisch-römische und altorientalisch-jüdische »Wunderland«-Vorstellungen). Im Spanischen heißt das Land tierra de Jauja[13], und vivir oder estar en Jauja; »in Jauja leben« sagt man noch heute sprichwörtlich im Spanischen. Hier hat das Wort eine andere Dimension: es verbindet sich ähnlich wie Eldorado mit dem Kolonialmythos des 16. Jahrhunderts:
Von dem reichen peruanischen Jauja-Tal mit seiner ehemals blühenden indianischen Kultur berichtete der Kolonialchronist Cieza de León 1553.[14] Mit den typischen Zügen des Schlaraffenlandes, wo »die Männer für das Schlafen bezahlt« und »die Männer, die arbeiten wollen, gepeitscht werden«, erscheint die tierra de Jauja dann erstmals in einem Schwank von Lope de Rueda von 1567. Um den Hunger geht es in diesem Stück, und zwei Gauner erzählen einem Dörfler:
»Schau, in dem Land von Jauja gibt es einen Honigfluß und neben ihm fließt ein anderer aus Milch und zwischen den beiden Flüssen gibt es einen Brunnen, aus dem Butter und Schichtkäse in den Honigfluß hineinfließen, und es scheint, als ob sie sagen würden: ›Eßt uns! Eßt uns!‹… In dem Land von Jauja gibt es einige Bäume, deren Stämme aus Schinken bestehen, die Blätter sind aus Blätterteig und die Früchte dieser Bäume sind Krapfen, die in den Honigfluß fallen, und sie sagen: ›Kaut mich! Kaut mich!‹ … Und in Jauja gibt es Hähnchen, Hähne, Rebhühner, Hasen, Turteltauben, die auf einem dreihundert Fuß langen Feuer gebraten werden …«[15]
Aber indem die beiden Hungerleider dem leichtgläubigen törichten Mendrugo dies und anderes vom Jauja erzählen, wollen sie ihn nur ablenken und am Ende haben sie ihm den Topf leer gegessen, den er seiner Frau ins Gefängnis bringen wollte. Ähnlich wie schon in Boccaccios Decamerone[16], der ältesten italienischen Cuccagna-Beschreibung, ähnlich auch wie im italienischen Lied vom schlauen Campriano[17], wird die Erzählung hier benutzt, um jemanden hereinzulegen: Wer an Schlaraffenland glaubt, ist ein Gimpel! Xauxar-se heißt im Katalanischen sich über einen lustig machen, und vielleicht (so eine andere Etymologie) geht das spanische Jauja – dann also etwa in der Bedeutung Lügenland – auch auf dieses katalanische Wort zurück[18] und überlagert sich erst später mit umlaufenden Nachrichten über das reiche abgelegene Andental.
Die merkwürdig schillernde Bedeutung dieses Landesnamens, die Vermischung von »süßem Leben«, »Narrenland« und »Lügengeschichte«, das Ineinander auch von Utopischem, Groteskem und Schwankhaftem ist charakteristisch für Cucania. Auch in dem deutschen Landesnamen, wenngleich etymologisch eindeutig, fallen ähnliche Bedeutungs-Mischungen auf:
Im Deutschen setzt sich eine dem französischen Cocagne entsprechende, also aus dem Mittellateinischen abgeleitete Bezeichnung für das populäre Wunschland nicht durch. Zwar taucht schon im 13. Jahrhundert ein Mal das eingedeutschte Adjektiv kokanisch (für »phantastisch«) auf[19] und Cocagne gehört, als Fremdwort, zum Beispiel noch zu Goethes Wortschatz[20]. Aber die romanische Bildung bleibt im Deutschen doch ohne Relevanz. Das liegt nicht nur daran, daß sie den germanischen Sprachen etymologisch fremd ist. Mit Schlaraffenland mischen sich in die genußvolle Schilderung des Landes der Trägen und der Genießer deutlicher Züge der bürgerlich-frühaufklärerischen Moral-Satire.
Schlaraffenland[21] ist, von der Wortbildung her, das Land der Schlaraffen. Zugrunde liegt ein mittelhochdeutsches Verbum slûren, slûderen, dessen Verwandte sich in mundartlichem schludern, schlurig, Schluri erhalten haben. Aus der Verbindung von slûr mit dem Namen des komischen verachteten Tieres[22] entstand gegen Ende des Mittelalters slûraffe, slûderaffe, daraus Schlauraff, in der Bedeutung »Faulenzer, Nichtstuer, üppig lebender Müßiggänger«. In diesem Sinne definiert es, moralisierend, noch Johann Christoph Adelung in seinem Wörterbuch von 1780: Schlaraffe: eine Person, welche ihr Leben in einem hohen Grade des trägen Müßigganges zubringet, welche sich einer wollüstigen und üppigen Muße widmet; in welchem Verstande es noch hin und wieder üblich ist, und von beyden Geschlechtern gebraucht wird[23].
Mundartlich haben sich das Wort und verwandte Bildungen noch erhalten, bezeichnen dort oft wenig Schmeichelhaftes. Im Elsaß und in Schwaben ist der Schlaraff ein einfältiger, fauler Mensch[24], im Rheinischen sagt man zu einer häßlichen Visage Schlaraffengesicht[25], und Schlaraffel ist im Bayrischen, wie in anderen oberdeutschen Mundarten, Schimpfwort für ein häßliches altes Weib[26].
Seinen eigentlichen Ursprung hat das Wort wahrscheinlich in der Kultur des Karneval, und hier hat es sich mundartlich noch lange erhalten: Schlaraff lebte im Elsaß und in Schwaben in der Bedeutung »Faschingsmaske« weiter.[27] In den oberdeutschen Fastnachtsspielen des 15. Jahrhunderts begegnet dann der Schlaraff wiederholt in Ketten »sprechender Namen« für einen jener gewalttätigen, ungeschlachten, lüsternen Gesellen, die es immer mit dem Fressen und Saufen, mit dem Dreck und mit der Liebe haben.
In einem der Spiele stellt der Ausrufer diese Gesellen zu Beginn seinem Publikum vor, bevor sie dann der Reihe nach derbe sexuelle Späße zum besten geben:
»Ir herren, erschreckt nit ob den gesten
Und kert uns unser sach zum pesten,
Wann mit geschrei wir offenbern
Die hendel, damit wir uns dann neren [durchbringen],
Als ir von uns wert horen gar.
Gotz Speckuch, Tiltapp und Sutzelmar,
Lullapp, Seutut und Studvol,
Weidenstock, Schlauraff und Fleuchdenzol,
Fiselmann, Lantschalk und der Feltrud,
Seufridel, Pirnkunz und der tauft Jud,
Schweinsor, Kalbseuter, Ginloffel und Eberzan,
Tret her und laßt eur hendel verstan![28]«
Auch in einer Kalenderparodie des Nürnberger Meistersingers Hans Folz, einer Art »verkehrtem Jahr«, 1480, erscheint der Name:
»Das erst new [= der 1. Neumond] wird an Kuncz Schlauraffen hochzeyt, zwen schrit von Fricz Sewdutten [= Saubrust] kelbertancz, zwo minuten jensit der arskerben.«[29]
Schlaraffen-Land nun ist die Heimat jener Fresser und Grobiane, wobei eine nähere Beschreibung in den Quellen des 15. Jahrhunderts nicht zu finden ist. In Heinrich Wittenwilers komischem Versepos »Der Ring« (um 1410) wird von einem großen Fresser erzählt, der an einer Gräte erstickt:
»Also fuor do Farindwand
Da hin gen Schläuraffen land
Mit seiner sel: daz was ir fuog [Recht];
Den leib man in den Neker trug.[30]«
Schlaraffenland meint hier also wahrscheinlich eine Art Fresser-Himmel. Als »bessere Heimat« der Schlauraffen gilt dieses Land auch in einem Fasnachtsspiel, wo sieben Gesellen ihrem bisherigen lockeren Treiben (scherzhaft) abschwören:
»Hört ir iemanz [jemand], der nach uns frag,
Der vint uns zwischen Wien und Prag
Bei ainander in der Schlauraffen lant,
In der stat Pomperlörel genant;
Da werden wir alle gar schön empfangen,
Da port [bohrt] man di ers [Ärsche] mit deichselstangen.«[31]
Schon sehr früh haben Schlauraff und Schlauraffenland im Deutschen allerdings auch einen deutlich herablassenden verächtlichen Nebensinn bekommen, und wie so oft wäre auch hier eine »authentische« Volkskultur erst hinter ihrer intellektuell-literarischen Inszenierung zu suchen. Denn die Sprache der Unterschichten ist uns ja nicht unmittelbar erhalten, auch wenn sie von der herrschenden Kultur in der Renaissance teilweise aufgenommen wurde. In der volkstümelnden Sprache der gelehrten Bürger, der Prediger und Satiriker der Zeit um 1500 ist Schlauraff der Tölpel und Wildling, über den die »feinen Leute« sich lustieren (und von dessen Triebhaftigkeit sie doch heimlich angezogen werden!) Anders als die Bewohner der romanischen Cucania zeigen die des deutschen Schlaraffenlandes und des niederländischen Luilekkerlandes häufiger derb-grobianische Züge:
»Ein Furtz gilt einen Binger haller [Heller]
Drey gröltzer [Rülpser] einen Jochims Thaler …«,
das ist die Währung in Hans Sachs’ Schlauraffen Landt (1530)[32]. Und auf einem niederländischen Stich des 17. Jahrhunderts sieht man einen der Leuyaarts (Faulenzer) mit heruntergelassener Hose neben einem abgesetzten Haufen, darunter die Verse:
»Doch pfui! Des Faulpelz’ wahres Wesen,
Kann man von diesem Bild ablesen:
Das kommt von der Schlampamperei
Und ist doch wirklich Sauerei.«[33]
Und stärker als mit Cucania verbindet sich in den Ländern des protestantischen Nordens mit ihrer früher entwickelten Arbeitsideologie der (durch die Wortbildung erleichterte) moralische Tadel des Schlaraffenwesens.
Der abschätzigen und moralisierenden Tendenz in der Rede von Schlaraffia (vgl. dazu Kapitel 20) hat dabei neben Hans Sachs’ Gedicht vor allem Sebastian Brants weit verbreitetes »Narrenschiff« (1494) Vorschub geleistet, dessen Spuren sich in der schlaraffischen Tradition Deutschlands, der Niederlande und Englands immer wieder finden[34]. Schluraffen landt ist hier die Fata Morgana einer gottlosen und unweisen Schar von Narren, die am Ende kläglich Schiffbruch erleiden.
2. Wunderland und Goldenes Zeitalter, Totenreich und Paradies. Zur Vorgeschichte Schlaraffenlands
Schlaraffenland als Land des Überflusses und des seligen Wohllebens hat eine lange Vorgeschichte.
1. Von weit entfernten Wunderländern an den Grenzen der bekannten Welt wurde unter den seefahrenden Griechen früh erzählt. Von selber biete dort die Erde den Menschen ihre Gaben, in Frieden und ohne Krankheit lebten sie – wie zum Beispiel in dem sagenhaften Meropis, jenseits des Okeanos, von dem Theopomp aus Chios (4. Jh.v.Chr.) berichtet[35]. In der alten attischen Komödie haben sich fragmentarisch Anspielungen auf solche Geschichten erhalten, wobei hier schon ironische Töne einzufließen scheinen[36]: Von einem Land kulinarischen Wohllebens in einem zukünftigen »Perserreich« (dem Land sagenhaften Reichtums) erzählt ein Passus aus den »Persern« des Pherekrates (um 420 v.Chr.)[37]; vom künftigen Fabelland der Tiere, wo man keine Sklaven brauche, weil einem die Dinge von selber in die Hand kämen, berichtet ein Fragment aus den »Tieren« des Krates (vor 424)[38].
Im philosophischen Diskurs erscheint das Wunderland-Motiv in Platons kurzem Bericht von der Insel Atlantis, einst jenseits der Säulen des Herkules im Okeanos gelegen[39]. Mit fabulösen Elementen bunt und bizarr ausgeschmückt lebten Wunderland-Berichte dann vor allem in griechischen Reiseerzählungen und geographischen Werken weiter (hier spielt der äußerste Osten, das Wunderland Indien, eine große Rolle)[40] und kamen über den spätgriechischen Alexanderroman und seine zahlreichen volkssprachlichen Bearbeitungen in die Nationalliteraturen des Mittelalters[41].
2. Die Wunderland-Geschichten haben sich nicht selten mit dem Mythos vom Goldenen Zeitalter vermischt. Utopia erschien hier nicht, wie in den Reiseberichten, in geographischer, sondern in historischer Dimension: als verlorener paradiesischer Urzustand der Menschheit.
»Jene lebten, als Kronos im Himmel herrschte als König,
Und sie lebten dahin wie Götter ohne Betrübnis,
Fern von Mühen und Leid, und ihnen nahte kein schlimmes
Alter, und immer regten sie gleich die Hände und Füße,
Freuten sich an Gelagen, und ledig jeglichen Übels
Starben sie, übermannt vom Schlaf, und alles Gewünschte
Hatten sie. Frucht bescherte die nahrungsspendende Erde
Immer von selbst, unendlich und vielfach. Ganz nach Gefallen
Schufen sie ruhig ihr Werk und waren in Fülle gesegnet,
Reich an Herden und Vieh, geliebt von den seligen Göttern«.
So beschreibt Hesiod (8./7. Jh.)[42] den goldenen Urzustand der Menschen unter der glücklichen Herrschaft des Kronos (Saturn), des Vaters von Zeus. Schon bunter mit Motiven ausgestattet, die sich später in Schlaraffenland wiederfinden, malt ein griechisches Komödienfragment (um 430 v.Chr.) die sagenhafte Urzeit:
»Jeder Gießbach schäumte von Wein und das Brot und die Semmeln lagen im Rangstreit
Vor den Mäulern der Menschen und flehten sie an, man möge sie gnädig verschlingen,
Denn die weißesten liebten doch alle! Hinein in die Häuser spazierten die Fische
Und brieten sich selber und legten sich hin auf den Tisch. Doch den Sitzen entlang, da
Ergoß sich ein Strom fetter Suppe und wälzt’ die gesottenen Stücke des Rindfleischs …«[43].
Der Mythos von der Goldenen Urzeit ist nicht nur in der griechisch-römischen Überlieferung verbreitet; er findet sich auch in Erzählungen außereuropäischer Kulturen[44]. Die Zusammenhänge dieses Mythos mit dem Schlaraffenland-Stoff sind auffallend; Camporesi sieht in Schlaraffenland »gleichsam eine plebejische Version des aristokratischen ›Goldenen Zeitalters‹«[45].
Bei der Frage nach den »Traditionslinien« zwischen antiker und mittelalterlicher Überlieferung[46] des Mythos vom Goldenen Zeitalter ist an Vergils 4. Ecloge zu denken, die im Mittelalter als messianische Christus-Prophezeiung gedeutet wurde[47]. Hier wird der alte Mythos vom Saturnischen Zeitalter in die Zukunft projiziert und wird, im Rahmen einer Huldigung an Augustus, zum utopischen Bild eines politischen Messianismus: Von neuem steige mit der Geburt des Knaben im kommenden Augusteischen Zeitalter die ehemalige Goldene Weltzeit auf, wo die Ziegen von selber ihre Milch bieten, der Weinstock ohne Pflege gedeiht, aus Eichen Honig quillt, am Ende gar die Lämmer schon gefärbte Wolle tragen und so weder Ackerbau noch Seehandel mehr getrieben werden müßten, denn omnis feret omnia tellus, »die Erde wird überall alles tragen«[48].
Die Vorstellung vom Wiederaufsteigen des Uralten im Kommenden wird zu einem der meist verbreiteten Muster der politischen Utopien bis in die Neuzeit hinein.
3. Auch antike Vorstellungen vom Totenreich trugen, wenngleich nicht einheitlich, die Züge eines alternativen Lebens ohne Mühe, Krankheit und Leid.
»… Dort wandeln die Menschen
Leicht durch das Leben. Nicht Regen, nicht Schnee,
nicht Winter von Dauer – Zephyros läßt allezeit seine
Hellen Winde dort wehen …«
heißt es in der ältesten Darstellung in der Odyssee (IV, 565–67) über die Gefilde Elysions (und auch dieser Zug von der Abwesenheit jahreszeitlicher Unbilden findet sich später in Schlaraffenland wieder.)[49]
In einem Komödienfragment des Pherekrates trägt das Totenreich schon den Charakter späterer »Eßlandschaften«:
»Da zogen murmelnd Flüsse mit schwarzer Suppe längs
Der Stadtquartiere, andere führten Weizenbrei …«,
so beginnt der Bericht einer Frau von einer Hadesfahrt.[50]
Die jenseitige Welt hat dabei möglicherweise – so Vladimir Propp in seinem Buch über die historischen Wurzeln der Zaubermärchen – diesen Charakter einer Welt des Überflusses und der Nicht-Tätigkeit erst auf einer jüngeren Stufe der Menschheitsentwicklung angenommen. Die historisch ältere Vorstellung sei die einer produktiven Jenseitswelt (wo z.B. die Jäger ihre Tätigkeit fortsetzten, jedoch kein Mangel an Wild herrsche); erst seitdem die menschliche Arbeit beim Übergang zur Klassengesellschaft den Charakter der bedrückenden Zwangsarbeit angenommen habe, werde das Jenseits kompensatorisch als nahrhafte Welt der Nicht-Tätigkeit vorgestellt.[51] (Man wünscht sich nach dem Tod die »ewige Ruhe«, nicht die »ewige Arbeit«).
Zahlreiche antike Vorstellungen von Wunderländern, Goldener Zeit und Totenreich vermischen sich in jenem fabulösen Reisebericht von der Insel der Seligen, den Lukian von Samosata (um 120–185) in seinen »Wahren Geschichten«[52] gegeben hat.
Der Reiseerzähler findet das Totenland unter der Herrschaft des Rhadamanthys im Okeanos jenseits der Säulen des Herkules, also jener ehemals beinahe »magischen« Westgrenze der bekannten Welt.[53] Von Wohlgerüchen, sanften Lüften und Musik umschmeichelt, leben dort die Heroen in steter Dämmerung und ewigem Frühling, ohne älter zu werden als sie zum Zeitpunkt ihres Todes beim Betreten der Insel waren. Zwölf Mal im Jahr tragen die Reben, auf den Ähren wächst Brot, die Flüsse strömen von Wein und Honig. Die Frauen und die schönen Knaben sind allen gemein, man tafelt begleitet von Musik, Gesang und Homerrezitationen.[54]
Einzelne Elemente dieser Beschreibung finden sich in späteren schlaraffischen Texten und Bildern wieder. Dennoch ist die Insel der Seligen in ihrer literarischen Form nicht Schlaraffenland. Die Freuden dieses Utopia sind zwar nicht spiritueller Natur, sie tragen aber doch eher den Charakter eines »gehobenen Wohllebens«; auch der Besucher der Insel genießt vor allem das Vergnügen, die Heroen der antiken Mythologie und Geschichte persönlich befragen zu dürfen. »Was für eine Ursache er gehabt habe«, wird Homer gefragt, »sein Gedicht gerade mit dem Worte ›Zorn‹ (menis) anzufangen? Seine Antwort war: es sei ihm eben just auf die Zunge gekommen, ohne daß er sich lange darüber bedacht habe.«[55] Das ist Spott auf die Beckmessereien der antiken (Homer-)Philologen, die hinter allem einen Sinn suchen – und dies: die breit entfaltete parodistische Auseinandersetzung mit antiker Philogogie, Philosophie und Mythologie steht im Mittelpunkt von Lukians Text. Er spielt mit gelehrten Kenntnissen, ist eher eine Parodie gängiger Jenseitsvorstellungen als ein »irdisches Paradies«: vorgetragen von einem skeptischen, aufgeklärten Autor, der seine Geschichten selber als unwahr bezeichnet und der für ein gelehrtes hellenistisches Publikum schreibt, das die Auseinandersetzungen zwischen Stoikern, Akademikern und Epikureern um »Jenseitsfragen« kannte und allen Positionen mit ironischer Distanz gegenüberstand. So sind die einzelnen »Gags« dieses Textes Bestandteile einer gelehrten, nicht aber einer populären Kultur des Lachens. »Bald darauf erschien auch Empedokles, am ganzen Leibe gebraten und mit Brandblasen bedeckt: er wurde aber, alles seines Bittens ungeachtet, abgewiesen.« Lachen kann darüber nur ein Publikum, das weiß, daß sich Empedokles der Überlieferung zufolge lebendigen Leibes in den Ätna stürzte und daß er, als Anhänger der Seelenwanderungslehre an diese »Insel der Seligen« nicht glauben konnte (von der er daher gebührend abgewiesen wird.) Vor allem aber findet sich in Lukians Beschreibung der Toteninsel ein Zug nicht, der doch für das spätere Schlaraffenland konstitutiv ist: daß man hier faul sein darf und nicht arbeiten muß. Denn Lukian schreibt für soziale Schichten, für deren Angehörige körperliche Arbeit kein Problem war, weil sie selber nicht arbeiten mußten.
4. Eng verbunden mit der Vorgeschichte des Schlaraffenland-Stoffes sind schließlich die jüdischen, christlichen und islamischen Vorstellungen vom Paradies.
Der alttestamentliche Bericht vom Sündenfall (1. Mose 3) deutete Arbeit als Strafe, als göttlichen Fluch über den Menschen. (»Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen!«). Der verlorene Urzustand der Menschen im Garten Eden war danach also der Zustand ohne Arbeit. Die späteren jüdischen Exegeten haben dies so gedeutet, daß damals die Erde ihre Güter von selber hervorgebracht habe. In einer Schrift über die Weltschöpfung heißt es zum Beispiel bei dem gelehrten Philon von Alexandrien (geb. 13 v.Chr.) über den Sündenfall:
»Der Mann andrerseits (erhielt zur Strafe) die Arbeiten, Mühsale und beständigen Anstrengungen zur Herbeischaffung der Lebensbedürfnisse und den Verlust der von selbst kommenden guten Gaben, die die Erde bisher ohne die Kunst des Landmanns hervorgebracht hatte; denn nun mußte er selbst die unablässigen Arbeiten zum Erwerbe des Lebensunterhaltes und der Nahrung übernehmen, um nicht durch Hunger umzukommen. Ich meine nämlich: gleichwie die Sonne und der Mond immer leuchten, nachdem es ihnen einmal, gleich bei der ersten Entstehung des Weltalls befohlen war, und wie sie dieses göttliche Gebot deswegen genau beobachten, weil die Sünde aus den Himmelsgrenzen verbannt ist, ebenso würde auch der fruchtbare und ertragreiche Erdboden ohne die Kunst und Mitwirkung von Ackersleuten reiche Ernten in den einzelnen Jahreszeiten tragen.«[56]
Nach rabbinischer Überlieferung und apokryphen christlichen Quellen wird nun auch die kommende Endzeit solche paradiesischen Züge tragen. Von neuem werde dann die Erde ihre Güter von selber und in einer jede Vorstellungskraft sprengenden Fruchtbarkeit bieten. So werde dann Wirklichkeit, was die Kinder Israel auf ihrer Wüstenwanderung im Land Kanaan suchten: das Land, darin Milch und Honig fließt (2. Mose 3, 8 u. öfter) und aus dem Moses’ Kundschafter eine Weintraube mitbrachten, an der zwei Männer zu tragen hatten (4. Mose 12). Von der Endzeit heißt es:
»Es werden Tage kommen, an denen Weinstöcke wachsen, die 10000 Ranken haben und jede Ranke hat 10000 Zweige und jeder Zweig hat 10000 Sprossen und jeder Sproß hat 10000 Triebe und jeder Trieb hat 10000 Trauben und an jeder Traube sind 10000 Beeren und jede Beere gibt, ausgepreßt, fünfundzwanzig Quart Wein. Und wenn einer der Heiligen eine Traube anrührt, so wird eine andere Traube rufen: Ich bin besser, nimm mich; preise durch mich den Herrn.«[57]
Solche Bilder einer exorbitanten Fruchtbarkeit in der paradiesischen Endzeit sind in rabbinischen Quellen[58] weit verbreitet: am Tag der Aussaat wird schon geerntet, auch die Bäume des Waldes werden Früchte tragen, die Frauen werden täglich ohne Schmerzen gebären, ja die Erde wird sogar von selber Brot, wollene Gewänder und Wein hervorbringen. Auch in den frühchristlichen sibyllinischen Weissagungen über die Endzeit wird die Wiederkehr des Paradieses prophezeit, wobei hier auch die schlaraffischen Bilder einer allgemeinen Gleichheit der Menschen im Überfluß auftauchen:
»Allen gemeinsam ist jetzt das Dasein und auch der Reichtum,
Gleich ist für alle die Erde und nicht mehr durch Mauern getrennet,
Oder durch Schranken, sie bringt viel mehr noch Früchte hervor jetzt.
Quellen voll süßen Weins und weißer Milch und von Honig
Wird sie hervorsprudeln lassen …«.[59]
In der islamischen Überlieferung ist das Paradies der herrliche Garten, in den die Gerechten nach ihrem Tod einziehen werden, wobei die Freuden dieses Aufenthaltes besonders farbkräftig ausgemalt werden.
»Er [Allah] belohnt sie für ihre Standhaftigkeit mit einem Garten und Gewändern aus Seide. Gelehnt in ihm auf Ruhebetten, sehen sie in ihm weder Sonne noch schneidende Kälte, und nahe über ihnen sind seine Schatten, und nieder hängen über sie ihre Trauben, und es kreisen unter ihnen Gefäße von Silber und Becher wie Flaschen, Flaschen aus Silber, deren Maß sie bemessen. Und sie sollen darinnen getränkt werden mit einem Becher gemischt mit Ingwer; eine Quelle ist darinnen, geheißen Salsabil, und die Runde machen bei ihnen unsterbliche Knaben; sähest du sie, du hieltest sie für zerstreute Perlen. Und wenn du hinsiehst, dann siehst du Wonne und ein großes Reich. Angetan sind sie mit Kleidern von grüner Seide und Brokat und geschmückt sind sie mit silbernen Spangen und es tränkt sie ihr Herr mit reinem Trank …«.[60]
Das Paradies hatte nun allerdings in der spätantiken und mittelalterlichen Überlieferung nicht nur eine zeitliche Dimension (der verlorene Garten Eden – die kommende paradiesische Endzeit), sondern meinte zugleich eine irdische Lokalität. Denn nach dem alttestamentlichen Bericht über den Sündenfall (1. Mose 3) hatte ja Gott Adam und Eva aus einem Garten vertrieben, in dem Euphrat und Tigris entsprangen. Der Gedanke lag nahe, daß sich dieser Ort noch irgendwo auf Erden befinden müsse. Nach der jüdischen Erzählüberlieferung von Talmud und Midrasch[61] nehmen die Gerechten nach ihrem Tod dort den ihnen zugeteilten Platz ein; von Rabbi Josua ben Levi wird sogar erzählt, daß er, ohne den Tod zu erleiden, dorthin gelangt sei.[62] Bis an die Pforten des Gartens Eden kam nach einer jüdischen Adaptation des Alexanderroman-Stoffes auch Alexander der Große auf seinem Zug in den Osten.[63]
Auch in der christlichen (außerbiblischen) Überlieferung gibt es das seit den Tagen des Sündenfalls auf Erden verbliebene »irdische Paradies«[64] – im Gegensatz zum himmlischen »Paradies Gottes«, von dem die Johannesapokalypse (2,7) berichtet, daß es am Ende der Tage herabkommen werde. Nach mittelalterlicher Auffassung liegt es am äußersten Osten der Erdscheibe, wird dort auch »kartographisch« verzeichnet, so auf den Mappae Mundi, benediktinischen Weltkarten aus dem 8. Jahrhundert mit dem Mittelpunkt Jerusalem:[65]
»Dat paradijs es sekerlike
Dat oest ende van erderike«.[66]
Als Erden-Ort wurde das Paradies Ziel zahlreicher fabulöser Reiseberichte.[67] Der (genealogisch) erste »Paradieswanderer« der christlichen Legende war Adams Sohn Seth, der dort für seinen todkranken Vater den Zweig des Lebensholzes holt.[68] Auch der Apostel Paulus war im Paradies, so berichtet es schon die frühchristliche (apokryphe) Paulus-Apokalypse; der Apostel wandert dort durch einen Ort des Überflusses mit einem Fluß aus Milch und Honig, an dessen Ufer Bäume wachsen, die zwölf Mal im Jahr verschiedene Früchte tragen, »und jeder Weinstock hatte zehntausend Reben«.[69] Der bekannteste Paradiesfahrer wurde dann der irische Abt Sankt Brandan, dessen Legende im 10. Jahrhundert entstand.[70] Nach langer Irrfahrt auf dem Meer erreicht er mit seinen Gefährten die Paradies-Insel, die hier, alter keltischer Erzählüberlieferung folgend, im westlichen Meer zu suchen ist. Die Brandan-Legende war über volkssprachliche Bearbeitungen im Mittelalter und der frühen Neuzeit weit verbreitet; im Zeitalter der Entdeckung der Erde wurde die fabulöse Brandans-Insel sogar Ziel geographischer Expeditionen, so noch im Jahr 1721.[71]
Nach scholastischer Theologie lag das Irdische Paradies in der dritten und höchsten der drei aristotelischen Luftzonen, die bis an die Mondsphäre heranreicht. Dort, an der Spitze des Läuterungsberges, findet es auch der Jenseitswanderer in Dantes Divina Commedia: mit einem Wald, dessen Blätter von einem gleichbleibend sanften Wind – der Sphärenbrise – bewegt werden, durchströmt von einem lauteren Fluß, der aus göttlicher Quelle springt und an dessen Blumenufern Dante der schönen Matelda begegnet (Purg. XXVIII).
Eher volksläufigen Vorstellungen entsprangen hingegen jene Irdischen Paradiese, die – in bunter Vermischung mit Bildern vom himmlischen Jenseits – einen Ort des Überflusses und des sinnlichen Vergnügens ausmalten; im Motiv des »Bauernparadieses« (vgl. Text 9) haben sie sich lange erhalten.
»Das Paradies ist ein köstlicher Ort, an dem man zu jeder Zeit des Jahres Früchte von jeder Art und den immerdar fließenden Strom von Honigmilch und Wein, von süßem Wasser findet. Und dort sind schöne und vornehme Häuser, nach dem Verdienst eines jeden geschmückt mit Edelsteinen aus Gold und Silber. Jeder wird Weiber haben und wird sie immer schöner finden.«[72]
3. Schlaraffenland als historische Szenerie
Der Überblick über die älteren Überlieferungen scheint den Schluß nahezulegen: »Dieser Wunschtraum (von einem Land des Überflusses) ist vermutlich so alt wie die Menschheit«.[73] Die Märchenforschung hat immer wieder auf die älteren »Parallelstellen« zum »Märchen von Schlaraffenland« hingewiesen:[74] Sie schienen durch ihr hohes Alter und ihre Verbreitung in unterschiedlichen Kulturen und literarischen Kontexten die Auffassung von der »Universalität« des Märchens zu stützen. Das 19. Jahrhundert sah dabei in Märchen die Überreste uralter »zerbröckelter Mythen« (Brüder Grimm); für die Brüder Grimm schloß Schlauraffenland (KHM158) daher ebenso wie das Motiv vom Pfefferkuchenhaus in »Hänsel und Gretel« (KHM15) »an die noch tiefern Mythen von dem verlorenen Paradies der Unschuld, worin Milch und Honig strömen«,[75] an. Späterer Volkskunde schienen dann solche Übereinstimmungen nicht so sehr auf einen verlorenen historischen Urmythos hinzuweisen, als vielmehr eine Art kollektives Universale der Menschheit auszudrücken.
»Für die phantasie war es jederzeit etwas äusserst naheliegendes, sich im gegensatz zu den leiden und mühseligkeiten des täglichen lebens gelegentlich in vorstellungen zu ergehen von einem dasein der reinsten glückseligkeit.«[76]
Der jüngeren, eher auf Motivverwandtschaften achtenden volkskundlichen Märchenforschung geht es hingegen mehr um die formale Bestimmung von »Märchentypen«, d.h. sie kategorisiert die einzelnen Texte als »Varianten« eines Typus’.
Der aussichtsreichere Weg scheint mir allerdings der einer historischen Motivuntersuchung zu sein: es geht dabei um die Geschichte der Bilder im Prozeß ihrer Überlieferung und um ihre Zusammenhänge mit dem Leben der Menschen. Der Traum von einem »seligen Land« ist uralt und in Mythologie und Religion tief verwurzelt; auch die einzelnen Elemente der Beschreibung sind aus unterschiedlichen älteren Traditionen überliefert. Sie fügen sich jedoch, in einer Art »Motivbündelung«, im späten Mittelalter zum Bildkomplex von Cucania/Schlaraffenland: einer populären Utopie, die von den sozialen Spannungen und Hoffnungen der Zeit genährt wird. Der schlaraffische Bildkomplex ist dabei im einzelnen unterschiedlich zusammengesetzt (d.h. die Beschreibung des Landes war für neue Einfälle offen), allerdings lassen sich bestimmte Konstanten der »Topographie« Schlaraffenlands feststellen. Der Prozeß der weiteren Entwicklung ist dann durch verstärkte Moralisierungstendenz und die zunehmende Reduzierung des alten utopischen Horizonts gekennzeichnet. Als schließlich in der Romantik das »Märchen vom Schlaraffenland« wiederentdeckt wird, hat es den alten Charakter einer plebejischen Utopie weitgehend verloren und ist mehr und mehr zur Kindergeschichte geworden.
4. Reise über die imaginäre Grenze
Die Wunschbilder vom guten Leben verdichten sich in Schlaraffenland zu einer geographischen Utopie – im Gegensatz zu historischen Utopien wie dem »Goldenen Zeitalter«, gesellschaftlichen wie dem »Idealstaat« oder metaphysischen wie dem himmlischen Jenseits. Die ästhetische Struktur der Texte und Bilder wird dadurch bestimmt; »Wohlleben« wird in Landschaftsbilder übersetzt. Die Übertragung ins Zeichensystem der Geographie kann dabei bis zur detailliert gezeichneten Schlaraffenlandkarte[77] oder der voluminösen barocken Staatsbeschreibung[78] gehen.
Wer nach Schlaraffenland will, muß sich also auf den Weg machen:
»Ich schlag die Trommel, rufe überlaut:
Wir nehmen Dienst jetzt auf dem Schiff Rynuyt …« –;
wie auf diesem niederländischen Bilderbogen[79] als Bericht von einer Reise erscheint das Schlaraffenland-Motiv häufig, gewinnt mit diesem narrativen Rahmen ja auch erst das Handlungsmoment, wird, über die Beschreibung hinaus, zur Erzählung. Aufbruch – Landesbeschreibung (– Rückkehr): das ist das idealtypische Erzählmodell der Geschichte – und dabei berührt es sich mit einem Erzählschema des Märchens, das ja ebenfalls vom Aufbruch des Helden aus einer Mangelsituation und von seiner Reise in die Anderswelt erzählt.[80] Noch der Spott auf die liederlichen und müßiggängerischen Schlaraffen kann sich der Form der Reiseerzählung bedienen, wie Sebastian Brants Narrenschiff (Text 19) zeigt, wobei der Autor das Erzählschema modifiziert: Für die Reisenden ad Narragoniam wird es weder Ankunft noch Wiederkehr geben:
»Ein Wirbel wird es [das Schiff] leicht bezwingen
Und Schiff und Mannschaft jäh verschlingen.
Wir sind all guten Rates bar,
Uns droht des Untergangs Gefahr,
Der Wind uns mit Gewalt hintreibt.
Ein weiser Mann zu Hause bleibt.«[81]
Nicht selten setzt sich dabei der Erzähler selber in Szene: Zahlreiche erhaltene Texte sind in der Ich-Form erzählt, der Rezitator – als Wandersänger oder -erzähler ohnehin ein Mann, von dem sein Publikum weiß, daß er viel in der Welt herumkommt – berichtet also von seiner Reise nach Schlaraffenland:
»Entor l’apostoile de Romme
Alai por penitance querre,
Si m’envoia en une terre
La ou je vi mainte merveille«[82]–
im altfranzösischen Fabliau aus dem 13. Jahrhundert wird von der Pilgerbußfahrt erzählt.
»Nu hoert, ich sall v wat geseggen:
Ick quam lesten in eyn lant,
Dat my vremde was ende onbekant …« –[83]
so weiß der niederländische Sänger im 15. Jahrhundert zu berichten, und auch der Erzähler des italienischen Capitolo di Cuccagna aus dem 16. Jahrhundert war selber in jenem Land:
»Son stato nel paese di Cuccagna …«.[84]
Die Geschichte vom Schlaraffenland gehört also in den Zusammenhang der Imaginären Reisen[85] – obwohl diese Klassifizierung im Grunde mißverständlich ist. Sie geht von der modernen Trennung von fiction und non-fiction, dem »erfundenen« im Gegensatz zum »wahren« Reisebericht aus. Vor allem bei den älteren Reiseerzählungen kann man eine solche reinliche Scheidung nicht machen. Das »Phantastische« war in der vor-aufgeklärten Epoche kein eigener Bereich des literarischen Feldes, sondern konstitutiver Bestandteil aller erzählenden Genres. Und was die Hörer oder Leser einer solchen alten Reisegeschichte wirklich geglaubt (oder nicht geglaubt) haben, ist ohnehin nicht mehr festzustellen. (Im übrigen ist natürlich auch der moderne ethnographische Reisebericht alles andere als »objektiv«; er erzählt aus der Perspektive der eigenen Kultur von der »fremden« als »Verkehrter Welt«.)[86]
Wer seine Welt verlassen, nach Schlaraffenland reisen will, muß über eine imaginäre Grenze. Der dicke Brei aus Hirse, Buchweizen oder Reis ist nur eine Möglichkeit dieser Grenze: seit dem Schlaraffenland-Spruch von Hans Sachs (1530) taucht dieser Brei in der deutschen und niederländischen Erzähl- und Bildtradition (Brueghel) immer wieder auf.[87] Sieben Jahre bis zum Kinn im Schweinemist muß waten, wer in der irischen Erzählung des 14. Jahrhunderts[88] nach Cokaygne will. Drei Meilen durch lauter Dreck fressen muß man sich auch in einem deutschen Lied der Zeit um 1600.[89] In einem anderen heißt es:
»Das Land leit drey Meil hinder den Weynachte,
Man muß durch Schne und Eyse,
Dem der Weg wirt bekandt,
Zur lincken Handt
Nahent beym Paradeyse
Daselben leyt Schlauraffenland.[90]
Aber auch Wasser kann den Zugang versperren: Nach Cuccagna muß man aus dem Mamelukkenhafen über das Lügenmeer segeln – so lautet die Wegbeschreibung im italienischen Capitolo.[91] Es ist schwierig, solchen und ähnlichen Lagebezeichnungen einen eindeutigen Sinn zu geben. Wollen sie, rationalisierend, auf die Unmöglichkeit des Unterfangens hinweisen? Sind sie, als Teil populärer Lachkultur, ein Stück verkehrter Welt: falsch weisender Wegweiser? Sind sie gar – so Carlo Ginzburg – bewußte Camouflage, um den subversiven Sinn der Wünsche nach einer Neuen Welt durch possenhafte Ironisierung zu schützen?[92] In jedem Fall ist die imaginäre Grenze Barriere zwischen dieser und der Anderen Welt (un altro mondo heißt Schlaraffenland in der Schwankerzählung vom Bauern Campriano, wo diese Welt, wie in vielen Märchen, am Grund des Wassers liegt[93]); erst durch die Grenze konstituiert sich diese Andere Welt als geschlossener Raum; und erst die Grenze verwehrt und ermöglicht den Zugang.
Das Schlauraffenlandt. Holzschnitt von Erhard Schoen, Nürnberg, 16. Jh. – Bildersaal D 2
5. Eßbare Welt
Angekommen in Schlaraffenland, findet der Reisende eine gewaltige Eßlandschaft. Die Flüsse strömen von Wein, auf den Wiesen wachsen Kuchen, vom Himmel regnet es Konfekt, aus Fleisch und Fischen sind die Häuser, die Dächer aus Eierfladen, über die Straßen gehen die gebratenen Gänse und durch die Luft fliegen die gebratenen Tauben. Kein Bereich der Landschaft und der Architektur wird ausgenommen; wie dem königlichen Midas alles zu Gold, so wird dem plebejischen Schlaraffen alles zu Essen und Trinken. Oder wie dem Kind, das alles in den Mund steckt, weil es alles für eßbar und trinkbar hält und dem man, wenn es gelernt hat zu unterscheiden, als Relikte einer eßbaren Welt, noch kleine gebackene Häuslein oder Bäumchen aus Zucker vorsetzt.
»Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen …« (Goethe)[94] – nur primärem Narzißmus mag es scheinen, als ob es anders sei. Und: dem, der sehr großen Hunger hat. Auch für ihn verschwimmen die Grenzen zwischen Genießbarem und Ungenießbarem. Baumrinde nimmt er für Brot, kaut Schuhleder für ein Stück Fleisch. Die »eßbare Welt«, ist, so oder so, aus primärer Lust oder aus quälendem Hunger, der Traum dessen, der vor allem aus Mund und Bauch besteht.[95]
6. Triumph des Bauches
Zu allem Überfluß stehen in dieser eßbaren Welt auch noch köstlich gedeckte Tische, wo man königlich bewirtet wird, ganz anders als in der Welt, in der die leben, die von Schlaraffenland erzählen:
»In allen straten vint men gespreit
Schoen tafelen, die men nyemant wederseit
Met witten laken onbeflect,
Broet ende wijn daer op geset,
Ende daertoe vissche ende vleysche,
Elkerlijc nae sijnen heysche.
Men mach daer eten ende drincken al den dach,
Daer en geldt nyet ghelach
Als men hier te lande doet
O dat lant is al soe goet!«[96]