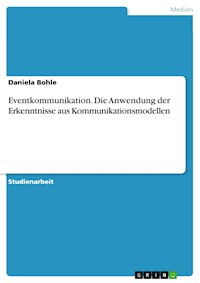Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Für viele ist es ein Traum, die Protagonistin dieser Geschichte erfüllt ihn sich: einmal den Zuckerbäckern in einer Konditorei über die Schulter blicken. Daniela Böhles erster Roman ist mit dieser, von der Autorin durchgesehenen Neuausgabe in frischer Optik endlich wieder erhältlich. »Praktikant/in gesucht«, steht in handgemalten Buchstaben im Fenster der Wilmersdorfer Konditorei. Schon immer waren Backstuben Sehnsuchtsorte für Nina. Nur hat sie dem Gefühl nie nachgegeben. Jetzt, mit über 40, bewirbt sie sich für ein Praktikum und steigt fortan jeden Morgen in die verheißungsvoll duftende Backstube hinab wie in eine Zauberwelt. Die Arbeit mit dem spröden Zuckerbäcker Sven bleibt nicht die einzige Herausforderung in ihrem Leben: Ihre beste Freundin hat sie bei einem Datingportal angemeldet, was eine ungeahnte Welle an skurrilen Mailwechseln und Begegnungen auslöst, noch dazu hat Nina eine eigene Geschäftsidee …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANIELA BÖHLE
SCHMETTERLINGE AUS MARZIPAN
ROMAN / SATYR VERLAG
Daniela Böhle (Jahrgang 1970) stammt aus Köln und lebt seit 1999 mit zwei Kindern in Berlin. Nach einem Kunstgeschichtsstudium und einem medizinischen Staatsexamen arbeitet sie heute beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie schreibt Romane, Kurzgeschichten und Hörspiele.
Bei Satyr sind von ihr erschienen:
–
Amokanrufbeantworter
(Geschichten: 2005)
–
Mein bisher bestes Jahr – Wer vorher nachdenkt, verpasst ’ne Menge
(Jugendbuch: 2016)
–
Überlebenstraining
(Roman, 2022)
E-Book Neuausgabe Januar 2023
Die Originalausgabe erschien 2019 im Deutschen Taschenbuch Verlag dtv.
© Daniela Böhle 2019
www.satyr-verlag.de
Coverfoto: Susanne M. Riedel
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
E-Book-ISBN: 978-3-947106-93-6
Für meine Großmutter, die mir die Liebe fürs Backen mitgegeben hat, und für Meret, die den Staffelstab weiterträgt
INHALT
KIRSTENS REZEPT
GNOCCHI
HONIGKUCHEN
ERDBEERSCHOKOLADE
KANTINENESSEN
FRANKFURTER KRANZ
KEKSE AUS DEM GEHEIMEN VORRATSSCHRANK
BACKSTUBE DER TRÄUME
ERDBEERZEIT
LEIPZIGER LERCHEN 1
ZUCKERGLASUR
SCHOKOLADENZAHLEN
TORTEN NACH MASS
RHABARBER-SCHMAND
PETITS FOURS
TÖRTCHENMASSAKER
LEIPZIGER LERCHEN 2
LIMETTENCREMEBAISER
TOMATENCONSOMMÉ
CURRYWURST UND ERDBEEREN
FONDANTHUMMEL
MOOSKUCHEN
ECLAIRS
SCHMETTERLINGE AUS MARZIPAN
BITTERSCHOKOLADE
MEHR BITTERSCHOKOLADE
KALTE BUTTERCREME
TEQUILA SUNRISE
SHORTBREAD
SÜSSES GEHEIMNIS
DANKSAGUNG
KIRSTENS REZEPT
Es gibt so viele Theorien darüber, wie lange man braucht, um über eine Trennung hinwegzukommen. Ein Jahr. Bis man jemand anderen kennengelernt hat. Genauso lang, wie man zusammen gewesen ist. Ich weiß nicht, wer diese letzte These aufgestellt hat, aber ich bin sicher, dass es ein Sadist war.
Seit ich aus unserem gemeinsamen Haus ausgezogen war – als mäßig bezahlte Krankenhaussekretärin hätte ich Christoph nie auszahlen und zum Auszug zwingen können –, war ein gutes Jahr vergangen, aber es fühlte sich an, als wäre es gestern oder höchstens letzte Woche gewesen. Ich war sicher, für Kirsten fühlte es sich länger an. Sie ist meine beste Freundin und hat mein Gejammer vom ersten Tag an ertragen.
Gerade als ich dachte, ich wäre es Kirsten schuldig, nicht erst in siebzehn Jahren mit dem Geheule fertig zu sein, sagte sie: »Ich muss dir was beichten.«
Wir saßen in unserem Wohnzimmer, in Leonhards und meinem, und Kirsten versuchte seit zwei Stunden, mich zu einer Freitagabendbeschäftigung aus der Wohnung zu locken. Leonhard war zu alt, als dass »Ich muss auf meinen Sohn aufpassen« noch ziehen würde, trotzdem fielen mir seit zwei Stunden Ausreden ein. Es war nicht das erste Wochenende, an dem Kirsten sich anhören musste, dass ich mir nicht die Beine rasiert hatte, nicht die Augenbrauen gezupft, dass ich müde war, mir alternativ das linke, das rechte Knie oder beide wehtaten, dass ich ein gutes Buch lesen wollte. Meist endeten diese Abende damit, dass ich heulte, weil ich mich nur vergraben wollte, und gleichzeitig platzte vor Sehnsucht nach einem unbeschwerten Abend. Aber wie sollte ich jemals wieder einen unbeschwerten Abend verbringen, wenn ich so herzlos gegen eine jüngere, schönere, schlankere Frau ausgetauscht werden konnte? Das war meist der Moment, in dem Kirsten kapitulierte. Dann sahen wir uns irgendeinen Mist im Fernsehen an, den man nur gemeinsam ertrug, ohne überzuschnappen, oder sie ließ mich mit einem Buch allein. Und danach stand ich den halben Abend auf meinem Crosstrainer, um mich am nächsten Wochenende endlich schlank und schön und begehrenswert zu fühlen und mit Kirsten die Stadt unsicher zu machen. Aber im Grunde meines Herzens glaubte ich nicht daran, dass dieses Wochenende jemals kommen würde.
»Was beichten?«, fragte ich. Ich fühlte mich sehr bang. Ich wollte nicht wirklich etwas wissen, was Kirsten mir beichten musste.
»Ich habe dich bei Doublecheck angemeldet, dieser Partnerbörse im Internet.«
Damit fing alles an. Es fing nicht an, als mich Christoph betrog oder als ich ihn dabei erwischte. Es fing nicht an, als ich mit unserem Sohn auszog. Damit endete etwas, sogar eine ganze Menge. Aber es war Kirstens Anmeldung, mit der die Geschichte anfing, die ich meine Geschichte nennen kann.
GNOCCHI
Mein Weg zur Arbeit war kürzer geworden, seit ich mit Leonhard ausgezogen war. Dafür bekam ich in der U-Bahn meist keinen Sitzplatz mehr.
Ich war schon viele Jahre Chefsekretärin, aber ich mochte es immer noch, auf dem Weg zur chirurgischen Station durch das hohe Steintor das Krankenhausgelände zu betreten. Nach dem Straßenlärm, der um den Platz vor dem Tor toste, war es dort ruhig wie in einer Kurklinik. Mit mir strömten wie jeden Tag Besucher und Angestellte durch das Tor, alle schweigsam und in morgendlicher Eile. Ich nickte dem Pförtner zu, der in dem breiten Durchgang seine Kabine hatte, und steuerte auf das Gebäude der chirurgischen Abteilung zu, das etwa hundert Meter die Allee hinunter auf der rechten Seite lag. Dort hatte ich mein Büro, das Vorzimmer von Professor Wolff, mit zwei f. Der Nebeneingang führte zur Ambulanz, dahin brachten die Krankenwagen die Notfälle, doch jenseits des Haupteingangs spürte man nichts von Hektik und Lebensgefahr. Ich nahm die Treppe zum ersten Stock.
»Guten Morgen!« Cindy aus der Buchhaltung grüßte immer so verblüfft, als würde sie morgens um acht noch nicht mit anderen Menschen rechnen.
»Hallo Cindy«, entgegnete ich und bog in mein Büro ab.
Professor Wolff war bereits in seinem Büro gewesen, denn auf meinem Schreibtisch lagen einige Zettel. Ich setzte mich und überflog sie, während ich den Computer startete. Eine der Nachrichten stammte von Dr. Burkhard-Stegemann, dem momentan einzigen Oberarzt der Abteilung. Ich spürte, wie sich mein Nacken verspannte. Ihm konnte man es schwer recht machen, und mir schien das noch schwerer zu fallen als anderen. »Abtippen. B-S« stand auf dem Post-it, das an einer Minikassette aus seinem Diktafon klebte. Die Wörter Bitte und Danke schienen ihm gänzlich unbekannt. Obwohl er nicht mein Chef war, würde ich seine Kassette wie immer als erste abtippen, aus Angst vor einem Wutausbruch. Ich verachtete mich für diese Angst, das ließ sie aber leider nicht verschwinden. Burkhard-Stegemann wurde nicht laut, wenn er sich ärgerte, er wurde gemein. Am besten war es, sich so weit wie möglich von ihm fernzuhalten. Normalerweise wäre ich als Chefsekretärin gar nicht zuständig für ihn, aber er hatte Professor Wolff erklärt, er sei kein Assistenzarzt und könne daher auch nicht die Schreibkraft der Assistenten nutzen. In ungefähr diesen Worten hatte es Professor Wolff an mich weitergegeben und mich dabei nicht ansehen können. Seitdem war ich Chef-und-Oberarzt-Sekretärin und den Launen von Burkhard-Stegemann ausgeliefert.
Nachdem ich drei der Zettel abgearbeitet hatte und mich gerade an die Minikassette machen wollte, betrat Professor Wolff mit schnellen Schritten mein Zimmer, hinter dem das seine lag.
»Guten Morgen«, grüßte er zerstreut und ich grüßte zurück. Die Besprechung war ebenso vorüber wie die Visite, sagte mir ein Blick auf die Uhr. Donnerstags begann sein Operationsprogramm später. »Die Seminarunterlagen liegen auf Ihrem Tisch«, sagte ich, »und die Zahlen habe ich Ihnen rausgesucht.«
Er sah mich überrascht an und ich musste lächeln. Inzwischen arbeitete ich schon so viele Jahre für ihn und er konnte mich für erledigte Arbeiten immer noch ansehen, als hätte mich das Christkind gebracht. Burkhard-Stegemann begegnete ich an diesem Tag nur kurz, als er in großer Eile seine Briefe aus seinem Fach holte. Ich hakte diesen Tag als guten Tag ab.
Auf dem Weg nach Hause kaufte ich für meinen Sohn und mich Gemüse und eine Packung eingeschweißter Gnocchi zum Abendessen. Leonhard war nicht zu Hause, als ich unsere gemeinsame Wohnung betrat. Seit ich mit Leonhard aus unserem Haus ausgezogen war, musste ich mit Platz ökonomisch umgehen. Wir hatten drei Zimmer – ein Zimmer für Leonhard, ein Zimmer für mich und ein Wohnzimmer. In die Küche passte gerade mal ein Tisch für zwei Personen, wir konnten also keinen Besuch bekommen, der zum Essen blieb, oder wir mussten Snacks auf dem Sofa anbieten.
Da Christoph in unserem Haus wohnen bleiben wollte, hatte er mich zur Scheidung abfinden müssen. Einen Großteil der Summe habe ich auf die hohe Kante gelegt und vom Rest unsere neue Einrichtung gekauft. Leonhard und ich waren gemeinsam zu Ikea gefahren. Dort hatte ich mich seit der Scheidung zum ersten Mal vielleicht nicht gerade glücklich, aber doch zufrieden gefühlt. Christoph hatte am liebsten Möbel aus Holz, hell oder dunkel, und über jede starke Farbe die Nase gerümpft. Deshalb waren meine zusammengewürfelten Billigmöbel allesamt auf dem Sperrmüll gelandet, als wir unser Haus bezogen. Wir waren jetzt erwachsen, wir waren jetzt Eltern, in unsere vier Wände kam nur Echtholz.
Ehe der Möbelwagen kam, um unsere restlichen Dinge und wenigen Möbel aus dem alten Haus in Leonhards und meine neue Wohnung zu transportieren, hatte ich die neue Küche gelb und den winzigen Flur hellblau gestrichen. »Jetzt fehlen nur noch Fische«, spottete Leonhard. »Meinst Du?«, hatte ich gefragt, als er das mit den Fischen gesagt hatte, und dann waren wir losgezogen, hatten bunte Farbe gekauft und gemeinsam Fische in den Flur gemalt. Sie wurden ziemlich hässlich und wir lachten viel, vielleicht zum ersten Mal, seit Christophs Betrug aufgeflogen war.
Leonhard hatte in den Wochen vor unserem Auszug seine Hausaufgaben lieber in der neuen, leeren Wohnung gemacht. Das Risiko, im Haus seinen Vater zu treffen, ging Leonhard nicht gern ein. Ich hätte mir gewünscht, unseren Sohn aus alldem heraushalten zu können. Kein Kind soll Partei für ein Elternteil ergreifen müssen, aber wie hätte das gehen sollen? Auf der einen Seite stand ich und auf der anderen sein Vater und dessen Französin. Ich nannte sie inzwischen sogar hin und wieder Fabienne, wenn ich an sie dachte. Fabienne war schwanger, wie ich von Leonhard wusste. Den Gedanken, ob das Kind demnächst Leonhards Zimmer bekommen würde, versuchte ich mir zu verbieten.
Das erste Möbelstück für Leonhards und meine Wohnung war ein knallrotes Sofa. »Augenkrebs, Mama«, hatte Leonhard bei Ikea gesagt und gegrinst. Ich hatte seinen Arm gedrückt und das rote Sofa ebenso liefern lassen wie einen grasgrünen Küchentisch und einen Wohnzimmerteppich aus bunten Quadraten. Dazu brauchte nicht einmal ich noch einen bunten Couchtisch. Die Quadrate leuchteten unter dem weißen Couchtisch besonders schön.
Während ich nun für Leonhard und mich Gnocchi zum Abendessen kochte, dachte ich an meinen Termin am nächsten Tag. Kirsten hatte behauptet, dass die Partnersuche im Internet mit den Fotos stehe und falle. »Ich kenn da ein Fotostudio, die machen die perfekten Fotos, wirst du sehen«, hatte sie gesagt und hinzugefügt: »Ich hab schon einen Termin gemacht, für Freitag.« Weil ich nicht undankbar sein und weil ich es nicht von vorneherein vermasseln wollte, hatte ich einfach nur genickt und »Okay« gesagt. Mir war es wie eine heroische Tat vorgekommen – mein erster Besuch in einem richtigen, professionellen Fotostudio. In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch viel heroischere Taten von mir verlangt werden würden.
HONIGKUCHEN
Um es kurz zu machen: Ich habe Fotos bekommen. Dass es zwei geschlagene Stunden gedauert hat und die Fotografin vermutlich danach über einen Berufswechsel nachgedacht hat, brauche ich nicht zu erwähnen. Obwohl das Eisbärenfell eigentlich schon eine Erwähnung wert wäre: Ich hätte mich nicht daraufgelegt, wenn ich nicht vorher eine erfolglose Stunde auf fünf verschiedenen Sitzgelegenheiten verbracht hätte. Eine davon war eine Sprossenwand, die eigentlich gar nicht als Sitzgelegenheit gezählt werden darf. Wie fühlt man sich wohl, wenn eine dünne, gelenkige Frau freundlich sagt, klettern Sie mal die Sprossenwand zur Hälfte hoch und setzen sich so seitlich hin? Ich jedenfalls bin zur Hälfte hochgeklettert. Dann habe ich meinen nicht richtig fetten, aber auch wirklich nicht dünnen und auf keinen Fall sprossenwanddünnen Hintern so zwischen die Rundhölzer zu quetschen versucht, dass es hält. Die dünne Fotografin, deren Hintern glatt durchgeflutscht wäre, starrte mich die ganze Zeit sorgenvoll an. Mehrmals öffnete sie den Mund wie ein Fisch, so als wolle sie etwas sagen, wüsste aber nicht genau, was. Währenddessen versuchte ich mein Bestes. Längst war ich über den Punkt hinweg, an dem ich sagen konnte, »haha, lustig, eine Sprossenwand! Und wohin soll ich mich jetzt wirklich setzen?« Die riesigen schwenkbaren Lampen leuchteten nach jedem Positionswechsel mein Elend aus.
»Das ist wirklich schon ganz toll«, hörte ich die Fotografin sagen, als sie mich in der Sprossenwand hängen sah, »aber vielleicht ist der Hocker hier noch toller!«
Die Fotos auf der Sprossenwand sind genauso mies geworden wie die, auf denen ich auf diesem einbeinigen Hocker balanciere. Der wog weniger als meine Nur-Brieftasche-Taschenspiegel-und-Lippenstift-Handtasche und schwankte wie ein Hochseeschiff, weswegen ich ständig Grimassen zog. Die arme Fotografin zeigte mir viele Male geduldig, wie einfach es ist, auf dem Hocker zu sitzen, wenn man das Gewicht eines Goldhamsters hat. Alles, was sie damit erreichte, war, dass ich mich alt und dick fühlte. Und mich ständig entschuldigte, weil ich das alles nicht so gut konnte wie die Fotografin. Die sich dann wiederum zurückentschuldigte, weil sie einfach nicht »meine Herzensposition« fand. Den schlimmen Höhepunkt bildete dann das Eisbärenfell.
Schließlich hatte die Fotografin eine unerwartet brillante Idee und machte mir vor, was ich tun sollte. Das war so irrwitzig, dass ich richtig gute Laune bekam: Die Fotografin nahm Marilyn-Monroe-Posen ein, die in dünn wie eine Karikatur aussahen – sie streckte ihren kleinen Po raus, machte einen Schmollmund und warf der Kamera Handküsse zu. Es sah sehr merkwürdig aus, aber auch sehr lustig, und immerhin dachte ich zum ersten Mal, aha, das kann ich besser. Ich streckte also meinen entschieden Marylin-mäßigeren Hintern Richtung Kamera, verdrehte mich, warf Kusshände und grinste die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd auf Drogen. Es wurden richtig gute Fotos.
Als ich nach der Fotosession in meine Wohnung kam, blinkte mich der Anrufbeantworter im Wohnzimmer an. Ich drückte auf »abspielen« und fuhr dann den Computer hoch. Kirstens verzerrte Stimme schepperte durch den Raum. »Ruf mich an, wenn du zurück bist! Du musst mir erzählen, wie es bei der Fotografin war!« Ich atmete tief durch, während ich mein Passwort in den Computer eingab. Leise brummend las der Computer die Foto-CD, dann lud ich zwei Bilder auf meine Profilseite. Glücklicherweise war alles sehr unkompliziert. Ich nahm an, dass das zum Erfolgsrezept des Internetportals gehörte – alles musste einfach genug sein, dass sogar Computerungeübte wie ich das allein schafften. Nachdem ich fertig war, rief ich Kirsten zurück.
»Ich habe Bilder reingestellt«, sagte ich.
»Brav«, antwortete Kirsten.
Ich konnte sie vor meinem inneren Auge sehen, wie sie mit dem Telefon am Ohr am Fenster stand. Sie wohnte in der Sanderstraße an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln und genoss die ruhige Seitenstraße, nur wenige Schritte vom Trubel entfernt. In der einen Richtung landete man am Kottbusser Damm, in der anderen am Maybachufer, man konnte sich also jederzeit zwischen Stadttrubel oder Naturtrubel entscheiden. An schönen Tagen saßen Kirsten und ich oft auf dem Deck der »Ankerklause«, einer Gaststätte auf einem Schiff, das genau dort lag, wo sich Kottbusser Damm und Maybachufer trafen. Dort konnte ich vergessen, dass ich in einer Großstadt war, und fühlte mich gleichzeitig so sehr in Berlin wie an wenigen anderen Orten.
Eine knappe Stunde später klingelte es und Kirsten stand vor der Tür. »Es gibt noch etwas Wichtiges zu tun«, sagte sie beim Eintreten. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte es mich deprimiert, dass sie, ohne vorher anzurufen, davon ausgegangen war, dass ich den Freitagabend zu Hause verbringen würde. Heute aber war ich zu neugierig.
Ich hatte mir schon gedacht, dass meine Freundin mich nicht ganz uneigennützig bei dieser Partnerbörse angemeldet hatte. Kirsten schreibt für das Apotheken-Journal und wenn sie genug hat von Artikeln über Verstopfungen oder Lungenkrebs, dann schreibt sie das, was sie »buntes Zeug« nennt, zum Beispiel Reportagen über Hobbygärtner, filzende Selbsthilfegruppen oder eben Partnerbörsen im Internet. Darüber spricht sie immer abfällig, aber ich kenne sie lang genug und weiß, dass sie ein perverses Vergnügen an diesem bunten Zeug hat.
»Nina!«, rief sie gekränkt, als ich sie fragte, ob das Apotheken-Journal eigentlich meine Mitgliedsgebühr bezahlte, aber sie bekam verräterische rote Flecken im Gesicht und ich wusste, dass ich ins Schwarze getroffen hatte.
»Willst du über hoffnungslose Fälle schreiben?«, fragte ich.
Kirsten schüttelte den Kopf und sah ein wenig hilflos aus. »Hör doch mal damit auf«, sagte sie. »Ich kann echt nicht mehr hören, wie du über dich redest. Lass uns lieber dein Profil vervollständigen.«
Wir setzten uns nebeneinander vor meinem Computer. Ich dachte daran, wie oft ich mich in meinem Leben einfach nur hatte treiben lassen, und gab mir einen Ruck.
»Das ist die wichtigste Seite, quasi dein Aushängeschild, also gibt dir Mühe!«, sagte Kirsten, während sie die einzige Fragebogenseite aufrief, die ich noch ausfüllen musste. Auf den anderen Seiten hatte sie schon alles für mich angekreuzt: ob ich lieber in die Berge oder lieber ans Meer reise, wie viel ich verdiene – hatten wir darüber jemals gesprochen? –, wie wichtig mir Sex ist – darüber hatten wir ganz sicher nicht gesprochen! –, wie viele Kinder ich habe und weitere Fragen in der Art.
»›Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?‹. Das ist die erste Frage. Hier kann man nichts ankreuzen, hier musst du jetzt kreativ sein.« Kirsten sah mich herausfordernd an.
Mein Gehirn streikte umgehend. Auf die anderen Fragen fiel mir auch nichts Geistreiches ein: »Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?«, »Welches Tier wären Sie gern?«, »Was ist Ihnen besonders wichtig und was können Sie überhaupt nicht leiden?«.
Kirsten öffnete eine Flasche Weißwein, während ich mir den Kopf zerbrach. Es dauerte fast drei Gläser, bis wir schließlich einige Antworten zusammengebastelt hatten, die uns beiden gefielen.
Meine Freundin Kirsten kenne ich seit meinem Studium vor gefühlt hundert Jahren. Wir haben beide Biologie studiert, ich hatte das in der Schule immer gemocht. Das fällt mir immer nur ein, wenn ich mich zu erinnern versuche, seit wann ich Kirsten kenne, denn außer Kirsten ist mir von dem Studium nichts geblieben. Ich bin im letzten Jahr meines Studiums schwanger geworden und habe auf den letzten Drücker mein Examen gemacht. Dann kam mein Sohn Leonhard. Und danach – ich weiß, das klingt total dämlich, aber ich hatte einfach keinen Mut mehr. Ich hatte einfach nicht mehr den Mut, mich als Biologin irgendwo zu bewerben. Ich hatte nie einen echten Berufswunsch in diese Richtung gehabt – ich wollte nicht für eine Naturschutzorganisation arbeiten, nicht in der Forschung oder im Institut für Risikobewertung. Ich wollte auch nicht die Wasserqualität der Berliner Gewässer überprüfen. An solchen Orten landeten meine Studienkollegen. Ich hatte auch nie schreiben wollen wie Kirsten. Kirsten hatte gleich nach dem Studium angefangen, für Zeitungen zu arbeiten, für Wissenschaftsseiten vor allem. Schließlich war sie beim Apotheken-Journal gelandet und ist bis heute ziemlich zufrieden damit. Ich kann Leonhard prima den Unterschied zwischen Ionenbindungen und Disulfidbindungen erklären oder welche biologischen Prozesse besonders viel ATP verbrauchen, aber mehr habe ich eben nie daraus gemacht.
In der Tür stellte sich Kirsten in Positur und wackelte unternehmungslustig mit dem Kopf. »Wann kann ich vorbeikommen und mit dir Briefe lesen? Oder gibst du mir deine Zugangsdaten?«
»Bist du verrückt?«
»Komm schon«, sagte Kirsten und fingerte eine Zigarette aus ihrer Tasche. »Eine Hand wäscht die andere, du findest einen Mann und ich befriedige meine Neugier!«
Ich musste lachen. »Ich denk drüber nach«, sagte ich.
ERDBEERSCHOKOLADE
Als ich Samstagmorgen auf der Wohnzimmercouch zum ersten Mal meine Doublecheck-Seite aufrief, war ich aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Obwohl ich darauf gehofft hatte, erschrak ich, als ich sah, dass tatsächlich Nachrichten eingegangen waren. Ich starrte die Seite mit den kleinen Brief-Symbolen sehr lang an und konnte mich nicht dazu durchringen, eines davon anzuklicken. Was genau ich fürchtete, hätte ich nicht sagen können. Enttäuschung? Leistungsdruck? Ob die Männer wohl sehen konnten, wenn ich ihre Mail gelesen hatte? War das technisch möglich? Noch während ich darüber nachdachte, bemerkte ich das kleine grüne Feld, das allen Doublecheck-Mitgliedern zeigte, dass ich online war. Reflexhaft schloss ich den Deckel des Laptops. Ich atmete ein paarmal tief durch, dann öffnete ich ihn wieder. Das Programm hatte mich aus Sicherheitsgründen rausgeworfen und ich musste mich neu einloggen. Es half wohl nichts – wenn ich die Mails abrufen wollte, musste ich in Kauf nehmen, dass die Absender es mitbekamen. Misstrauisch prüfte ich, ob die schwarze Pappe, die Leonhard vor ein paar Monaten vor die Linse meiner Laptopkamera geklebt hatte, noch hielt. Das tat sie. Selbst ein Hacker würde mich also nicht sehen können.
Ich brauchte zur Gesellschaft dringend eine Tafel Erdbeerschokolade. Kurz dachte ich darüber nach, ob ich die Tür zu meinem Zimmer öffnen sollte, um den direkten Blick auf meinen Crosstrainer zu haben. Ein Schreibtisch befand sich dort nur deswegen nicht, weil sonst mein monströses Sportgerät nicht hineingepasst hätte. Und ohne das hätte ich es längst aufgegeben, gegen meine zusätzlichen Pfunde anzukämpfen. Die Vorstellung, dass ich für jede Tafel Schokolade den halben Abend auf dem Crosstrainer verbringen musste, hielt mich in der Regel erfolgreich von einer zweiten Tafel ab.
Ich brach die Schokolade in Riegel und legte sie neben den Computer, den ersten schob ich in einem Stück in den Mund. »Hallo Unbekannte«, las ich. »Mir gefällt dein Profil. Ich heiße Torsten und wohne in Tempelhof. Ich freue mich über Post.« »Hallo Unbekannte«, fing auch die nächste Mail an. »Ich habe bei dir sofort eine große geistige Nähe gespürt. Ich bin Wassermann mit Aszendent Waage. Willst du mir deine Kombination schicken? Viele Grüße, Werner.« Ich seufzte.
»Liebe Doublecheckerin! Als Controller für eine große IT-Firma habe ich in den letzten Jahren so viel gearbeitet, dass mein Privatleben auf der Strecke geblieben ist. Das soll sich nun ändern! Ich suche eine verwandte Seele für gemeinsame Unternehmungen. Könntest du diese verwandte Seele sein? Viele Grüße, Jochen.«
Ein vierter Mann wünschte sich neben meinem Foto auch das meines Sohnes. Mich schauderte und ich fand instinktiv die Taste, mit der ich den Absender sperren konnte. Es fühlte sich unangenehm an, sie zu betätigen, und kurz bedauerte ich, die Mail nicht einfach nur ignoriert zu haben. Würde der unheimliche Mann jetzt wütend auf mich sein? Konnte er herausfinden, wer ich war und wo ich wohnte? Ich schalt mich einen Trottel: Selbst wenn er ein Computergenie wäre und ihm das gelingen würde – was sollte er tun? Mein Stalker werden, nur weil ich ihn bei Doublecheck abgelehnt hatte? Mal ehrlich – wer würde denn bei so einer Frage den Knopf nicht drücken? Trotzdem brauchte ich eine Weile, um mich wieder zu beruhigen.
Die fünfte Mail stammte von einem Arzt, der sympathisch klang, aber fünfzehn Jahre älter war als ich und im nächsten Monat wegen eines Jobwechsels nach München ziehen würde. Nur der Schreiber »Wassermann Aszendent Waage« hatte sein Foto freigegeben. Ich blickte auf einen blonden Haarkranz und eine gestreifte Weste über einem weißen Hemd.
Ich dachte gerade darüber nach, wie vollgestopft mein Kopf mit Klischeevorstellungen war, beispielsweise bezüglich gestreifter Westen, als Leonhard nach Hause kam. Immerhin hatte unsere Wohnung einen winzigen Flur, sodass ich keinen Herzkasper bekommen musste, als ich seinen Schlüssel im Schloss hörte. Ich hatte also noch Zeit, hektisch den Laptopdeckel zuzuklappen, ehe er die Wohnzimmertür öffnete.
»Mama!« Auch er schien nicht gerade begeistert zu sein, mich zu sehen.
Mein Sohn Leonhard schlägt ziemlich nach meinem Exmann. Er ist groß und schlank, nur sein Kinn ist weniger kantig. Vermutlich denken die meisten Mütter, dass ihre Söhne gut aussehen, aber meiner sieht wirklich gut aus. Von mir geerbt hat er die vollen Lippen, die er nun kräuselte. Er fuhr sich nervös durchs dunkle Haar. Leonhard war zu lang nicht mehr beim Friseur gewesen, dachte ich. Und dann: Warum um alles in der Welt ist er so nervös wie seine Mutter bei der Partnersuche? Hinter ihm tauchte der Grund für seine Nervosität auf.
»Hallo!« Das Mädchen und hob die Hand ein wenig, um so etwas wie zu winken.
»Hallo«, antwortete ich lahm und sah meinen Sohn an.
»Das ist Diana. Diana, meine Mutter«, sagte Leonhard.
Wir lächelten uns vorsichtig an und sagten noch einmal »Hallo!«. Diana war einen halben Kopf kleiner als mein Sohn und damit knapp größer als ich. Das blonde Haar fiel ihr glatt auf die Schultern. Unscheinbar, dachte ich, bis sie lächelte. Sie hatte eine Lücke oben zwischen den Vorderzähnen, was mich schlagartig für sie einnahm. Ich hatte lang kein junges Mädchen mehr gesehen, das in der Pubertät nicht aufhörte zu essen, sich nicht die blond gefärbten Haare wachsen und nicht die Zähne regulieren ließ, um einem fragwürdigen Schönheitsideal zu entsprechen.
»Kommt rein«, sagte ich und warf einen besorgten Blick auf den Laptop, als könne er mich verraten.
»Wir wollten nur schnell etwas holen.«
Ich kenne meinen Sohn lang genug, um zu erkennen, dass er log. Aber so schlecht lügen wie er konnte ich schon lange.
»Ich muss noch einkaufen«, sagte ich und stand auf. »Brauchst du noch was aus dem Supermarkt?«
Leonhard schüttelte stumm den Kopf.
»Alles klar, wir sehen uns.« Ich und ging an ihnen vorbei in den Flur. Dort griff ich zu dem kleinen verschnörkelten Schlüsselschrank von meiner Großmutter, in dem ich diebesfreundlich sowohl meinen Schlüssel als auch meine Geldbörse aufbewahrte. Aus der Kommode holte ich einen Einkaufsbeutel, dann öffnete ich die Tür und zog sie leise hinter mir zu.
Als ich auf der Straße stand, war ich richtiggehend fassungslos über mich. War ich gerade aus meiner eigenen Wohnung geflüchtet, damit mein kaum volljähriger Sohn mit seiner neuen Freundin ungestört sein konnte? Ja, das war ich. Ich wusste nicht, wie das andere Mütter machten und weiß es bis heute nicht: Wie geht man halbwegs angemessen mit der Tatsache um, dass aus einem Wickelkind ein Erwachsener wird? Klar, das passiert nicht über Nacht, wenn es aber so weit ist, kommt es einem so vor! Und ich kann nur sagen: Einen Mitbewohner zu haben, dem man früher einmal die Windeln gewechselt hat, ist schwieriger, als man denkt. Zunächst einmal ist man immer doppelt betroffen, beispielsweise wenn er das Badezimmer nicht putzt. Das nervt, weil man alles selber machen muss, gleichzeitig fragt man sich: Hätte ich ihm das nicht beibringen müssen? Ist das im Grunde mein Fehler? Und dann erinnert man sich, dass man das dem Erwachsenen, mit dem man eine Windelvergangenheit teilt, sehr wohl beigebracht hat, und das schlechte Gewissen verwandelt sich in leise Wut. So jedenfalls war das bei mir. Ich mochte meinen Sohn und ich mochte, dass er erwachsen war, aber ich schwankte zugleich ständig zwischen schlechtem Gewissen und Verärgerung.
Und dann war da noch diese andere Sache. Das Privatleben meines Sohnes. Wenn Kinder klein sind, bringt man ihnen Obst ins Zimmer, wenn sie Besuch von Freunden haben. Wenn die Freunde zum Abendessen bleiben, lässt man sich am Esstisch Geschichten aus der Schule und von der Familie erzählen, man gibt Aufräumanweisungen, ehe der Kinderbesuch aufbricht, und wenn sie sich verkrachen, gibt man Ratschläge. Rollenbeschreibung: Versorgerin, Coach, Chefin. Diese Rollen nach so vielen Jahren auf einmal aufzugeben und meinen Sohn mit seinem Besuch ganz einfach in Ruhe zu lassen, fiel mir schwer.
Die Abendsonne stand tief und beleuchtete die Häuser sonderbar unwirklich. An unserer Wohnung mag ich nicht zuletzt, dass wir wunderbar ruhig wohnen und dennoch innerhalb weniger Minuten mitten im südberliner Einkaufstrubel sein können. Heute allerdings war mir nicht nach so vielen Menschen zumute, ich hatte ein zu großes Durcheinander im Kopf. In solchen Fällen wähle ich den Supermarkt am nördlichen Rand des Einkaufstrubels. Zwar mag ich weder die mürrischen Kassiererinnen noch die hohen Preise für so ziemlich alles, was wir regelmäßig brauchen. Dafür gefällt mir, dass der Supermarkt quer durch einen Wohnblock zwei Straßen miteinander verbindet, die Bundesallee und die Rheinstraße. Ich fühle mich immer ein wenig wie in einem Zaubertrick gefangen – Nina tritt durch den Spiegel und kommt in einer anderen Stadt wieder heraus. Zugegeben, weder Bundesallee noch Rheinstraße sahen aus wie eine Feenwelt, aber es ist dennoch immer wieder ein sonderbares und wirklich gutes Gefühl.
Nachdem ich eine halbe Stunde im Supermarkt herumgelungert und ein paar Schritte auf die Rheinstraße gemacht hatte, kehrte ich in den Supermarkt zurück und zahlte auf der Bundesallee-Seite. Die Kassiererin war weniger mürrisch als sonst, was ich als gutes Omen wertete. In meinem Einkaufsbeutel brachte ich ein Glas Kirschen, eine Dose Tomaten und eine Dose Pfirsiche mit nach Hause.
Die Luft war inzwischen wieder rein und ich loggte mich sofort bei Doublecheck ein. Ich hatte zwei neue Mails. »Hallo Unbekannte«, begann die erste. »Dein Profil gefällt mir gut. Ich bin auch gern in den Bergen. Aber ich bin beruflich so viel unterwegs, dass ich in meiner Freizeit am liebsten in meinem Garten bin. Ich kann über mich sagen, dass ich ein guter Gärtner bin. Ich habe dir mein Foto freigeschaltet. Viele Grüße, Michael.« Michael trug auf seinem Foto Schnäuzer und kurze Hosen. Ich saß lang vor diesem Foto und dachte nach. Ich hatte das Gefühl, eine Grundsatzentscheidung treffen zu müssen. Wollte ich dumme Äußerlichkeiten entscheiden lassen?
Mit einem weiten Sprung tauchte ich kopfüber in eine Zeit ein, die ich lang vergessen zu haben glaubte. Ich war fünfzehn und schrecklich verliebt in Thomas Kübler. Der ging in meine Klasse und ich konnte richtig mit ihm reden, so wie mit keinem anderen Jungen. Er war ziemlich dick, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er deswegen jemals gehänselt worden wäre. Im Sportunterricht wurde er immer als Letzter gewählt, aber das scheinen wir alle so hingenommen zu haben, einen Jungen im Stimmbruch hätte man ja auch nicht für den Chor ausgesucht. Wenn Thomas zuhörte, lehnte er sich nach vorn, stützte sich mit den Unterarmen auf die breiten Oberschenkel und sah so konzentriert aus, als dürfe er keines meiner Worte verpassen. Er selber sprach leise, aber mit einer wunderbar dunklen Stimme. Die hatte er nicht immer gehabt, aber an seine Kinderstimme konnte ich mich nicht erinnern. Vor und nach der Schule saßen wir auf der großen Freitreppe, die zum Schulgebäude hinaufführte, einem mächtigen Backsteinbau. Thomas wartete dort immer auf mich, immer auf der obersten Stufe. Fast einen Monat lang traf ich mich dort jeden Morgen mit ihm und auch nach dem Unterricht hatten wir es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Ich hatte jeden Tag mehr Herzklopfen. Schließlich kam der Tag, an dem er vorschlug, mich nach Hause zu bringen. Inzwischen träumte ich nahezu Tag und Nacht davon, den ersten Kuss von ihm zu bekommen. Heute würde es so weit sein, dachte ich, als wir nebeneinanderher gingen.
Meine Mutter öffnete die Tür, als ich mich gerade zu Thomas drehen wollte. Offenbar hatte sie mich durchs Fenster schon kommen sehen, die Haustür gehört und gewartet, bis wir vor der Wohnungstür standen. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn ich mich jetzt ihm zugewandt hätte, hätte mich Thomas ganz bestimmt geküsst, und das vor meiner Mutter. Eigentlich hätte sie gar nicht zu Hause sein dürfen, dienstags um diese Zeit war sie immer schwimmen. Doch nun stand sie in der Tür und musterte Thomas.
»Komm rein, Annette«, sagte sie mit eisiger Stimme, ohne den Blick von ihm abzuwenden. Annette nannte mich nur meine Mutter. Und weil sie es so sagte, wie sie es tat, konnte ich nicht einmal sagen »Das ist Thomas, Mama«. Ich flüsterte nur »Bis morgen« und glitt in die Wohnung.
»Was war das?«, fragte meine Mutter, als sie die Tür hinter uns geschlossen hatte. Mit »was« meinte sie ganz offensichtlich Thomas.
»Thomas.«
»Woher hast du den?«, fragte sie.
»Er geht in meine Klasse.«
»Das ist kein Umgang für dich«, sagte sie. Und dann würgte sie sie nahezu hervor: »Was hat dieser Junge für Eltern, dass sie ihn so mästen?«
Das war das Lebensthema meiner Mutter: das Fettsein. Unter dieser Flagge bin ich mein Leben lang gesegelt.
Bis heute wünsche ich mir verzweifelt, ich könnte die Uhr zurückdrehen und vor der Tür mit fester Stimme sagen: »Das ist Thomas, Mama.« Dann würde ich mich zu ihm drehen, »Bis morgen« sagen und ihm einen Kuss auf die Lippen drücken. Doch meine Mutter war, wie sie war, und Gleiches galt für mich. Seit jenem Tag habe ich nicht mehr mit Thomas gesprochen. Ich nickte ihm nur noch zum Gruß zu, und er war nicht der Typ, der mich zur Rede gestellt hätte. Ich würde gern sagen, dass es mir danach jedes Mal wehgetan hat, wenn ich Thomas begegnet bin. Aber es war, als hätte meine Mutter all meine Gefühle mit einer einzigen harschen Handbewegung vom Tisch gewischt. Als würde ich von ihr ferngesteuert. Heute tat mir das alles weh. Immerhin jetzt, nach all den Jahren, konnte ich das spüren.
Da saß ich nun vor meinem Computer und erinnerte mich an Thomas Kübler und meine ganze Erbärmlichkeit. Ich hörte meine Mutter hinter mir flüstern »Das ist kein Umgang für dich!« und klickte Michael mit dem Schnäuzer weg. Nachdem ich einige Male tief durchgeatmet und meine Mutter innerlich so weit von mir fortgeschoben hatte, wie es nur ging, öffnete ich das nächste Profil und las mir die zweite Mail durch.
»Liebe Unbekannte«, schrieb der Absender. »Auch ich kann wohl als Einziges nicht auf meinen Sohn verzichten – aber auf die einsame Insel würde ich ihn nicht zwingen, mitzukommen. Wenn wir zusammen dort wären, könntest du mir mit dem Werkzeugkasten aushelfen und ich dir mit Feuer: Ich habe nämlich Streichhölzer dabei. Was hältst du davon? Viele Grüße, Peter.« Peter bezog sich auf die Startseite meines Profils, auf der ich mit Kirstens Unterstützung notiert hatte, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Es klingt albern, aber bei dieser Mail dachte ich: der oder keiner. Ich holte mir eine zweite Tafel Schokolade aus dem Schrank, legte sie aber wieder zurück. Das Putzzeug habe ich nicht wieder zurückgelegt und nach einer Stunde sah die Wohnung tipptopp aus. So etwas nennt man, ich weiß es als Biologin, Übersprungshandlung. Ich habe es nicht geschafft, Peter zu antworten.
In der Nacht träumte ich aus vermutlich total komplizierten und tiefsinnigen Gründen von zwei gefährlichen Schafherden, die mich von rechts und links von den Schienen zu schubsen versuchten, auf denen ich lief. Unterhalb der Schienen gähnte ein tiefer Abgrund, in den ein monströser Wasserfall hinunterbrodelte. Noch im Fallen wachte ich auf.
Ich dachte an das, was ich am Tag zuvor erlebt hatte. Eigentlich war wenig mehr als nichts passiert, trotzdem fühlte es sich an, als befände ich mich auf einem Weg. Ob es ein guter Weg war, würde sich noch zeigen.
KANTINENESSEN
Ich saß noch keine Stunde im Krankenhaus am Schreibtisch als klar wurde: Dieser Freitag war mir nicht so gewogen wie die vergangenen Arbeitstage. Burkhard-Stegemann stand mit zwei Briefen vor mir und funkelte mich an. Ich hatte diese Briefe noch nie gesehen und das war offenbar das Problem.
»Warum finde ich diese Briefe im Fach von Zielinski?«, herrschte er mich bereits zum zweiten Mal an.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Wenn ich die Briefe dort versehentlich abgelegt habe, tut es mir leid.«
»Es tut Ihnen leid, ja?« Sein Gesicht verzog sich zu einer höhnischen Grimasse.
Ich war so verschreckt, dass ich seine Emotionen schon gar nicht mehr sicher benennen konnte. Trotzdem versuchte ich, nach außen hin Fassung zu bewahren. »Es wird nicht mehr vorkommen, Herr Dr. Burkhard-Stegemann«, gelang es mir zu sagen. Hinter ihm tauchte Professor Wolff auf. »Hier stecken Sie, Burkhard-Stegemann«, rief er. »Kommen Sie, ich will, dass Sie sich das Lungen-CA ansehen, wir haben gerade die Bilder bekommen.«
So linkisch mein Chef in persönlichen Dingen war, so souverän war er in chirurgischen. Ohne ein weiteres Wort drehte sich Burkhard-Stegemann um und folgte ihm. Aber ich war sicher, dass der Vorfall mit dem Brief damit nicht erledigt war.
Stunden später, auf dem Weg zur Kantine, durchquerte ich den Flur der Röntgenabteilung. Als ich um die Ecke bog, schrak ich zurück. Burkhard-Stegemann stand vor Kabine drei und plauderte mit einer der Röntgenassistentinnen. Doch er hatte mich bereits gesehen und ich konnte nicht mehr umkehren. Den Blick auf mich gerichtet, sagte er etwas zu der Assistentin und beide lachten. Da mir die junge Frau daraufhin einen verstohlenen Blick zuwarf, war ich sicher, dass sie über mich gesprochen hatten. Mit hölzernen Bewegungen stakste ich an den beiden vorbei, mein Gesicht brannte.
Ich hasse den Oberarzt, ich hasse ihn, dachte ich während des Essens wieder und wieder. Ich hätte hinterher nicht sagen können, was es eigentlich zu essen gegeben hatte. Und gebracht hatte mir dieser Gedankenstau rein gar nichts.
Auf dem Weg nach Hause hoffte ich auf freundliche Post. Auf Post von ein paar weiteren Peters. Vielleicht würde mich das aufmuntern.
Ein Joachim hatte geschrieben. Er wollte sich mit mir auf dem Minigolfplatz verabreden, das nahm mich für ihn ein. Dann rief Kirsten an.
»Wie läuft es?«, fragte sie in einem Ton, als wäre sie bei einem besonders aufregenden Pferderennen und ich ihr bestes Pferd auf der Bahn.
»Ich bekomme Post«, sagte ich lahm.
»Details«, forderte Kirsten.
»Drei Männer haben markiert, dass ihnen mein Profil gefällt, und einer hat geschrieben«, berichtete ich folgsam und las vor: »Hallo Unbekannte. Ich habe gelesen, dass du gern Minigolf spielst. Was hältst du davon, dich mit mir zu einem Spiel zu verabreden? Ich glaube, ich habe das letzte Mal als Kind gespielt, aber mit etwas Glück ist das wie mit dem Fahrradfahren und man verlernt es nicht. Ein paar Worte zu mir: Ich arbeite in einem großen Handelsunternehmen in der Personalabteilung. Das klingt vielleicht trocken, aber ich arbeite gern mit den vielen unterschiedlichen Menschen zusammen. Ich habe gesehen, dass du in der Krankenhausverwaltung arbeitest. Das klingt interessant! Viele Grüße, Joachim.«
»Der geht ja mächtig ran«, sagte Kirsten und ich hörte heraus, wie viel Spaß ihr die ganze Sache machte.
»Ich finde, er klingt nett«, sagte ich.
Kirsten machte zustimmende Geräusche. »Wirst du dich mit ihm verabreden?«, fragte sie.
»Bist du verrückt?«
»Ich dachte ja, dass es genau darum geht. Hast du dir sein Profil angesehen?«
Ich nickte, obwohl sie das nicht sehen konnte. »Nett«, sagte ich. »Aber irgendwie nichtssagend. Also ich meine, ich kann mir den Menschen dahinter nicht richtig vorstellen«, beeilte ich mich zu sagen. Der Gedanke, dass sich Männer mein Profil ansehen und »irgendwie nichtssagend« denken könnten, machte sich in mir breit und versperrte mir die Sicht.
»Überleg es dir, und halt mich bitte auf dem Laufenden«, sagte Kirsten. Das klang mehr wie eine Anweisung als wie eine Bitte. Ich versprach es und legte auf.
Leonhard hatte eine Nachricht auf dem Wohnzimmertisch hinterlassen, er würde bei Diana übernachten. Ich hatte seine Handynummer, verzichtete aber darauf, ihn anzurufen, um nachzufragen. Was hätte ich auch fragen sollen? Wo das genau war, damit ich mit Dianas Eltern sprechen konnte? Wohnte Diana überhaupt noch bei ihren Eltern?
Den Abend verbrachte ich mit einem Buch im Bett, nachdem ich eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer Sport gemacht und dabei ferngesehen hatte. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man beim Fernsehen weniger Kalorien verbraucht als beim einfachen Herumsitzen.
FRANKFURTER KRANZ
Das Wochenende hatte begonnen. Es war richtig warm, die Sonne schien gleißend durch mein rotes Lamellenrollo und ich konnte Zeit verplempern, so lange und wie es mir gefiel. Zehn Minuten nach diesem Gedanken saß ich in meinem Lieblingsschlafanzug wieder am Computer. Er war lila-weiß gestreift und unförmig. Das war rasend bequem, aber ich hoffte, dass Leonhard nachts nicht überraschend mit Diana nach Hause gekommen war.
Zum Wochenende kam offenbar mächtig Bewegung in die Doublecheck-Gemeinde. Ich bekam einen richtigen Schreck, als ich sah, wie viele Mails eingegangen waren. Schon der Gedanke, mir zu all diesen Männern eine Meinung bilden zu müssen, setzte mich unter Druck.
Ein Teil der Zuschriften bestand nur aus der Bemerkung »Mir hat dein Profil gefallen, schreibst du mir?«. Aber es gab auch fünf persönlichere Mails, auf die ich eigentlich antworten sollte. Eine Seite von mir freute sich über die Zuschriften, eine andere fühlte sich mehr als überfordert. Wenn ich nicht bald anfing, zu antworten, würde mich die schiere Arbeitsmenge lähmen, die dann vor mir liegen würde.
»Ich habe dir meine Fotos freigeschaltet. Deine Fotos würde ich auch gern sehen«, las ich. Ich hätte etwas gegeben für einen Mann, der geschrieben hätte: »Egal wie du aussiehst, Charakter ist entscheidend.« Aber so dachte ich selbst ja auch nicht.
Nachdem ich sämtliche Mails im Postfach mehrmals gelesen hatte, ging ich duschen. Und putzte mir die Zähne. Und zog mich an. Als ich mich bei dem Plan ertappte, die perfekt geputzte Wohnung ein zweites Mal innerhalb von knapp vierzehn Stunden zu putzen, schüttelte ich mich wie ein nasser Hund. Es wurde Zeit, zumindest Peter zu antworten.
Mein Frühstück bestand aus drei Marmeladenbroten. Ich sterbe für gute Marmelade und habe immer ein halbes Dutzend verschiedener Sorten im Haus. Vermutlich könnte ich ohne große Probleme die magischen fünf Kilo weniger wiegen, wenn ich weder Marmelade noch Schokolade im Haus hätte. Ein Brot mit Ananasmarmelade, ein Brot mit Himbeer-Marzipan, ein Brot mit Schwarzkirsche. Nie Sauerkirsche, nur Schwarzkirsche, die beste Marmeladensorte der Welt. Ich schmierte mir die Brote in der Küche und hörte dabei Radio, bis mir die aufgedrehte Moderatorenstimme auf die Nerven ging und ich ausschaltete. Zeit, mit der Drückebergerei aufzuhören, entschied ich.
»Lieber Peter«, schrieb ich. »vielen Dank für das Angebot mit den Streichhölzern – vermutlich ist es viel weitsichtiger, vor einer Höhle Feuer machen zu können, als in einer prima Hütte zu frieren. Wie alt ist dein Sohn? In deinem Profil habe ich gesehen, dass er nicht bei dir lebt. Wie oft siehst du ihn denn? Viele Grüße, Nina. PS: Was kontrollierst du als Controller?« Ich las meine Mail so oft, bis ich sie vermutlich rückwärts hätte buchstabieren können. War das nett oder bemüht nett? Locker oder kindisch? Sollte ich mehr über mich schreiben? Mehr fragen? Schließlich drückte ich auf »senden« und mir fiel ein Stein vom Herzen.
Nun brauchte ich dringend Bewegung. Ich fühlte mich aufgezogen wie eines dieser wackelnden Plastiktierchen und brauchte ebenso viel Platz. Aufgezogen und beschwipst zugleich. Ich hatte eine Antwortmail geschrieben! Und sogar abgeschickt! Ich war ungeheuer stolz auf mich. Ich schlüpfte in ein lockeres Kleid und flache Ballerinas, mit denen ich weite Strecken gehen konnte. Mit dem Schlüssel in der einen und meiner Brieftasche in der anderen Hand verließ ich die Wohnung.
Kurz hing ich der Frage nach, warum ich nie ohne meine Brieftasche aus dem Haus ging. Als ich Teenager war, ging das Gerücht um, man müsse sich jederzeit ausweisen können und immer zehn D-Mark bei sich haben. So richtig haben wir das damals nicht geglaubt, trotzdem war ich seit dieser Zeit nie ohne meine Brieftasche und das Geld, heute natürlich in Euro, unterwegs. Eines Tages würde mich ein Polizist anhalten und herrisch auffordern: »Ihre Brieftasche und die zehn Euro!« Und dann würde ich triumphierend beides hochhalten und denken: Das ist für alle, die sich immer über mich und meinen Brieftaschentick lustig gemacht haben, ganz besonders mein Exmann Christoph! Mit diesen Gedanken eilte ich die zwei Etagen hinunter und durch den breiten Hausflur mit den Briefkästen. Ich fühlte mich ganz leicht und fast ein wenig übermütig.
Im Treppenhaus hatte ich niemanden getroffen, aber vor dem Haus begegnete mir der alte Maczeyzek. Der wohnte im Erdgeschoss und fühlte sich nicht richtig lebendig, wenn er nichts zu nörgeln hatte.
»Hallo, Herr Maczeyzek!«, rief ich unangemessen fröhlich.