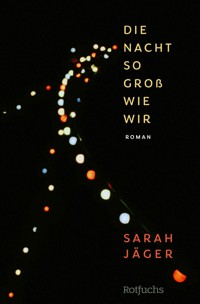14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Bevor diese Geschichte beginnt, fliegt eine Kaffeemaschine aus dem Fenster des Lehrerzimmers. Dann fliegt Kim. Und zwar von der Schule. Ihre Mutter schickt sie in ein Dorf im Nirgendwo, zu ihrem Exfreund René. Dort geht Kim zur Schule und arbeitet nebenbei an einer Tankstelle, wo sie Janne trifft, der süchtig nach Erdnussbutter-Schokoriegeln ist. Gegen ihren Willen werden Janne und Kim so etwas wie Freunde. Doch sie bleiben nicht lange zu zweit. Aus Janne, Kim und Alex(andra Sofie) entsteht ein Dreiergespann. Bald wissen sie nicht mehr so richtig, wer genau was für wen empfindet. Und wäre das nicht schon kompliziert genug, muss Kim immer wieder den Drang bekämpfen, alles zu zerstören, was ihr zu nahe kommt. Sarah Jäger erzählt klug, berührend und humorvoll von einer Dreierfreundschaft, die eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Ähnliche
Sarah Jäger
Schnabeltier Deluxe
Über dieses Buch
Bevor diese Geschichte beginnt, fliegt eine Kaffeemaschine aus dem Fenster des Lehrerzimmers. Dann fliegt Kim. Und zwar von der Schule. Ihre Mutter schickt sie in ein Dorf im Nirgendwo, zu ihrem Ex-Freund René. Dort geht Kim zur Schule und arbeitet nebenbei an einer Tankstelle, wo sie Janne trifft, der süchtig nach Erdnussbutter-Schokoriegeln ist. Gegen ihren Willen werden Janne und Kim so etwas wie Freunde. Doch sie bleiben nicht lange zu zweit. Aus Janne, Kim und Alex(andra Sofie) entsteht ein Dreiergespann. Bald wissen sie nicht mehr so richtig, wer genau was für wen empfindet. Und wäre das nicht schon kompliziert genug, muss Kim immer wieder den Drang bekämpfen, alles zu zerstören, was ihr zu nahekommt.
Sarah Jäger erzählt klug, berührend und humorvoll von einer Dreierfreundschaft, die eigentlich zum Scheitern verurteilt ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Sarah Jäger wurde in Paderborn geboren und lebt seit zwanzig Jahren im Ruhrgebiet. Sie ist IHK-zertifizierte Call-Center-Agentin, ausgebildete Theaterpädagogin und umgeschulte Buchhändlerin. Für ihren Debütroman «Nach vorn, nach Süden» wurde sie vielfach ausgezeichnet.
Ich schaue aus dem Fenster des Lehrerzimmers, schaue auf die fliegende Kaffeemaschine und denke, dass ich mir die Sache mit dem Urknall genau so vorgestellt habe. Ich denke, dass es vor zig Milliarden Jahren diesen Urknall gegeben hat und deshalb jetzt gerade eine Kaffeemaschine durch das Fenster fliegt, auf den Asphalt des Schulhofs kracht und sich in tausend Einzelteile zerlegt.
Die Klassenlehrerin hat uns vor einer halben Stunde den Physiktest zurückgegeben. Sie hat einen Mundwinkel nach unten gezogen und den Kopf geschüttelt – als ob die Zahl auf dem Papier nicht ausgereicht hätte. Außer der Sechs und zehn Fragen zu den Urknalltheorien gab es da nicht mehr viel zu sehen.
Eine Explosion, hatte ich geschrieben. Alles ist auseinandergeflogen, und dann ist daraus was Neues entstanden. Schätzungsweise unser Universum. Ist aber nur eine Theorie.
Krach, Lärm, Zerstörung. Genau so muss das damals gewesen sein.
Nach der Kaffeemaschine werfe ich Untertassen aus dem Fenster, einfach nur, weil ich den Gedanken an fliegende Untertassen so lustig finde. Das Problem ist allerdings, dass ich damit alleine bin. Niemand lacht, weder die Sekretärin noch der Schuldirektor, die als Erste in das Lehrerzimmer gestürmt sind, und wenn man einen Witz erklären muss, dann ist er nicht mehr gut. Statt mit mir am Fenster zu stehen und die fliegenden Untertassen zu bewundern, fasst mich der Schuldirektor grob am Arm.
Ich sehe den Arm, ich sehe seine Hand – und ich weiß, dass ich das nicht vergessen werde.
Ich lasse mich ohne große Gegenwehr in sein Büro zerren.
Als ich auf dem Stuhl vor seinem Schreibtisch sitze, fragt er wütend: «Was fällt dir ein?!», und seine Augen wirken müde.
«Das war nur ein Experiment», antworte ich. «Urknalltheorie.» Ich schaue mich in seinem Büro um. Aktenordner stehen im Regal, viele Aktenordner, weil Aktenordner immer nach Arbeit aussehen, und in der Ecke des Raums steht eine Zimmerpflanze, die wahrscheinlich vom Hausmeister am Leben gehalten wird, denn der Hausmeister ist der einzige Erwachsene in diesem Gebäude, der noch ein Herz hat. Es gibt nichts Neues in diesem Zimmer, all das kenne ich schon. Ich bemerke nur, dass ein Foto weniger auf dem Schreibtisch steht als beim letzten Mal. Vielleicht gibt es gerade eine Ehekrise im Hause Schuldirektor. Das würde auch seine müden Augen erklären, schließlich kann ich nicht für alles verantwortlich sein.
«Und Ihrer Frau, wie geht es der so?», frage ich, aber der Schuldirektor bleibt mir eine Antwort schuldig, die Tür zu seinem Büro öffnet sich, und die Klassenlehrerin betritt den Raum. Ihr Gesicht verrät sofort, dass ich sie genau da getroffen habe, wo ich wollte, ohne sie auch nur berühren zu müssen. Es ist ihre Kaffeemaschine gewesen, die ich aus dem Fenster geworfen habe. Vor zwei Monaten wurde die Maschine geliefert, und die Klassenlehrerin ist durch die Schulflure getänzelt, immer dem unterbezahlten Paketboten hinterher. «Ist sie das?», haben die anderen Lehrer aufgeregt gefragt und den unterbezahlten Paketboten dabei fast aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Klassenlehrerin hat stolz genickt und «Wir müssen uns doch auch mal was Gutes tun», gesagt. «Das gibt garantiert Pluspunkte für die Beförderung», hat der Schulsprecher geflüstert.
Die Kaffeemaschine habe ich heute zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, denn was Gutes haben sich natürlich nur die Lehrer verdient, für uns Schüler gibt es Kakao aus dem Getränkeautomaten in der Pausenhalle, und für den unterbezahlten Paketboten gab es noch nicht mal ein Trinkgeld.
Die Klassenlehrerin steht neben dem Stuhl, schüttelt fassungslos den Kopf und zischt: «Was fällt dir eigentlich ein?» Mir fällt gar nichts mehr ein, deshalb wiederhole ich nur: «Experiment. Urknalltheorie», fühle mich wie die Zimmerpflanze, in die Ecke gedrängt und doch irgendwie egal. Ich kann noch nicht mal auf ein nettes Wort vom Hausmeister hoffen, weil er mich seit der Sache mit der Theater-AG keines Blickes mehr würdigt. Das mit dem Bühnenbild hat er wirklich persönlich genommen, obwohl es dabei gar nicht um ihn gegangen war. Auch der Schuldirektor hat das nicht vergessen. «Viel Lärm um nichts», sagt er gerade. Die Klassenlehrerin sagt überhaupt nichts mehr, denkt wahrscheinlich immer noch an ihre zerstörte Kaffeemaschine. Ich werde nun endgültig zur Zimmerpflanze, bewege mich nicht mehr, lasse den Kopf hängen und starre auf den Boden. Gleich werden sie mich nach Hause schicken, auch das kenne ich schon. Die Kaffeemaschine kann nicht schlimmer sein als das Bühnenbild, denke ich. Eine Woche Suspendierung, schließe ich mit mir selbst eine Wette ab.
Die Mutter und ich leben in einer Fernbeziehung. Sitze ich auf dem Bett, darf sie einen Schritt in das Zimmer machen, in dem ich wohne. Wenn sie es einmal auf einen weiteren Schritt ankommen lässt, rücke ich von der Bettkante zurück an die Wand. Sie hat es schon lange nicht mehr darauf ankommen lassen, «weil dein Zimmer ein Saustall ist», sagt sie.
Die unausgesprochene Wahrheit jedoch ist, dass uns drei Armlängen Abstand guttun.
Als die Mutter zwei Tage nach dem Urknall die Tür öffnet und keinen einzigen Schritt in das Zimmer macht, sondern im Türrahmen stehen bleibt, weiß ich sofort, dass ich die Wette mit mir selbst verloren habe. Ich berühre mit dem Daumen das Pause-Symbol auf dem Handydisplay, ‹Fünf Tiere, die sich auf eine mehrspurige Straße gelegt haben und überlebten›, sie müssen warten.
Das linke Augenlid der Mutter zuckt, und ich sehe, dass ihre Hände zittern. Sie bleibt weiterhin im Türrahmen stehen, vielleicht sehnt sie sich nach ein bisschen Halt. Ich richte mich auf und sitze nun auf der Bettkante, rücke weiter nach vorn, bis nur der Hintern die Kante berührt, um der Mutter so nah zu sein, wie wir es beide noch aushalten.
An ihren Füßen schon die grünen Turnschuhe, die sie zur Arbeit im Altenheim trägt. Vor ihrem linken Fuß eine Socke, vor ihrem rechten Fuß ein Papierkügelchen.
Ich wollte mich nur gegen den runtergezogenen Mundwinkel der Klassenlehrerin wehren, aber mit der Kaffeemaschine habe ich wohl eine rote Linie überschritten und die gesamte Lehrerschaft gegen mich aufgebracht. Die Entscheidung der Schule ist nur konsequent. Erst fliegt die Kaffeemaschine, dann fliege ich.
«Es war doch nur eine Kaffeemaschine», antworte ich auf eine Frage, die die Mutter gar nicht gestellt hat.
«Eine Siebträgermaschine», korrigiert mich die Mutter, und jetzt klammert sie sich mit ihrer linken Hand an den Türrahmen. Es ist, als hätte ich die Welt unter ihr zum Wanken gebracht.
Lass nichts zu nah an dich heran, sonst macht es dich kaputt, das wissen wir beide. Nur haben wir schon immer andere Konsequenzen aus diesem Familienwissen gezogen. Kommt etwas zu nah an mich heran, dann warte ich nicht darauf, dass es mich kaputtmacht. Mach es kaputt, bevor es dich kaputtmacht, habe ich einmal mit signalrotem Edding auf das Laminat im Wohnungsflur geschrieben. Danach habe ich zwei Wochenendschichten im Kiosk an der Ecke machen müssen, damit ich der Mutter das Geld für den beigen Teppichboden zurückzahlen konnte, der nun im Flur liegt. Aber das ist es mir wert gewesen.
Vielleicht sucht die Mutter zwischen dem Türrahmen auch gar keinen Halt, vielleicht hat sie gerade das Gefühl, einen größeren Sicherheitsabstand zwischen ihr und mir zu brauchen.
Ich schaue wieder auf das Handydisplay, weil alles gesagt ist und ich nichts weiter fühle, das in Worte gepackt werden müsste, ich werde die Schule nicht vermissen, die Mitschüler kaum, die Lehrer auf gar keinen Fall, und der Hausmeister, der redet ja nicht mehr mit mir. Ich starte das Video. Ein Braunbär liegt auf einer mehrspurigen Straße. Er wird überleben, genau wie ich. Ich spüre den Blick der Mutter, vielleicht brüllt sie auch. Die Menschen sagen und fühlen immer so viel mehr als ich.
Ich bin eine Zimmerpflanze, denke ich und bedauere sehr, dass ich nicht wegen der Untertassen geflogen bin.
Für die Mutter ist es eine unlösbare Aufgabe, eine neue Schule für mich zu finden. Wie ein unangekündigter Physiktest über die Urknalltheorie. Und ich kann sie weder abschreiben lassen noch ihr einen Spickzettel rüberschieben, ich kann nur einen sauberen Pullover anziehen und freundlich lächeln, wenn wieder ein Termin in irgendeiner Schule ansteht.
Nach dem fünften Termin dämmert uns langsam, dass ich mit der Kaffeemaschine nicht nur die Lehrerschaft der Schule, sondern die Lehrerschaft aller Schulen in dieser Stadt gegen mich aufgebracht habe. Die Kaffeemaschine ist dem Lehrer heilig. Und auch der Lehrerin. Oder aber es ist so gewesen, dass bei der stillen Post durch die verschiedenen Lehrerzimmer vielleicht doch die Kaffeemaschine auf der Strecke geblieben ist, dass sich inzwischen nicht mehr «Da ist die Kaffeemaschine der Lehrerin aus dem Fenster geflogen» gegenseitig ins Ohr geflüstert wird, sondern nur noch: «Da ist die Lehrerin aus dem Fenster geflogen.» Das wäre dann immerhin eine logische Erklärung für all die versteinerten Mienen, die uns auf den Schulfluren begegnen. Oder es liegt an dem orange-pink gestreiften Pullover, den ich trage. Manchmal ist sauber einfach nicht genug.
Als uns das Schulamt zu einem Gespräch einlädt, erwartet die Mutter wohl, dass ihr nun endlich die Lösungen für den Physiktest zugeschoben werden, sie bemalt ihre Lippen und zieht hohe Schuhe an, auf denen sie gar nicht laufen kann. Am Tag des Termins steigen wir aus dem Aufzug, gehen über den graubraunen Linoleumboden – er warnt uns, dass es hier trist und ungemütlich werden wird – und suchen das Zimmer Nummer 803. Ich schaue in einen Raum, es ist der Pausenraum des Amtes. Ich sehe eine Küchenzeile, sehe eine Siebträgermaschine auf der Arbeitsplatte stehen, und da weiß ich schon, dass der Linoleumboden nicht gelogen hat. Im Zimmer 803 erwartet uns ein Mensch hinter seinem Schreibtisch. Er sieht kaum auf, als wir hereinkommen, deutet nur mit der Hand auf zwei Stühle und murmelt: «Setzen Sie sich», während er mit seinem dunkelbraunen Kugelschreiber Notizen in eine hellbraune Akte macht. «Schwierig», sagt er, «schwierig.» Und ich weiß nicht so genau, ob er über mich oder die Akte spricht oder ob wir für ihn das Gleiche sind, ich und die Akte. Er könne mich sicherlich an einer Berufsfachschule unterbringen, sagt er, legt den Kugelschreiber auf den Schreibtisch, um ihn ein paar Sekunden später wieder in die Hand zu nehmen. «Für Schulabgänger nach der 9. Klasse», sagt er, und «10 Jahre Schulpflicht», die hätte ich dann erst mal erfüllt, und dass man danach weitersehen könne. Einen Termin mit der schulpsychologischen Beratungsstelle solle man für mich vereinbaren, weil es ja auf der Hand liege – er streichelt mit dem Daumen sanft über seinen Kugelschreiber, es muss ein besonderer Kugelschreiber für ihn sein, während er der hellbraunen Akte sagt: «Es liegt ja auf der Hand, dass du ein Aggressionsproblem hast.»
Als der Mensch vom Schulamt kurz aus dem Raum geht, lässt er seinen Kugelschreiber unbeaufsichtigt auf dem Schreibtisch liegen. Wenige Minuten später kommt er zurück und drückt mir Infobroschüren über die beiden Berufsfachschulen in die Hand, Holztechnik oder Metalltechnik, das könne ich mir aussuchen, sagt er. Und der Mutter überreicht er einen Zettel mit der Telefonnummer für das Aggressionsproblem. Als wir aus dem Schulamt treten, werfe ich seinen Kugelschreiber in den erstbesten Mülleimer. Rote Linien, die habe ich auch.
Die Mutter macht zwei Schritte in das Zimmer hinein, erst dann bleibt sie stehen. Das Herz muss ihr schwer sein, das verrät der erste Schritt, und der zweite noch mehr. Trotzdem stütze ich mich mit beiden Händen auf der Matratze ab und schiebe den Körper an die Wand. Den linken Fuß lege ich auf eine der Schulbroschüren.
Eine Ausbildung im Bereich der Metalltechnik ist das Richtige für dich, wenn
– du gerne Dinge reparierst
– die Naturwissenschaften zu deinen Lieblingsfächern zählen
«Ich glaube, ich nehme die Schule mit dem Holz», sage ich zu der Mutter, um ihr zu zeigen, dass sie nicht alleine ist, auch wenn sie das manchmal denkt. Doch die Mutter macht mit einer Handbewegung deutlich, dass ihre Gedanken gerade weder aus Holz noch aus Metall gefertigt sind.
«Ich habe mit René telefoniert», sagt die Mutter stattdessen. Sie muss sich wirklich einsam fühlen, wenn sie wieder mit ihrem Ex-Freund spricht.
«Schön», sage ich, weil ich mit dem Ex-Freund immer gut klargekommen bin. Der Ex-Freund und die Mutter sind drei Jahre zusammen gewesen. Wahrscheinlich sind sie sich zu nah gekommen, und deshalb hat das mit ihnen kaputtgehen müssen. Nach der Trennung ist der Ex-Freund wieder zurück in sein Heimatdorf gezogen, zurück in das Haus seiner Tante. Vor vielen Monaten haben wir ihn dort besucht, dreimal haben wir umsteigen müssen und den ganzen Tag in Zügen und auf Bahnhöfen verbracht. Ich denke angestrengt nach, aber an den Namen des Dorfes kann ich mich nicht mehr erinnern.
Die Mutter erzählt, dass der Ex-Freund einen Schuldirektor kennt: «Sie haben damals zusammen im Sandkasten gesessen», sagt sie. Und dieser Sandkastenkumpel leitet eine Gesamtschule, die ein paar Kilometer von dem Dorf entfernt ist, in dem der Ex-Freund nun wieder bei seiner Tante wohnt.
«Diese Schule würde dich aufnehmen», schließt die Mutter ihre Erzählung, und ich sehe, wie sie das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert, ihr schweres Herz wird jetzt vom rechten Bein getragen.
«Trotz Kaffeemaschine?», frage ich vorsichtig.
«Die haben wir nicht erwähnt. Und auch das Auto nicht.» So läuft das, wenn man erwachsen ist: Solange man nicht darüber redet, ist es nicht passiert. Die Strategie der Mutter ist nicht nur golden, sie ist klug, denn die stille Post hat garantiert nicht über drei Umstiege und Bahnhöfe hinweg von einem Lehrerzimmer zum anderen funktioniert. Und sollte das doch der Fall gewesen sein, dann hat der Sandkastenkumpel nur noch ein dahingenuscheltes «dailehreflogen» gehört, verständnislos den Kopf geschüttelt und dem Ex-Freund mit Lächeln, Handschlag und «aber selbstverständlich» auf den Lippen einen Schulplatz für mich angeboten.
«Wir ziehen also um?», frage ich weiterhin vorsichtig, weil ich damit rechne, dass irgendwann ein Haken kommen muss. Und der Haken, auf dem geschrieben steht, dass wir in die Provinz ziehen müssen – dieser Haken scheint mir zu stumpf, er bohrt sich nicht tief genug ins Fleisch hinein.
«Nicht wir. Nur du», sagt die Mutter, und da ist er also. Der Haken, an dem ich zappele und nach Luft schnappe.
«Natürlich nicht für immer», ergänzt sie schnell. «Vielleicht ein Jahr. Wenn du die zehnte Klasse abgeschlossen hast, dann haben sich auch hier die Gemüter wieder beruhigt. Ich kann nicht einfach weg, wegen der Arbeit. Du, du musst doch …»
Ich schnappe weiter nach Luft, aber da sind nur Worte. Nur die Worte der Mutter, die in mich hineinströmen.
«Es ist ja nicht so», sagt sie gerade, «als würden dir viele Türen offen stehen.»
Erst wirft sie mich in die Welt, denke ich, nun wirft sie mich weg. Für ein leichteres Herz, denke ich. Für einen begehbaren Kleiderschrank oder einen Fitnessraum. Oder was immer aus dem Zimmer, in dem ich lebe, werden wird, wenn ich nicht mehr da bin. Die Mutter hofft auf eine Reaktion von mir, das sehe ich in ihren Augen, aber mit der Hoffnung konnte ich noch nie viel anfangen, ich schaue sie nur an, die Mutter und die Hoffnung, und schweige. Schaue sie an und schweige, bis die Mutter wegguckt, bis sie sich umdreht, bis sie geht und von außen die Zimmertür schließt. Kurze Zeit später höre ich die Wohnungstür, jetzt bin ich allein. ‹Nicht so, als würden dir viele Türen offen stehen›, dröhnt es im Kopf, ‹Türen offen stehen.› Ich springe aus dem Bett und renne aus dem Zimmer. Ich reiße die Tür zum Badezimmer auf, fasse sie an den Seiten und hebe sie aus den Angeln. Es geht viel leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Die Mutter und die ganze Welt, sie werden staunen, werden darüber staunen, was ich mit Türen anstellen kann. Ich drehe mich zusammen mit der Tür um die eigene Achse, noch eine Runde und noch eine Runde, ich tanze mit ihr, bis ihr schwindelig wird, dann lasse ich sie fallen. In mir ein großes Bedauern, dass im Flur kein Laminat mehr liegt. Es wäre laut gewesen, lauter noch als eine Kaffeemaschine, die auf den Asphalt trifft. So ein Teppich ist ein Leisetreter, ist viel zu feige für Krach. Ich packe mir die Tür vom Schlafzimmer der Mutter, sie knallt auf die Badezimmertür, und ich klatsche in die Hände.
Die Küche besitzt nur einen Bambusvorhang, mit einem Ruck habe ich ihn heruntergerissen. Das leise Rascheln ist eine Enttäuschung.
So etwas wie ein Wohnzimmer gibt es hier nicht. Ich öffne die Wohnungstür. Bin überrascht, wie schwer sie ist. Trotzdem gelingt es mir, sie hoch genug zu heben, damit sich die beiden Stifte aus den Halterungen lösen. Ich muss einen Ausfallschritt nach hinten machen. Fast stürze ich über die beiden Zimmertüren. Verhindere gerade noch, dass mich die Wohnungstür unter sich begräbt. Ich gehe ein wenig in die Knie, spanne die Muskeln an, drehe mich so, dass die linke Schulter den linken Türrahmen streift, und mit zusammengebissenen Zähnen schaffe ich es, die Wohnungstür seitlich zu kippen. Drei Schritte, ich ächze leise, dann sind wir im Hausflur. Die Tür, die offen neben mir steht, und ich.
Wenn sich unten bei den Briefkästen zwei Menschen unterhalten, hallt es jedes Mal durch das ganze Treppenhaus bis nach oben in den vierten Stock. Ich höre schon die Zukunft, höre den tosenden Lärm, den es gleich geben wird, wenn ich die Wohnungstür über die Treppen hinunter ins Erdgeschoss schicke. Ich ziehe die Tür über die Hausflurfliesen, bis sie frontal vor mir steht. Einmal kurz verschnaufen, denke ich, für den letzten Akt. Ich presse die Stirn gegen die weiß lackierte Tür oder presse die weiß lackierte Tür gegen die Stirn. So oder so oder anders, so ist es doch immer, denke ich und schließe kurz die Augen.
«Was hast du jetzt schon wieder?» Die Stimme der Mutter. Erschrocken lasse ich die Tür los. Ein dumpfes Geräusch, viel leiser als die Badezimmertür, die auf den Teppich gefallen ist. Ein dumpfes Geräusch. Ich kannte es schon, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und nun die Wohnungstür und der Schädel der Mutter. Dieses dumpfe Geräusch, es explodiert in den Ohren.
Die Mutter muss über Nacht im Krankenhaus bleiben. «Zur Beobachtung», sagen die Ärzte.
«Da haben Sie richtig Glück gehabt», diagnostiziert der Krankenpfleger und stellt einen Plastikbecher mit drei bunten Pillen auf den Nachttisch. Von wegen vierblättrige Kleeblätter und Sternschnuppen. Das Glück ist eine umfallende Tür. Die Mutter und ich schauen uns an. Sie sieht gar nicht glücklich aus, nur blass auf dem weißen Kopfkissen. Und viel zu schwach, um wütend auf mich zu sein. Wenn sie nicht brüllt, dann ist es am schlimmsten. Das schlechte Gewissen hat große Hände, die gegen die oberen Rippen drücken.
Ich denke an das Video mit dem Braunbären. Der Braunbär ist unverletzt geblieben, noch nicht einmal eine Gehirnerschütterung hat er davongetragen. Das Glück ist keine umfallende Tür, will ich widersprechen. Das Glück ist ein Braunbär, der sich auf eine mehrspurige Straße legt und überlebt. Doch der Krankenpfleger ist schon längst verschwunden.
In dem Zimmer stehen zwei weitere Betten. Die Menschen in den Betten tragen geblümte Schlafanzüge und haben Besuch, der auf ihren Bettkanten sitzt. Ich stehe zwei Schritte von der Mutter entfernt. Sie trägt einen pinken Einteiler mit Kapuze und Hasenohren, der eigentlich mir gehört. Ich habe ihn schnell aus dem Schrank gezerrt und in eine Einkaufstüte gestopft. Zusammen mit einer Zahnbürste, Duschgel, Bananenchips und den Werbeprospekten aus dem Briefkasten. Weil man doch etwas zu lesen braucht im Krankenhaus.
«War ein Unfall», sage ich zum dreiundsechzigsten Mal.
«Weiß ich doch», erwidert die Mutter erschöpft.
«War ein Unfall», sage ich zum vierundsechzigsten Mal.
Diesmal schweigt die Mutter.
«Du hast schon als Kind nicht gerne gebastelt», sagt sie dann. «Immer im Zickzack mit der Schere durch das Tonpapier. Nie die aufgemalten Linien entlang.» Sie flüstert. Ich muss mich vorbeugen, um sie zu verstehen. «Und dann kommen sie uns mit Holz und Metall.»
Sie tastet auf dem Nachttisch nach ihrem Handy und hält es mir hin. Ich denke an die Telefonnummer für das Aggressionsproblem. Den Zettel habe ich gefunden, als ich auf der Suche nach der Krankenkassenkarte gewesen bin. Sauber gefaltet hat er im Portemonnaie der Mutter gesteckt.
«Die Nummer von René ist eingespeichert», sagt sie. Da sind sie wieder. Die Provinz und der Ex-Freund. «Das ist das Beste für dich.» Dann noch leiser, fast stumm: «Und für mich.»
Vier Tage danach überquere ich eine vierspurige Straße in einer fremden Stadt und ziehe einen großen Rollkoffer hinter mir her. Ich überlege kurz, ob ich mich hinlegen soll, aber ich bezweifele, dass ich so ein sonnengeküsstes Glückskind wie der Braunbär bin. Deshalb bleibe ich aufrecht und stelle mich an die Bushaltestelle, warte auf die Linie 258, die mich in ein Dorf bringen soll, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Als ich vor dem Busfahrer stehe, halte ich ihm beide Fäuste vors Gesicht. Weil ich mir den Namen des Dorfes nicht merken kann, habe ich ihn über die Fingergelenke geschrieben. Einen Buchstaben für jeden Finger, nur die Daumen blieben vom Kuli verschont. Ich habe das lustig gefunden, es sieht aus wie ein Knasttattoo. Aber der Busfahrer verzieht keine Miene, er sagt nur: «Endstation.» Und Endstation, das bringt es genau auf den Punkt.
«Neuanfang», so hat es die Mutter genannt, als sie vor drei Tagen aus dem Krankenhaus gekommen ist. Ich habe mit dem Kopf genickt und nicht widersprochen.
Weil die Mutter nun mal meine Mutter ist.
Und weil ich sie liebe, so gut ich das eben kann.
Ich suche einen Platz für mich und den großen Koffer, was nicht schwer ist, denn es sitzen kaum Menschen in diesem Bus.
Kaum Menschen und zwei Hunde.
Der Bus verlässt die Stadt, fährt die Landstraße entlang und hält an keiner einzigen Bushaltestelle. Für wen auch, draußen nur Wiesen und Kühe.
Ich ziehe eine Flasche Eistee aus dem Rucksack, höre dabei den beiden Menschen zu, die schräg vor mir sitzen. Sie käuen ihre Worte wieder wie die Kühe da draußen ihr Gras, und sie berühren vorsichtig ihre frisch frisierten Köpfe. Sie reden über Gartenhecken, über ihre eigenen und über die ihrer Nachbarn. Gartenhecken haben mich noch nie interessiert.
Aus Langeweile forme ich ein kleines Papierkügelchen aus dem Flaschenetikett und schnipse es zielsicher über die Sitzreihen, ich habe in den letzten Wochen viel Zeit zum Üben gehabt. Das Papierkügelchen trifft den Nacken des Busfahrers. «Tssss», zischen die zwei Menschen schräg vor mir, weil sie plötzlich keine Worte mehr hervorgewürgt bekommen. Sofort zeige ich mit dem Finger auf sie und frage empört: «Warum machen Sie denn so was? Papierkugeln schnipsen … Was hat Ihnen der arme Busfahrer denn getan?»
«Unverschämter Kerl», muht mich eine der beiden an. Sie sieht kurz geschnittene Haare, mehr sieht sie nicht. Ich zeige immer noch auf sie und sage zum Busfahrer, die Stimme weiterhin gefüllt mit Empörung: «Sie müssen sich von Ihren Fahrgästen wirklich nicht beleidigen lassen.»
Doch der Busfahrer dreht sich gar nicht erst um. «Jetzt ist Ruhe dahinten!», brüllt er gegen die Frontscheibe seines Busses.
Die beiden Kühe gucken eingeschnappt auf ihre Handtaschen, die zwei Hunde verstecken sich hinter den Beinen ihrer Besitzer, und auch ich senke den Finger. Obwohl ich doch mit der Hoffnung gar nichts anfangen kann, hoffe ich, dass das Dorf nicht so klein ist, wie ich es im Gedächtnis habe. Bis zum nächsten Urknall sollte ich den Menschen und Tieren aus diesem Bus wohl besser nicht mehr über den Weg laufen.