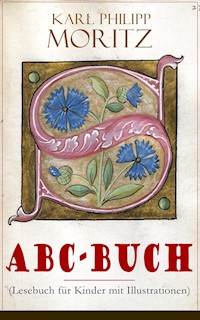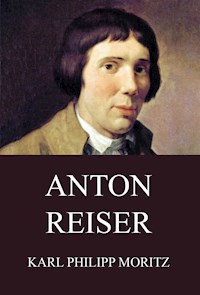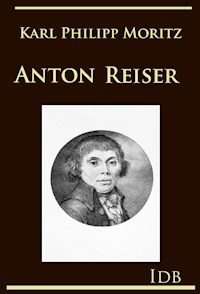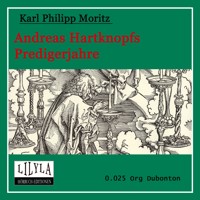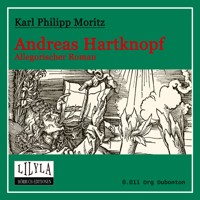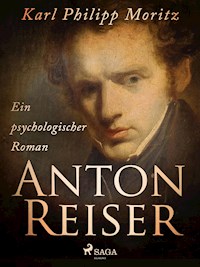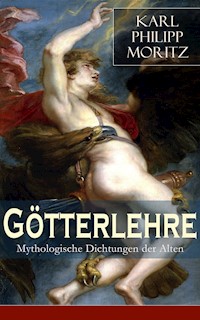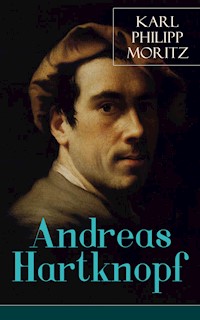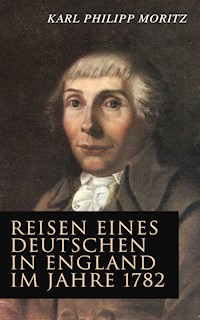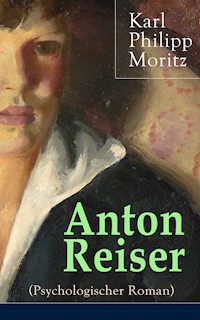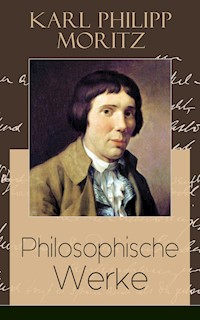5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
»Über die schönen Wissenschaften muß entweder etwas sehr gutes, oder gar nichts geschrieben werden«, erklärte Karl Philipp Moritz 1785. Und tatsächlich gelang es ihm, auf dem Gebiet der Kunstreflexion etwas Besonderes zu leisten: Noch vor Kant und Schiller begründete er die Autonomieästhetik, d. h. die Idee, dass das Schöne »ein in sich vollendetes« Ganzes sei. Seine große Programmschrift ›Über die bildende Nachahmung des Schönen‹ (1788) wurde von Goethe und Schiller rezipiert und bildet das Fundament der Weimarer Klassik. Der vorliegende Band präsentiert Moritz' wichtigste Schriften zur Ästhetik, gut kommentiert und mit einem ausführlichen Nachwort versehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Karl Philipp Moritz
Schriften zur Ästhetik
Herausgegeben von Christof Wingertszahn
Reclam
2018 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2018
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961363-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019519-2
www.reclam.de
Inhalt
Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaften1 unter dem Begriff des in sich selbst Vollendeten
An Herrn Moses Mendelssohn.2
Man hat den Grundsatz von der Nachahmung3 der Natur, als den Hauptendzwek der schönen Künste und Wissenschaften verworfen, und ihn dem Zwek des Vergnügens untergeordnet, den [226] man dafür zu dem ersten Grundgesetze der schönen Künste4 gemacht hat. Diese Künste, sagt man, haben eigentlich bloß das Vergnügen, so wie die mechanischen5 den Nutzen, zur Absicht. – Nun aber finden wir sowohl Vergnügen am Schönen, als am Nützlichen: wie unterscheidet sich also das erstre vom letztern?
Bei dem bloß Nützlichen finde ich nicht sowohl an dem Gegenstande selbst, als vielmehr an der Vorstellung von der Bequemlichkeit oder Behaglichkeit, die mir oder einem andern durch den Gebrauch desselben zuwachsen wird, Vergnügen. Ich mache mich gleichsam zum Mittelpunkte, worauf ich alle Theile des Gegenstandes beziehe, d. h. ich betrachte denselben bloß als Mittel, wovon ich selbst, in so fern meine Vollkommenheit dadurch befördert wird, der Zwek bin. Der bloß nützliche Gegenstand ist also in sich nichts Ganzes oder Vollendetes, sondern wird es erst, indem er in mir seinen Zwek erreicht, oder in mir vollendet wird. – Bei der Betrachtung des Schönen aber wälze ich den Zwek aus mir in den Gegenstand selbst zurük: ich betrachte ihn, als etwas, nicht in mir, sondern in sich selbst Vollendetes, das also in sich ein Ganzes ausmacht, und mir um sein selbst willen Vergnügen gewährt; indem ich dem schönen Gegenstande nicht sowohl eine Beziehung auf mich, als mir vielmehr eine Beziehung auf ihn gebe. Da mir nun das Schöne mehr um sein selbst willen, [227] das Nützliche aber bloß um meinetwillen, lieb ist; so gewähret mir das Schöne ein höheres und uneigennützigeres Vergnügen, als das bloß Nützliche. Das Vergnügen an dem bloß Nützlichen ist gröber und gemeiner, das Vergnügen an dem Schönen feiner und seltner. Jenes haben wir, in gewissem Verstande, mit den Thieren gemein; dieses erhebt uns über sie.
Da das Nützliche seinen Zwek nicht in sich, sondern außer sich in etwas anderm hat, dessen Vollkommenheit dadurch vermehrt werden soll; so muß derjenige, welcher etwas Nützliches hervorbringen will, diesen äußern Zwek bei seinem Werke beständig vor Augen haben. Und wenn das Werk nur seinen äußern Zwek erreicht, so mag es übrigens in sich beschaffen sein, wie es wolle; dies kömmt, in so fern es bloß nützlich ist, gar nicht in Betracht. Wenn eine Uhr nur richtig ihre Stunden zeigt, und ein Messer nur gut schneidet; so bekümmre ich mich, in Ansehung des eigentlichen Nutzens, weder um die Kostbarkeit des Gehäuses an der Uhr, noch des Griffes an dem Messer: auch achte ich nicht darauf, ob mir selbst das Werk in der Uhr, oder die Klinge an dem Messer, gut ins Auge fällt oder nicht. Die Uhr und das Messer haben ihren Zwek außer sich, in demjenigen, welcher sich derselben zu seiner Bequemlichkeit bedienet; sie sind daher nichts in sich Vollendetes, und haben an und für sich, ohne die mögliche oder [228] wirkliche Erreichung ihres äußern Zweks, keinen eigenthümlichen Werth. Mit diesem ihren äußern Zwek zusammengenommen als ein Ganzes betrachtet, machen sie mir erst Vergnügen; von diesem Zwek abgeschnitten, lassen sie mich völlig gleichgültig. Ich betrachte die Uhr und das Messer nur mit Vergnügen, in so ferne ich sie brauchen kann, und brauche sie nicht, damit ich sie betrachten kann.
Bei dem Schönen ist es umgekehrt. Dieses hat seinen Zwek nicht außer sich, und ist nicht wegen der Vollkommenheit von etwas anderm, sondern wegen seiner eignen innern Vollkommenheit da. Man betrachtet es nicht, in so fern man es brauchen kann, sondern man braucht es nur, in so fern man es betrachten kann. Wir bedürfen des Schönen nicht so sehr, um dadurch ergötzt zu werden, als das Schöne unsrer bedarf, um erkannt zu werden. Wir können sehr gut ohne die Betrachtung schöner Kunstwerke bestehen, diese aber können, als solche, nicht wohl ohne unsre Betrachtung bestehen. Jemehr wir sie also entbehren können, desto mehr betrachten wir sie um ihrer selbst willen, um ihnen durch unsre Betrachtung gleichsam erst ihr wahres volles Dasein zu geben. Denn durch unsre zunehmende Anerkennung des Schönen in einem schönen Kunstwerke, vergrößern wir gleichsam seine Schönheit selber, und legen immer mehr Werth hinein. Daher das ungeduldige Verlangen, daß alles dem Schönen huldigen [229] soll, welches wir einmal dafür erkannt haben: je allgemeiner es als schön erkannt und bewundert wird, desto mehr Werth erhält es auch in unsern Augen. Daher das Mißvergnügen bei einem leeren Schauspielhause, wenn auch die Vorstellung noch so vortreflich ist. Empfänden wir das Vergnügen an dem Schönen mehr um unsert- als um sein selbst willen, was würde uns daran liegen, ob es von irgend jemand außer uns erkannt würde? Wir verwenden, wir beeifern uns für das Schöne, um ihm Bewundrer zu verschaffen, wir mögen es antreffen, wo wir wollen: ja wir empfinden sogar eine Art von Mitleid beim Anblik eines schönen Kunstwerks, das in den Staub darniedergetreten, von den Vorübergehenden mit gleichgültigem Blik betrachtet wird. – Auch das süße Staunen, das angenehme Vergessen unsrer selbstbei Betrachtung eines schönen Kunstwerks, ist ein Beweis, daß unser Vergnügen hier etwas untergeordnetes ist, das wir freiwillig erst durch das Schöne bestimmt werden lassen, welchem wir eine Zeitlang eine Art von Obergewalt über alle unsre Empfindungen einräumen. Während das Schöne unsre Betrachtung ganz auf sich zieht, zieht es sie eine Weile von uns selber ab, und macht, daß wir uns in dem schönen Gegenstande zu verlieren scheinen; und eben dies Verlieren, dies Vergessen unsrer selbst, ist der höchste Grad des reinen und uneigennützigen Vergnügens, welches uns das Schöne [230] gewährt. Wir opfern in dem Augenblik unser individuelles eingeschränktes Dasein einer Art von höherem Dasein auf. Das Vergnügen am Schönen muß sich daher immer mehr der uneigennützigen Liebe6 nähern, wenn es ächt sein soll. Jede specielle Beziehung auf mich in einem schönen Kunstwerke giebt dem Vergnügen, das ich daran empfinde, einen Zusatz, der für einen andern verlohren geht; das Schöne in dem Kunstwerke ist für mich nicht eher rein und unvermischt, bis ich die specielle Beziehung auf mich ganz davon hinwegdenke, und es als etwas betrachte, das bloß um sein selbst willen hervorgebracht ist, damit es etwas in sich Vollendetes sei. – So wie nun aber die Liebe und das Wohlwollen dem edeln Menschenfreunde gewissermaßen zum Bedürfniß werden können, ohne daß er deswegen eigennützig werde; so kann auch dem Mann von Geschmak das Vergnügen am Schönen, durch die Gewöhnung dazu, zum Bedürfniß werden, ohne deswegen seine ursprüngliche Reinheit zu verlieren. Wir bedürfen des Schönen bloß, weil wir Gelegenheit zu haben wünschen, ihm durch Anerkennung seiner Schönheit zu huldigen.
Ein Ding kann also nicht deswegen schön sein, weil es uns Vergnügen macht, sonst müßte auch alles Nützliche schön sein; sondern was uns Vergnügen macht, ohne eigentlich zu nützen, nennen wir schön. Nun kann aber das Unnütze oder Un-[231]zwekmäßige unmöglich einem vernünftigen Wesen Vergnügen machen. Wo also bei einem Gegenstande ein äußerer Nutzen oder Zwek fehlt, da muß dieser in dem Gegenstande selbst gesucht werden, sobald derselbe mir Vergnügen erwekken soll; oder: ich muß in den einzelnen Theilen desselben so viel Zwekmäßigkeit finden, daß ich vergesse zu fragen, wozu nun eigentlich das Ganze soll? Das heißt mit andern Worten: ich muß an einem schönen Gegenstande nur um sein selbst willen Vergnügen finden; zu dem Ende muß der Mangel der äußern Zwekmäßigkeit durch seine innere Zwekmäßigkeit ersetzt sein; der Gegenstand muß etwas in sich selbst Vollendetes sein.
Ist nun die innere Zwekmäßigkeit in einem schönen Kunstwerke nicht groß genug, um mich die äußere darüber vergessen zu lassen; so frage ich natürlicher Weise: wozu das Ganze? Antwortet mir der Künstler: um dir Vergnügen zu machen; so frage ich ihn weiter: was hast du für einen Grund, mir durch dein Kunstwerk eher Vergnügen als Mißvergnügen zu erwekken? Ist dir an meinem Vergnügen so viel gelegen, daß du dein Werk mit Bewußtsein unvollkommner machen würdest, als es ist, damit es nur nach meinem vielleicht verdorbnem Geschmak wäre; oder ist dir nicht vielmehr an deinem Werke so viel gelegen, daß du mein Vergnügen zu demselben hinaufzustimmen suchen wirst, damit seine Schönheiten von mir empfunden [232] werden? Ist das letztere, so sehe ich nicht ab, wie mein zufälliges Vergnügen der Zwek von deinem Werke sein könnte, da dasselbe durch dein Werk selbst erst in mir erwekt und bestimmt werden mußte. Nur in so fern du weißt, daß ich mich gewöhnt habe, an dem, was wirklich in sich vollkommen ist, Vergnügen zu empfinden, ist dir mein Vergnügen lieb; dies würde aber nicht so sehr bei dir in Betracht kommen, wenn es dir bloß um mein Vergnügen, und nicht vielmehr darum zu thun wäre, daß die Vollkommenheit deines Werks durch den Antheil, den ich daran nehme, bestätiget werden soll. Wenn das Vergnügen nicht ein so sehr untergeordneter Zwek, oder vielmehr nur eine natürliche Folge bei den Werken der schönen Künste wäre; warum würde der ächte Künstler es denn nicht auf so viele als möglich zu verbreiten suchen, statt daß er oft die angenehmen Empfindungen von vielen Tausenden, die für seine Schönheiten keinen Sinn haben, der Vollkommenheit seines Werks aufopfert? – Sagt der Künstler: aber wenn mein Werk gefällt oder Vergnügen erwekt, so habe ich doch meinen Zwek erreicht; so antworte ich: umgekehrt! weil du deinen Zwek erreicht hast, so gefällt dein Werk, oder daß dein Werk gefällt, kann vielleicht ein Zeichen sein, daß du deinen Zwek in dem Werke selbst erreicht hast. War aber der eigentliche Zwek bei deinem Werke mehr das Vergnügen, das du [233] dadurch bewürken wolltest, als die Vollkommenheit des Werks in sich selber; so wird mir eben dadurch der Beifall schon sehr verdächtig, den dein Werk bei diesem oder jenem erhalten hat.
»Aber ich strebe nur den Edelsten zu gefallen.« – Wohl! aber dies ist nicht dein letzter Zwek; denn ich darf noch fragen: warum strebst du gerade den Edelsten zu gefallen? Doch wohl, weil diese sich gewöhnt haben, an dem Vollkommensten das größte Vergnügen zu empfinden? Du beziehst ihr Vergnügen auf dein Werk zurük, dessen Vollkommenheit du dadurch willst bestätiget sehen. Muntre dich immer durch den Gedanken an den Beifall der Edlen zu deinem Werke auf; aber mache ihn selber nicht zu deinem letzten und höchsten Ziele, sonst wirst du ihn am ersten verfehlen. Auch der schönste Beifall will nicht erjagt, sondern nur auf dem Wege mitgenommen sein. Die Vollkommenheit deines Werks fülle während der Arbeit deine ganze Seele, und stelle selbst den süßesten Gedanken des Ruhms in Schatten, daß dieser nur zuweilen hervortrete, dich aufs neue zu beleben, wenn dein Geist anfängt, laß7 zu werden; dann wirst du ungesucht erhalten, wornach8 Tausende sich vergeblich bemühen. Ist aber die Vorstellung des Beifalls dein Hauptgedanke, und ist dir dein Werk nur in so fern werth, als es dir Ruhm verschaft; so thu Verzicht auf den Beifall der Edlen. Du arbeitest nach einer eigennützigen Richtung: [234] der Brennpunkt des Werks wird außer dem Werke fallen, du bringst es nicht um sein selbst willen, und also auch nichts Ganzes, in sich Vollendetes, hervor. Du wirst falschen Schimmer suchen, der vielleicht eine Zeitlang das Auge des Pöbels blendet, aber vor dem Blik des Weisen wie Nebel verschwindet.
Der wahre Künstler wird die höchste innere Zwekmäßigkeit oder Vollkommenheit in sein Werk zu bringen suchen; und wenn es dann Beifall findet, wird’s ihn freuen, aber seinen eigentlichen Zwek hat er schon mit der Vollendung des Werks erreicht. So wie der wahre Weise die höchste mit dem Lauf der Dinge harmonische Zwekmäßigkeit in alle seine Handlungen zu bringen sucht; und die reinste Glükseligkeit,9 oder den fortdaurenden Zustand angenehmer Empfindungen, als eine sichre Folge davon, aber nicht als das Ziel derselben betrachtet. Denn auch die reinste Glükseligkeit will nur auf dem Wege zur Vollkommenheit mitgenommen, und nicht erjagt sein. Die Glükseligkeitslinie läuft mit der Vollkommenheitslinie10 nur parallel; sobald jene zum Ziele gemacht wird, muß die Vollkommenheitslinie lauter schiefe Richtungen bekommen. Die einzelnen Handlungen, in so fern sie bloß zu einem Zustande angenehmer Empfindungen abzwekken, bekommen zwar eine anscheinende Zwekmäßigkeit; aber sie machen zusammen kein übereinstimmendes harmonisches Ganze [235] aus. Eben so ist es auch in den schönen Künsten, wenn der Begriff der Vollkommenheit oder des in sich selbst Vollendeten dem Begriff vom Vergnügen untergeordnet wird.
»Also ist das Vergnügen gar nicht Zwek?« – Ich antworte: was ist Vergnügen anders, oder woraus entsteht es anders, als aus dem Anschauen der Zwekmäßigkeit? Gäbe es nun etwas, wovon das Vergnügen selbst allein der Zwek wäre; so könnte ich die Zwekmäßigkeit jenes Dinges bloß aus dem Vergnügen beurtheilen, welches mir daraus erwächst. Mein Vergnügen selbst aber muß ja erst aus dieser Beurtheilung entstehen; es müßte also da sein, ehe es da wäre. Auch muß ja der Zwek immer etwas Einfacheres als die Mittel sein, welche zu demselben abzwekken: nun ist aber das Vergnügen an einem schönen Kunstwerke eben so zusammengesetzt, als das Kunstwerk selber, wie kann ich es denn als etwas Einfacheres betrachten, worauf die einzelnen Theile des Kunstwerks abzwekken sollen? Eben so wenig wie die Darstellung eines Gemäldes in einem Spiegel der Zwek seiner Zusammensetzung sein kann; denn diese wird allemal von selbst erfolgen, ohne daß ich bei der Arbeit die mindeste Rüksicht darauf zu nehmen brauche. Stellt nun ein angelaufner Spiegel mein Kunstwerk desto unvollkommner dar, je vollkommner es ist; so werde ich es doch wohl nicht deswegen unvollkommner machen, damit weniger Schön-[236]heiten in dem angelaufenen Spiegel verlohren gehen? –
Über die bildende Nachahmung des Schönen
[3] Wenn der griechische Schauspieler, in der Komödie des Aristophanes11 dem Sokrates auf dem Schauplatze,12 und der Weise ihm im Leben nachahmt:13 so ist das Nachahmen von beiden so sehr verschieden, daß es nicht wohl mehr unter einer und eben derselben Benennung begriffen werden kann: wir sagen daher der Schauspieler parodierte den Sokrates, und der Weise ahmt ihm nach.
Dem Schauspieler war es freilich nicht darum zu thun, dem Sokrates im Ernst nachzuahmen, sondern vielmehr nur, das Eigenthümliche desselben, oder seine Individualität in Gang, Miene, Stellung und Gebehrden, auf eine gewisse übertriebne Art, wodurch sie bei dem Zuschauer lächerlich werden sollte, nachzubilden. Weil dieß nun der Schauspieler mit Bewußtseyn, und gleichsam im Scherz that, so sagen wir: er parodierte den Sokrates.
[4] Wäre aber der Schauspieler, den wir hier vor uns sehen, nicht Schauspieler, sondern irgend einer aus dem Volke, der dem Sokrates, welchem er sich innerlich schon ähnlich dünckte, nun auch im Äussern, in Gang, Stellung und Gebehrden, im Ernst nachzuahmen suchte; so würden wir von diesem Thoren sagen: er äfft dem Sokrates nach; oder, er verhält sich zum Sokrates ohngefähr so, wie der Affe, in seinen possierlichen Stellungen und Gebehrden, sich zum Menschen verhält.
Der Schauspieler also schließt den Weisen aus, und parodiert nur den Sokrates; denn die Weisheit läßt sich nicht parodieren: der Weise schließt in seiner Nachahmung den Sokrates aus, und ahmt in ihm nur den Weisen nach; denn die Individualität des Sokrates kann wohl parodiert und nachgeäfft, aber nie nachgeahmt werden. Der Thor hat keinen Sinn für die Weisheit und hat doch Nachahmungstrieb: er ergreift also, was ihm am nächsten liegt; äfft nach, um nicht nachahmen zu dürfen;14 trägt die ganze Oberfläche einer fremden Individualität auf die seinige über,15 und die Basis oder das Selbstgefühl dazu legt ihm seine Thorheit unter.
Wir sehen also aus dem Sprachgebrauch, daß Nachahmen, im edlern moralischen Sinn, mit den Begriffen von nachstreben und wetteifern fast gleichbedeutend wird; weil die Tugend, welche ich z. B. in einem gewissen Vorbilde nachahme, etwas Allgemeines, über die Individualität Erhabnes ist, das von jeder-[5]mann, der darnach strebt, und also auch von mir sowohl, als von meinem Vorbilde, mit dem ich zu wetteifern suche, erreicht werden kann. Weil ich aber diesem Vorbilde doch einmal nachstehe, und ein gewisser Grad von edler Gesinnung und Handlungsweise mir ohne dasselbe vielleicht nicht so bald, oder gar nie denkbar geworden wäre: so nenne ich mein Streben nach einem gemeinschaftlichen Gute, das auch von meinem Vorbilde erst mußte errungen werden, eine Nachahmung dieses Vorbildes.
Ich ahme meinem Vorbilde nach; ich strebe ihm nach; ich suche mit ihm zu wetteifern. – Durch mein Vorbild ist mir bloß das Ziel höher, als von mir selbst, hinaufgesteckt. Nach diesem Ziele muß ich nun, nach meinen Kräften, auf meine Weise, streben; zuletzt mein Vorbild selbst vergessen, und suchen, wenn es möglich wäre, das Ziel noch weiter hinaus zu stecken.
Durch diese Gesinnung muß das Nachahmen im edlern moralischen Sinn erst seinen eigentlichen Werth erhalten. – Und es frägt sich nun: wie von diesem Nachahmen im moralischen Sinn, das Nachahmen in den schönen Künsten, oder von der Nachahmung des Guten und Edlen, die Nachahmung des Schönen unterschieden sey? –
Diese Frage muß sich alsdann von selbst beantworten, wenn wir die Begriffe von Schön und Gut, wiederum nach dem Sprachgebrauch, gehörig unterscheiden: denn daß dieser sie oft verwechselt, darf uns [6] hier nicht kümmern, wo es beym Nachdenken über die Sache bloß aufs Unterscheiden ankömmt; und nothwendig, so wie auf dem Globus, gewisse feste Grenzlinien, die in der Natur selbst nicht Statt finden, gezogen werden müssen, wenn die Begriffe sich nicht wiederum eben so, wie ihre Gegenstände, unmerklich in einander verlieren und verschwimmen sollen: ein getreuerer Abdruck der Natur können sie in diesem letztern Falle seyn, aber das eigentliche Denken, welches nun einmal im Unterscheiden besteht, hört auf.
Nun schließt sich aber im Sprachgebrauch das Gute und Nützliche, so wie das Edle und Schöne, natürlich aneinander; und diese vier verschiednen Ausdrücke bezeichnen eine so feine Abstufung der Begriffe, und bilden ein so zartes Ideenspiel,16 daß es dem Nachdenken schwer werden muß, das immer ineinander sich unmerklich wieder Verlierende gehörig auseinander zu halten, und es einzeln und abgesondert zu betrachten. So viel fällt demohngeachtet deutlich in die Augen, daß das bloß Nützliche dem Schönen und Edlen, mehr als das Gute, entgegenstehe; weil durch das Gute vom bloß Nützlichen zum Schönen und Edlen schon der Übergang gemacht wird.
Wir denken uns z. B. unter einem nützlichen Menschen einen solchen, der nicht sowohl an und für sich selbst, als vielmehr nur in Beziehung auf irgend einen Zusammenhang von Dingen ausser ihm, unsre Aufmerksamkeit verdienet: der gute Mensch hingegen fängt schon an und für sich selbst betrachtet, an, un-[7]sre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und unsre Liebe zu gewinnen; in so fern wir uns nehmlich denken, daß er, seinem innern Fond17 von Güte nach, uns nie durch Eigennutz und Selbstsucht schaden, in den Zusammenhang von Dingen, worinn wir uns befinden, nicht leicht disharmonisch eingreifen, kurz, unsern Frieden nicht stören wird. – Der edle Mensch aber, zieht, für sich ganz allein, unsre ganze Aufmerksamkeit und Bewundrung auf sich; ohne alle Rücksicht auf irgend etwas ausser ihm, oder auf irgend einen Vortheil, der uns für unsre eigne Person aus seinem Daseyn erwachsen könnte.
Und weil nun der edle Mensch, um edel zu seyn, der körperlichen Schönheit nicht bedarf, so scheiden sich hier wiederum die Begriffe von Schön und Edel, indem durch das letztre die innre Seelenschönheit, im Gegensatz gegen die Schönheit auf der Oberfläche, bezeichnet wird. In so fern nun aber die äussre Schönheit zugleich mit ein Abdruck der innern Seelenschönheit ist, faßt sie auch das Edle in sich, und sollte es, ihrer Natur nach, eigentlich stets in sich fassen. Hiedurch hebt sich aber demohngeachtet der Unterschied zwischen schön und edel nicht wieder auf. Denn unter einer edlen Stellung denken wir uns z. B. eine solche, die zugleich eine gewisse innere Seelenwürde bezeichnet: irgend eine leidenschaftliche Stellung aber kann demohngeachtet immer noch eine schöne Stellung seyn, wenn gleich nicht eine solche innere Seelenwür-[8]de ausdrücklich dadurch bezeichnet wird; nur darf sie einem gewissen Grade von innerer Würde nie geradezu widersprechen; sie darf nie unedel seyn.
Hieraus erklärt sich nun zugleich beiläufig der Begriff vom edlen Stil in Kunstwerken jeder Art, welcher kein andrer ist, als derjenige, der zugleich mit eine innre Seelenwürde des hervorbringenden Genies bezeichnet. Ob nun gleich dieser edle Stil die andern untergeordneten Arten des Schönen nicht vom Gebiet des Schönen ausschließt, so schneidet er doch alles, was ihm geradezu entgegensteht, davon ab; er schließt das Unedle aus.
In so fern nun unter dem Edlen, im Gegensatz gegen das äussre Schöne, bloß die innre Seelenschönheit verstanden wird, können wir es auch, so wie das Gute, in uns selbst nachbilden. – Das Schöne aber, in so fern es sich dadurch vom Edlen unterscheidet, daß, im Gegensatz gegen das Innre, bloß das äussre Schöne darunter verstanden wird, kann durch die Nachahmung nicht in uns herein, sondern muß, wenn es von uns nachgeahmt werden soll, nothwendig wieder aus uns herausgebildet werden.
Der bildende Künstler kann z. B. die innre Seelenschönheit eines Mannes, den er sich in seinem Wandel zum Vorbilde nimmt, ihm nachahmend in sich übertragen. Wenn aber eben dieser Künstler sich gedrungen fühlte, die innre Seelenschönheit seines Vorbildes, in so fern sie sich in dessen Gesichtszügen abdrückt, nachzuahmen: so müsste er seinen Begriff da-[9]von nothwendig aus sich herauszubilden und ausser sich darzustellen suchen; indem er nehmlich diese Gesichtszüge nicht geradezu nachbildete, sondern sie gleichsam nur zu Hülfe nähme, um die in sich empfundne Seelenschönheit eines fremden Wesens auch ausser sich wieder darzustellen.
Die eigentliche Nachahmung des Schönen unterscheidet sich also zuerst von der moralischen Nachahmung des Guten und Edlen dadurch, daß sie, ihrer Natur nach, streben muß, nicht, wie diese, in sich hinein, sondern aus sich heraus zu bilden.
Wenden wir nun die Begriffe von Gut, Schön und Edel wiederum auf den Begriff von Handlung an; so denken wir uns unter einer guten Handlung eine solche, die nicht allein um ihrer Folgen, sondern zugleich um ihrer Beweggründe willen, unsre Aufmerksamkeit erregen, und unsern Beifall verdienen kann: bei der Schätzung einer edlen Handlung vergessen wir ganz die Folge, und sie scheinet uns allein schon um ihrer Beweggründe, das ist, um ihrer selbst willen, unsrer Bewundrung werth. Betrachten wir nun eine solche Handlung nach ihrer Oberfläche, von der sie einen sanften Schein in unsre Seele wirft, oder nach der angenehmen Empfindung, die ihre blosse Betrachtung in uns erweckt; so nennen wir sie eine schöne Handlung: wollen wir aber ihren innern Werth ausdrücken, so nennen wir sie edel. Jede schöne Handlung aber muß nothwendig auch edel seyn: das Edle ist bei ihr die Basis oder der Fond des Schönen, durch [10] welches sie in unser Auge leuchtet. Durch den Mittelbegriff des Edeln also wird der Begriff des Schönen wieder zum Moralischen hinübergezogen und gleichsam daran festgekettet. Wenigstens werden dem Schönen dadurch die Grenzen vorgeschrieben, die es nicht überschreiten darf.
Da wir nun einmal genöthigt sind, uns den Begriff von der Nachahmung des eigentlichen Schönen, den wir nicht haben, aus dem Begriff von der moralischen Nachahmung des Guten und Edlen, den wir haben, zu entwickeln; und, da wir uns die eigentliche Nachahmung des Schönen, ausser dem Genuß der Werke selbst, die dadurch entstanden sind, gar nicht anders denken können, als in so fern sie sich von der bloß moralischen Nachahmung des Guten und Edlen unterscheidet: so müssen wir nun schon die Begriffe von nützlich, gut, schön, und edel, noch weiter in ihre feinern Abstufungen zu verfolgen suchen.
Dadurch also, daß z. B. die That des Mutius Scaevola18 erwünschte Folgen hatte, wurde sie nicht im geringsten edler, als sie war; und würde auch, ohne den Erfolg, von ihrem innern Werth nichts verlohren haben: sie brauchte nicht nützlich zu seyn, um edel zu seyn; bedurfte des Erfolges nicht, eben weil sie ihren innern Werth in sich selber hatte: und wodurch anders hatte sie diesen Werth, als durch sich selbst, durch ihr Daseyn?
Das Edle und Grosse der Handlung lag ja eben darinn, daß der junge Held, auf jeden Erfolg gefaßt, [11] das alleräusserste wagte, und, da es ihm mißlang, ohne Bedenken seine Hand in die lodernde Flamme streckte, ohne noch zu wissen, was sein Feind, in dessen Gewalt er war, über ihn verhängen würde. – So kann nur der handeln, welcher eine grosse That, deren Erfolg so äusserst ungewiß ist, um dieser That selbst willen unternimmt, wovon allein schon das grosse Bewußtseyn ihn für jeden mißlungnen Versuch schadlos hält.
Wäre Mutius, unter andern Umständen, bloß das Werkzeug eines Andern, dem er aus Pflicht gehorchte, zu einer ähnlichen That gewesen, und hätte sie, mit Beistimmung seines Herzens, vortreflich, und so wie er sollte, ausgeführt: so hätte er zwar noch nicht edel, aber gut gehandelt: denn obgleich seine Handlung auch schon vielen Werth in sich selber hat, so wird doch immer ihre Güte zugleich mit durch den Erfolg bestimmt.
Hätte aber eben dieser Mutius den Angriff auf den Feind seines Vaterlandes, meuchelmörderischer Weise, aus Privatrache und persönlichem Haß gethan, und sie wäre ihm nicht mißlungen: so hätte sie seinem Vaterlande, ohne gut und edel zu seyn, dennoch genützt, und hätte, ohne den mindesten innern Werth zu haben, dennoch durch den Erfolg, eine Art von äussrem Werth erhalten.
Wie nun das Gute zum Edlen, eben so muß das Schlechte zum Unedlen sich verhalten: das Unedle ist der Anfang des Schlechten, so wie das Gute der An-[12]fang des Schönen und Edlen ist; und so wie eine bloß gute, noch keine edle, so ist eine bloß unedle deswegen noch keine schlechte Handlung. Und wie das Nützliche zum Guten, eben so verhält wiederum das Unnütze sich zum Schlechten; das Schlechte ist gleichsam der Anfang des Unnützen, so wie das Nützliche schon der Anfang des Guten ist. Wie das bloß Nützliche deswegen noch nicht gut ist, so ist auch das bloß Schlechte deswegen noch nicht unnütz.
Nun steigen die Begriffe von unedel, schlecht, und unnütz, eben so herab, wie die Begriffe von nützlich, gut, und schön heraufsteigen. Von den heraufsteigenden Begriffen steht das Edle und Schöne <auf der höchsten, so wie von den herabsteigenden das Unnütze> auf der niedrigsten Stufe. Von allen diesen Begriffen nun, stehen der vom Schönen, und der vom Unnützen am weitesten voneinander ab, und scheinen sich am stärksten entgegengesetzt zu seyn; da wir doch vorher gesehen haben, daß das Schöne und Edle sich eben dadurch vom Guten unterscheidet, daß es nicht nützlich seyn darf, um schön zu seyn, und also der Begriff vom Schönen mit dem Begriff vom Unnützen oder nicht Nützlichen sehr wohl müßte zusammen bestehen können.
Hier zeigt es sich nun, wie ein Zirkel von Begriffen zuletzt sich wieder in sich selbst verliert, indem seine beiden äussersten Enden gerade da wieder zusammenstossen, wo, wenn sie nicht zusammenstiessen, von einem zum andern der weiteste Weg seyn würde.
[13] Der Begriff vom Unnützen nehmlich, in so fern es gar keinen Zweck, keine Absicht ausser sich hat, warum es da ist, schließt sich am willigsten und nächsten an den Begriff des Schönen an, in so fern dasselbe auch keines Endzwecks,19 keiner Absicht, warum es da ist, ausser sich bedarf, sondern seinen ganzen Werth, und den Endzweck seines Daseyns in sich selber hat.
In so fern aber nun das Unnütze nicht zugleich auch schön ist, fällt es auf einmal wieder am allerweitesten vom Begriff des Schönen bis unter das Schlechte hinab, weil es nun weder in sich noch ausser sich, eine Absicht hat, warum es da ist, und sich also gleichsam selbst aufhebt. Ist aber das Unnütze, oder dasjenige, was ausser sich keinen Endzweck seines Daseyns hat, zugleich auch schön, so steigt es plötzlich auf die höchste Stufe der Begriffe bis über das Nützliche und Gute empor, indem es eben deswegen keines Endzwecks ausser sich bedarf, weil es in sich so vollkommen ist, daß es den ganzen Endzweck seines Daseyns in sich selbst hat.