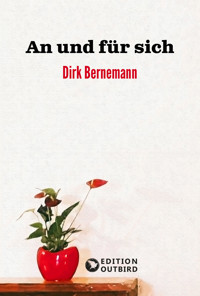6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gunnar Bäumer hat vor sieben Jahren mit Ende Zwanzig die Provinz verlassen, um nach Berlin zu ziehen. Jetzt kehrt er für eine Woche in sein Elternhaus zurück, um »das Haus zu hüten«. In diesen Tagen findet auch das alljährliche Schützenfest statt, dem er sich eigentlich verweigern wollte, um zur Ruhe zu kommen. Doch dem Fest entkommt er nicht und muss sich innerhalb der nächsten Tage dem Dorfleben, seinen Lebenskonzepten und seiner Vergangenheit stellen, vor allem auch seiner Jugendliebe Franziska mit deren Ehemann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Willkommen auf dem Dörrfelder Schützenfest. Es ist klein, bunt und nervenaufreibend. Gunnar Bäumer ist kurzzeitig zurück in seinem Heimatdorf, nachdem er vor einigen Jahren abrupt jeden Kontakt zu seinen Wurzeln gekappt hat und nach Berlin gezogen ist. Doch so richtig weit hat er es dort auch nicht geschafft. Jetzt soll er für eine Woche das Haus seiner Eltern hüten. Ausgerechnet in diesen Tagen findet in Dörrfeld das dreitägige Schützenfest statt, in das er wider Willen hineingezogen wird. Zwischen Bierzeltromantik, Marschmusik, Fische füttern und allerhand unliebsamen Begegnungen muss er sich seiner Jugendliebe Franziska stellen, die mit Mann und Kind eine Vorzeigeehe zu führen scheint. Je näher das Fest seinem Höhepunkt entgegensteuert, desto mehr eskaliert es in Gunnar, offene Wunden und Konflikte kommen zum Vorschein. So sehr er seine Wurzeln auch loswerden will, er entkommt ihnen nicht. Die Tage werden zu einer Achterbahnfahrt durch die Landschaft der unaufgeräumten Reste.
Schützenfest ist im weitesten Sinne ein Heimatroman aus der westfälischen Provinz. Dirk Bernemann legt den Finger tief in die deutsche Seele - das liest sich mitunter sehr witzig, doch das Lachen wird dem Leser rasch im Halse hängenbleiben
Der Autor
Dirk Bernemann, geboren 1975 im westlichen Münsterland ist Schriftsteller und Journalist. Seit 2005 schreibt er Romane und Kurzgeschichten, darunter den Bestseller Ich hab die Unschuld kotzen sehen. Derzeit sind fünfzehn Romane und Kurzgeschichtenbände von ihm erschienen, von zwei Titeln gibt es verschiedene Theaterinszenierungen. 2016 hatte sein erstes eigenes Theaterstück »Bella Noir, 2 Zigaretten Demut« Premiere in München. Außerdem moderiert er den Podcast UNTENDURCH. Dirk Bernemann lebt in Berlin.
Dirk Bernemann
Schützenfest
Roman
Wilhelm Heyne Verlag
München
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette
Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter
sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
@heyne.hardcore
Copyright © 2021 by Dirk Bernemann
Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Lektorat: Markus Naegele
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel / punchdesign, München
unter Verwendung eines Motivs von Plainpicture / Rudi Sebastian
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-27124-4V002
Donnerstag
»Ich glaube, es gibt dich gar nicht.« Anne hatte sich zur Tür gewendet. Ich stand hinter ihr im Flur und dachte über ihren Satz nach. Dieses ekelhafte Denken. Man möchte es abstellen und einfach nur den Abwasch machen, Tiere streicheln, Rolltreppen fotografieren. Es fiel mir schwer zu erfassen, ob ihr Satz klug oder dumm oder einfach nur provokant sein sollte. Ich versuchte hier auf den letzten Metern Gemeinsamkeit, meine Gedanken zu entfalten, wie eine alte Landkarte, die man anschließend nie wieder in ihre Ausgangsposition zurückfalten kann. Ich hatte etwas gesagt, woran ich mich nicht erinnere, nur dass es wie hilfloses Wimmern klang. Ich weiß, dass ich ein langsamer und ungeschickter Mensch bin, der trotzdem nicht gelassen ist. Außerdem kann ich wahrscheinlich bei niemandem die Spuren hinterlassen, zu denen meine Schuhgröße eventuell fähig wäre. Man könnte tatsächlich auf die Idee kommen, es gäbe mich nicht. Ich teilte ihr sachlich meine Analyse mit, natürlich unter Berücksichtigung meiner verdammten gesammelten Defizite. »Ich bin ungeschickt und langsam«, sagte ich. »Vielleicht liegt es daran, wo ich herkomme.« Leider war sie schon gegangen. Sie hatte meine Wohnungstür mit der Gewalt einer zärtlichen Elfe geschlossen, und trotzdem klang es so, als wäre dabei mein Genick gebrochen wie ein trockener Stock. Die Landkarte meiner Gedanken, komplett entfaltet, und trotzdem verstand Anne mich nicht. Nun ja.
Anschließend blieb ich einfach da stehen. Vielleicht zwei Minuten. Annes Duft war noch im Raum. Dann rief ich meine Eltern an, um zu klären, was zu klären war. Mein Vater meldete sich. Gespräche mit ihm dauern selten länger als eine Minute.
»Bäumer.«
»Papa, Gunnar hier.«
»Ah, Gunnar.«
»Ich bin Samstag um 8:37 Uhr da.«
»Wir holen dich.«
»Okay, danke, bis dann.«
»Bis dann.«
Ich schaute aufs Display. Dreizehn Sekunden.
Ich bin vorsichtig geworden mit meinen Wünschen. Längere Gespräche, tiefere Bindungen, am Ende irgendwas mit Glück. Und fröhlich winken vom Gipfel der Bedürfnispyramide. Mit jeder Enttäuschung werden Schwierigkeiten schwieriger. Die Fallhöhe der uneingelösten Erwartung. Daher lebe ich in meiner Wohnung ein bisschen wie ein Tier. Nah am Boden. Oder in der Ecke. Mit einer Schüssel Erdnüsse in den Händen. Wenn meine Wohnung ein Käfig in einer Zoohandlung wäre und das Licht aus einem bestimmten Winkel hereinfiele, sodass ich im Schatten säße, man könnte tatsächlich behaupten, es gäbe mich nicht. Ich wünsche mir, dass Anne mich so sehen könnte. Wie ich in der Ecke kauere, mich aus einem ungespülten Napf ernähre und mein Gesicht mit Spucke putze. Sie kommt herein, in ihrem grünen Mantel, den sie so mag, der immer etwas schwingt, wenn sie elegant geht. Anne geht immer elegant. Sie kommt also in die Zoohandlung, auf der Suche nach einem Tier. Schaut in meinen Käfig. Dann in weitere Käfige. Ihre dünnen Finger lässt sie zärtlich über die Gitterstäbe gleiten, sodass es ein ganz feines, rhythmisches Geräusch erzeugt. Frrrr. Frrrrrrrr. Frrrr. Frrrrrrr. Sie entscheidet sich für ein anderes Tier. Schön und pflegeleicht ist es, und da sie ein Auge für schöne Gegenstände hat, weiß sie auch, dass das neue Tier gut in ihr Wohnzimmer passt.
Kurz bevor sie behauptete, es gäbe mich nicht, saßen wir auf meinem niedrigen Sofa. Anne schaute mich mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid an. Ich hatte mir schon gedacht, dass es heute passieren würde. Die Stimmung war so weit runtergerockt, die good vibrations verbraucht. Anne sagte, dass ich, wenn ich bleibe, wie ich bin, für immer, immer, immer, immer allein sein werde. Sie sagte wirklich viermal »immer«. Vielleicht aus Gründen der Dramaturgie, vielleicht um mich vor mir selbst zu warnen. Dieser Satz zirkuliert in meinem Kopf, seit sie ihn ausgesprochen hat. »Wenn du bleibst, wie du bist, bleibst du für immer, immer, immer, immer allein.« Manchmal sind einzelne Sätze das Einzige, was von Menschen übrig bleibt. Der Rest verblasst, stirbt, zieht weg, heiratet andere Leute, zeugt Kinder aus dem Samen von Idioten, wird unsichtbar, ghostet alles kaputt. Das war vor ein paar Stunden. Jetzt bin ich ein haltmäuliger Akzeptierender, was soll ich auch sonst tun? Sitze da und schaue die Wand an. Ich lasse Dinge so weit kommen, wie sie kommen, und dann werde ich traurig, weil ich denke, dass es ganz normal ist, dass die Dinge so weit gekommen sind, wie sie eben gekommen sind. Ich bin wie das Dorf, aus dem ich stamme: erbarmungslos und schweigsam.
Irgendetwas ist nicht in Ordnung, das weiß ich schon länger. Aber ich unternehme nichts dagegen, weil ich nicht genau weiß, was es ist. Ich möchte jetzt mindestens zwei Tage schlafen und in einer Welt aufwachen, die mit weniger Problemen vollgestellt ist. Stattdessen kaufe ich ein Ticket für einen Nachtzug. Berlin–Dortmund–Reckfeld–Dörrfeld.
Freitag
Ich habe aufgehört, mich gegen unabänderbare Dinge zu wehren. Menschen wie Anne, Orte wie Dörrfeld. Herkunft ist immer nur Zufall. Heimat, eine Kleinigkeit mit großer Wirkung in der eigenen Biografie. Heimat, überwindbares Areal. Manche Tiere kacken in ihre Nester, andere nicht. Überstrapazierte Zitate verirren sich in meinem Kopf. »Alles hängt damit zusammen, wo man herkommt«, hat meine Geschichtslehrerin Frau Gräbe oft gesagt, wenn sie uns Schülern erklären wollte, wie man sich als Deutscher fühlen soll. Sich dem Gefühl Heimat zu nähern, war gar nicht so einfach. Sie spielte uns in abgedunkelten Klassenzimmern Befreiungen von Konzentrationslagern auf VHS-Kassetten vor. Die Gefühle wurden eindeutiger. Dass es seltsam ist, ein Deutscher zu sein. Das mitgeführte Unbehagen. Der historische Rucksack. Die potenzielle Wachsamkeit, die uns in die Sinnesorgane gepflanzt wurde, die Wachsamkeit, den Anfängen zu wehren, den Anfängen, wenn man sie erkennt, ein Ende zu bereiten. All das lag in diesen Filmen in abgedunkelten Klassenzimmern und in den Geschichtsbüchern.
Da, wo ich herkomme, gibt es keine Gefühle, nicht mal deutsche. Alles geht so seinen Gang. Vielleicht ist es ja das Deutscheste überhaupt, wenn alles seinen Gang geht, wenn alle Menschen nach außen wie freundlich polierte Teile einer betriebsamen Maschine zusammenleben. Eine Maschine, die wunderschön ist, aber keinerlei Funktion hat. Da, wo ich herkomme, werden Konflikte häufig durch abwarten und eine Mischung aus Ignoranz und Akzeptanz gelöst. Da, wo ich herkomme, ist es freundlich und leise.
Viele Jahre nach meiner Schulzeit denke ich immer noch, dass die Gegend, aus der ich stamme, eher ein perfekt arrangiertes Szenenbild für einen Heimatfilm ist als wirklich ein Ort zum Leben. Eine Art Kulisse könnte das sein, vollgestellt mit schönen Dingen und emotionsmüden Schauspielern.
Ich hatte nicht versucht, Anne von mir zu überzeugen. Ich war selbst nicht überzeugt von mir. Eher sogar unterzeugt. Es war nicht das erste Mal, dass mir so etwas passierte, nicht mal in diesem Jahr. Anne hatte flink erkannt, dass es da nichts gab, was für sie interessant war. Ich hatte sie in einer Bar kennengelernt. Meine Suff- Eloquenz traf ihre leichte sommerliche Einsamkeit. Sie führte diese typische Berliner Medienexistenz, welche sie ab und zu an abgefuckte Küsten wie diese Bar oder mein Leben spülte. Fröhlich und an den richtigen Stellen zerbrochen. Aber nicht so zerbrochen, dass da alle wichtigen sozialen Funktionen und jede emotionale Stabilität fehlten, sondern so, dass die Bruchstellen wie interessant verheilte Narben auf ihrer Persönlichkeit aussahen. Die ersten zwei Wochen fickten wir wie die Tiere. Nicht wie so niedliche, zugewandte Tiere, die an Nestbau und Nachkommenschutz interessiert wären, sondern wie welche, die sich jeden möglichen skeptischen Gedanken wegficken wollen. Weil man ja hinter dem Punkt, wo die Lust aufhört, auch immer etwas Schmerz vermutet.
Ihre Wohnung war hell und aufgeräumt. Bei Anne lebte noch ein weißer Kater namens Pjotr. Pjotr war ein freundliches Tier. Ich hatte Katzen zuvor eher als unbehagliche Mitbewohner abgespeichert. Wenn Anne und ich übereinander herfielen, sprang Pjotr meistens auf den Schrank und beobachtete uns von oben. Sein Blick ließ erst von uns ab, wenn wir lustdreckverklebt übereinander zusammenbrachen. Dann traute er sich wieder in Annes Nähe. Zu mir hielt er stets eine skeptische Distanz.
Es war so unglaublich sauber bei Anne, fast klinisch, es roch gut. Alles, was hier erledigt wurde, tat man sanft. Dazu dieser unglaublich elegant schleichende Kater. Mein eigenes Leben hatte eher einen leicht erhöhten Versiffungsgrad angenommen. Die vollgestellte kleine Bude, meine fortwährende Berliner Ziellosigkeit, die ich einfach nicht loswurde, die an mir klebte wie ein Stück Sinnlosigkeit. Anne und Pjotr waren ein Geschenk mit ihren wunderbaren Eigenschaften. Ihre Entschleunigung, die Langsamkeit des Alltags, all das entsprach mir. Es tat gut, fast fühlte ich mich wie ein sauberer Mensch. Keine Zwänge, alles schön.
Nach drei Wochen fragte sie mich, ob wir jetzt zusammen wären. Ich meinte, wenn das cool für sie wäre, wäre es das auch für mich. Eigentlich sträube ich mich vor Definitionen, gehe ihnen möglichst aus dem Weg. Unkonkret, schwammig. Aber warum nicht auch mal annehmen, was man angeboten bekommt. Ein sauberes Leben, das gut riecht.
Wir schauten koreanische Arthouse-Filme und bestellten Sushi, die uns abgehetzte Lieferando-Männer auf niedlichen Rollern brachten. Aufgehoben in dieser Oase der Sauberkeit ließ sich mein Restleben ertragen. Aber letztendlich wirkte die Begegnung wie ein Irrtum. Denn schon bald begann die Skepsis, wahrscheinlich ihre Skepsis, begünstigt durch meine Skepsis.
Anne trug eine dieser Handyketten, an der ihr Mobiltelefon wie eine Handtasche baumelte. Ihr Telefon war immer dabei, Anne beruflich und privat immer und für jeden verfügbar. Das fiel mir aber erst nach einiger Zeit auf, als wir die erste große Hormonwelle in ihre sauberen Laken getanzt hatten. Ich meinte, und wollte es wie eine Nebenbeibemerkung klingen lassen, dass diese Handyketten ja die ultimative Kapitulation vor der Fähigkeit des Sicheinlassens auf das jeweilige Gegenüber wären. Der totale Intimitätszerstörer. Anne lachte und sagte, ich wäre ein alter Mann, der einfach gute Innovationen, ob nun modisch oder sozialpolitisch, nicht zu schätzen wüsste. Ich antwortete, dass ich das schon einzuschätzen wüsste, weil all ihre angebrochene Kommunikation und ihr ganzes Telefonbuch mit am Tisch oder im Bett oder im Café sitzen würde, und die persönliche Tiefe, die zumindest ich anstrebte, nie entstehen könnte, wenn ich sie ewig mit der kompletten Weite des Internets teilen müsste. Anne lachte. »Idiot«, sagte sie in ihrer unsterblich niedlichen Art.
Mir fiel ein, dass sie sich während der drei Monate, die wir miteinander verbracht hatten, nie merken konnte, wie ich meinen Kaffee trinke. Und ich trinke ihn schwarz. Ich fühlte mich daraufhin wie ein unsichtbarer Mensch. Ein unliebsamer Einzelfall, Separatist der Liebe. Wie einer, den uninteressante Menschen nicht sehr interessant finden. Aber ich dachte die ganze Zeit, das wird schon werden. Zeitvergehen wird die Unebenheiten reduzieren. Dinge, die man eben denkt, wenn man Hoffnung hat. Der Schmerz von gestern führt zu einer seltsamen Leere.
Ich weiß, man sollte Menschen nicht in Löcher stecken, die aus dem eigenen Elend, zuweilen sogar dem eigenen Versagen heraus, entstanden sind. Niemand kann sie stopfen, auch wenn es einem so vorkommt, dass es funktionieren könnte. Man muss sie alleine füllen, mit der Sicherheit, man selbst zu sein. Klingt wie eine verballerte Ansage aus einem Buch für spirituelle Lebensweisheiten. Und ebenso unschaffbar.
Ich fühle mich wie ausgestopft. Wie ein totes Tier, seiner Innereien beraubt, welches nun zu Dekozwecken knopfäugig von der Wand eines Landgasthofs starrt. Unter ihm essen Leute Schlachtplatten und sind laut und lustig. Sie sagen Sätze wie »Musik erreicht die Menschen in Zonen, da kommen Hände gar nicht hin«und hören dann doch nur Coldplay. Das ewige Debakel. Ich und die anderen. Die anderen und ich. Das mögliche Wir, das komplette Wirr.
Tagsüber habe ich frei. Sitze mit einem Roman von Thomas Bernhard in einem Café, aber zum Lesen fehlt mir die Konzentration. Zurück in meiner Wohnung langweilt Netflix mit seiner gleichbleibenden Beliebigkeit. Zwischendurch habe ich immer wieder die Idee, eine Psychotherapie zu beginnen, die meine Probleme anfasst. Jene Probleme, die ich nicht mal richtig benennen kann, deren Ursprung ich nicht mal mehr kenne, die aber regelmäßig an mein Bewusstsein klopfen. Ich schreibe Therapie auf einen Schmierzettel. Lege ihn gut sichtbar auf den Schreibtisch. Gehe eine Stunde ins Fitnessstudio. Sehe dort die Körper derer, die ihr Leben mit Disziplin unter Kontrolle geprügelt haben. Die definiert über Laufbänder huschen, als gäbe es tatsächlich einen Weg. Die sich beim Hantelstemmen gegenseitig anbrüllen und sich dabei im Spiegel betrachten. Die Ziele haben mit ihrer Körperlichkeit. Und dann betrachte ich meinen Körper. Dusche, gehe heim, putze mein Bad und meine Küche. Staubsauge. Wenn ich meine Wohnung verlasse, finde ich es immer gut, sie in einem Zustand bestmöglicher Reinlichkeit wieder zu betreten. Zumindest das befindet sich innerhalb meiner Kontrolle. Ich werfe den Zettel, auf den ich Therapie geschrieben habe, in den Mülleimer.
Ich fahre mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof. Steige in den Nachtzug. Destination Dörrfeld.
Samstag
Ich stehe an einem Bahnhof, der aussieht, als würde er um seinen Abriss betteln. Von fern rauscht zärtlich eine Landstraße. Wie so ein Knistern. Mit mir warten noch zwei weitere Personen hier. Reckfeld ist ein Ort, an den sich niemand einfach so zufällig verliert. Man hält sich hier nur auf, wenn man ein Leben verwaltet. Oder wenn man wie ich auf der Durchreise ist. In dieser Gegend geboren zu sein, fühlt sich an, als hätte man gegen seinen Willen ein Tattoo gestochen bekommen, das man von Anfang an nicht gemocht hat. Ein Tattoo ohne Aussage, ohne Relevanz, ohne irgendeine Besonderheit. Eins, das einfach nur da ist, kaum von einer Hautauffälligkeit zu unterscheiden. Man weiß, es wird einen jetzt für immer begleiten, aber schön ist es nicht.
Ich komme zurück. Für eine Woche. Ich weiß auch nicht, warum ich mich habe breitschlagen lassen. Zugunsten familiärer Harmonie wahrscheinlich. Damit mir niemand vorhalten kann, mir wäre alles egal.
Es ist in Ordnung, dass ich jetzt auf dem Weg bin. Abstand von Berlin, Abstand von Anne. Mir fällt ein, dass ich letzte Woche mit ihr beim Tierarzt war. Pjotr wurde geimpft, und während sie mit dem Kater im Behandlungszimmer verschwand, saß ich zwischen all diesen besorgt guckenden Tierbesitzern. Humpelnde Hunde, stille Papageien, nervöse Kaninchen. Eine seltsame Szenerie. Auch da hatte ich mich wieder mal breitschlagen lassen und fühlte mich unwohl zwischen all diesen Leuten mit ihren kranken Tieren, aber ich tat es für Anne. Als sie mit Pjotr aus dem Behandlungszimmer kam, maunzte es heftig aus der Transportbox. Anne zahlte und lief sehr schnell. Ich hatte fast Mühe, sie einzuholen. Sie ging meistens schnell, das war Teil ihrer urbanen Eleganz. Flink, flatterhaft und schön. Aber ihre Schnelligkeit wirkte da schon so, als wäre sie auf der Flucht vor mir. In der U-Bahn saßen wir nebeneinander und schwiegen. Wir hätten wahrscheinlich die ganze Fahrt über geschwiegen, wenn ich nicht irgendwann gefragt hätte, ob Pjotr alles gut überstanden hatte. Anne redete gern über Pjotr, und so redeten wir die ganze Fahrt über die Katze, aber auf keinen Fall über den seltsamen Graben zwischen uns und ihre Fluchtversuche und meine Angst.
In der Ferne bellt ein heiserer Hund. Meine Eltern haben mich gebeten, nach ihrem Haus zu sehen. Haus bedeutet in diesem Fall Haus, Garten, Fischteich, Mülltonnen. Zum Glück kein Hund. Hunde machen mich immer nervös, weil sie von einem abhängig sind und man das in ihren Augen sieht. Ich habe keine Lust auf so eine emotionale Erpressung, auch nicht, wenn sie von einem Hund ausgeht. Ich weiß genau, wenn ich ihm eine Woche nichts zu fressen geben würde, so würde auch das dünne Band seiner antrainierten Zivilisiertheit reißen, und er würde mich portionieren und seinem Überlebenswillen opfern.
Es gibt jede Menge Hunde in dieser Gegend. Kleine Grundstücksverteidiger. Viele Besitzer haben sie sich angeschafft, weil ihr Hausarzt oder Kardiologe gesagt hat, dass sie zu fett sind und Bewegung brauchen. Jüngere Paare trainieren an ihnen die gemeinsame Fähigkeit zur Kindererziehung. Wenn es mit dem Hund funktioniert, wird mit dem Kind schon nichts schiefgehen. Klare Anweisungen geben, Strukturen schaffen. Am Ende hat man Kind und Hund, zusätzlich einen Ehepartner, und das eigene Leben ist derart vollgestellt, dass man es kaum noch erkennt.
Mein Elternhaus. Es gibt schon seit Jahren keine Probleme mehr, weil ich einfach keine mehr zulasse. Ich bin so ein freundlicher Dienstleistungssohn geworden, der manchmal zurückkommt und sich Nostalgie gönnt. Ich glaube, das geht vielen so, wenn sie lange nicht in der Gegend waren, in der sie aufgewachsen sind. Erinnerungen ploppen an verschiedenen Orten wieder auf, mit manchen beschäftigt man sich ein bisschen länger, andere will man sofort durch irgendetwas ersetzen. Und so denkt der Kopf manchmal von selbst, und man sitzt dort, die Augen streifen die Wiesen und die Ortsschilder und die Gebäude, die man kennt, und man fühlt sich trotzdem nicht zu Hause. Denn was heißt schon zu Hause? Was will schon Heimat?
Reckfeld ist der letzte Zwischenstopp. Hier wurde lange nichts mehr gemacht, und beim Anblick des Dorfes, das sich vor meinen Augen zu erstrecken versucht, erfasst mich nahezu Mitleid. Viele, die hier wohnen, würden es Idylle nennen, mir schwebt das Wort Gottverlassenheit ins Gemüt. Die Kirchenglocken lärmen, weil es gerade acht Uhr geworden ist. Ich sehe vom Bahnsteig aus die kleine Bäckerei, vor der zwei Männer in Arbeitslatzhosen sitzen, Kaffee trinken und rauchen. Ich habe auch Lust auf einen Kaffee, aber in zwei Minuten kommt der Zug.
Ich höre den Gesprächen der beiden anderen Wartenden zu. Es sind zwei Frauen um die sechzig, und sie unterhalten sich im heimischen Dialekt. Dem Plattdeutsch merkt man an, dass es vermehrt aus Nutz- statt aus Fühlwörtern besteht. Alles klingt nach Ackerbau und Viehzucht, nach Überleben, nie nach Genuss. Ewig tritt das Bäuerliche aus den groben Silben hervor. Auch mir hört man an, dass ich aus diesem Landstrich stamme, wenn ich nicht darauf achte, mich genau zu artikulieren. Es ist unvermeidbar, quasi im Gencode vermerkt. Auch ich bin einer dieser Bauern, grob im Denken, unfein in der motorischen Präzision. Sogar wenn man mich mit Designerklamotten ausstaffieren würde, würde man immer erkennen, wo ich geboren bin, denn ich gehe wie ein Bauer. Ich weiß, man kann lernen, wie ein Geschäftsmann oder wie ein Tänzer zu gehen, doch man würde an meinen Schritten immer wieder meine Herkunft erkennen. Und ich bemerke an mir selbst, dass ich gröber werde, gröber denke, gröber laufe und um ein paar Grad verdumme, wenn ich hierher zurückkehre.
Es wäre ein Leichtes, diese ganze Gegend hier lächerlich zu machen. Einerseits ist da dieser Zorn, den ich seit Jahren mit mir herumtrage, ob der Sturheit dieses Landstriches und seiner Bewohner, die sich einfach jeder Veränderung widersetzen. Da tut sich nichts. Keine Bewegung. Keine Zuwendung zu Gedanken, die man selbst nicht gedacht hat. Andererseits möchte ich der Welt nicht ewig meine schlechten Beurteilungen zukommen lassen. Davon wird auch mein Charakter düster. Ich will diesen Zorn verlieren, ihn bestenfalls gegen Gelassenheit eintauschen. Na ja, jetzt bin ich eben hier.
Ich habe meinen Eltern versprochen, eine Woche lang nach dem Rechten zu sehen. Sie fahren in ein Ferienhaus an die Nordsee. Das machen sie jedes Jahr. Immer in die gleiche Ecke, maximal drei Stunden Autofahrt. Ich glaube, diese Routine macht sie glücklich. Ich würde sterben, wenn ich jedes Mal bereits wüsste, was mich erwartet. Ähnlich ist es mit Dörrfeld, meinem Heimatdorf. Wenn ich dort ankomme, fühle ich mich müder, als ich eigentlich bin. Tristesse weht durch meinen Kopf, wie ein Wind, den man kaum spürt.
Meine Eltern kennen die meisten, wahrscheinlich sogar alle Menschen in Dörrfeld, wollen diese jedoch nicht unbedingt damit belästigen, die Mülltonnen rauszustellen, die Blumen zu bewässern und die Fische im Teich zu füttern. Dafür hat man doch den Sohn. Das, was meine Eltern mit mir machen, fühlt sich wie gewöhnlicher Zwang an. Aber mit einer großen Dosis familiärer Freundlichkeit. Es gibt diese Eltern-Sohn-Beziehungen, bei denen man über alles reden und seine Beweggründe erklären kann, seine Vorhaben verständlich machen darf und es einfach auch Raum gibt für Gefühle, die nicht nur Durst und Hunger sind. Außerdem gibt es solche, wie ich sie pflege. Ich habe aufgehört, Konflikte zu führen, weil ich im Laufe der Zeit bemerkt habe, dass das Resultat keine Verbesserung für mein Leben darstellt. Daher mache ich den Leuten, mit denen ich verwandt bin, einfach irgendwas recht, sofern es mich nicht umbringt, das zu erledigen. Und es bringt mich eben nicht um, hier zu sein. Es ist vielleicht sogar ganz gut, für ein paar Tage aus Berlin rauszukommen. Dörrfeld ist leise, das habe ich immer schon gemocht. Wenigstens muss ich mich in der Woche meines Aufenthaltes nur ein paar Stunden mit meinen Eltern auseinandersetzen.
Ich bin mir sicher, man könnte die Erziehung, die hier fast jedem Kind meiner Generation zuteilgeworden ist, auf diese dreizehn Punkte herunterbrechen:
Sei haltmäulig.Sei emotionsleise und anweisungslaut.Lebe unauffällig und kardialverhärtet.Sei tiefenskeptisch bei allen Dingen, die versuchen, dein Leben zu ändern.Übe dich in Übellaune.Sei so nachkommenschützend, dass deine Nachkommen kaum bemerken, ein eigenes Leben zu haben.Behalte dein Lächeln (für dich).Sei konfliktfördernd, ohne direkte Teilhabe am Konflikt.Auch wenn du keine Stabilität hast, zeige sie.Schütze Haus, Einkommen und Vertraute (in dieser Reihenfolge) vor den Zugriffen Externer.Hege keine Skepsis an den Wegen deiner Ahnen.Vertraue nur jemandem, der seine Familie liebt (und bestenfalls eine eigene gegründet hat).Eskaliere positiv auf Volksfesten.Zum letzten Punkt der Liste hätte ich tatsächlich die Möglichkeit, weil in den nächsten drei Tagen das Dörrfelder Schützenfest stattfindet. Meine Mutter hatte das bei unserem letzten Telefonat mit einfließen lassen. »Kannst ja hingehen, gucken, ob dich noch wer kennt.« Interessant, dachte ich da. Interessant, wie sie das sieht. Als ob die Vergangenheit einfach so ein Fakt wäre, den man geschmeidig wegignorieren kann.
Ob mich noch jemand kennt? Bedeutet denn mein Weggehen, dass mich alle vergessen haben? Man kann das nicht einfach wegvergessen, was man an einem Ort erlebt hat. Und schon dreimal nicht am Ort seiner Jugend und seiner Kindheit. Vielleicht wird die eigene Empfindung dazu im Laufe der Zeit entspannter, im Idealfall sogar egal. Aber ich glaube, das passiert nicht einfach so. Es gehört halt dieses Zeitvergehen dazu, verblassende Erinnerungen. Zwischendurch in Berlin ist die Vergangenheit weit weg. Aber wenn ich in Dörrfeld bin, ist alles wie früher.
Der Zug fährt ein. Ich steige zu. Das Zischen der Regionalbahntüren klingt fast genauso wie das Zischen der S-Bahntüren in Berlin. Nur irgendwie gelangweilter. Zwei rotgeschwitzte Frauen sitzen da, unterbrechen ihr Gespräch in diesem Dialekt. Derbe Wörter, Gespräche wie grobe Leberwürste, lautes Gelächter. Weitsicht nur, weil es Fenster gibt. Aber egal, was gehen mich die Leute an. Die beiden blicken kurz auf, ich schaue an ihnen vorbei. Beide tragen diese bunten luftigen Blusen, blumengemustert und Frohsinn suggerierend. Sie reden weiter, als sie sich darauf geeinigt haben, dass ich zwar ein Unbekannter, aber kein Störenfried bin. Der Zug fährt an, rattert desorientiert. Ich drücke meine Stirn an die kalte Scheibe der Regionalbahn. Es sind vier Stationen bis Dörrfeld. Augen zu, und das Rattern der Räder auf den Schienen versöhnt mich mit der Realität. Diese klapprige Regelmäßigkeit. Dieser nörgelnde Gleichmut. Wie ein Technoloop aus den Neunzigern aus einer leicht defekten Clubanlage. Das passt alles viel zu gut hierher.
»Nächster Halt Dörrfeld«, sagt die Frauenstimme aus dem Regionalbahnlautsprecher. Meine Eltern stehen am Gleis. Wenn sie nicht meine Eltern wären, würde ich sagen: Fuck, was für ein niedliches Paar, was die wohl so machen? Aber nein, es sind meine Eltern. Meine Mutter lächelt, als sie mich entdeckt. Beide umarmen mich. Mein Vater klopft mir wie immer auf den Bauch, irgendwann hat er sich das zum Ritual gemacht. Dabei lacht er. Ich lache auch. Freue mich über die beiden. Aber mich überfällt gleichzeitig so eine tief greifende Entkräftung, als ich mich auf die Rückbank des Kombis setze. »Erst mal frühstücken, dafür ist noch Zeit«, sagt er, und meine Mutter nickt eifrig. Mehr reden wir vorerst nicht.
Es folgen zehn Minuten Autofahrt durch mein Geburtsdorf. Tal der Tränen, Festung der Freude. Ein paar Dörrfelder schlendern in der Frühe schon am Straßenrand entlang. Fahrräder. Hunde an Leinen, die gegenseitig ihre Ärsche beschnuppern, Hundebesitzer, die Gespräche führen, über was auch immer. Der Wagen meines Vaters riecht gut. So, als ob ihm an der Pflege dieses Fahrzeuges gelegen wäre. Der Duft kompromissloser Sauberkeit.
Der Friseursalon heißt immer noch unprätentiös Frau Kopf. Wenn ich mir überlege, was sich Großstadthairdresser für eine überzogene Mühe geben, ihre Läden gezwungen kreativ zu benennen, um dann doch letztendlich irgendwelchen drittklassigen Wortspielen zu verfallen, da lobe ich mir tatsächlich diese einfachen Dorffriseure. Bei Frau Kopf im Fenster hängen immer noch die Frisurenmodellbilder aus den Neunzigerjahren. Der beschützende Mann mit der praktischen Kurzhaarfrisur und die Frau, die durch ihre Lockenmähne besticht. Ich glaube, an diesem Rollenverständnis hat sich hier seit Jahrzehnten nichts geändert. Frau Kopfwird inzwischen seit drei Generationen von der Dörrfelder Familie Schulze-Wernig betrieben. Als wir langsam vorbeifahren, kann ich durch das große Fenster die jüngste Tochter Maria sehen, wie sie gerade dabei ist, den Laden aufzuschließen.
Meine Eltern haben den Tisch auf der Terrasse gedeckt. Körnerbrot, Käse, Schinken. Das Frühstück dauert vielleicht zwanzig Minuten. Anschließend erzählt meine Mutter mir von den neuesten Entwicklungen in der Nachbarschaft, während mein Vater das Auto mit Urlaubsutensilien vollpackt. Danach erklärt er mir den Garten (die Rosen nicht vergessen, täglich zwei Gießkannen, direkt an die Wurzeln, das Wasser nicht zu kalt, lieber die Kanne nach dem Gießen direkt wieder auffüllen und einen Tag in der Sonne stehen lassen), und meine Mutter hat einen Zettel vorbereitet, auf dem steht, wann welche Mülltonne an die Straße gestellt werden muss. Täglich Fische füttern steht da auch. Es vermischen sich Misstrauen und Liebe. Irgendwo in der Nachbarschaft bellt ein Hund.
Unkonkrete Lebenspläne meinerseits kreuzen sich wie liebevoll ineinander verschlungene Zufälle mit den Lebensumständen meiner Eltern, das sind so zusammengefasst die letzten Jahre. Da ist schon was Familiäres, ein Band, das uns zusammenhält, aber eigentlich existieren wir sorglos in Parallelwelten. Wir sitzen noch ein paar Minuten auf der Terrasse und teilen Belanglosigkeiten.
Eine Viertelstunde später sehe ich ihrem Auto nach, das fast wie in Zeitlupe von der gepflasterten Einfahrt rinnt. Auto, Haus, Garten, Kinder, denen man zuwinken kann. Ich bleibe zurück wie der seriöse Typ, der ich auf keinen Fall bin. Stehe im Türrahmen und winke. Bevor sie in den Kombi gestiegen sind, haben wir uns an der Tür umarmt, skeptische Blicke meiner Mutter, Schulter- und Bauchklopfen vonseiten meines Vaters. Ich lächle, so kommunizieren wir uns nonverbal die Welt schön. »Wir melden uns, sobald wir da sind«, ruft meine Mutter noch aus dem geöffneten Fenster. Die reduzierte Sprache der Sachlichkeit tropft ihr aus dem Mund. Jeder unserer Kommunikationsformen wohnt eine gewisse Rauheit inne, die schwerlich wegzulächeln ist.
Ich gehe wieder ins Haus und denke über das Wort Hausherr nach. Ich kann es nicht mit Sinn füllen, ähnlich wie die Begriffe Schlossherr, Herr der Lage oder, am schlimmsten noch, Bauherr. Ein Haus zu bauen, zu planen, zu gestalten, kaum etwas liegt mir ferner. Ich möchte nicht mal eins besitzen, weil ein Haus zu besitzen, automatisch auch verwurzelt sein meint. Das Alleinsein steht mir gut in dieser Bude, diesem Museum meiner Kindheit. An jedem Teil, an jedem Ding, an jedem Möbelstück klebt eine Erinnerung, haften ein paar Krümel Nostalgie.