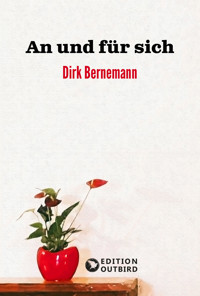
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Outbird
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An und für sich ist alles in Ordnung. In den letzten Jahren wurden allerdings viele von uns an das Gewicht der Vereinzelung erinnert. Das Gewicht der Liebe konnte das oft nicht ausgleichen. Bestseller-Autor Dirk Bernemann gibt mit diesem Erzählband den Isolierten eine Stimme, erzählt Szenarien der Qual und der Hoffnung in den Fugen des Zusammenlebens. Ein Ausleuchten des Zwischenmenschlichen in Krisenzeiten. Aber an und für sich ist doch alles in Ordnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An und für sich
von Dirk Bernemann
Impressum
Veröffentlichungsdatum: 14. Februar 2024
© Edition Outbird, Gera
www.edition-outbird.de
Coverfoto: Dirk Bernemann
Covergestaltung: Benjamin Schmidt
Lektorat: René Porschen, Merri Holste, Tristan Rosenkranz
Buchsatz: Danilo Schreiter, Telescope Verlag
ISBN: 978-3-948887-64-3
Alle Rechte vorbehalten.
„True love will find you in the end You‘ll find out just who was your friend Don‘t be sad, I know you will But don‘t give up until“
Daniel Johnston
An und für sich ist alles in Ordnung.
Januar
Es ist der erste Samstagmorgen des Jahres. Im Januar erscheinen einem Dinge oft übertriebener, als sie eigentlich sind. Man hat das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel überstanden, ist glücklich darüber, es geschafft zu haben, weil da immer viel Sentimentalität in den Fugen klebt und man sich glücklich schätzen kann, wenn man das abermals überlebt hat. Das ist manchmal nicht selbstverständlich.
Ich habe dieses Café betreten, nichts Genaues wollte ich hier. Ich will ohnehin nichts Genaues mehr. Ich lebe definitiv ungenau. Wenn auch nicht beliebig oder konturlos, sondern ausschließlich ungenau. Vielleicht wollte ich meine eigene Stille für ein paar Momente gegen eine unkontrollierbare Wuseligkeit austauschen. Vielleicht bin ich einfach schon Anfang Januar erschöpft vom Jahr, das sich ja immer vor einem aufbaut mit seinen abstrakten Erwartungen an Optimierung, Überleben, dem Erreichen von Zielen. Es gibt nichts anderes mehr für die Menschen. Es einfach schön haben, alleine, das Gefühl zu haben, niemanden zu brauchen, entspannt auf den Weltuntergang zu warten, das wäre gut, ist aber mittlerweile unvermittelbar.
Es gibt eine unbestimmte Sehnsucht nach genau diesem nicht näher bekannten Nichts, dieser Zwischenleere innerhalb des Funktionierenmüssens. Helden und Heldinnen des Alltags haben sich viele Aufgaben aufgeladen, was sie zu diesen Helden und Heldinnen macht. Das Leben schaffen, es bewerkstelligen, trotz Widerständen und Hindernissen, das macht die Leute anerkennenswert. Jenen, die in Hängematten hängengeblieben sind, wird ein lapidares Lächeln geschenkt, denn so richtig dazu gehören sie nicht. Und die Schaffer, und das ist das Allerschlimmste, foltern einander mit Visionen ihrer Ruhe, die sie aber nur dazu verwenden, anschließend wieder leistungsfähige Roboter zu werden. Wer am besten professionell chillen kann und am besten darüber noch adäquat referieren kann, steigert gnadenlos sein Ansehen.
„Ich hätte gerne einen Kaffee und ein Croissant“, sage ich zur Servicekraft, und sie schaut mich nicht an. Warum auch, ich bin einer von vielen Passanten, die hier in ihrer Einsamkeit umkommen. Ihre Stimme ist trotzdem trainiert, freundlich und zugewandt.
„Haben Sie sonst noch einen Wunsch?“
Als ob es so einen Muskel gibt, der Freundlichkeit simulieren kann. Wo werden diese Menschen gezüchtet? Diese Bedienungscyborgs? Oder hat sie das Weltgeschehen dergestalt deformiert, dass sie nur noch so sein können?
Fitness, Entrümpeln, Job, Familie steht auf einer Illustrierten, die dort zum Zeitvertreib für die Gäste ausgelegt ist. Das Wort Zeitvertreib erweckt den Anschein, als wäre Zeit eine endlose Kapazität, die man vertreiben müsste wie einen lästigen Fliegenschwarm. Ganz so, als hätten alle hier die Taschen voll davon, aber ich war schon zu oft in Krankenhäusern oder auf Friedhöfen, um das widerlegen zu können.
Auch ich bin heute widerwillig erwacht, einen ganzen Vormittag, einen ganzen Tag, ein komplettes Jahr vor mir. Die Leute hier sind anstrengend und glücklich. Aber ich denke mir, dass es nun mal jetzt so sein muss. Denn wer sich nicht anstrengt oder sich in anstrengende Szenarien begibt, der wird auch nicht glücklich. Glücklich wird man nicht einfach so, das ist mit Arbeit verbunden, mit Arbeit an sich selbst und Arbeit an sich selbst in Gegenwart anderer. Auf die Arbeit anderer am eigenen Glück kann man nur vertrauen.
Jetzt aber erstmal der Versuch von Gelassenheit im Café. Kaffee, Lesen. Ruhe unter lauten Menschen. In der Ecke spielen Kinder. Warum spielen in der Ecke Kinder? Was wollen sie, wer hat sie dort hingestellt? Das wichtigste Privileg von Kindern ist es, öffentlich laut weinen und schreien zu dürfen. Jeden Bedarf nach Liebe immer äußern zu dürfen. Die Natur hat es so eingerichtet, dass wir durch die Niedlichkeit von Kindern gezwungen werden, auf ihre abstrusen Bedürfnisse einzugehen. Warum können Erwachsene nicht einfach in die Bahn einsteigen und verkünden: „Liebe Fahrgäste, ich hatte einen beschissenen Tag in meinem Job als Essenslieferant. Es war kalt, das Trinkgeld spärlich und viele Blicke, die mich trafen, stellten infrage, ob ich überhaupt ein Mensch bin. Ich spüre eine Erkältung in mir hochklettern, nicht nur emotional. Zuhause erwartet mich nichts außer billiges Essen, Tinder, Depression, Netflix, Youporn und mein Leben ohne weitere interessante Aktivitäten, außer früh schlafen zu gehen, um morgen den ganzen Mist zu wiederholen. Könnte mir bitte jemand einen Impuls zum Weiterleben geben? Oder mich in den Arm nehmen?“
Dann anfangen zu weinen.
Wieso haben wir uns das abtrainiert? Ich sehe keinen tieferen Sinn darin, warum aus fröhlichen Kindern diese misantrophischen Erwachsenen geworden sind. Das hat mir noch niemand plausibel erklären können. Es kommt eine Impulskontrolle, irgendwann, irgendwoher, und dann ist man auf einmal dieser ernsthafte Mensch, der sich aufs Sterben vorbereitet.
Kinder zu kriegen ist natürlich eine gute Sache. Schon weil man damit Menschen erschafft, die einmal genauso toll werden, wie man selbst, vielleicht sogar noch überragender, weil man ja sicher ist zu wissen, an welchen Reglern man drehen muss, um die eigenen Unzulänglichkeiten nicht weiter zu geben. Man erschafft außerdem Menschen, die einen selbstlos mögen, selbst, wenn man ein Arsch ist.
Am Nebentisch sitzt ein Paar, überdimensionierte Lattewannen vor sich. Beide Gesichter werden von der jeweiligen Displayhelligkeit ihrer Endgeräte angestrahlt.
Sie guckt, etwas in ihren Augen blitzt, das erkennt jeder, der es mit Menschen ernst meint.
Er fragt: „Was?“
Sie entgegnet: „Was was?“
Er darauf: „Was was was?“
Anschließend starren beide auf ihre Handys, der Liebe wegen.
Selbst die, die jemanden haben, sind so unglaublich einsam.
Kaffee und Croissant treffen ein. Ich zahle direkt, weil ich verschwinden will, wohin genau, weiß ich nicht. Trinke und esse hastig und verlasse dann das Etablissement. Auf der Straße schwindet der Zusammenhang. Ich laufe angriffslustig und ziellos geradeaus, gehe so aggressiv spazieren wie selten zuvor, will, dass mich jemand aufhält, dass mich endlich jemand aushält. Aber der Zusammenhalt schwindet. Ich stampfe durch die Biomasse. Zum Glück habe ich Angst vor Gewehren, und außerdem davor, von Polizisten nach einem Amoklauf mit Beinschüssen am Fliehen gehindert zu werden. Genauer gesagt habe ich Furcht vor dem Eintreffen der Kugel in mein Fleisch, vor dem Durchdringen des Gewebes und dem damit verbundenen Schmerz, der mich am Weiterlaufen hindern würde. Aber ich wäre ein guter Attentäter. Ich wäre akkurat und zielsicher. Aber niemand hindert mich an meiner Ziellosigkeit.
Tatsächlich schwinden Zusammenhang und Zusammenhalt, irgendetwas passiert hier, jeder spürt das, das hier ist das Jahr, in dem der Krieg beginnt. Jeder erfährt das, jeden betrifft es und jeder wüsste gerne: Was ist eigentlich los?
Mein Klingelton reißt mich aus meinen Denkschleifen. Meine Mutter meint, Anfang nächsten Monats wird mein Opa 97. Und in diesem Alter, man wisse ja auch nicht, ob es da noch folgende Geburtstage geben werde. Ob ich da nicht auch vorbeikommen wolle, zu Kaffee, Kuchen, Familienglück. Ich sage zu und wir reden noch ein wenig über die Zustände der Verwahrlosung anderer Leute, zum Beispiel dem meines dementen Großvaters. Unsere eigenen Zustände lassen wir außen vor, zum Glück sind wir erwachsene Menschen.
Februar
„Die freudespendende Tradition der nachmittäglichen Kuchenpause wird weitgehend unterschätzt.“
Wer diesen Satz gesagt hat, weiß niemand mehr genau. Die glückliche familiäre Zusammenkunft macht aus vielen Stimmen eine Geräuschkulisse, unterbrochen von Lachen, dem Geräusch, das Kaffee beim Eingeschenktwerden in dünnwandige Porzellantassen macht, und gelegentlichem Schmatzen schlemmbaren Kuchenmaterials. Die Gesichter sind froh, dieser formschöne Satz mit dem friedlichen Inhalt kam also aus einem fröhlichen Gesicht. Jemand schenkt Kaffee aus, alle freuen sich. Die Heizung steht auf vier, es ist okay, diese Wärme in den Raum zu transferieren. Damit niemand frieren muss. Und alle, die hier verweilen, gönnen einander die abgestrahlte Wärme.
Harald hustet. Seine Tochter Claudia wischt ihm mit einer Serviette das schleimige Gemisch aus fluffigem Sahnekuchen und zähem Speichel vom Handrücken. Bis man sich auf ein gemeinsames Tempo aus Kauen, Schlucken und Nahrungreichen entschieden hat, muss etwas Zeit vergehen. Zeit vergeht ja immer, für Harald nicht mehr viel, für die anderen immerhin noch so viel, dass sich eine gewisse Dosis Hoffnung lohnt.
„97 ist schon was“, sagt Claudias Mann Michael anerkennend, aber alle wissen, dass Harald nur noch auf Sätze antwortet, die er selbst sagt. Aber es war auch keine Frage an Harald, sondern lediglich eine Feststellung, die er dem öffentlichen Raum und seiner Familie überantwortete. Der Satz als solches fällt ins Leere. Der alte Mann dreht trotzdem kurz seinen Kopf in Michaels Richtung, etwas Angst in seinem Blick, als ob er eine Aggression aus dieser Richtung vermuten würde. Auch als Harald noch in geregelten Bahnen denken konnte, haben sich die beiden Männer nicht gemocht. Jeder in diesem Raum weiß das, Harald spürt das nur noch. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.
„Was ist da an der Kreuzung passiert? Wahrscheinlich nichts“, sagt Harald und seine Tochter führt ihm wieder eine kuchengefüllte Gabel zum Mund. Das greise Geburtstagskind sieht sich im Raum um, nur Angst im Blick, als sei er zum ersten Mal hier, als sei das kein Ort, der Sicherheit verspricht. Die Gespräche gehen an ihm vorbei, sie sind nur noch eine Kulisse aus unverständlichen Wortgebilden, die Gott weiß was mit ihm zu tun haben könnten. Die Gesichter sehen aus wie Radierungen, aus denen wiedererkennbare Merkmale entfernt wurden.
„Wo ist Elisabeth? Elisabeth ist nicht im Wohnzimmer“, sagt er dann unvermittelt, nachdem er irgendetwas sehr lange und scheinbar nachdenklich im gegenüberliegenden Regal fixiert hat. Nach seiner Frau hat er schon lange nicht mehr gefragt. Claudia treten Tränen in die Augen und verwässern ihren Blick. Einen kurzen Moment sehen Vater und Tochter sich in ähnlicher Unschärfe.
„Mama ist einkaufen, sie kommt gleich.“
Es gab mal eine Einigung, dass man ihren Tod nicht erwähnt. Warum sollte man Harald in dieser Phase seiner Demenz noch mit dem Schrecken der Realität konfrontieren? Keine Fehler mehr korrigieren, alles zulassen, schlechte Nachrichten fernhalten, sagte der behandelnde Arzt damals. Alle hielten sich daran, es ging auch ohne ihre Erwähnung, die Trauer heruntergeschluckt, tief in das eigene Darmkonstrukt eingewoben, dort liegengelassen, unverdaut.
Claudia und Michael haben Harald nach dem Tod Elisabeths bei sich aufgenommen. Ein Pflegebett aufgestellt. Seitdem werden sie täglich Zeugen seines physischen und kognitiven Niedergangs. Ein nachvollziehbarer Verfall, die Auflösung von allem, was an einem Menschen erinnert haben könnte. Am Anfang war es nur eine Unruhe, dann ein Synapsenabbau, dann der Verlust verschiedener Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es gab Streit, als Harald in Michaels Arbeitsschuhe urinierte. Der ganze Ballast des langsamen Sterbens stand im Raum wie ein hospitalistischer Elefant.
Das ganze Haus wurde auf Dauer weglaufsicher eingerichtet. Claudia hält es für ihre Pflicht, ihren Vater in den Tod zu begleiten. „Ein Heim kommt nicht in Frage“, sagte sie nach mehreren Sichtungen von Fernsehbeiträgen über Pflegemängel in Seniorenheimen.
Es vergeht eine halbe Stunde quälender Gespräche mit verschiedenen Inhalten zwischen den übrigen Gästen des Geburtstags. Ein paar Luftschlangen hat Claudia um die Deckenleuchte gehängt. Den Luftschlangen sieht man an, dass sie nur aus Gewohnheit aufgehängt worden sind und keinem weiteren Zweck dienen, und Claudia es eigentlich kaum erwarten kann, sie am Abend von der Lampe zu reißen und dem Mülleimer zu überantworten. Wenn das Fest dann regulär zu Ende ist und wieder ein neutraler Allgemeinzustand eintritt.
„Kriegt der doch gar nicht mehr mit“, hatte Michael gesagt und seine Frau meinte, dass er das gar nicht wissen könne, es ginge ja vor allem ums zu vermittelnde Gefühl, und dann schwiegen beide. Michael verschwand im Hobbykeller, seiner letzten Bastion der Männlichkeit, wie er kürzlich zu einem Arbeitskollegen meinte, und masturbierte traurig bis gelangweilt zu einem Handyvideo mit dem Titel Discobitch pisst auf die Tanzfläche und wird auf dem Clubklo gemaßregelt. In Erwartung feinster Tropfen Restsexualität und einer Menge betrübter Erbärmlichkeit. Wie er da so steht, das Handy in der einen, seinen Schwanz in der anderen Hand, und die Ebenen verschwimmen fühlt, und dann im Verlauf der Selbstbefriedigungsmaßnahme für ein paar Augenblicke tatsächlich denkt, er sei einer der Beteiligten, die der Discobitch sehr klar reinprügeln, dass es sich nicht ziemt, auf die Tanzfläche zu strullern. Dann Erleichterung, dann lange nichts.
Einige Gäste erzählen von ihren Berufen und Kindern. Dann reden die Männer über Fußball und die Frauen über Gärten und Tiefkühlkost. Die Gespräche sind laut, die Sätze sinnlos, alle lachen, das mildert das augenscheinliche mentale Verbleichen des Gastgebers etwas ab. Harald bleibt an diesen Gesprächen unbeteiligt. Draußen hält sich ein komischer Winter auf, in den hineinzusehen auch nichts verändert. Es ist unglaublich kalt draußen, hier drin seniorengerecht heiß. Einer ihrer Söhne, erzählt Claudia noch, sei jetzt Fahrradkurier, als wenn das was Besonderes wäre. Fahrradkurier klingt sehr schön, aber die Wahrheit ist, er bringt als prekäre Person weniger prekären Personen Mahlzeiten, die sie bei Lieferservices bestellt haben. Er würde auch noch kommen, wenn er seine Schicht beendet habe.
„Kuchen haben wir genug“, sagt Michael und wartet darauf, dass etwas passiert. Er blick kurz zu seiner Frau, die immer noch ein bisschen nass in den Augen ist, und fragt sich, wann sie zuletzt nicht nass in der Augengegend war. Unmotiviert und destruktiv schlägt er einen Kaffeelöffel auf den Rand der Tasse und freut sich über das entstehende Geräusch wie ein Kind.





























