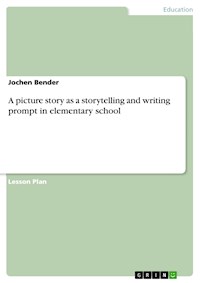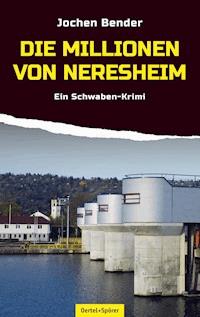7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
… aus heimlichen Schatten schreit Vergangenheit ihre Wahrheit ins Licht … Ein böses Zeichen aus Blut wurde auf einen Sarkophag geschmiert. Wurde der Mann zum Opfer, weil er Afrikaner ist? Und ist es Zufall, dass im benachbarten Völkerkundemuseum gerade eine Ausstellung zur deutschen Kolonialgeschichte in Afrika gezeigt wird? Sicher scheint nur, dass sich der Ermordete am Tag zuvor mit einem Urlaubsflirt getroffen hat, was eine unheilvolle Dynamik in Gang setzte. Kommissar Neven Rohlfing und Kommissarin Sabrina Eisele ermitteln zwischen Eifersucht, Rassismus und der Vergangenheit, bis das BKA übernimmt und Neven Rohlfing suspendiert wird. Während es zum Showdown zwischen Rohlfing und seiner Chefin kommt, erhält ein Artefakt aus der Kolonialzeit eine immer größere Bedeutung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Ich verstehe erst jetzt, wie sehr unsere Geschichte mit der Namibiasverwoben ist. Die Kolonialzeit, bei uns lange vergessen oder verklärt – in Namibia ist sie jeden Tag präsent geblieben.(Christiane Habermalz, Deutschlandfunk Kultur)
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com und Adobe StockEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8426-9
Jochen BenderSchwabenSchatten
Diesen Krimi widme ich allen Freunden regionaler Kultur. Den Lesern regionaler Krimis wünsche ich spannende Unterhaltung. Den an ihrer Kultur interessierten Menschen Afrikas wünsche ich die baldige Rückgabe aller in der Kolonialzeit geraubten Kulturgüter.
Tag 1
Seit ihrem ersten Kuss war er jedem Streit aus dem Weg gegangen. Im Laufe der gemeinsam verbrachten Monate, die sich zu Jahren aneinanderreihten, hat er sich eine Leidensmiene angewöhnt, um ihr stumme Vorwürfe zu machen. Das ärgerte sie so, dass sie ihn immer häufiger durch gemeine Äußerungen provozierte. Jedes Mal, wenn er sich dann feige wegduckte, statt seinen Mann zu stehen, wuchs ihre Verachtung für ihn. Zuletzt hatte ihre Verachtung eine Dimension erreicht, dass sie bei seinem Anblick nur noch dürre, sarkastische Worte für ihn übrighatte.
Jetzt ist alles anders. Ihr Reptilienhirn hat das Kommando übernommen und die toughe, selbstbewusste Verena in einen fernen Winkel ihres Bewusstseins verbannt. Todesangst führt die Regie.
„Du gehst heute nirgendwo hin!“ Sein Blick flackert, jeden Moment wird er ihr an die Gurgel gehen.
„Okay, aber bitte reg dich nicht so auf.“
Sie senkt die Augen, in diesem Moment bereit, sich ihm vollständig zu unterwerfen.
„Ich rege mich auf, solange ich will! Viel zu lange habe ich geschwiegen und mir deine Frechheiten gefallen lassen! Damit ist jetzt Schluss!“
Seine Faust kracht gegen die Wand. Sie zuckt zusammen. Ein Zittern erfasst ihren Körper.
„Und zwar ein für alle Mal!“
Verena wagt es nicht, den Blick zu heben. Auch so weiß sie, dass er grinsend ihre Unterwürfigkeit genießt. Später wird sie es vielleicht schaffen, ihn dafür zu hassen.
„Ist das klar?“
Sie ist erstarrt, stellt sich tot. Grob packt er sie unterm Kinn und hebt ihren Kopf an.
„Ob das klar ist!“
Panisch nickt sie. In seinen Augen glitzert etwas, das sie noch nie gesehen hat und nie wieder sehen will.
„Gut!“
Er lässt ihr Kinn los. Sofort senkt sie erneut den Blick. Erstarrt steht sie vor ihm, wagt es nach wie vor nicht, sich zu rühren. Verena glotzt auf seinen Bauch, als sie die Schwellung in seiner Hose erkennt. Erschrocken wendet sie den Blick ab. Ein großformatiges Wüstenfoto gerät in ihr Sichtfeld, eine Erinnerung an ihre Reise durch Namibia. Wie eine Ertrinkende an ein Stück Holz klammert sie ihren Blick an eine der schönsten Erinnerungen ihres Lebens. Innerlich fleht sie einen Gott, an den sie bisher nie glaubte, an, ihr zu helfen, seine Wut zu überstehen.
Seine Ohrfeige trifft sie unerwartet und mit solcher Gewalt, dass sie zu Boden stürzt. Er reißt das Bild von der Wand, zerschmettert es auf dem Boden.
„Damit ist es vorbei! Für immer.“
Tränen strömen aus ihren Augen, während sie krampfhaft ihr Schluchzen unterdrückt. Er beugt sich zu ihr hinab, greift grob in ihre Haare und reißt Verena an ihnen hoch, bis sie vor ihm kniet.
„Wenn du gerade schon da unten bist“, sagt er gehässig und öffnet seinen Hosenladen.
Die Leiche liegt wie drapiert auf einem Steinsarkophag. Das Blut ist von der Kehle die Seitenwände hinabgeflossen, dort zu dunkelroten Schlieren geronnen. Im Hintergrund, auf der gegenüberliegenden Seite der Absperrung, saugt eine junge Frau gierig an ihrer Zigarette. Ihr Blick hängt gebannt am Toten. Sie hat das Mordopfer gefunden. Wir werden sie gleich befragen, auch wenn das nichts bringen wird, liegt die Tat doch sicher etliche Stunden zurück. Tief Luft holend breche ich das Schweigen.
„Ein Schwarzer.“
„Was soll das jetzt?“
Sabrina starrt mich mit gerunzelten Augenbrauen an.
„Nichts.“
Ich zucke mit den Achseln.
„In knapp zwanzig Jahren Mordermittlung ist mir noch nie eine dunkelhäutige Leiche untergekommen, das ist alles.“
„Bestimmt handelt es sich um eine rassistische Tat.“
„Wie kommst du darauf? Nur weil das Opfer schwarz ist?“
Skeptisch sehe ich meine Kollegin an.
„Sabrina hat recht!“
Der Fotograf tritt in seinem Plastikoverall zu uns. Den Blick auf das Display seiner Digitalkamera geheftet, drückt er einige Knöpfe, dann streckt er uns den kleinen Bildschirm entgegen.
„Hier!“
„Scheiße!“, fluche ich.
„Ich habe es doch gleich gesagt!“, triumphiert sie.
Aus dem am Sarkophag hinabfließenden Blut hat jemand ein Hakenkreuz gemalt.
„Das war bestimmt der Mörder.“, meint Sabrina.
„Sehe ich auch so“, erwidert der Fotograf. „Wenn wir Glück haben, hat der Idiot dabei wenigstens einen Fingerabdruck hinterlassen.“
Ich hebe meinen Blick. Die junge Frau gegenüber zündet sich eine weitere Zigarette an. Mir wird bewusst, wie schrecklich es für sie sein muss, hier im Angesicht einer Leiche zu stehen. Also schlage ich vor: „Sollen wir die Zeugin befragen, damit sie endlich gehen kann?“
„Frag sie ruhig, ich informiere Frau Riecke über das Hakenkreuz.“
Wortlos umrunde ich die Absperrung. Die junge Frau sieht mich kommen, wirft nach einem letzten gierigen Zug ihre Kippe auf den Boden und tritt sie aus.
„Kein schöner Anblick, vermutlich Ihre erste Leiche?“
Sie verzieht das Gesicht zu einem müden Lächeln.
„Keineswegs, ich bin Krankenschwester, da sieht man öfters Tote, als einem lieb ist. Wenngleich denen nicht die Kehle durchgeschnitten wurde.“
„Arbeiten Sie drüben im Katharinenhospital?“
Mit der Hand zeige ich in Richtung der kaum hundert Meter entfernten Gebäude.
Sie nickt. „Ich war auf dem Weg zur Arbeit, als ich ihn dort liegen sah.“
„Kennen Sie ihn?“
„Nein.“
„War außer Ihnen noch eine Person hier auf dem Friedhof?“
„Keine Ahnung, ich war müde und lief in Gedanken versunken vor mich hin, bis ich ihn entdeckte. Ich habe niemanden bemerkt.“
„Haben Sie die Leiche berührt?“
Entsetzt schüttelt sie den Kopf.
„Wie nah sind Sie an den Toten herangetreten? Ich muss das wegen der Spurensicherung wissen.“
„Nicht näher, als ich jetzt von ihm entfernt bin. Von hier aus habe ich die Notrufnummer gewählt. Der Beamte sagte, ich solle mich nicht von der Stelle rühren, also blieb ich stehen.“
„Sie sind Krankenschwester. Haben Sie nicht versucht, ihm zu helfen?“
„Mir war gleich klar, dass der tot ist. Man sieht von hier aus deutlich den Schnitt durch die Kehle und dass er literweise Blut verloren hat. Ich brauchte nicht näher an ihn heranzugehen.“
„Okay, das war’s auch schon. Ihre Kontaktdaten haben wir ja, falls wir noch etwas wissen müssen. Sie können gehen.“
Ich erwarte, dass sie es nach der langen Warterei eilig hat, wegzukommen. Sie wirft jedoch erneut einen Blick auf die Leiche, öffnet den Mund, schließt ihn wieder.
„Ist noch was?“
„Ja!“ Mit einem Ruck reißt sie sich von dem verstörenden Anblick los und sieht mich an. „Hat der Mord etwas mit der Ausstellung zu tun?“
„Mit der Ausstellung?“ Verblüfft starre ich in ihr hübsches Gesicht. „Mit welcher Ausstellung?“
„,Wo ist Afrika‘?“
Der Leichenfund hat sie stärker erschüttert, als ich dachte.
„Soll einer der Beamten Sie zum Arzt fahren? Schließlich findet man nicht alle Tage eine Leiche ...“
„Quatsch! Mir geht es gut! Ich frage mich einfach schon die ganze Zeit, ob sein Tod mit der Ausstellung „,Wo ist Afrika‘?“ dort drüben im Linden-Museum zusammenhängt.“
Brüsk wendet sie sich ab, um hoch erhobenen Hauptes davonzustolzieren. Ratlos starre ich ihr nach. Warum sollte der Mord im Zusammenhang mit dieser Ausstellung stehen? Etwa nur, weil der Tote schwarz ist? Wahrscheinlich stammt er aus Allmersbach oder Bad Cannstatt. Lebte er noch, wäre er empört, von ihr als Afrikaner bezeichnet zu werden.
Aus sicherer Entfernung beobachtet er das riesige Polizeiaufgebot auf dem Hoppenlaufriedhof. Seine morgendliche Runde führt immer über den Friedhof zum dahinterliegenden Spielplatz und weiter durch den Stadtgarten zum Campus der Stuttgarter Universität. In einem anderen Leben belegte er selbst an der Uni Vorlesungen und Seminare. Dass ihn seine morgendliche Runde über den Campus der Uni führt, hat jedoch keine sentimentalen, sondern ganz praktische Gründe. Dank der vielen feiernden Studenten gibt es dort besonders viele Pfandflaschen und -dosen. An guten Tagen beträgt seine Ausbeute aus den Mülleimern des Spielplatzes und des Stadtgartens mehrere Euro. Zumindest wenn er früh genug unterwegs ist, um der Erste zu sein. Das kann er heute vergessen. Die Bullen haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als hätte er mit denen nicht schon genug Ärger! Hass wallt in ihm auf. Wenn er eine Knarre hätte, am besten ein Maschinengewehr, würde er jetzt hinübergehen und einige von ihnen umbringen. Aber leider hat er keine.
Beschwörungsformeln vor sich hin murmelnd, dreht er sich mehrmals um sich selbst. Seine Hände führen dabei eine exakt festgelegte Abfolge von Bewegungen aus. Langsam klingt sein Hass ab. Sein Blick streift über die Polizeifahrzeuge weiter die Rosenbergstraße entlang Richtung Hegelstraße. Andere könnten einfach dort entlanglaufen, um bei der Agip-Tankstelle in den Stadtgarten abzubiegen. Für ihn geht das jedoch nicht. Ihm wird nichts anderes übrig bleiben, als zu warten, bis die Bullen abziehen, um seine Morgenrunde genau in der festgelegten Reihenfolge zu Ende zu bringen, auch wenn es noch Stunden dauert und er mit Sicherheit keine einzige Pfandflasche mehr finden wird.
Als unter den Polizisten am Tatort die Nachricht die Runde macht, dass beim Toten weder Papiere noch ein Telefon gefunden wurden, stöhnen die Kollegen auf. Uns bleibt nichts anderes übrig, als in weitem Umkreis die Müllbehälter und das Gebüsch gründlich zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass der Täter dort einen Teil der Dinge entsorgt hat.
Ich teile die Kollegen ein und koordiniere die Suche, während Sabrina zum Verfassungsschutz fährt. Sie brennt darauf, von denen zu hören, welche Gruppierungen oder auch welche Einzeltäter für einen rassistischen Mord infrage kommen.
Leider bleibt unsere Suche ergebnislos. Die Uniformierten und die Kriminaltechnik steigen nach und nach in ihre Fahrzeuge und rücken ab. Spontan beschließe ich, einen Abstecher ins Linden-Museum zu machen. Schon oft bin ich an dem markanten, im neoklassizistischen Stil errichteten Gebäude vorbeigefahren. Drinnen war ich nur ein einziges Mal vor vielen Jahren, kurz nachdem ich als junger Polizist neu nach Stuttgart gezogen war. Als ich den imposanten Bau betrete, frage ich mich, ob mich soeben bloße Neugier oder mein kriminalistischer Instinkt antreiben. Aber manchmal sind diese schwer voneinander zu trennen, bedingen die beiden doch einander.
Hinter der Kasse sitzt eine mittelalte Frau mit schwarz gefärbter Dauerwelle. Mit freundlicher Neugierde sieht sie mir entgegen. Beim Anblick meines Dienstausweises werden ihre Augen groß.
„Ich würde gerne Ihren obersten Boss sprechen.“
„Kommen Sie wegen der Leiche drüben auf dem Hoppenlaufriedhof?“
Ich nicke.
„Unser Boss ist eine Sie. Ich rufe bei Frau Professorin Ribeiro an.“
Wenig später werde ich ins Büro der Direktorin geleitet. Die Professorin entpuppt sich als rassige Frau in den besten Jahren, die ich spontan mit einem Salsa-Konzert oder einer Milonga assoziiere. Sie erweckt so gar keinen professoralen Eindruck, bis vielleicht auf die Lesebrille, die an einer Kette um ihren Hals baumelt.
„Wie kann ich Ihnen helfen?“
Sie ist offensichtlich nervös, was nicht ungewöhnlich ist.
„Mein Anliegen ist wahrscheinlich an den Haaren herbeigezogen. Bitte missverstehen Sie es nicht! Wir wollen einfach keine Spur übersehen, und sei sie noch so unwahrscheinlich. Kennen Sie diesen Mann?“
Auf dem Display meines Telefons zeige ich ihr ein Foto vom Gesicht des Toten. Sein blutiger Hals ist nicht zu sehen. Sie setzt ihre Brille auf und betrachtet es eingehend.
„Tut mir leid“, sie schüttelt den Kopf, „den Mann habe ich noch nie gesehen.“
„Trotzdem danke. Und entschuldigen Sie meinen Überfall.“
„Keine Ursache! Ist das der Tote vom Hoppenlaufriedhof?“
„Ja.“
„Ein Schwarzer, also sind Sie wegen unserer aktuellen Ausstellung ,Wo ist Afrika?‘ auf uns aufmerksam geworden?“
„Es war einen Versuch wert.“
„Ich rufe Herrn Dr. Voith an. Er ist für unsere afrikanische Abteilung zuständig.“
Noch ehe ich mich bedanken kann, hat sie das Telefon in der Hand. Wenige Minuten später betritt Crocodile Dundee den Raum, inklusive seiner eher in die Wildnis als in die Großstadt passenden Kleidung. Die Professorin erklärt mein Anliegen, und ich strecke ihm mein Handy hin. Nach einem kurzen Blick auf das Display sieht er mich spöttisch an.
„Sie meinen, wegen seiner Hautfarbe müsste ich ihn kennen?“
„Kennen Sie ihn oder nicht?“
„Natürlich nicht! Die meisten Schwarzen, die in Stuttgart herumlaufen, sind in Bad Cannstatt …“
„... oder Allmersbach geboren, ich weiß!“
„Warum kommen Sie dann hierher? Ihre Handlung zeugt von einem gewissen Rassismus.“
„Herr Kollege, ich muss doch sehr bitten! Der Kommissar macht doch nur …“
„Schon gut!“, winke ich ab. „Das war wirklich eine blöde Idee!“
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, verlasse ich das Büro. Es ärgert mich tierisch, ausgerechnet von Crocodile Dundee als Rassist bezeichnet zu werden. Warum eigentlich? Als Polizeibeamter sollte ich daran gewöhnt sein. Wahrscheinlich einfach, weil ich als halbes Gastarbeiter-Kind selbst unter Rassismus gelitten habe.
Im lieblichsten Tal der Welt mäandert ein Flüsschen mit kristallklarem Wasser durch die üppig grünen Wiesen des Frühsommers. Mit seinem köstlichen Nass kann man jederzeit seinen Durst stillen. Zitronenfalter und Tagpfauenauge flattern von Blüte zu Blüte der in allen Farben prächtig blühenden Wiesenblumen. Drosseln und Finken trällern lauthals Lieder purer Lebensfreude, während Hummeln und Bienen eifrig summend die Schmetterlinge bei der Befruchtung der Blüten unterstützen. Über diese Orgie aus Fruchtbarkeit und Lebensfreude wacht hoch droben auf einem Berg die Burg Lichtenberg mit ihren schroffen Mauern, über denen kantig der mächtige Burgfried thront. Der Anblick der herbstlich bunten Weinberge an den steilen Hängen unterhalb der Burg lässt sein Herz höherschlagen. Ach, der schwäbische Wein! Was gibt es Schöneres, als auf einem ausgelassenen Fest mit einem Trollinger in der Hand ein fesches Mädel in ihrem eng geschnürten Mieder mit einladendem Dekolleté anzuflirten?
Schlagartig ändert sich die soeben noch ausgelassene Feststimmung. Eine wüste Schlägerei bricht aus, Flüche und wüste Beschimpfungen dröhnen in seinen Ohren. Jemand packt ihn am Kragen und schüttelt ihn heftig.
„Aufwachen! Überfall!“
Die Explosionen mehrerer Schüsse in unmittelbarer Nähe wecken ihn schlagartig. Verwirrt versucht Wilhelm sich in der Dunkelheit zu orientieren. Wo ist er? War er nicht eben noch in seinem lieblichen Bottwartal?
„Wilhelm! Nun mach schon!“
Etwas Hartes, Kaltes wird ihm in die Hand gedrückt. Seine Hand umschließt automatisch das Mauser 98. Bitter erinnert sich Wilhelm daran, dass er Idiot freiwillig die Heimat verlassen hat, um Abenteuer in der großen, weiten Welt zu erleben. Gemeinsam mit anderen Narren wie ihm befindet er sich in diesem Moment auf Patrouille in einem heißen, trockenen Land, in dem es kein seiner Bottwar ebenbürtiges Flüsschen gibt. Wilhelm stülpt sich seinen Filzhut über, dann kriecht er endlich aus dem Zelt und sucht seine Kameraden.
Die Lage hat sich beruhigt, keine weiteren Schüsse ertönen. In geringer Entfernung erhellen mehrere Laternen eine Gruppe Männer. Widerwillig nähert sich Wilhelm ihnen, ahnend, dass ihn dort nichts Gutes erwartet. Als er in den Kreis tritt, sieht er in der Mitte zwei Tote liegen, die aus mehreren Einschüssen bluten. Wilhelm kämpft gegen den Drang zu erbrechen an. Er wird sich nie an den Anblick von Toten gewöhnen. Ein dritter Hottentotte kauert mit der Stirn im Staub und winselt: „Gnade! Massa! Gnade!“
„Drecks-Nigger!“ Einer der Umstehenden spuckt auf ihn. „Lasst uns nicht lange fackeln. Knüpfen wir den Dieb einfach auf!“
Erst jetzt sieht Wilhelm den Mehlsack halb unter einem der Toten hervorlugen. Wegen des Hungers waren die drei Eingeborenen offensichtlich verzweifelt genug, ausgerechnet eine Patrouille der Schutztruppe zu bestehlen. Anders kann Wilhelm sich eine derart selbstmörderische Wahnsinnstat nicht erklären.
„Ein Diebstahl ist doch kein Grund, jemanden zu hängen!“, empört er sich.
„Ist doch nur ein Hottentotte!“
„Auch Hottentotten sind Menschen! Vielleicht ist er zudem ein Christ!“
„Der? Nie im Leben, sonst würde er nicht stehlen!“
Als ob Christen nicht stahlen! Was war das ganze Unterfangen hier in Deutsch-Südwestafrika anderes als Diebstahl? Wilhelm kann sich gerade noch zurückhalten, seine Gedanken laut auszusprechen.
„Ruhe, Männer!“, mischt sich Feldwebel Bach ein. „Wilhelm hat recht, wir können den Hottentotten nicht einfach hängen! Fesselt ihn, wir nehmen ihn mit.“
Wilhelm verspürt Erleichterung, auch wenn einige Kameraden ihm böse Blicke zuwerfen. Damit kann er leben, Hauptsache, sein Gewissen bleibt rein, damit er eines Tages mit sich im Reinen vor den Schöpfer treten kann. Wie die Sache hier in Deutsch-Südwestafrika läuft, wird das schwer genug werden.
Um dem Hottentotten unnötige Misshandlungen zu ersparen, greift er sich einen Strick und tritt auf den noch immer im Staub knienden Mann zu. Jener wendet seinen Kopf in Wilhelms Richtung. Im flackernden Schein der Laterne sieht er mit seinen dunklen Augen zu ihm empor.
„Danke, Massa.“
***
Die Leiche ist längst in der Gerichtsmedizin, als ich endlich am Präsidium eintreffe. Sabrina ist noch beim Verfassungsschutz. Nicht nur die kennen sich bei den Rechtsextremen aus, sondern auch unsere Kollegen von der Kriminalinspektion 6, dem Staatsschutz. Ich rufe Mehmet an, der vor Jahren von der K 3 dorthin gewechselt ist, und erkläre ihm, was ich wissen will. Er verspricht mir, sich umzuhören und bald wieder bei mir zu melden. Ich rechne damit, frühestens am nächsten Tag von ihm zu hören. Stattdessen steht er wenige Minuten später aufgeregt in meinem Büro.
„Es gibt ein Bekennerschreiben!“
„Wegen des Friedhofs-Mords?“
„Ja.“
„An wen ist es adressiert?“
Mehmet verdreht die Augen.
„An den Verfassungsschutz, den Staatsschutz und die übrigen Mitglieder der Atomwaffen Division.“
„Der was?“ Misstrauisch fixiere ich ihn. „Verarschst du mich?“
Mehmet verzieht keine Miene und erklärt ruhig: „Die Atomwaffen Division ist eine Telegram-Gruppe, in der …“
„Langsam, ich verstehe nur Bahnhof!“
Er sieht mich an, als ob ich ein begriffsstutziges Kind wäre. Schon in der Schule hasste ich diesen Blick mancher Lehrer. Ich will ihn soeben angehen, als er einlenkt.
„Also gut, dann für Anfänger. Für Smartphones gibt es Messenger-Dienste, deren bekanntester WhatsApp ...“
„Das habe selbst ich mitbekommen!“
„Das beruhigt mich ungemein.“ Er lächelt. „Telegram ist eine weniger weit verbreitete Konkurrenz von WhatsApp. Jeder, der will, kann dort Gruppen bilden, bei denen wiederum prinzipiell jeder, der bei Telegram ein Konto eröffnet, Mitglied werden kann. Hast du so weit alles verstanden?“
„Klar, so schwer ist das schließlich nicht. Und bei Telegram existiert eine Gruppe mit dem abartigen Namen Atomwaffen Division?“
Mehmet nickt.
„Dabei handelt es sich um eine Neonazi-Gruppe. Jedenfalls brüstet sich dort ein gewisser Udo88 damit, auf einem Friedhof mit einem Schnitt durch die Kehle einen Nigger kaltgemacht und auf einem Grabstein abgelegt zu haben.“
Ich durchdenke das Gehörte, er lässt mir Zeit. Schließlich frage ich: „Kann dieser Udo88 aus der Presse von dem Mord erfahren haben und sich als Trittbrettfahrer mit fremden Federn schmücken?“
„Nein, definitiv nicht. Er hat es bereits gestern Abend um zwanzig Uhr einunddreißig geschrieben.“
Der Leichenfund wurde dem Notruf erst heute Morgen kurz vor sieben Uhr gemeldet. Also stammt das Bekennerschreiben höchstwahrscheinlich tatsächlich vom Mörder oder zumindest aus seinem Umfeld.
„Also haben wir es hier tatsächlich mit einem politischen Mord zu tun?“
„Sieht ganz so aus.“
„Wie habt ihr das Bekennerschreiben so schnell gefunden?“
„Das BKA hat uns einen Tipp gegeben. Vermutlich werden die den Fall übernehmen.“
Ich presse meine Lippen fester aufeinander, sage jedoch nichts. Meine letzte Zusammenarbeit mit dem BKA verlief alles andere als gut. Aber nicht jeder Mitarbeiter dort ist ein Vollpfosten, also besteht selbst in diesem Fall Hoffnung, auch wenn ich einen einmal begonnenen Fall äußerst ungern aus der Hand gebe.
Mehmet sieht mich fragend an. „War das alles?“
„Nein. Was wisst ihr über Udo88? Fiel er euch schon früher auf?“
„Bei ihm handelt es sich um einen üblen Gesellen, der sich schon häufig extrem rassistisch und sexistisch äußerte. Was ich von ihm finden konnte, habe ich dir ausgedruckt.“
Mehmet legt mehrere Blätter vor mir ab. Ich nehme sie zur Hand und fange an zu lesen. Schon auf den ersten Blick ist Udo88 eine Dumpfbacke.
„Warum habt ihr ihm nicht schon längst das Handwerk gelegt?“
„So einfach ist das nicht, besonders solange er sich auf Äußerungen in geschlossenen Gruppen beschränkt. Außerdem werdet ihr selbst schnell merken, wie schwer es ist, die wahre Identität der Typen zu ermitteln. Sie benutzen anonyme Prepaidkarten und sind immer nur für kurze Zeit online. Viel Spaß bei der Fahndung.“
Grußlos verlässt Mehmet mein Büro. Ich bleibe alleine zurück und starre auf die vor mir liegenden Ausdrucke. Etwas Düsteres, Bedrohliches geht von dem Stapel Papier aus. Sind Neonazis das personifizierte Böse, der Antichrist der Postmoderne? Grundsätzlich neige ich nicht zu dieser Ansicht. Von den zahllosen Möglichkeiten, sich eigene Überlegenheit vorzugaukeln, ist Rassismus sicher eine der weniger cleveren, um nicht zu sagen, eine richtig dumme. Aber ist er deshalb böse? Ist überhaupt irgendetwas per se böse?
Ein weiteres Mal lese ich die Ausdrucke, diesmal ganz langsam, lasse jedes einzelne Wort auf mich wirken. Die Worte von Udo88 drücken unbändige Wut und tiefen Hass aus. Aber oft sind beides nur sekundäre Emotionen, die dazu dienen, äußerst schmerzhafte primäre Emotionen nicht fühlen zu müssen. Verbirgt sich unter diesen starken Emotionen die tiefe Verzweiflung eines lebenslänglich Ausgegrenzten, der gelernt hat, sich oberflächlich anzupassen, ohne im Menschsein wirklich klarzukommen? Nutzt er seinen Hass, um das unerträgliche Gefühl von Verzweiflung und Ausgrenzung nicht spüren zu müssen?
Dann diente der Hass eher der Selbstregulation und wäre nicht oder nur wenig kriminell, noch weit von einem kaltblütigen Mord entfernt, zumindest solange Udo88 sich auf seine Fantasie und Worte in einer geschlossenen Gruppe beschränkt. Welcher Impuls führte dazu, dass Udo88 die Welt seiner unappetitlichen Fantasien verließ und zur Tat schritt? Und werden jetzt, da er einmal die Grenze überschritten hat, bald weitere Opfer folgen?
Plötzlich überfallen mich Zweifel, ob überhaupt dieser Udo88 den Mord begangen hat. Nach dem ersten Befund des Gerichtsmediziners wurde dem Opfer, einem großen, kräftigen Mann, vermutlich von hinten mit einem einzigen gezielten Schnitt die Kehle durchtrennt. Das sieht mir eher nach der kaltblütigen Tat eines Killers aus, der so etwas schon oft getan hat, vielleicht auch eines Elitesoldaten, der so etwas bis zur Routine geübt hat. Aber mordet jemand, der sich von seinem Hass steuern lässt, derart kaltblütig?
Seufzend nehme ich mein Telefon zur Hand und installiere darauf Telegram. Kurz zögere ich, melde mich dann aber unter dem Pseudonym Arier88 an und beantrage die Aufnahme in die Gruppe Atomwaffen Division. Die 88 muss sein, steht sie in diesen Kreisen doch für „HH“ oder „Heil Hitler“. Zu meiner Überraschung dauert es keine Minute, dann bin ich drin. Die scheinen ja sehnsüchtig auf neue Mitglieder zu warten. Oder liegt es an meinem verheißungsvollen Pseudonym, dass ich so schnell in die Gruppe aufgenommen wurde?
Ich scrolle zum Beitrag von Udo88, unter dem sich zahlreiche Kommentare aufreihen. Alle sind zustimmend, teilweise wird er als Held gefeiert. Ausnahmslos handelt es sich bei den Kommentaren um Schwachsinn. Mich erstaunt, dass niemand seine Täterschaft anzweifelt. Wer gerne sein eigenes Maulheldentum verdrängt, konfrontiert offensichtlich ungern andere mit dem ihren.
„Hast du Pics?“, tippe ich ein.
Es erscheint mir absurd, auf solchem Weg mit einem möglichen Mörder in Kontakt zu treten, aber einen Versuch ist es wert. Vielleicht bin ich einfach zu altmodisch und habe noch nicht mitbekommen, dass heutzutage selbst Mörder sich gerne mit Selfies von ihren Taten brüsten. Gerade als ich Telegram verlassen will, antwortet jemand auf meine Frage.
„Au ja, Bilder wären geil!“
Leider keine Antwort von Udo88. Ein weiterer Post ploppt auf.
„Ein Video mit dem spritzenden Blut des Niggers wäre noch geiler!“
Schnell schließe ich Telegram, um mich vor Seelenmüll und Hass zu schützen. Stattdessen öffne ich auf meinem Computer die amerikanische Suchmaschine, die manche ebenfalls für das Böse halten.
„Anonyme Prepaidkarte“, tippe ich in die Suchmaske.
Der Riese aus dem Silicon Valley benötigt einen Sekundenbruchteil, um mir dreihunderteinundachtzigtausend Ergebnisse zu liefern. Ich mag es nicht glauben. Ist es wirklich so verdammt einfach, an die Grundausstattung illegalen oder zumindest unappetitlichen Handelns zu gelangen? Fast ganz oben wird in den Ergebnissen auf einen anderen Silicon-Valley-Riesen verwiesen. Ich öffne die Seite des größten Auktionshauses der Welt. Zu Spottpreisen werden anonyme Prepaidkarten frei Haus offeriert. Soll ich eine bestellen?
Ein Klopfen stört meine Überlegungen. Auf meine Aufforderung hin tritt Klaus-Maria Henssler ein, der Leiter unserer Kriminaltechnik. In der Hand hält er einen schmalen Hefter. Also hat er erste Ergebnisse.
„Mittels seiner Fingerabdrücke haben wir die Identität des Toten ermittelt.“
Klaus-Maria reicht mir den Hefter. Ich öffne ihn. Ab diesem Moment besitzt der Tote für mich einen Namen und wird zu einer Person, nämlich zu Herrn Festus Munjuku aus Namibia. Im Stillen verspreche ich ihm, alles zu tun, damit sein Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt wird.
„Vor drei Tagen ist der Mann in Frankfurt gelandet“, informiert mich Klaus-Maria.
„Weiß man, was er hier wollte?“
„Nein, aber sein Quartier passt weder zu einem Geschäftsmann noch zu einem gewöhnlichen Touristen.“
„Wo hat er sich denn einquartiert?“
„In der Pension Leypoldt.“
„Der Name sagt mir nichts. Muss man die Pension kennen?“
„Heutzutage nicht mehr. Aber früher, zu den Glanzzeiten des Stuttgarter Balletts, logierten dort Stars wie Marcia Haydée.“
„Willst du damit sagen, der Tote war ein Fan des Stuttgarter Balletts?“
„Wer weiß.“ Er zuckt mit den Achseln. „Du bist der Ermittler, ich bin nur der Techniker. Der Ruf der Primaballerina zog andere Künstler an, wenn sie zu Besuch in der Stadt waren, dort ebenfalls abzusteigen. Ich tippe jedenfalls darauf, dass er in Künstlerkreisen verkehrte.“
Grußlos verlässt Klaus-Maria mein Büro. Ich beschließe, mir das Zimmer des Toten näher anzusehen. Zuvor bestelle ich im Internet noch schnell eine anonyme Prepaidkarte.
Durch die Stadt fahre ich die Alte Weinsteige hoch Richtung Filderebene. Knapp unterhalb Degerlochs liegt die Pension Leypoldt. Sie entpuppt sich als eine einst stolze Villa, umfunktioniert zu einer Beherbergungsstätte, deren gute Zeiten Jahre, oder eher Jahrzehnte, zurückliegen.
Das Gebäude wirkt ungepflegt und verwahrlost. Die Leuchtbuchstaben sind altmodisch und teilweise defekt, der Putz blättert ab, und auch die Fenster benötigen dringend einen Anstrich. Hier steigen entweder Leute ab, die in der Vergangenheit leben und in ihrer Fantasie den Glanz vergangener Tage heraufbeschwören, oder natürlich jene, denen das Geld nicht so locker sitzt oder die schlicht keines haben. Zumindest dürften einige der Zimmer einen grandiosen Blick über den Stuttgarter Talkessel hinweg auf den Killesberg und das Neckartal haben. Ich parke und will das Haus betreten. Die Tür ist abgeschlossen. Hinter der Scheibe ist eine handschriftliche Notiz mit einem Stück Tesa schief aufgeklebt. Darauf stehen eine Handynummer und die Aufforderung, dort anzurufen, sollte die Tür verschlossen sein. Ich folge der Aufforderung, tippe die Nummer in mein Telefon ein und erhalte als Belohnung die Auskunft, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar sei.
Ich hole tief Luft und werfe einen Blick auf die Uhr. Ob Sabrina beim Verfassungsschutz etwas erreicht hat? Vermutlich nicht, sonst hätte sie mich angerufen. Da der Tote ein Reisender aus Namibia ist, kann ich heute weder seine Angehörigen informieren noch sein Umfeld befragen. Ich beschließe, Feierabend zu machen. Ganz in der Nähe ist das Teehaus Weissenhof. In dem hübschen Pavillon war ich schon zu lange nicht mehr. Heute werde ich mir dort ein Abendessen gönnen.
Tag 2
Die Nacht brachte keinen tiefen, erholsamen Schlaf, sondern quälte mich mit Albträumen. Jene kreisten darum, ein weiteres Mal ohnmächtig mit ansehen zu müssen, wie ein vom Ehrgeiz zerfressener Ermittler des BKA die Ermittlungen in den Sand setzt. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe absolut nichts gegen Ehrgeiz, im Gegenteil. Aber alle Ambitionen eines Mordermittlers müssen dem richtigen Ziel dienen, nämlich unter Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien einen Mörder zu überführen.
Erschöpft von meinen quälenden Albträumen stehe ich heute später als üblich auf. Kurzerhand verzichte ich auf das Frühstück in meiner Küche. Stattdessen kaufe ich mir unterwegs beim Bäcker ein Croissant. Meinen alten Daimler bugsiere ich in eine zu schmale Parklücke am Präsidium. Mühsam quetsche ich mich dann durch die nur einen Spalt weit zu öffnende Fahrertür.
Ich seufze. Der Tag droht genauso lausig zu werden wie die hinter mir liegende Nacht. Um das miese Karma zu durchbrechen, beschließe ich, mir ein schönes Frühstück am Schreibtisch zu gönnen. Gerade als meine Siebträger-Maschine fauchend den Kaffee zum Croissant ausspuckt, klopft es. Ehe ich reagieren kann, wird die Tür aufgerissen und Sabrina stürmt herein.
„Wir sind raus aus dem Fall! Wegen des Verdachts auf eine rechtsextreme, rassistisch motivierte Gewalttat übernimmt ab sofort das BKA!“
In Ruhe schalte ich die Maschine aus, nehme den Cappuccino und setze mich an meinen Schreibtisch. Dort gönne ich mir einen herzhaften Biss ins Croissant und einen Schluck vom heißen Kaffee, ehe ich frage: „Guten Morgen, Sabrina, weiß man schon, wen Wiesbaden zu uns schickt?“
„Ein Kommissar Lohse leitet deren Team. Er stammt aus der Nähe Stuttgarts und war vor einigen Jahren schon einmal hier. Gestern wurde zuerst eine Frau als Teamleiterin angekündigt, aber Lohse wollte unbedingt den Job.“
Ich verschlucke mich an meinem zweiten Schluck Kaffee, stelle hastig die Tasse ab und springe auf.
„Scheiße!“
Warum vertrödele ich hier unnötig Zeit mit Frühstücken? Sabrina sieht mich überrascht an.
„Kennst du den Kollegen Lohse?“
„Allerdings!“
„Oh, dann wird es für euch ja ein Wiedersehen. Ich soll dich übrigens für eine erste Besprechung mit den Wiesbadenern holen. Komm mit!“
Sie dreht sich zur Tür.
„Du hast mich hier nicht mehr angetroffen! Ich war schon unterwegs!“
„Unterwegs?“ Sie hält inne, dreht sich zurück in meine Richtung und glotzt mich an. „Aber du bist doch hier.“
„Gleich nicht mehr.“
Ich stürme zur Tür. Im Vorbeigehen greife ich nach meiner Jacke. Sabrina starrt auf mein auf dem Schreibtisch zurückgelassenes Frühstück und das ebenfalls dort liegende Handy.
„Wo willst du hin?“
„Mir das Zimmer des Ermordeten ansehen.“
„Kennst du seine Identität?“
„Erkläre ich dir alles später, wenn ich wieder zurück bin.“
„Aber …“
Ich schließe die Tür hinter mir, hetze den Flur entlang und stürze die Treppe hinunter. Erst als sich die Schranke hinter meinem Daimler schließt, atme ich auf. Mit wirren Gedanken im Kopf durchquere ich den Talkessel. Genau wie am Vortag tuckere ich auf der gegenüberliegenden Seite die Neue Weinsteige hoch. Wie konnten meine Träume wissen, dass erneut Lohse kommen würde?
Beim hellen Licht des Tages wirkt die Pension Leypoldt noch trostloser. Ich wünschte, Herr Munjuku hätte sich auf seiner letzten Reise eine luxuriösere Unterkunft gegönnt. Wie gestern parke ich auf einem für Pensionsgäste reservierten Parkplatz und laufe zum Eingang. Der Zettel mit der Handynummer wurde entfernt, die Tür lässt sich öffnen. Erleichtert betrete ich das Haus. Augenblicklich überfällt mich der aufdringliche Zitrusduft eines Reinigers. Bei der chemischen Attacke auf meine Sinnesorgane handelt es sich um einen armseligen Versuch, den unter Chlor und künstlichen Aromen lauernden Muff der Verwahrlosung zu übertünchen.
Die Rezeption ist verwaist. Ich blicke mich um, kann jedoch niemanden entdecken. Also tippe ich auf die altertümliche Messingklingel. Ein helles Ping erklingt und wabert durch die Räume.
„Komme gleich!“, schallt es umgehend aus einem seitlich wegführenden Flur.
Ich höre jemanden etwas wegräumen. Dann erscheint eine Frau mit langen, schwarzen Haaren, ihr hübsches Gesicht ziert ein gewinnendes Lächeln. Zu einem knielangen, schwarzen Rock und einer blickdichten, ebenfalls schwarzen Strumpfhose trägt sie eine weiße, seidig schimmernde Bluse. Zielstrebig schiebt sie sich an mir vorbei hinter die kleine Rezeption. Trotz ihres eleganten Outfits bin ich mir sicher, dass ich sie soeben vom Reinigen des Bodens abhalte. Die Pension Leypoldt ist ein Eine-Frau-Betrieb, sie hier das Mädchen für alles.
„Wollen Sie ein Zimmer?“
Gewinnend lächelt sie mich an. Ihre Hoffnung berührt mich. Es behagt mir nicht, sie enttäuschen zu müssen.
„Nein, tut mir leid, ich bin Polizist und dienstlich hier. Kennen Sie diesen Mann?“
Ich lege einen vergrößerten Abzug des Passfotos von Herrn Munjuku vor ihr auf die Theke. Dabei bin ich froh, ihr kein schauriges Bild seiner Leiche präsentieren zu müssen. Ihrem Blick entnehme ich, dass sie ihn erkennt. Sie hebt ihre Augen wieder, sieht mich reserviert an.
„Zeigen Sie mir zunächst bitte Ihren Dienstausweis?“
„Selbstverständlich.“
Ich zücke ihn und strecke ihn ihr hin. Sie starrt eine Weile angestrengt darauf, bricht dann in ein herzliches, warmes Lachen aus.
„Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie der Dienstausweis eines Polizisten aussieht. Woher soll ich wissen, ob Ihrer echt ist oder Sie ihn selbst gebastelt haben?“
Spätestens ab jetzt hat sie direkten Zugang zu meinem Herzen. Mit dunklen, tiefgründigen Augen sieht sie mich eindringlich an.
„Aber Sie besitzen ein gutes Herz, ich vertraue Ihnen.“
Egal, wie schäbig das Gebäude ist, solange diese Frau die Gäste betreut, lohnt sich eine Übernachtung auf jeden Fall. Mich zumindest berührt sie zutiefst.
„Er ist Ihr Gast, oder?“
Sie nickt.
„Er kam vorletzte Nacht nicht. Ist ihm etwas passiert?“
„Woher wissen Sie …“
„Bevor ich gestern das Frühstück abräumte, klopfte ich an der Tür seines Zimmers. Als er nicht reagierte, schloss ich leise auf und betrat vorsichtig sein Zimmer. Das Bett war unbenutzt. Heute ist er auch noch nicht heruntergekommen. Wollen Sie mir nicht endlich verraten, was mit ihm ist?“
Ich zögere. Einerseits will ich sie nicht mit so etwas Schrecklichem wie einem Mord belasten, andererseits will ich aber auch ihr gegenüber ehrlich sein.
„Der Mann wurde ermordet. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?“
Sie zieht scharf die Luft ein, taumelt und krallt sich mit beiden Händen an der Theke fest. In weniger als einer Sekunde bin ich um die Theke herum, packe sie am linken Oberarm und führe sie zu einem grünen Samtsessel. Ihre Nähe und ihr Duft betören mich so sehr, dass mir schwindelt. Beim Sessel angelangt, helfe ich ihr behutsam, sich zu setzen. Bedauernd zaudere ich, sie loszulassen.
„Geht’s wieder einigermaßen?“
„Ja, danke.“
„Die Konfrontation mit dem Tod ist immer schwer.“
Sie schenkt mir ein zauberhaftes Lächeln.
„Ich heiße Anica.“
Soll ich jetzt etwa meinen Vornamen nennen und ihr das Du anbieten? Anica sieht mir meine Verlegenheit an und fährt fort: „Vorgestern, um kurz nach sieben Uhr, sah ich Herrn Munjuku letztmals. Er wollte zu Fuß in die Innenstadt, um sich mit jemandem zu treffen.“
„Wissen Sie, mit wem er sich treffen wollte?“
„Nein, da muss ich passen.“ Sie schüttelt ihren hübschen Kopf. „Aber vermutlich ging es um eine Familienangelegenheit.“
„Um welche Familienangelegenheit?“
„Keine Ahnung, aber sie war der Grund für seine Reise.“
Wenn das stimmt, liegt Klaus-Maria mit seiner Vermutung richtig, dass der Ermordete weder Tourist noch Geschäftsreisender war. Herr Munjuku kam auf Verwandtschaftsbesuch nach Stuttgart. Wurde er zum Opfer eines blutigen Familienstreits, vielleicht um eine große Erbschaft?
„Also besuchte Herr Munjuku hier in Stuttgart Verwandte?“
Anica runzelt die Stirn.
„Während ich ihm vorgestern den Tee servierte, telefonierte er in seiner Sprache mit jemandem. Direkt im Anschluss fragte er nach dem besten Weg zu Fuß hinunter in die Stadt. Auf mich erweckte es den Eindruck, als habe er sich mit jemandem aus seinem Land in der Stadt verabredet.“
„Was meinen Sie mit seiner Sprache?“
„Für mich klang es afrikanisch, zumindest war es weder Deutsch noch Englisch, obwohl er beide Sprachen perfekt beherrscht.“
„Wie war die Stimmung während des Telefonats?“
„Es gab keinen Streit, falls Sie darauf hinauswollen.“
„Sondern?“
Ihr erneutes Stirnrunzeln zeigt, dass sie angestrengt nachdenkt.
„Er wirkte streng und entschlossen. So, als würde er eine junge Verwandte davor bewahren wollen, einen Fehler zu begehen.“
Unwillkürlich muss ich grinsen.
„Interessant! An welche Art von Fehler denken Sie denn?“
Anica errötet, hält meinem Blick jedoch stand.
„Natürlich daran, sich auf den falschen Mann einzulassen!“
Ich bin versucht zu fragen, ob sie selbst diesen Fehler einmal begangen hat. Die Antwort interessiert mich zwar brennend, hat mit den Ermittlungen aber rein gar nichts zu tun. Also stelle ich sie nicht. Stattdessen frage ich: „Haben Sie eine Handynummer?“
Ihr Blick wird misstrauisch.
„Klar, jeder hat heute ein Handy, ich besitze ebenfalls eines.“
Irritiert öffne ich den Mund, um zu fragen, was das soll, als mir bewusst wird, was ich gesagt habe, und selbst erröte.
„Äh … Ich meine, haben Sie seine Handynummer, also die von Herrn …“
Verzweifelt suche ich in meinem Hirn nach seinem exotischen Namen.
„… Munjuku? Ich müsste nachsehen, aber üblicherweise haben wir die. Zumindest fragt unser Buchungssystem die Gäste danach.“