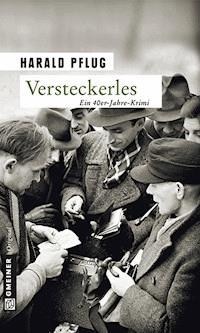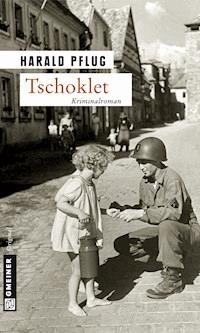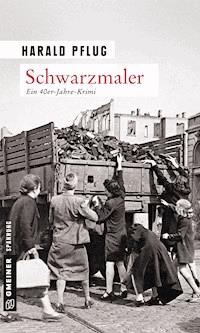
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Captain John Edwards
- Sprache: Deutsch
In der Karlsruher Oststadt wird die Leiche des Ettlinger Stadtrats Schüssele entdeckt. In seiner Brust steckt ein Jagdmesser. Captain Edwards und seine Scouts nehmen die Ermittlungen auf. Doch diese gestalten sich zunehmend schwieriger. Die Amerikaner haben es mit einem gerissenen Täter zu tun, der seine Spuren verwischt und Karlsruhe mit einer Brandserie überzieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Pflug
Schwarzmaler
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von:
© SZ Photo / Süddeutsche Zeitung Photo
ISBN 978-3-8392-4674-0
Widmung
Für meine Familie und unsere besten Freunde
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst.
Er gibt auch anderen eine Chance.
(Winston Churchill)
Prolog
Ein grauer, wolkenverhangener Himmel hing über der Karlsruher Oststadt mit ihren allgegenwärtigen Trümmerbergen und hohlen Hausfassaden. Ein eisiger Wind fegte das letzte Laub des vergangenen Herbstes durch die Straßen. Durch die Schuttberge der Gerwigstraße hindurch konnte Albert Semmelmann die riesige Dunstglocke aus Dampf und Abgasen erkennen, die ständig von den Öfen und Schornsteinen der Gaskokerei am Schlachthof aufstieg.
Auf das vor ihm liegende Gelände der Molkereizentrale hatten einige Tage zuvor ein paar Lastwagen mehrere große Haufen mit Steinkohle gekippt. Diese lagen nun, zwar hinter einem Zaun, doch trotzdem einladend wie auf dem Präsentierteller, vor ihm. Ein paar leere Eisenbahnwaggons säumten den Ostteil des Geländes und boten ihm, wie jeden Abend, Schutz vor neugierigen Augen.
Jede Handvoll Kohlen war in diesen Tagen willkommen, bot sie doch die Möglichkeit zu heizen und etwas zu kochen, falls noch Lebensmittel da waren.
Albert schaute sich ein letztes Mal um, konzentrierte sich und kletterte, flink wie eine Katze, über den Zaun der Molkerei, wo er in den dunklen Schatten der teilweise verfallenen Lagergebäude verschwand und sich in der Nähe seines Stammplatzes, einem hölzernen Turm mit einem verbeulten Blechbehälter darauf, versteckte.
Sein Unterschlupf lag günstig. Die Wachen patrouillierten nichts ahnend an ihm vorbei und während er darauf wartete, dass sie hinter den Lagern verschwanden, begann er, die mitgebrachten Fäustlinge anzuziehen.
Erst als er sich sicher war, dass ihn niemand sehen konnte, rannte er geduckt hinüber zu dem im Schatten der angrenzenden Häuser liegenden Kohleberg, erklomm ihn und begann die Kohlestücke durch seine Beine hindurch, ähnlich wie ein grabender Hund, nach hinten Richtung Zaun zu werfen. Die auf dem Fußweg wartenden Begleiter hatten bereits einige Decken darüber gehängt, um den Lärm der anfliegenden Kohlen zu vermindern. Gleichzeitig zogen viele Kinderhände den Brennstoff unter dem Zaun hindurch, wo die Menschen ihn in ihren Taschen verschwinden ließen.
Fünf Minuten hatte der Mann jeweils Zeit, um seinen Diebstahl durchzuführen, dann musste er sich wieder in dem Turm verstecken. Die ganze Aktion würde normalerweise ein paar Stunden dauern und ihm und den Leuten vor dem Zaun einige Zentner Kohlen bescheren. Bis jetzt war immer alles gut gegangen. Einer der Männer auf dem Gehweg sah auf die Uhr, klopfte seinen Absatz auf den Boden und die Decke verschwand in Windeseile von dem Zaun.
Albert rannte die knapp zwanzig Meter praktisch lautlos zurück zu dem Holzverschlag, nicht einmal eine Minute später waren die Wachleute wieder da. Diese bemerkten ihn jedoch nicht.
Der Schuppen, der den Wasserbehälter stützte, war ideal. Er hatte tagsüber schon Kinder darin Räuber und Gendarm spielen sehen, während die umliegenden Bauern ihre Milch ablieferten.
Wenn er hier saß, roch es nach faulendem Holz und feuchter Erde. Die Zeit, bis das Fundament nachgeben würde, musste mit nächtlichem Kohlendiebstahl genutzt werden.
Heute war es jedoch anders. Ein feiner, süßlicher Hauch von Parfüm und Leder vermischte sich mit dem erdigen Odem der Umgebung. Einer inneren Eingebung folgend stand Albert auf, statt in dem Versteck hocken zu bleiben, und begab sich über die Leiter in dem Verschlag auf die nächsthöhere Ebene. Dort bemerkte er einen großen unförmigen Gegenstand, der auf dem Bretterboden lag. Als er ihn in Windeseile abtastete, erschrak er. Der vermutete Sack entpuppte sich als ein dicker menschlicher Körper, in dessen Brust ein langes Messer steckte. Kälte hatte den Leichnam einigermaßen konserviert, sodass die Verwesung noch nicht weit fortgeschritten war. Gerade als er wieder von der Ebene heruntersteigen und den Toten sich selbst überlassen wollte, hörte er ein Ächzen im Gebälk, gefolgt von einem lang anhaltenden Knarren. Albert merkte, wie die ganze Holzkonstruktion in Schräglage geriet.
Ehe er sich versah, brach alles um ihn herum zusammen, der leere Blechbehälter fiel scheppernd herunter und das Stützgestell legte sich der Länge nach direkt vor die Füße der erschrockenen Wachmänner. Als diese den Kohledieb im Schein der Taschenlampen erkannten, sahen sie, wie dieser sich krampfhaft am Griff des Messers im Leichnam festhielt und die Männer mit einem schiefen Grinsen anstarrte.
Montag, 26. November 1945, 15.30 Uhr
»Nehmen Sie Platz, meine Herren«, schnarrte der Kasernenkommandeur der Blackhawk-Kaserne in Knielingen, Lieutenant Colonel Theodor Armstead, und setzte für den Bruchteil einer Sekunde ein Lächeln auf. Der rothaarige, untersetzte Mann mit dem großen Feuermal am Hals wirkte gereizt. Seine bleichen Hände umkrallten den Rand des Rednerpults, sodass die Knöchel weiß hervortraten. Kurz zuvor hatte er ein kleines Buch aus seiner Uniformjacke hervorgezogen und darin geblättert. »Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Quartalsbriefing in meinem Büro. Da wir nicht riskieren möchten, dass uns mal wieder alle im Kasino zuhören«, er grinste in die Runde, »müssen Sie heute Nachmittag auf Ihren geliebten Kaffee und Ihre Zigarette verzichten.« Diese Bemerkung ließ die Zuhörer angesäuerte Blicke tauschen. »Ich möchte Ihnen kurz unsere weitere Vorgehensweise in den nächsten drei Monaten erörtern. Diese wird geprägt sein von, sagen wir malNoteinsätzenfür die Bevölkerung und einer stetigen Weiterentwicklung unseres Standortes Karlsruhe. Wie Ihnen sicherlich nicht entgangen sein dürfte, stehen wir vor einem frühen Wintereinbruch«, sagte er und unterbrach sich, um seine Brille zu putzen. »Punkt 1: Um dem hiesigen Heizproblem in der Bevölkerung vorzubeugen, haben wir bei dem übergeordneten District Command erreicht, dass uns innerhalb der nächsten zwei Wochen aus dem Hafen in Mannheim Züge mit dreißigtausend Tonnen Kohle, verteilt auf fünf Dampfzugfahrten, beliefern werden. Das Haupteisenbahnnetz in der US-Zone ist dank der Hilfe der Military Railway Service Division wieder zu achtzig Prozent befahrbar. Es ist geplant, pro Tour sechstausend Tonnen aus Mannheim zu holen. Mein Stab und ich haben die logistischen Gegebenheiten und das Verladeschema im Mannheimer Hafen geprüft.« Der Offizier stützte sich auf sein Rednerpult und sah die Zuhörer wohlwollend an. Dann erhob er seine Stimme. »Es müsste machbar sein, die Tour an einem Tag zweimal zu schaffen, entsprechende Ausfälle sind natürlich eingeplant. Die erste Tour haben wir für Sonntag, den 2. Dezember geplant, die zweite am Sonntag darauf. Das ist möglich, da an diesem Tag mit einem verminderten Zivilverkehr zu rechnen ist. Und dabei zähle ich auf Sie, meine Herren. Die Kohlen und Briketts werden zu fünfzig Prozent bei der Gaskokerei an der Durlacher Allee gelagert, die andere Hälfte kommt in den Rheinhafen. Mitte Dezember bekommen wir noch einmal so viel, sollte das Wetter mitmachen. Es liegt an uns, alles gerecht zu verteilen.« Lautes Gemurmel setzte unter den Offizieren ein. Manche waren sich nicht sicher, ob der Transport ohne Störung verlaufen würde.
»Ruhe, meine Herren!« Armstead pochte mit den Fingern auf das Pult. »Nächsten Sonntag machen wir uns auf den Weg. Wir sehen uns vorab noch einmal am Donnerstag. Planen Sie bitte um fünfzehnhundert ein weiteres Treffen ein.« Die Zuhörer blieben unruhig. »Meine Herren, wir sind noch nicht fertig. Kommen wir zu Punkt zwei. Die seit Längerem bekannte, negative Entwicklung bei den Beseitigungsarbeiten der Rheinbrücke werde ich in den nächsten Wochen forcieren lassen. Es ist geplant, einen der fast eingestürzten Brückenpfeiler aus Gründen der Sicherheit sprengen zu lassen, außerdem sollen große Metallteile mithilfe von unseren und französischen Pionieren aus dem Strom gezogen und an Ort und Stelle zerlegt werden. Punkt drei: die Blackhawks. Aufgrund wichtiger und strategischer Umstrukturierungen innerhalb des europäischen Auftretens der US-Streitkräfte haben wir und das Oberkommando uns entschlossen, zwei Drittel der Panzerbrigade inklusive aller gepanzerten Fahrzeuge von Karlsruhe zurück nach Fort Louis in Washington D. C. zu verlegen. Der Rest bildet ab 1946 das Rückgrat der neuen 1. Constabulary Squadron in Karlsruhe. Gleichzeitig werden die Flüchtlinge in den anderen Kasernentrakt, in die Artillerie-Kaserne in der Moltkestraße, verlegt. Innerhalb unserer Kaserne sollen ab Februar eine Kirche und eine Sporthalle mit Swimmingpool gebaut werden, außerdem wird es ein kleines Theater geben. Im Gebäude der Mannschaftskantine wird eine Snack-Bar eingerichtet, die abends und am Wochenende geöffnet hat. Zusätzliche Parkplätze auf Grünflächen, ein Grillplatz und ein Baseball-Feld sind geplant. Das bereits vorhandene, provisorische Spielfeld, wird ausgebaut und mit roter Asche befüllt, so dass wir schon im Frühling ein Eröffnungsspiel machen können.«
Die Anwesenden applaudierten begeistert. Erneut klopfte Armstead auf die Holzplatte.
»Sir, eine Frage.« Ein Captain von der Instandsetzung erhob sich von seinem Stuhl, die anderen sahen ihn erstaunt an. »Was passiert mit dem Namen der Kaserne? Wenn die Blackhawks weg sind, wie heißen wir dann?«
Der Lieutenant Colonel hatte mit diesem Einwand anscheinend gerechnet. »Danke, Collins, eine gute Frage. Doch auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Ab 15. Dezember 1945 werden die Mudrakaserne mit den Flüchtlingen und wir, die Pionierkaserne, zu einem Stützpunkt zusammengefasst und offiziell in Gerszewski Barracks umbenannt. Des Weiteren ist vorgesehen, Anfang 46 die Forstner-Kaserne in Smiley Barracks und die Mackensen-Kaserne am Hauptfriedhof in Philips Barracks umzubenennen. Diese Namen sollen an die auf dem Feld der Ehre gefallenen Soldaten erinnern.«
Ein Raunen ging durch die Gruppe der Zuhörer. Der Kommandeur griff währenddessen unter sein Rednerpult, zog ein Glas Wasser hervor und trank es in einem Zug aus. Als er die Blicke der anderen Offiziere bemerkte, beugte er sich nach vorne und flüsterte: »Ich rede mir hier die Zunge fusselig, da kann ich mir auch etwas zu trinken mitbringen.« Er blätterte erneut in dem Buch. »Die restlichen Informationen beziehen sich auf die aktuelle Besetzung in unserer Kaserne. Wir hängen das später am Schwarzen Brett aus. Wie ich bereits erwähnte, wird ein Teil der Blackhawks nach Fort Louis versetzt, dies wird ab dem 10. Dezember erfolgen und Ende März nächsten Jahres logistisch abgeschlossen sein. Die Vorbereitungen laufen bereits. Dafür bekommen wir im Januar von den Constabularies aus dem Sub-Headquarter am Mühlburger Tor ein Platoon mit dreißig Mann in unsere Basis überstellt. Zur Monatsmitte verlegen wir alle Flüchtlinge aus dem abgesperrten Teil in die andere Kaserne. Wenn dies alles abgeschlossen ist, wir rechnen mal so Mitte April, wird hier zum Jahresende 1946 ein Flugabwehr-Artillerie-Bataillon, bestehend aus zwei Kompanien, mit je acht Flugabwehr-Geschützen stationiert sein.« Er räusperte sich erneut. »Zuletzt möchte ich an die noch immer nicht erledigten logistischen Nachwehen des Besuches von General Dwight D. Eisenhower im September erinnern und schlussendlich das Thema Scouts, denn darum hat mich Captain Codellany persönlich gebeten.« Der Lieutenant Colonel holte tief Luft, kritzelte etwas in sein Buch und wandte sich dann an den Leiter der Scouts, Captain John C. Edwards, der die ganze Zeit nur mit halbem Ohr zugehört und gelangweilt karierte Muster auf seinen Notizblock gemalt hatte. »Edwards, in Anbetracht der Tatsache, dass Sie seit Monaten keine Mannschaftsdienstgrade mehr haben, wird sich die Situation insofern ändern, dass wir den in zwei Wochen abgehenden Sergeant durch zwei neue Privates, einen Versorger und einen ehemaligen Polizisten, ersetzen werden. Da Sie oft und viel Kontakt mit der Stadtverwaltung von Karlsruhe haben, werden Sie einen direkten Kontaktmann bei der Stadtverwaltung im Rathaus sowie zwei Ansprechpartner bei dem von den Polen verwalteten Dienstfahrzeuglager der Stadt erhalten. Beide Kontaktmänner sprechen Englisch und werden Tag und Nacht für Sie erreichbar sein. Für die Scouts wird es eine neue Aufgabe geben, deren Priorität wir noch nicht richtig abschätzen können: das Heizproblem im kommenden Winter. Die Stadtverwaltung wird Sie deswegen kontaktieren.« Der Lieutenant Colonel gab seinem Adjutanten einen Zettel und nickte Captain Edwards wohlwollend zu. Dann bedankte er sich bei den Anwesenden für ihre Geduld und vertagte die Stabsbesprechung augenzwinkernd ins Offizierskasino, wo er Kaffee und Aschenbecher für alle bestellt hatte.
Die zehn Offiziere erhoben sich von ihren Sitzen und begaben sich auf den Flur vor dem Besprechungsraum. Der Adjutant des Lieutenant Colonel, First Lieutenant Mendoza und Captain Codellany von der MP liefen zu Edwards und hielten ihn auf. Mit knappen Worten informierte der Captain ihn über den Kohledieb und den seltsamen Toten in der Oststadt. Er bat Edwards, die Umstände zu untersuchen, die zu dessen Tod geführt hatten.
»Wir haben ein paar Beweisstücke gefunden, dass der Mann vermutlich nicht aus der Oststadt, sondern aus Ettlingen stammte«, informierte ihn der Militärpolizist. »Er schien aufgrund seiner hochwertigen Bekleidung sehr vermögend gewesen zu sein. Der Ausweis, den er bei sich trug, wurde ausgerechnet von der Mordwaffe durchstochen. Wir haben ihn trotzdem schon einmal überprüft: Er gehört einem Mann namens Julius Engel aus Karlsruhe. Was der allerdings mit dem Toten zu tun hatte, wissen wir nicht. Geh in die Asservatenkammer bei der MP und hol dir die Kiste mit den Klamotten. Morgen fahrt ihr bitte nach Ettlingen und versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.« Er klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen.«
Edwards schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss noch ein paar Berichte von unseren letzten Ermittlungsfahrten machen. Sorry, Cody«, er drehte sich um und wollte gerade losmarschieren, da rief der Adjutant des Lieutenant Colonel seinen Namen. »Captain Edwards, hier ist die Liste ihrer Personalveränderung. Soll ich Ihnen von Armstead geben. Die Polen haben sich vor ein paar Tagen vorgestellt. Nette Leute. Der Deutsche ist für die Beschaffung von Heizmaterial der städtischen Einrichtungen zuständig. Ach übrigens, die beiden Soldaten für Ihr Team sind bereits hier angekommen. Freuen Sie sich auf ein paar nette Namen!«
»Warum?« Edwards verzog misstrauisch das Gesicht.
»Ich habe ewig gebraucht, um sie fehlerfrei auszusprechen. Viel Spaß damit!« Mendoza lachte kurz voller Schadenfreude und überreichte ihm den handgeschriebenen Zettel:
PFC Pietro Farina, Militärpolizist
Private Sammy Ka’hale Veelapinat, Versorger
Stadtverwaltung Karlsruhe, Dezernat 15 Heizmaterial, Herr Albert Schöller, Apparat -4100
Motor Pool der Stadt Karlsruhe, Lorenzstrasse: Wladislaw Brzeczyszykiewicz und Helfer Krzysztof Wrosziescylak, Apparat -5401
Dienstag, 27. November 1945, 8.05 Uhr
Der klein gewachsene Soldat mit den braunen Mandelaugen, der sonnengebräunten Haut und den kurzen schwarzen Locken sah seinen neuen Vorgesetzten, Captain Edwards, sichtlich genervt und doch auf eine bestimmte Art amüsiert an.
»Ich habe Ihren Namen leider noch immer nicht verstanden, Private Veela…« Edwards versuchte erneut, seine eigene Handschrift auf dem Zettel vor sich zu entziffern. Er atmete hörbar ein. »Sammy. Sammy Kalala… Kaa… Ich gebe es auf.« Er schüttelte resigniert den Kopf.
»Privade Sammy Ka’hale Veelapinad, Sir. Darf ich es Ihnen aufschreiben?«
»Nein! Was fällt Ihnen ein? Das schaffe ich schon selbst. Also, noch mal.« Edwards knüllte das Formular zusammen und warf es hinter sich in eine Ecke seines Büros, dort wo der Mülleimer stand. Um diesen herum lagen schon ein paar Papierkugeln. Dann öffnete er eine Schublade und zog ein neues unbeschriebenes Formblatt hervor.
»Dienstgrad: Private. Vorname: Sammy«, murmelte er.
»Ja, Sir.«
»Nachname Ke… Ka.«
»Nein, Sir. Zweiter Vorname Ka’hale. Mit einem Okina nach dem ersten A.«
»Ach ja, Okina. Das war der kleine Strich.« Edwards stützte seinen Kopf verzweifelt auf die Hand und fuhr sich mit der anderen durch sein verschwitztes Haar. Im hinteren Teil des Raumes knackte es in dem gusseisernen Radiator. Sein Blick wanderte verstohlen vom Formular auf die danebenstehende Kaffeetasse und den leeren Aschenbecher. Was hätte er darum gegeben, jetzt mit Captain Codellany, dem Vize-Chef der MP in Karlsruhe, einen Kaffee zu trinken und Small Talk zu betreiben. Stattdessen musste er in dem überheizten Office sitzen und die Erfassungsblätter für zwei neue Scout-Mitglieder ausfüllen, die ihm die Stabsstelle gegen seinen Willen und ohne vorherige Information, zugewiesen hatte. Er hatte nicht um Verstärkung gebeten. Aber viel zu spät war vom Stab durchgesickert, dass Sergeant Piece’ Dienstzeit in drei Wochen enden würde. Deshalb erhielt er den Nachwuchs. In den letzten Wochen waren die fünf Scouts ein eingeschworenes Team geworden. Sie saßen in dieser Karlsruher Blackhawk-Kaserne fest, mussten der Militärpolizei wegen Personalmangels unter die Arme greifen und zeitweise stupide Schreibarbeiten machen. Doch es tat sich was in der US-Army. An allen Stellen wurde umstrukturiert, reorganisiert, aufgelöst, neu geschaffen und versetzt. Jeden Tag sahen die Scouts neue Gesichter in der Kaserne. In die Einheit der Blackhawks, einer schweren Panzereinheit des 172. Infanterieregiments, war Bewegung gekommen. Tag und Nacht wurden Fahrzeuge umgestellt, Alarmübungen abgehalten und schweres Gerät aus dem Stützpunkt heraus in den angrenzenden Wald des Pionierübungsplatzes verlegt. Fahrzeuge der UNRRA, der UN-Flüchtlingshilfsorganisation, transportierten neue Flüchtlinge in den anderen Teil der Kaserne oder von dort an weitere leer stehende Standorte. An vielen Stellen wurde gebaut, repariert, renoviert. Überall hausten Menschen, die aus dem Osten vor den Russen geflüchtet waren, Vertriebene aus Jugoslawien, Schlesien, Rumänien, Ungarn und Böhmen, heimgekehrte Soldaten auf der Durchreise, ehemalige KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene. Es war eng und ungemütlich, die ehemals deutsche Pionierkaserne in Knielingen platzte förmlich aus allen Nähten.
Musste ihm der Stab ausgerechnet jetzt einen Insulaner mit einem Sprachfehler schicken?
»Sir?«
Der Private mit dem seltsamen Namen, der angeblich aus Hawaii stammte, stand noch immer wie angewurzelt vor dem Tisch in Edwards Büro. Die immer wieder falsche Aussprache der Buchstaben T und Z des Hawaiianers irritierte den Offizier.
»Sir, darf ich Ihnen den Namen aufschreiben? Ich sag’s auch niemandem, dass Sie … äh, sich verschrieben haben. Mein Name isd edwas komplidsierd.«
Der Captain nickte geistesabwesend und drehte den Zettel um hundertachtzig Grad. »Verdammt, Sie haben recht. Holen Sie sich einen Stuhl und setzen Sie sich mir gegenüber an den Tisch, Private. Seien Sie so nett und füllen Sie den Bogen sauber aus. Bitte! Haben alle auf Hawaii so schwierige Namen?« Edwards betrachtete den jungen Soldaten interessiert. Seine rechte Hand fingerte dabei nervös nach den Zigaretten in seiner Brusttasche, während der Neuankömmling sich eine Sitzgelegenheit heranzog.
»Der isd philippinisch. Mein Dad kommd von den Philippinen, genauer gesagd aus Manila und had damals dord eine Hawaiianerin kennengelernd. Ein paar Monade späder haben sie sich verlobd und sind dsusammen nach Oahu gedsogen.«
Edwards musste lächeln. In seinem Kopf spielte sich gerade ein Film unter Palmen mit Hulamädchen, Ukulelenmusik und Baströckchen ab. So etwas hatte er mal in einer Newsweek gesehen. »Sie sind also im Paradies aufgewachsen, Private.«
»Ja. Bis dszu dem Momend, als die Japaner Pearl Harbor angriffen. Daraufhin beschloss ich, dsur Army dsu gehen.« Der Private füllte den Zettel aus und achtete sehr darauf, deutlich zu schreiben.
»Warum nicht zur Marine? Wäre das auf einer Insel nicht nahe liegender gewesen?«
Der Hawaiianer schüttelte entsetzt den Kopf. »Da wollde ich nichd hin. Bei der Navy gibd es du viel Alkohol und Dsigaredden. So viele Nachbarinnen von mir sind auf bedrunkene Seeleude hereingefallen. Nichds für mich.«
»Nachbarn?«
»Ja, Sir.« Der Insulaner machte ein betrübtes Gesicht. »Diese Haole, Endschuldigung, die Weißen wollen nur Liebe machen und wieder verschwinden. Sie machen die einheimischen Mädchen bedrunken und …« Er schwieg und sah eine Weile zur Seite. »Endschuldigung, Capdain. Ich habe Heimweh nach Oahu. Meine Kinder und meine Frau warden dord auf mich. Ich mache mir Sorgen um sie.«
Edwards ließ überrascht das brennende Streichholz auf den Tisch fallen. »Sie sind schon verheiratet und haben Kinder?«
»Ja, ich habe drei Kinder mit meiner Frau Pualani. Kuahi, Hulani und Keke Olana. Sie sind dwei, drei und vier. Die Army wollde mich anfangs nichd haben, weil ich denen dsu jung war. Da blieb mir genug Dseid, um eine Familie dsu gründen.« Er lächelte. »Vor neun Monaden had es endlich geklappd.«
Edwards war beeindruckt. Nun verstand er, warum der Insulaner wieder nach Hause wollte. Er selbst hatte damals, 1941 in Cliffdale, Illinois, alle Brücken hinter sich abgebrochen. Seinen Eltern schien es damals egal zu sein, dass er nach der Schulzeit an eine Universität ging und dann als Offizier zur Army. Seine alkoholabhängige Mutter machte sich meist nur über ihn lustig, hatte ständig Besuch von älteren Männern. Sein Vater war als Tagelöhner oft wochenlang unterwegs, das verdiente Geld versoff er meist schon am Abend.
Insgeheim beneidete der Offizier Veelapinat. Doch zu weiteren Gedanken kam er nicht, denn in diesem Moment steckte ein Corporal unaufgefordert seinen Kopf durch die Bürotür.
»Captain Edwards, soeben ist PFC Farina hier eingetroffen. Er wartet draußen im Gang auf Sie.«
Kaum hatte Edwards ein flüchtiges »Danke« gemurmelt, war der Corporal auch schon verschwunden.
»Ich bin ferdig, Sir. Alles ausgefülld.«
»Danke, Private.« Edwards musterte das Formular. Es sah aus, als hätte der Hawaiianer die Daten mit einer Schablone geschrieben. »Sie waren bei den Versorgern? Entschuldigung, ich vergaß, Sie danach zu fragen. Ihr Nachname hat mich zu sehr verwirrt.«
Veelapinat gab ein Kichern von sich. »Machd nichds, Sir. Sie sind da nichd der Ersde. Ich war bis April 45 in Ford Lee, Virginia dsur Ausbildung und habe bis vorgesdern als Deilebeschaffer für die 902. Heavy Dranspord in Köln gediend.«
Edwards würde sich nur schwer an die Aussprache des Neuen gewöhnen, doch er wollte ungern ein zweites Mal nachfragen.
»Was für Teile haben Sie denn so beschafft?«
»Dsubehör für Pandser, Lasdwagen, Werkdseuge, Werkdaddeinrichdungen.«
»Danke, Private.« Der Offizier hatte genug gehört. »Nehmen Sie Ihre Sachen und gehen Sie in Gebäude 9138. Der zuständige Sergeant der Wache zeigt Ihnen Ihre Stube. Anschließend melden Sie sich bei First Sergeant Vickers im Motor Pool. Der wird sich freuen, wenn er einen Versorger in seinem Team hat. Wegtreten, Private!«
Der Hawaiianer nickte, sprang auf, grüßte Edwards militärisch und verließ den Raum.
Der Captain lehnte sich in seinem Stuhl zurück, seufzte und steckte sich nun die Zigarette an, die er zuvor unbenutzt neben den Aschenbecher gelegt hatte. Wie kam der Stab bloß auf die Idee, ihm diesen Mann zu schicken? Hoffentlich würde der andere Private mehr taugen. Er nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette und brüllte: »Farina! Reinkommen!«
Der Private First Class mit dem italienischen Namen, der ›Mehl‹ bedeutete, betrat das Büro genauso ohne anzuklopfen wie kurz zuvor der Corporal. Mit beiden Händen tief in den Hosentaschen, Kaugummi kauend und mit einem schiefen Grinsen im Gesicht, ließ sich der Mann ohne Gruß auf dem Stuhl vor Edwards Schreibtisch nieder und streckte die Beine von sich.
»Ich bin der neue MP, den Sie haben wollten.« Farina formte zwei Blasen aus Kaugummi, ließ sie im Mund verschwinden und knackte sie dort hörbar. Daraufhin strich er sich eine lange schwarze Haarsträhne nach hinten, die ihm unter dem Schiffchen heraus ins Gesicht gefallen war.
Edwards beäugte den vor ihm im Stuhl lümmelnden Private. Der war das glatte Gegenteil des fast schüchternen Hawaiianers. Den Kopf an den Seiten kahl rasiert, lange Haare unter der Kopfbedeckung, eine bräunliche Hautfarbe, eine große Hakennase und ein loses Mundwerk. Der Offizier überlegte kurz, ob er dem jungen Mann erst einmal Manieren beibringen sollte, entschied sich aber dagegen. Dafür war später genug Zeit.
»Ich habe keine Unterstützung von der MP angefordert. Wie kommen Sie darauf?«
»Die bei uns im Stab erzählten, dass die Scouts ohne MP handlungsunfähig wären. Deshalb bin ich jetzt hier. Zumindest bis März. Dann ist finito mit Army.« Er knackte wieder zwei Blasen. »Ich bin Pietro Farina aus Philadelphia. Meine Familie stammt aus Sizilien, ich wurde in Sizilien geboren, capisce?«
»Warum nur bis März, Private?«, wollte der Offizier wissen.
»Ich bin schon seit fast zwei Jahren bei der Army. Meine Zeit ist nächstes Jahr abgelaufen. Ich gehe zurück nach Philly und arbeite im Ristorante meiner Eltern. Ich suche mir eine schöne Frau, nein, die Schönste in Philly und wir machen viele Bambini. Wenn ich alt bin, fahre ich zurück nach Sizilien. Bella isola, Sie verstehen?« Aus seinem Mund ertönten zwei derbe Knacklaute.
»Sizilien, soso. Laut meinen Unterlagen sind Sie die ganze Zeit bei der MP gewesen. Müssten Sie nicht längst Corporal sein?«
Farina grinste. »Ich war es auch schon eine Woche lang. Dann ist mir bei einer Hausdurchsuchung ein Fehler mit einer Deutschen unterlaufen.«
»Haben Sie sie etwa gleich heiraten wollen?«
»Madonna, nicht doch! Sie war höchstens eine Vier!«
»Eine Vier?«
»Mamma mia, Sie verstehen mich nicht! Eins ist hässlich, zehn ist Superfrau, bella donna! Ich habe ihr nur kurz an den Hintern gefasst. Ihr Vater war ein Bankdirektor und hat am nächsten Tag eine Anzeige beim Hauptquartier der siebenten Armeegruppe gemacht«, der Italiener verzog das Gesicht. »Dann wurde ich degradiert. Merda.«
»Also, zukünftig Finger weg von den Frauen. Bei den Scouts werden Sie keine Durchsuchungen ohne anwesenden Offizier machen. Frauen und Alkohol während der Dienstzeit dulde ich nicht, verstanden?«
»Ja, verstanden. Eine Zigarre nach Dienstschluss ist aber erlaubt, Captain?« Farina hatte sich nach vorn gebeugt und sah den Offizier treuherzig an, gleichzeitig knackte er respektlos ein paar weitere Kaugummiblasen.
»Wenn Sie Zigarren haben, von mir aus.«
»Mein Papa schickt mir alle zwei Wochen ein Paket mit Zigarren und Marsalawein aus Sizilien.« Farina leckte sich genießerisch über die Lippen.
»Liegt dort eigentlich nicht auch Neapel?« Edwards war gespannt auf die Antwort des Italieners. Die Hafenstadt vom Festland auf diese Insel zu verlegen, war eine verbale Ohrfeige für Farina.
Dieser explodierte auch fast sofort, wie der Vesuv, an dessen Fuß Neapel lag. »Mamma mia«, rief er laut aus. »Sie haben keine Ahnung, Capitano. Neapel in Sizilia! Madonna! Waren Sie noch nicht in Italien?«
Jetzt lag es an dem Offizier, sich Respekt zu verschaffen. »Ich komme aus der Nähe von Chicago, Farina. Al Capone war dort der Boss«, konterte er und sah den überraschten Italiener finster an. Was machten da schon unwesentliche zweihundertachtzig Meilen Distanz von Cliffdale bis Chicago aus? »Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns und wird beseitigt. Capisce?« Er lehnte sich im Stuhl nach hinten und blies Zigarettenrauch in die Luft. Dann erhob er seine rechte Hand, schnippte mit den Fingern und lächelte überlegen.
Pietro Farina schwieg. Er war sich nicht mehr sicher, ob Edwards ihm gerade Unsinn oder die Wahrheit erzählt hatte. Um von der Verlegenheit abzulenken, räusperte er sich und ergriff eilig das Wort: »Captain, muss ich ein Formular für Sie ausfüllen?«
Der Offizier schob ihm ein Blatt und einen Bleistift hin. »Die Familie muss alles über Sie wissen, verstanden Private?«
Dienstag, 27. November 1945, 10.42 Uhr
Lucien Keller hielt den Atem an. Soeben passierte das, was er bisher nur aus seinen Lehrbüchern und dem theoretischen Unterricht kannte: Der robuste Ein-Zylinder-Renault-Motor fing urplötzlich an zu stottern und die Drehzahl des Propellers wurde langsamer. Ein feiner Ölnebel machte sich in nach oben laufenden Schlieren auf der kleinen Windschutzscheibe breit. Ein Blick auf Höhenmesser und Tankanzeige: elfhundert Meter und halb voll. Doch der starke Südwestwind trieb ihn immer mehr in ein Gebiet ab, wo er eigentlich nicht hin wollte, besser gesagt, nicht hin durfte.
Vor über einer Stunde war er in Nancy gestartet, wollte einen kurzen Abstecher nach Baden-Baden machen, wo sein Vater als stellvertretender Garnisonskommandeur der französischen Streitkräfte diente. Fünfmal war Lucien diese Strecke in den letzten Wochen bereits geflogen, hatte normalerweise nach knapp achtzig Minuten Flugzeit, bei stetem Südwestwind, sicher in Oos landen können. Er konnte seinem Vater die neuesten Kuriernachrichten sowie eine Zeitung von zu Hause mitbringen und einen Kaffee mit ihm trinken.
Doch gerade ging alles schief. Der Motor lief nicht mehr rund und irgendwo war etwas undicht. Vielleicht ein Ventildeckel oder ein Lager, welches heiß lief? Der Pilot klopfte mit dem behandschuhten Zeigefinger gegen die Temperaturanzeige, doch der zitternde Zeiger näherte sich immer weiter dem gefährlichen roten Bereich. Das Flugzeug kämpfte mit den Elementen, den tief hängenden Wolken, dem beginnenden Nebel in den Bergen und dem noch immer sehr stürmischen Südwestwind. Deshalb betätigte Lucien das Ruder und die Fußpedale und setzte eine große Kurve nach links an. Nun war es ihm möglich, einen Blick nach unten auf die neblige Landschaft unter sich zu werfen und die Position einzuschätzen. Verdammt, war das da unten etwa schon Rastatt? Er drückte die Nase des silbernen Caudron C275 Luciole Doppeldeckers sacht nach unten, um unter die Wolkendecke zu kommen. Noch immer starrte er die Ansiedlung unter sich an und suchte nach dem Schloss Favorite und der Murg, den markantesten Punkten. Doch er sah keinen Fluss. Lediglich zahllose zerstörte Gebäude, durch die sich von Süd nach Nordwest ein Rinnsal zog. Baden-Baden? Kehl? Lucien griff hektisch nach der großen Karte in einer der Seitentaschen seines Zweisitzers und versuchte sie auseinanderzufalten. Immer wieder warf er einen Blick auf den Kompass und die Drehzahl. Das dünne Ölrinnsal hatte sich noch verstärkt, durch den Fahrtwind abgerissene Tropfen schlugen gegen seine Brille und die Mütze. Erst jetzt bemerkte der Elsässer die Rauchfahne, die er hinter sich herzog. Noch immer war er im Sinkflug und der Motor ließ beunruhigende Geräusche vernehmen. Von irgendwoher aus dem geschlossenen Triebwerksraum kam ein schrilles Pfeifen. Lucien sah wieder nach unten. Noch immer konnte er weder die Murg noch Reste der sternförmigen Festungsbauten von 1848 ausmachen. Der starke Aufwind ließ das kleine Flugzeug auf über sechshundert Meter ansteigen, mitten hinein in die stürmische Nebelsuppe, sodass der Elsässer die Maschine mit Gewalt hinunterdrücken musste. Unter sich sah er wieder Ruinen und mittendrin einen rechteckigen Platz, auf dem eine kleine Pyramide stand. Davor befand sich ein Trümmerzug mit einer dampfenden Lokomotive davor, der gerade in Richtung einer Schlossruine fuhr. Karlsruhe! Luciens Herz pochte wild. Mein Gott, er war über dreißig Kilometer in die amerikanische Zone abgedriftet, ohne es zu merken! Er drehte die Maschine in eine weitere Rechtskurve, doch das Flugzeug gehorchte seinen Steuerbefehlen nicht mehr wie gewünscht. Das austretende Motorenöl verdeckte ihm mehr und mehr die Sicht und der Kolbenmotor hustete und ruckelte zunehmend lauter.
Er musste sich erinnern! Karlsruhe hatte einen Landeplatz im Nordwesten, eine Autobahn im Osten und einen großen Exerzierplatz im Süden bei Forchheim. Dort, wo auch die französische Zone wieder begann. Dort musste er hin. Doch der Wind drückte ihn weiter in nördliche Richtung, obwohl die Nase nach Nordwesten zeigte. Merde, musste der Motor ausgerechnet jetzt kaputtgehen?
Er schlug mit der Faust gegen den Rand der Kanzel, sodass es dort einen großen Riss gab und ein Holm durchbrach. Entsetzt starrte er auf das im Wind flatternde Stück der Aluminiumverkleidung. Lucien drückte die Nase des rauchenden Flugzeugs weiter hinunter, der Höhenmesser zeigte bereits unter einhundert Meter, da erkannte er auf vier Uhr das große Flugfeld, wo sich angeblich auch eine Flugzeugwerft befand. Unter ihm rasten die Trümmer der Stadt, einige zerstörte Kirchen und mehrere Alleestraßen dahin. Menschen, die hier unterwegs waren, starrten nach oben und zeigten mit dem Finger auf ihn. Der Elsässer nahm allen Mut zusammen, zog den Doppeldecker in einer steilen Kurve nach rechts und flog nun mit Rückenwind direkt auf die große Wiese zu. Er musste Gewalt anwenden, um die Flügel zu stabilisieren. Nach Frankreich zurück würde er es auf keinen Fall mehr schaffen. In diesem Moment gab es im Motorraum einen Knall und der austretende Rauch wechselte von Weiß in Schwarz. Der kleine Metallzeiger der Temperaturanzeige, der gerade noch vor dem roten Bereich gestanden hatte, schlug nun gegen den rechten Anschlag. »Dunkelrot«, hatte der Fluglehrer das immer genannt und eine sofortige Landung empfohlen. An ein Aussteigen ohne Fallschirm war nicht zu denken. Lucien Keller tat das einzig Richtige, indem er den Benzinhahn zudrehte und das Steuer mit beiden Händen umkrallte. Innerlich bereitete er sich bereits auf einen Absturz vor.
*
Der Leiter des Motor Pools in der Knielinger Blackhawk-Kaserne, First Sergeant Joey Vickers, trippelte fröstelnd vor der Tür seines Werkstattbüros, in der einen Hand einen Becher mit dampfendem Kaffee und in der anderen eine Zigarette. Um ihn herum standen zahlreiche Militärfahrzeuge aller Art, sauber nebeneinander aufgereiht. Ein untergebener Corporal erzählte gerade Zoten, über die sich alle amüsierten. Als sie plötzlich ein Brummen wahrnahmen, verstummten die Soldaten und sahen neugierig in den grauen Himmel.
»Still!«, rief einer von ihnen. »Das ist doch ein Flugzeug?«
»Ja.« Vickers horchte interessiert. »Einmotorig. Mit Motorschaden.« Sie hörten deutlich die Aussetzer. Auch andere Soldaten, die im Freien zu tun hatten, unterbrachen ihre Arbeit und blickten suchend nach oben. Vickers bemerkte, wie sich an der Giebelseite in einem der benachbarten Unterkunftsgebäude ganz oben ein Fenster öffnete, ein Sergeant seinen Kopf rausstreckte und schrie: »Da hinten ist es. Ich kann etwas erkennen, ein Doppeldecker zieht eine Rauchfahne hinter sich her!« Er deutete in Richtung der Innenstadt, die für die anderen nicht zu sehen war.
»Brennt es, Alan?«, schrie Vickers nach oben.
»Weiß nicht, der Pilot versucht sicherlich auf dem Flugfeld zu landen. Hoffentlich stürzt er nicht vorher ab, er ist schon ziemlich tief. Jetzt ist er hinter den Häusern verschwunden.«
Joey wurde neugierig. »Los Männer, wir nehmen uns einen Jeep und dann fahren wir aufs Flugfeld. Das Flugzeug will ich sehen!« Die vier liefen kurz in die Werkstatt, um Feuerlöscher zu holen und sprangen in das nächstbeste Fahrzeug. Eine Minute später rasten sie davon.
Mit einem dumpfen Schlag aus dem Motorraum blieb der Propeller der Caudron C275 im Fahrtwind zitternd stehen. Lucien schätzte, dass es mindestens noch dreihundert Meter bis zur Grenze des Flugfelds waren. Das Singen der Flügelspanndrähte und das Rauschen des Windes waren nun auf einmal sehr deutlich zu hören, fast bedrohlich still war es um ihn herum. Eine ungewöhnliche Situation. Im Landeanflug ohne Motor. Oder sollte man es ein kontrolliertes Abschmieren nennen?
Die Augen des Franzosen fixierten gebannt den Höhenmesser. Vierzig Meter, dreißig Meter, zwanzig Meter. Die Dächer der letzten Häuser kamen den Rädern schon bedrohlich nahe.
Mein Gott, welcher Idiot hatte drei Pappeln direkt neben einem Flugplatz zugelassen? Linkskurve! Die rechte Flügelspitze rasierte einen Ast. Unter der Maschine rauschte ein Luftschutzbunker vorbei. Stabil halten! Zehn Meter. Lucien zog die Nase des Doppeldeckers etwas nach oben, um noch den letzten Restauftrieb auszunutzen. Die Wiese kam ihm immer näher. Inzwischen quoll ein schwarzer, stinkender Rauch aus den Ritzen der Trennwand zu ihm in die Pilotenkanzel. Der Motor brannte! Die Räder setzten mit einem Ruck auf, die Maschine sprang noch einmal kurz in die Luft und landete endgültig auf dem Boden, rollte über den holprigen Grund und blieb schließlich stehen. Erleichtert erkannte Lucien, dass er die zahlreichen Zugänge zu ausgedehnten Kaninchenbauten in dem sandigen Boden glücklicherweise knapp verfehlt hatte. Lucien schnallte sich ab, riss sich die Pilotenkappe vom Kopf, fummelte den kleinen Feuerlöscher unter dem Sitz hervor und kletterte aus der Kanzel. Behände sprang er erst auf die untere Tragfläche, dann auf die Wiese. Er kroch unter dem Flügel hindurch nach vorne, was schneller ging, als um ihn herumzulaufen. Mit geübten Handgriffen öffnete er den seitlichen Motordeckel, ließ kurz Qualm entweichen und sprühte den kompletten Inhalt des Löschers in die Öffnung hinein.
Erst jetzt, wo das Feuer aus war, sah er sich das Gelände genauer an. Auf der Wiese wuchs eine Art rötlich-grünes Heidekraut, unterbrochen von ein paar verstreuten Ginsterbüschen am Rande und zahllosen weiteren Kaninchenbauten dazwischen. Die eigentliche Landebahn hatte er um mehrere hundert Meter verfehlt. Am südlichen Horizont standen Häuser und ein paar Hallen. Er erkannte ein Gebäude mit einem verglasten Turm, welches vermutlich die Flugplatzverwaltung war, und auch, dass aus verschiedenen Richtungen Personen auf ihn zuliefen. Der Elsässer kletterte noch einmal zurück zu seinem Pilotensitz, holte die Mappe mit den Papieren und dem französischen Ausweis und erwartete das deutsche oder amerikanische Begrüßungskomitee.
Zuerst erreichte ihn ein riesiger Schäferhund, der mit respektvollem Abstand um ihn und das Flugzeug herumrannte und bellte. Kurz darauf war sein Besitzer, eine junge Frau mit Kopftuch, da und verlangte von dem Hund mit einem lautem »Koba, Platz!« Gehorsam, woraufhin dieser dem Befehl sofort nachkam. Vom Heck der Maschine näherte sich ein alter Mann mit fünf kleinen Kindern im Schlepptau, die den silbernen Vogel mit offenem Mund bestaunten. Lucien überlegte und sammelte seine spärlichen Deutschkenntnisse.
»Misch verstehen, Mademoiselle?«, fragte er die Hundebesitzerin. »Karlsruh hier?«
Die Frau nickte.
»Isch«, er deutete auf sich. »Lucien Keller von Baden-Baden. Mein avion äh … mécanique … Mechaniker? Moteur cassé … kaputt.«
Die Frau nickte erneut. »Die Amerikaner kommen«, bemerkte sie trocken. »Man wird Sie verhaften. Karlsruhe ist nicht gut für Franzosen.«
Der Elsässer verstummte.
Über eine versteckte Zufahrt brauste ein Militärjeep auf die kleine Gruppe am Rand des Platzes zu. Von Westen her kam ein weiteres Fahrzeug, doch es war noch wesentlich weiter entfernt. Der Jeep hielt, zwei bewaffnete Amerikaner sprangen heraus und zielten mit ihren Gewehren auf den Piloten. Ein weiterer Soldat lief wortlos auf Lucien zu und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Im Anschluss holte er seine Pistole hervor und hielt sie dem verdutzten Franzosen an den Kopf, der schon längst seine Hände im Nacken verschränkt hatte.
»Russki«, schrie der GI. »Keine Landebahn!« Dann schlug er ihm mit der Pistole ins Gesicht.
Die Frau mit dem Hund verfolgte in ein paar Metern Abstand die Szene und war entsetzt, was sich vor ihren Augen abspielte. »Kein Russe. Ein Franzose. Oh mein Gott!«, rief sie, wurde jedoch nicht verstanden.
Der Soldat trat derweil weiter auf den wehrlosen Mann ein, der sich inzwischen auf dem Boden zusammenkrümmte. »Russki, Russki!«, schrie der Amerikaner.
Ein weiterer Jeep mit vier Soldaten hielt neben dem Flugzeug. First Sergeant Vickers lief als Erster zu dem GI und zog ihn von dem Piloten weg. »Hör auf, du bringst ihn ja um! Was ist denn in dich gefahren?« Die beiden anderen Soldaten standen noch immer in einigem Abstand neben ihrem Kameraden. Unschlüssig hatten sie die Waffen gesenkt.
»Der Drecksrusse ist hier mit seinem Spionageflugzeug notgelandet. Meine Eltern sind von Russen umgebracht worden. Ich hasse sie alle!«, schrie er. »Dieser Bastard kam mir gerade recht!«
Vickers hielt den Mann weiterhin fest und warf einen prüfenden Blick auf den zivilen Doppeldecker, an dessen Flanke, noch gerade sichtbar, die französische Trikolore prangte.
F-LQAE
Ein Franzose. Herzlichen Glückwunsch. Der Festgehaltene gab derweil seinen Widerstand langsam auf und sah missmutig auf den Boden. Während Vickers den Griff vorsichtig löste, schrie er ihn an: »Das Flugzeug kommt aus Frankreich, du Arschloch. Du hast fast einen Franzosen totgeschlagen«, fuhr er wütend fort. »Einen Franzosen! Bist du farbenblind, Corporal?«
Der Angesprochene starrte auf das Opfer im Gras. »Schade, ich dachte, er wäre Russe.«
»Wir müssen ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Bete zu Gott, dass er überlebt, sonst sorge ich dafür, dass du eine Anklage wegen Mordes bekommst. Darauf kannst du dich verlassen.«
Gemeinsam luden sie den bewusstlosen Lucien in den Jeep und fuhren mit Höchstgeschwindigkeit davon. Der alte Mann, der bis jetzt nur zugesehen hatte, verabschiedete sich von der Frau mit einem knappen »Wiedersehn«, und machte sich mit den Kindern wieder auf den Heimweg. Die Frau starrte den Soldaten noch eine Weile nach. Ein feiner Nieselregen setzte ein. Als sie sich umdrehte und nach dem Hund rief, entdeckte sie die im Kaninchensand liegende Ledermappe des Franzosen. Sie beschloss, am nächsten Tag damit zur Polizei zu gehen, und steckte sie ein. Nachdenklich lief sie zurück Richtung Knielingen. Koba trottete seiner Herrin ergeben hinterher. Der fremde Geruch des Franzosen war für immer in seinem Gehirn gespeichert.
Dienstag, 27. November 1945, 13 Uhr
Mit dem einzig brauchbaren Beweisstück, der Lederjacke des unbekannten Toten unter dem Arm, kletterte Captain Edwards auf der Beifahrerseite in den Lastwagen vom Typ Studebaker