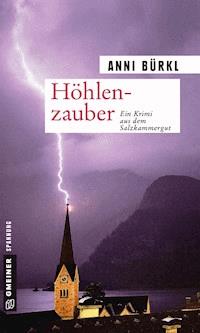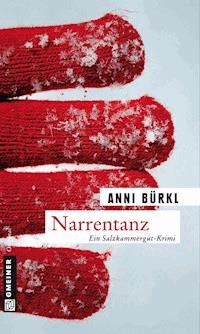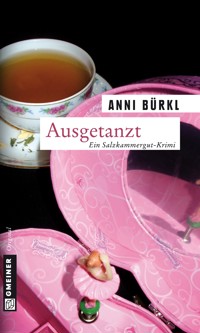Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Berenike Roither
- Sprache: Deutsch
Berenike Roither muss die Trennung von ihrem Freund Jonas verkraften, als ihre Schwester nur knapp einem Mordanschlag entgeht. Außerdem tauchen gestelzt formulierte Drohbriefe auf - allesamt gerichtet an Berenike ... Ratlos macht sie sich auf die Suche nach den Hintergründen, die sie in die Vergangenheit und die goldene Stadt an der Moldau führen. Im Labyrinth von Prags Gassen fühlt sich Berenike plötzlich wie eine Hauptfigur aus Kafkas Romanen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anni Bürkl
Schweigegold
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von:
© wagner_christian / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4610-8
Widmung
Für Chrisi & Maggie
Die Wiege von inneren und äußeren Kriegen ist die Familie.
Franz Kafka
Kapitel 1
Ein Tag im April, Altaussee
»Bei uns geht koana nit zu Fuß.«
Berenikes Blick wanderte von der nassen Fahrbahn zur grünen Karosserie eines Geländewagens, der knapp vor ihr gebremst hatte. Verschwommen erkannte sie die fragend aufgerissenen Augen von Max.
Was für ein Tag.
Sie hatte allein gefrühstückt, das Auto war nicht angesprungen, ausgerechnet heute. Nicht nur, dass ihre Schwester zu Besuch war und sie den Wagen brauchte, sie hatte auch endlich den lang erwarteten Massagetermin bei Anniko. Sylvie hatte ihr die angebliche Wunderheilerin kurz vor ihrem Tod noch empfohlen. Berenike hatte sich notgedrungen zu Fuß auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht. Der Regen prasselte mit urzeitlicher Kraft auf das Ausseerland nieder, als sollte die Evolution ein zweites Mal stattfinden, nur diesmal umgekehrt, eine Rückentwicklung vom Säugetier zurück zum Wasserlurch.
Von den Bergen waren nur Umrisse zu erkennen, Loser, Trisselwand, alles grau in grau. Gegen den Regen gestemmt, setzte Berenike einen Fuß vor den anderen. Dachte an ihre Schwester und ihre Probleme, an ihren eigenen Teesalon, wo es auch nicht berauschend lief. Nur an einen dachte sie nicht, wagte es nicht, an ihn zu denken. Sie fühlte sich allein, allein mitten in dieser feuchten, tristen Welt, als wäre niemand außer ihr übrig geblieben. Erst durch ein Hupen fuhr sie hoch, das gleichmäßige Fallen der Regentropfen musste sie in Trance versetzt haben. Die Luft dampfte nach der Wärme der letzten Tage.
»Was machst du hier, schöne Frau?«, fragte Max, der Wirt vom Grünen Kakadu, der aus seinem Wagen gesprungen war und sie jetzt fest an den Oberarmen fasste. »Alles okay bei dir?«
Okay? Nichts war okay, schon seit Längerem nicht. Aber wie sollte sie das ausgerechnet Max erklären? Sie wischte sich über das Gesicht und die Augen. »Entschuldige, ich hab nicht aufgepasst«, murmelte sie und versuchte, mit einer Kopfbewegung die an ihrer Stirn klebenden Haarsträhnen wegzuschütteln. Erfolglos.
»Ist wirklich alles okay bei dir?«, fragte Max eindringlicher.
»Lieb von dir, aber es geht schon, danke.«
»Soll ich dich ein Stück mitnehmen?«
»Ach …«
»Komm, steig ein, bevor ich auch noch pudelnass bin.« Mit der lässigen Eleganz eines Kutschers bei Hof hielt er ihr die Tür auf der Beifahrerseite auf. Sie setzte sich, er schloss galant die Tür und stieg selbst ein. »Na, dann fahrn mer ma’, Euer Gnaden«, lachte er sie an und fuhr entschlossen los.
»Angenehm, ins Trockene zu kommen. Danke, Max!« Sie strich sich mit beiden Händen über die Augen und blinzelte. »Stell dir vor, ich hab einen Massagetermin in Ischl und meine alte Karre hat mich in Stich gelassen.«
»Wundert dich das wirklich? Das ist doch immer so. Wo ist das in Ischl?«
»Es genügt, wenn du mich bei der Bushaltestelle absetzt«, sagte sie und sah nach draußen. Düsternis überall.
»Kommt nicht infrage. Ich muss sowieso selbst in die Stadt, ein Geschenk besorgen. Ich fahr dich gern hin.«
»Das ist wirklich nicht nötig.«
»Ich fahr dich.« Sein freundlicher, aber bestimmter Tonfall duldete keine Widerrede. Er warf ihr einen nicht zu deutenden Seitenblick zu. Also gab sie ihm die Adresse mitten im Zentrum der alten Kaiserstadt.
Max fuhr routiniert, erzählte dabei Belanglosigkeiten über Gäste im Wirtshaus, dass er eine neue Biersorte in die Karte aufnehmen wollte. Dabei warf er ihr hin und wieder einen fast sorgenvollen Blick zu, sah aber immer schnell weg, wenn sie seinen Blick erwiderte. Fast hätte sie sich ablenken lassen von ihrem Kummer, aber eben nur fast.
»Du gehst zu einer Massage?«, fragte er.
»Ja, weißt eh, mein ewiges Kreuzweh. Ich muss was dagegen tun.«
Max nickte. »Man wird nicht jünger. In dem Beruf überhaupt. In der Gastronomie ist man halt ständig auf den Beinen.«
»Wem sagst du das.«
Vor einem grauen Neubau unweit der Kaiservilla stoppte Max.
Berenike bedankte sich. »Das war wirklich nett, du warst mein Retter.«
»Aber immer«, erwiderte er. Regen trommelte auf das Autodach, die Scheiben beschlugen, als sie noch einen Moment sitzen blieb. Sie schwiegen. Es war wie früher, als Teenager, spät oder besser früh am Morgen, nach einer durchtanzten Nacht, wenn für einen Moment lang alles möglich war. Sie wusste, sie hatte Max von Anfang an gefallen, seit sie von Wien hierher gezogen war. Er ihr auch, aber mehr war nie gewesen. Sie hätte die entstandene warmherzige Freundschaft auch nicht mehr eintauschen wollen. Er war der Bruder, den sie nie gehabt hatte, der Bruder, den sie jetzt hätte brauchen können.
Leise verabschiedete sie sich und stieg aus.
Die Masseurin Anniko Luger arbeitete über einem zu dieser Tageszeit noch geschlossenen Souvenirgeschäft, dessen Schaufenster mit kitschigen Sisi-Souvenir-Tellern und Tassen mit Hirsch-Dekor vollgestellt war. Die Praxis stand dazu im vollen Kontrast. Die Wände waren in einem dunklen Violettton gestrichen, der nur auf den ersten Blick angenehm wirkte. Keine Bilder, kein Kitsch. Eine einzelne Kerze flackerte am Fenster gegen das Halbdunkel draußen an, ein Zimmerbrunnen plätscherte aufdringlich unaufdringlich mit dem Regen um die Wette. Berenike setzte sich. Die Müdigkeit fiel wie ein Federpolster über sie, da wurde sie schon in den Behandlungsraum gerufen.
Dort wirkte es noch düsterer. Die Wände waren auch hier violett, alle Vorhänge vor den Fenstern zugezogen, Kerzen leuchteten in Ecken und Winkeln. Eine große Frau mit schmalem, fast hagerem Gesicht, mandelförmigen Augen und langen, schwarzen Haaren trat auf Berenike zu. Der Blick aus ihren dunklen Augen wirkte brennend. Ihre Hand war knochig und rau, als sie sie Berenike zur Begrüßung gab.
»Was führt Sie zu mir, Frau Roither?«, fragte sie dann, nicht unfreundlich, aber distanziert.
Berenike schilderte die Rückenschmerzen, die sie seit Wochen plagten. Schmerzen, die andere Schmerzen fast überlagerten. Aber eben nur fast.
Anniko deutete auf eine schmale Liege, die mit einem schwarzen Leintuch bespannt war. »Legen Sie sich hier hin, auf den Bauch bitte. Entspannen Sie sich. Dort hinter dem Paravent«, sie zeigte in die dunkelste Ecke, »können Sie sich ausziehen. Ich bin gleich zurück.«
Während Berenike tat wie geheißen und sich in der engen Nische aus ihren feuchten Klamotten schälte, ertönte das Klicken einer Musikanlage, die eingeschaltet wurde. Zu mystischen Instrumentalklängen ließ sie sich schließlich auf die Liege gleiten. Gar nicht so einfach, so steif, wie sich ihr Kreuz anfühlte. Endlich lag sie erwartungsvoll da. Die Musik zog sie in ihren Bann. Die Gedanken drifteten ab. Schritte knirschten über Parkett, Hände legten sich sanft auf ihren Rücken. »Wo tut es am meisten weh?«, fragte die Masseurin mit ihrer tiefen Stimme.
Am meisten? Berenike stieß ein Lachen hervor. Einfacher wäre es, zu sagen, wo nichts wehtat.
»Hier? Oder mehr hier?« Die Hände der Masseurin wurden wärmer, je länger sie über ihren Rücken wanderten.
»Aua!« Plötzlich konnte sie einen Aufschrei nicht unterdrücken. »Hier tut es sehr weh.« Komisch, wie der Schmerz sie vor sich her treiben konnte, als hätte sie keinen eigenen Willen mehr. Wie er den eigenen Willen auflöste, für alles, was außerhalb dieses Schmerzes lag. Aller Wille bestand darin, den Schmerz zu beenden, egal wie.
Die Masseurin murmelte etwas wie: »Svadhisthana«, und dann noch einiges Unverständliche. »Zwischen dem zweiten und dritten Chakra, das heißt im Kreuz«, sagte sie schließlich lauter. »Verstehe. Gut, dann wollen wir mal.«
Die Masseurin arbeitete nun schweigend, die Musik wurde schneller, ruhiges Trommeln steigerte sich zu einem Wirbel. Das heiße Wachs der Kerze roch intensiv und mischte sich mit einem herben, aber nicht unangenehmen Duft, der vermutlich vom Massageöl kam. Sylvie hatte recht gehabt, das tat wirklich gut, obwohl es gleichzeitig schmerzte.
Anniko knetete Muskeln, strich über Knochen, dass sie davonlaufen wollte. Das Klopfen der Regentropfen vermischte sich mit den Trommelschlägen, wurde zu Schritten, die sie verfolgten, in immer schnellerem Rhythmus, sie weiter und weiter trieben, an einem dunklen Ort, von dem es keinen Ausweg gab.
»So, setzen Sie sich jetzt bitte auf, aber vorsichtig.«
Ein schriller Ton ließ Berenike hochfahren. War das ein Schrei gewesen? Zum zweiten Mal an diesem Tag wurde sie aus etwas wie einer Trance gerissen. Sie blinzelte, während sie sich aufrichtete, fasste sich an die Kehle, bekam keine Luft. Der Raum war unverändert, nichts Ungewöhnliches weit und breit. Trotzdem war Berenike sicher, einen Schrei gehört zu haben, einen Schrei, der zwischen den Mauern eines düsteren Verlieses widerhallte, aus dem es kein Entkommen gab.
Anniko stand abwartend hinter ihr, streckte helfend eine Hand aus. Berenike richtete sich auf. Schmerz fuhr ihr vom Kreuz bis in den Kopf mitten ins Herz. Sie rieb sich über die Augen, zwinkerte Tränen weg.
»Hab ich Ihnen wehgetan?«, fragte Anniko und beugte sich besorgt zu ihr vor.
»Nein, nein, es geht schon.«
Berenike lauschte. Keine Schreie. Die Musik war auch zu Ende.
»Wenn was stört«, sagte Anniko langsam hinter ihr und legte dabei sanft ihre Hände auf Berenikes Nacken, »wenn etwas nicht richtig ist, wenn etwas fehlt, dann muss man sich damit auseinandersetzen.« Sie strich sehr sanft über Berenikes Nacken, berührte die Stelle, die besonders empfindlich war, ihr einen wohligen Schauer über den Rücken jagte. Das fehlte. Sehr sogar. Der Schrei saß in ihrem Herzen.
»Danke schön«, sagte Anniko leise. Sie ließ ihre Hände von Berenikes Rücken gleiten, trat zur Seite und deutete eine kleine Verbeugung an. Die schwarzen Haare fielen ihr ins Gesicht, deckten die funkelnden dunklen Augen fast zu. »Bleiben Sie noch einen Moment sitzen.« Mit einem Klicken wurde die Musik ausgeschaltet. Berenike atmete ein paarmal tief durch, die brennenden Kerzen ließen die Luft stickig wirken. Während Anniko im halbdunklen Raum herumzukramen anfing, stand Berenike auf und zog sich wieder an. Als sie fertig war, bat die Masseurin sie, sich in einen Korbsessel an einem niedrigen Tisch zu setzen und nahm ihr gegenüber Platz.
»Möchten Sie eine Tasse Hibiskustee? Er wurde mir eben ganz frisch aus Ägypten mitgebracht.«
»Gerne.«
Plätschernd wurde rötlicher Tee aus einer Thermoskanne in zwei kleine Tassen eingeschenkt. Er roch fruchtig-sauer, erinnerte an Schulausflüge. Eine Kerze flackerte in der Mitte der Tischplatte. Berenike nahm die Tasse und legte ihr Handflächen darum. Die Wärme tat gut, der Schmerz verebbte ein wenig, das Gefühl, gleich in Tränen auszubrechen, ließ langsam nach. Dabei starrte sie in die Flamme der Kerze, deren Wachs so dunkel war, wie das Chili-Schokoladen-Eis bei ihrem ersten privaten Gespräch mit Jonas vor Jahren. Dunkel wie die Locken, die ihm immer in die Stirn fielen.
Mit aller Macht schob Berenike das Bild weg und lehnte sich vor, dass die Hitze der Kerzenflamme auf ihrer Haut brannte. Immer noch echote der Schrei von vorhin in ihrem Kopf. »Wie viel bekommen Sie?«, fragte sie, um sich ganz auf den Moment zu konzentrieren, und kramte nach ihrer Geldtasche.
»40 Euro, bitte.«
Berenike legte zwei Zwanzigeuroscheine auf den Tisch. Anniko bedankte sich mit einer kleinen Verneigung ihres Kopfes.
»Denken Sie an das, was ich vorhin gesagt habe. Verspannungen haben immer auch seelische Ursachen.« Die Masseurin räumte routiniert die Geldscheine in eine glitzernde Schatulle, die wie die Miniaturausgabe einer Schatztruhe aussah, und drehte sich mit einer fließenden Bewegung zum Fensterbrett, von dem sie eine bunt gekleidete Stoffpuppe nahm und sie vor Berenike hinlegte. »Ich habe die richtige Lösung für Sie. Überlegen Sie, was stört, was wehtut, was zu viel ist oder zu wenig. Welche Menschen Ihnen nicht guttun. Und überlassen Sie all das der Puppe. Stecken Sie für jedes Problem, für jeden einzelnen Punkt eine Nadel in den kleinen Körper. Denken Sie ganz fest daran, dass Sie den Umstand damit loslassen. Wenn Sie wiederkommen, sprechen wir darüber, wie es Ihnen damit ergangen ist.« Sie schloss und öffnete die Augen mit einem langsamen Wimpernschlag, was an eine müde Eule bei Tageslicht erinnerte. »Seien Sie bereit, eine Lösung zu finden. Ihre Lösung.«
Berenike war, als würde ihr Kopf von alleine nicken, ohne ihren Willen. Der Tee vor ihr roch säuerlich.
»Konzentrieren Sie sich und denken Sie über alle Probleme nach, die Sie ungelöst mit sich herumschleppen. Alles.« Sie schob die Puppe und ein kleines Päckchen über den Tisch zu Berenike und sah sie offen an. »Alles Gute!«
»Danke.«
»Sie dürfen loslassen, was zu schwer ist«, sagte Anniko leise mit warmer, mitfühlender Stimme. »Wenn es dabei zerbricht, ist es vermutlich richtig so, auch wenn sich die Zerstörung zuerst schmerzlich anfühlt. Wir sehen uns zu einem nächsten Termin?«
»Gern«, sagte Berenike. Schon beim Aufstehen spürte sie Erleichterung, als wäre ein wenig Gewicht von ihren Schultern gerutscht. »Ich melde mich.«
*
Es schüttete immer noch wie aus Kübeln, als Berenike vor die Haustür trat. Draußen war es nur unwesentlich heller als in den Räumen der Masseurin. Abwartend blieb Berenike vor der Auslage mit dem Sisi-Kitsch stehen und überlegte, ob sie ein Taxi nehmen sollte oder doch den Bus. Dabei atmete sie tief die saubere, erdig nach Frühling riechende Luft ein, ließ die Schultern kreisen. Lange war sie nicht mehr so entspannt gewesen! Bis auf diesen seltsamen Schrei, der immer noch in ihrem Kopf widerhallte.
»Na, Fräulein, noch nichts vor heute?« Ein etwa 60-jähriger Mann mit Steireranzug und grauem Hut verlangsamte den Schritt vor ihr. Ohne Schirm trotzte er dem Regen, obwohl das Wasser schon von der Hutkrempe tropfte. Ein echter Mann halt.
Sie wollte grad eine schnippische Antwort geben, da bog Max mit seinem grünen Geländewagen um die Ecke und bremste knapp hinter dem 60-Jährigen, der zur Seite sprang – genau in eine Regenlache. Wasser spritzte und Berenike verkniff sich ein boshaftes Lachen.
»Berenike, servus!« Max öffnete von innen die Beifahrertür. »Schnell, steig ein.« Der alternde Trachtenkerl stand in der Gegend herum und starrte aus großen, wässriggrauen Augen zu ihnen herüber. »Was ist, kennst du den?«
»Nein.«
»Geht er dir auf die Nerven?«
»Alles okay, Max. Was machst du schon wieder hier? Ich kann doch den Bus nehmen!«
»Nix da. Du fährst mit mir. Ich hab meine Einkäufe erledigt, dann hab ich auf die Uhr geschaut und mir gedacht, schaust, ob die Berenike schon fertig ist. Vielleicht kann’s mich brauchen.« Stolz sah er sie an. »Und, richtig so.«
»Kluger Kerl«, alberte Berenike. Beide lachten. Das überdeckte endlich den Schrei in ihrem Kopf. Diesen seltsamen Schrei, den es gar nicht gab. Sie hielt ihre Tasche zu, in die sie obenauf Annikos Utensilien gelegt hatte. Fehlte grad noch, dass Max blöde Witze über Puppen riss, die erwachsene Frauen in der Gegend herumtrugen.
Kapitel 2
Tief hing der regenschwere Himmel über dem See, als Max sie vor ihrem Salon für Tee und Literatur in Altaussee aussteigen ließ. »Magst du noch mit reinkommen auf einen Tee?«, fragte sie.
»Gern.« Von Max kam wieder so ein Blick, den sie nicht zu deuten wusste. »Bei mir ist ja heut Ruhetag.«
»Dann rein mit dir!« Sie hielt Max die Tür auf. Als sie sich umsah, bemerkte sie Albert Scheiner auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in der Nähe von Ragnhilds Pension. Ihr Vermieter hatte Berenike an diesem Tag noch gefehlt!
»Hallo, Herr Scheiner«, grüßte sie höflich. »Wollten Sie zu mir?«
»Nein, nein«, winkte er ab und nestelte, während er die Straße überquerte, an seinem Hut, um ihn sich tiefer ins Gesicht zu drücken. »Ich hatte in der Gegend zu tun. Ach so, wenn ich schon hier bin, Frau Roither, Sie sollten in Zukunft pünktlich bezahlen. Sonst kann ich für nichts garantieren. Es gibt schließlich genügend andere Interessenten für freie Lokale.«
»Habe ich etwas übersehen?« Sie überlegte, welches Datum sie hatten, konnte sich aber nicht konzentrieren. »Heute ist doch noch nicht der Monatserste. Oder?«
Scheiner schüttelte den Kopf. »Sie haben noch vier Tage Zeit. Übrigens gut, dass Sie den esoterischen Quatsch abmontiert haben.« Er deutete auf die britische Fahne, die über der Auslage hing.
»Buddhismus ist eine Religion wie viele andere«, entgegnete Berenike. »Wenn weiter nichts ist, dann auf Wiedersehen, Herr Scheiner. Ich werde nachher gleich die Zahlung veranlassen.«
Scheiner nickte ihr zu und überquerte die Fahrbahn. Endlich trat Berenike ein. Drinnen lief klassische Musik auf ihrem alten Plattenspieler. Berenike lauschte. Das war Smetanas »Mein Heimatland«, eben lief das Stück über die Moldau. Ihr war, als würde der Fluss in der Nähe vorbeirauschen. Und es duftete herrlich nach frisch gebackenem Kuchen.
»Was riecht denn hier so gut?«, fragte sie Tiffany, die gerade die wenigen Gäste bediente.
»Zitronenmuffins!«, rief ihre Angestellte fröhlich.
»Riecht verheißungsvoll«, sagte Berenike und atmete tief durch, um sich zu beruhigen. Ihr Herz klopfte so laut wie die vermeintlichen Schritte eines Verfolgers während der Massage.
Tiffany hieß eigentlich Slavica und stammte ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Besser gesagt, ihre Eltern waren von dort ins Salzkammergut zugewandert. Papa Jossip und Mama Dragica waren fleißig gewesen, hatten eine Tischlerei aufgebaut und vier Kinder bekommen. Alles war gut, bis auf die Namen, auf die sie ihre Kinder getauft hatten. Fand zumindest Tiffany. »Sie fahren kaum noch nach Jugo, sie essen am liebsten Wiener Schnitzel, die Sprache haben sie uns auch nicht beigebracht, aber wir Kinder sollen so tun, als wären wir serbisch«, schimpfte Tiffany ab und an. Sie hatte sich umgetauft, seit sie im Alter von 14 Jahren zum ersten Mal den Film »Frühstück bei Tiffany« gesehen hatte. Einmal hatte Berenike die Kellnerin gefragt, warum sie sich dann nicht gleich Audrey genannt hatte. »Den Namen kann doch hier erst recht keiner aussprechen!«, war die vorwurfsvolle, wenngleich berechtigte Antwort gewesen.
»Gleich hole ich die Muffins aus dem Ofen, dann kannst du kosten, Chefica!«, alberte Tiffany.
»Sehr gern«, sagte Berenike. »Aber bitte, hör auf, mich Chefica zu nennen!«
»Ist recht, Chefica!« Lachend verschwand Tiffany in der Küche. Immerhin verbreitete sie mit ihren Albernheiten gute Laune.
»Schön ist es wieder geworden bei dir«, sagte Max anerkennend und schwang sich auf einen Barhocker.
»Ja, die Renovierung hat gut geklappt, was?« Berenikes Blick glitt über die frisch gestrichenen Räume, als ob die hellen Farben das Grauen in ihr überdecken könnten. Die Einrichtung war diesmal britischer gestaltet. Kleine englische Fähnchen standen als Dekor auf den Tischen, die Bänke waren in rotem Schottenkaro bezogen worden. Vom selben Stoff hatte sie Decken für den Garten schneidern lassen. An der Theke standen altmodische Messing-Kuchenständer bereit für den High Tea. Miss Marple und Sherlock Holmes blickten von den Wänden auf die Gäste herab, zusammen mit einem Foto der Queen. Nur ein Bild von Prag war zwischen die britische Weltmacht quasi hineingeschmuggelt worden. Berenike hatte es von ihrer Großmutter geerbt, es hatte in dem Feinkostgeschäft gehangen, das die Großeltern jahrelang geführt hatten. Nach ihrem Tod hatte Berenike es als Erinnerung mitgenommen. Es zeigte einen dunklen Turm in Prag, ein altes Schwarz-Weiß-Bild. Zu dem Bild gehörte die dramatische Geschichte von der ersten großen Liebe der Großmutter, einem jungen Mann, den sie nur heimlich in der Nähe des Turms getroffen hatte und der während der deutschen Besatzung unter tragischen Umständen gestorben war, gerade einmal 20. Das hatte die Großmutter ihr in einem seltenen Moment der Offenheit erzählt, als im Laden nichts los war. Ihre Augen hatten dabei verdächtig geglänzt. Sie hatte ganz anders gewirkt als sonst, traurig, verletzlich, voller Gefühle. Berenike kannte den Namen des jungen Mannes nicht. Sinnierend sah sie das düstere Bild an. Sie fand, es machte sich gut zwischen der restlichen Einrichtung. Ihr Blick fiel auf das Schild: Where there’s tea, there is hope.
Ja, vielleicht.
Vielleicht könnte sie später noch Fruit Bread machen. Oder Scones. Sie hatte in letzter Zeit ein Faible für das Kuchenbacken. Allerdings wäre das nur sinnvoll, wenn mehr Gäste kämen. Sorgenvoll warf Berenike einen Blick auf die Uhr. Na gut, erst halb zwölf. Das war zwar fast Mittagszeit, aber vielleicht käme zur Tea Time am Nachmittag mehr Kundschaft. Der Regen wäre doch passend, um viel Tee zu trinken.
»Ich bin gleich wieder bei dir!«, rief sie Max zu und verstaute ihre Tasche in dem kleinen Büro. Die Utensilien, die Anniko ihr gegeben hatte, sperrte sie im Sekretär ein, der noch von ihrem Großvater daheim in Wien stammte. Dann zog sie statt der Jeans ihren roten Schottenrock zum schwarzen Rollkragenpulli an.
Zurück im Teesalon fand sie Max in einer der Ecken mit Ausblick zum See und zu den Bergen, wenn sie sich gezeigt hätten, was sie heute vor lauter Regenwolken aber nicht taten. »Wie wär’s, einen Jaipur-Tee mit Milch, Max?«, schlug sie vor. »Das ist eine Schwarztee-Mischung, die mehrere indische Gewürze enthält. Das wärmt von innen.«
»Soso. Wärmt von innen, aha. Da wüsst ich bessere Möglichkeiten.«
»Geh, Max, sei nicht so albern.« Sie musste auch lachen. Nach einem Moment des Erstaunens merkte sie, wie sich etwas in ihr löste. Vielleicht ging es aufwärts, weiter, vielleicht könnte sie endlich wieder durchatmen. Auch wenn sie jetzt allein lebte.
»Okay, okay. Bin ganz ernst. Gehst dann einmal wieder mit mir aus?« Seine Mundwinkel zuckten.
»Max!«
»Auf jeden Fall solltest du zu dem ganzen Tee endlich ordentlichen Schnaps ausschenken.«
»So wie den Lupitscher, nach dem sich keiner mehr auf die Piste wagt?«
»Keiner von den Wienern, meinst. Die Einheimischen schaffen das schon. Wegen dem bissl Schnaps mit Tee.«
»Egal.« Immer noch mit einem Schmunzeln zeigte Berenike hinter die Theke. Das Schild war eines der wenigen Dinge, die nach der Renovierung gleich geblieben waren: ›Strictly tea is served‹.
Max nickte verständnisvoll. »Ich weiß schon, heutzutag’ muss man ein eigenständiges Konzept haben für ein Lokal. Das war früher anders. Ich hab die Wirtschaft von meinem Vater so übernommen, wie sie auch jetzt noch ist.«
»Und das ist gut so, Max.« Sein Gasthaus in Bad Aussee besuchte Berenike immer wieder gern, einmal war sie dort sogar auf einem Trachtenball gewesen, zusammen mit Jonas. Und es war mörderisch zugegangen.
»Als dann, bring mir diesen Tee, bitte.«
»Mach ich.« Sie war froh, wieder von der Erinnerung an den Mordfall abgelenkt zu werden. Jetzt war Frühling, die Bäume trieben aus, überall junges Grün. Endlich. Sie wählte eine altmodische Kanne mit rosa Blümchen und ebensolche Tassen mit geschwungenem Goldrand. Sie stellte Wasser dazu, maß Teeblätter ab, goss auf und servierte schließlich. Nach vier Minuten Ziehzeit hob sie den Filter heraus und schenkte ein, schob Max eine Tasse hin, schenkte sich selbst ein. Ihr Magen rumorte auf einmal laut, sodass Max sich ein Grinsen nicht verkneifen konnte. Appetit hatte sie trotzdem so gar keinen. Sie ging in die Küche, wo tatsächlich die Zitronenmuffins zum Auskühlen standen, und legte ein paar davon auf einen Teller mit ebenfalls rosa Blümchen. Nach einem Moment des Überlegens nahm sie noch eine Packung Walkers von der Theke, die mit Cheese & Onion. Vielleicht würde sie von den Chips eher etwas runterbringen.
Sie stellte alles auf dem Tisch ab und setzte sich Max gegenüber. Wenigstens gab es aufgrund der wenigen Gäste die Möglichkeit, noch ein wenig zu entspannen. Nur eine Sache auf einmal, jetzt einfach nur Tee trinken und sich mit Max unterhalten. Sie griff nach der Tasse, legte beide Hände um die Schale, spürte, wie die Wärme von dort aus ihren Körper eroberte, nahm wahr, wie der Tee nach Zimt und Orange duftete.
Max hob seine Tasse, als wolle er ihr damit zuprosten. »Und wie geht’s dir sonst so? Nach diesem wilden Fall, den du und dein Jonas gelöst haben?«
»Er ist nicht mein Jonas«, brummte Berenike und nahm einen Schluck Tee.
»Nicht?« Max zog eine Augenbraue hoch. »Bist du sicher?«
Sie zögerte, nickte dann.
»Du hast nix mehr von ihm gehört, seit du geholfen hast, ihn zu befreien, Berenike?«
»Nein«, quetschte sie heraus.
»Das wird alles wieder, Berenike.« Max stellte seine Tasse ab und griff nach ihrer Hand. »Abwarten und Tee trinken. An deine Tür werden noch viele interessante Männer klopfen. Jonas ist ein Schuft und deiner nicht wert. Und ein miserabler Polizist ist er obendrein.«
»Ist er nicht.«
»Er wäre aus Leichtsinnigkeit fast draufgegangen bei dem Fall. Ist das vielleicht neuerdings die Art, wie man in Mordfällen ermittelt?«
»Nein. Eigentlich nicht.«
»Siehst du.« Endlich nahm er einen Schluck Tee. »Ah, das schmeckt wirklich überraschend gut. Ganz besonders, nachdem es gestern ein langer Abend wurde in der Wirtschaft.«
»Freut mich.«
Max stellte die Tasse klirrend ab. »Das war eine schreckliche Mordserie.«
»Ja, unglaublich, nicht?«
»Es wird Zeit, nach vorne zu blicken, Berenike.«
»Meinst du? Die Masseurin eben hat mir geraten, mich mit den alten Dingen zu beschäftigen, aber um sie endgültig loszuwerden.« In ihrem Kopf waren wieder die Bilder dunkler Mauern, sie bekam keine Luft. »Erst wenn man das Alte verdaut hat, kann man nach vorne blicken, meinst du nicht auch?« Den Kopf in eine Hand gestützt, sah Max sie eindringlich an.
»Kann sein.«
Die Glöckchen über der Tür bimmelten sachte, Alma stürmte direkt auf ihren Tisch zu. »Hast du einen Reiseführer über Kafkas Prag, Berenike? Wir fahren mit Pessoas Erben nach Prag, weißt du.«
»Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, Alma.« Max betrachtete neugierig die Astrologin, die zu einer Autorengruppe namens Pessoas Erben gehörte. Heute trug sie ein eng anliegendes nachtblaues Kleid, das ihre weiblichen Rundungen gut zur Geltung brachte.
»Ach, Max, grüß dich.« Alma wirbelte wie unter Strom herum.
»Servus, Alma«, sagte Berenike.
»Berenike, ich habe nicht viel Zeit. Mein nächster Kunde kommt gleich, ein wichtiger Mann, der seine Geschäftstermine nach den Sternen legt. Also was ist, hast du einen Reiseführer über Kafkas Prag?«
»Meinst du einen bestimmten Reiseführer?«
»Nein. Ich weiß nicht mal, ob es so ein Buch gibt. Ich dachte, du könntest mir das sagen.«
»Ich werde es gleich herausfinden.« Berenike stand auf und ging hinüber in den Literatursalon, gefolgt von Alma. Zwischen den hohen Regalwänden herrschte Stille, nur eine einzelne Kundin stöberte bei den Krimis.
Berenike tippte eine Suchanfrage in das Buchhandelsprogramm des Computers. Eine Liste mit Buchcovern tauchte auf, auf denen diverse Sehenswürdigkeiten abgebildet waren. Die astronomische Uhr, die Moldau, goldene Kuppeln, enge Gässchen, dunkle Gemäuer. »So, da haben wir alles, was verfügbar ist.« Sie druckte zwei Seiten mit den genauen Titeln aus und gab sie Alma. »Lies dir die Beschreibungen durch und gib mir Bescheid, okay?«
»Danke.«
»Wann fährst du denn?«, fragte Berenike.
»Nächste Woche. Wir wollen uns von Kafka für ein Theaterstück inspirieren lassen, das wir gemeinsam schreiben möchten.« Alma wollte den Zettel in ihre Handtasche schieben, aber irgendwas sperrte sich dagegen. Sie stopfte ihn mit aller Gewalt hinein. »Sepp hat die Idee gehabt und die anderen waren gleich dafür. Bis bald, Berenike. Danke!«
Nachdem Alma gegangen war und Max kurz darauf den Salon verlassen hatte, servierte Berenike ab und stellte alles in den Geschirrspüler. Dann holte sie das Püppchen von Anniko und nahm es nachdenklich in beide Hände. »Ist heute irgendwo was los, Tiffany? Irgendeine Veranstaltung?«
»Du meinst, weil keine Leute da sind?« Tiffany trat neben sie und sah ihr neugierig über die Schulter. »Ich weiß von nichts. Was hast du da?«
»Nichts.« Berenike legte das Püppchen auf die Arbeitsplatte. Tiffany ging in die Küche, Berenike blieb allein an der Theke stehen. Sie lauschte dem monotonen Klopfen des Regens auf den Fensterbrettern. Die Uhr zeigte fast eins. Sie starrte auf den Zeiger, der sich nicht zu bewegen schien. Als wäre sie aus der Zeit gefallen, von allen verlassen. Ihr Blick fiel auf die Teebehälter. Sie würde sich jetzt noch einen Tee zubereiten, China Rose am besten. Tee half immer. Allein durch die Bewegungen fühlte sie sich etwas lebendiger, die gewohnten Handgriffe waren wie Zen. Innere Leere, nichts anderes tun oder denken als das, was man gerade tut. Wenn es nur so einfach wäre!
Sie schnupperte an den zart blumig duftenden Teeblättern, goss das Wasser auf und drehte dann das Püppchen in den Händen hin und her. Sie dachte an die Worte der Masseurin. Alle Probleme dieser Figur anvertrauen. Da kam einiges zusammen: die ausbleibenden Gäste, Jonas, der sie verletzt hatte und ihr trotzdem fehlte. Sie hatten getrennte Wohnungen beibehalten, er in Graz, wo seine Dienststelle bei der Kriminalpolizei lag, sie in Altaussee, wohin sie nach ihrer großen Lebenskrise gezogen war. Sich gegenseitig zu besuchen war etwas Besonderes geblieben, auch wenn sie manchmal den Eindruck gehabt hatte, Jonas hätte es lieber gern anders gehabt. Und jetzt wusste sie gar nicht mehr, woran sie mit ihm war. War es vorbei mit ihnen? Oder nicht? Seine Sachen hatte er jedenfalls noch nicht geholt.
Sie nippte an dem Tee. Lächerlich, das alles einer Puppe zu sagen. Was konnte eine Puppe helfen gegen den Schmerz, dass womöglich alles vorbei war? Ob es ihm schon besser ging, seit er in Lebensgefahr geraten war? Sie dachte wieder daran, wie er damals weggegangen war. Ja, sie hatte ihn davor schon weggeschickt. Sollte sie ihn anrufen? Die Angst vor einer endgültigen Abfuhr lähmte sie. Sie fürchtete sich davor, wie er ihr in sachlichem Tonfall sagen würde, dass sie sich nie wieder sehen würden. Sie verstand nicht, was los war mit ihnen. Es war, als wüsste sie gar nichts mehr über ihn.
Die Teeuhr piepste in ihre Gedanken hinein. Berenike nahm das Filter aus der Kanne und warf es weg. Dann goss sie den duftenden Tee in eine feine weiße Porzellantasse mit zartem Rosenmuster, ein Erbstück ihrer geheimnisvollen Tante Salome, die als eine der wenigen jüdischen Verwandten ihres Vaters die Shoah überlebt hatte. Die Tasse hatte wohl einmal zu einem eleganten Service gehört, war aber als einzige erhalten geblieben, deshalb verwendete Berenike sie nur für sich selbst.
Tief durchatmend blickte sie durchs Fenster. Der Regen musste aufgehört haben, die Fensterscheiben waren vom Wasserdampf beschlagen. In der hereinbrechenden Dämmerung verschwamm das Licht von draußen im weißen Dunst auf dem Glas. Wenn sie ausgetrunken hatte, würde sie hier alles abschließen, Tiffany heimschicken und ihre Schwester Selene von Ragnhilds Pension gegenüber abholen, wo sie gerade wohnte. Sie würden sich einen schönen Abend machen und endlich vom Alltag ablenken; auch Selene hatte das nötig nach der Scheidung und dem Jobverlust.
Berenike nahm die Puppe zur Hand, um sie wegzuräumen. Tatsächlich fühlte sie sich etwas leichter, nachdem sie den Kummer einmal durchdacht hatte. In diesem Moment hörte sie einen Schrei, er klang wie zuvor bei der Massage. Berenike hielt sich die Ohren zu, aber er ließ sich nicht ausblenden. Ein Schmerzensschrei. Berenike spürte eine unglaubliche Trauer, bis sie merkte, dass er dieses Mal real war.
Es war die Stimme ihrer Schwester.
Berenike sprang auf, hörte noch die Tasse klirrend zu Bruch gehen, doch darauf achtete sie nicht mehr. Den Schrei in den Ohren hetzte sie los, hörte die Türglöckchen irre bimmeln, die Tür ins Schloss fallen, ein Auto hupen, als sie die Straße überquerte, und das Bremsen von Rädern, rannte weiter, auf Ragnhilds Pension zu.
Sie verhielt den Schritt, lauschte. Jetzt war alles still. Nur der leichte Gummigeruch der Reifen lag noch in der Luft. Was mochte Selene diesmal in Panik versetzt haben? Flugzeuge, die angeblich giftiges Zeug versprühten? Oder Fluorid in Zahnpasta, das Menschen hirntot machen sollte? Keuchend stieß Berenike die Eingangstür auf. Sanfte asiatische Musik erklang, völlig arrhythmisch zum Puls ihres Herzens und dem Rauschen des Blutes in ihren Ohren. Am unbesetzten Empfang vorbei hastete Berenike die Treppe nach oben und den Gang entlang. Etwas raschelte, Berenike erschrak, erkannte eine Palme, die gerade ein welkes Blatt verlor. Weiter! Über einen weichen roten Teppichboden, knarrende Holzstiegen hinauf. Welche Zimmernummer? 13? 13. Oder? Gab es diese Zahl überhaupt in Hotels? War es doch Zimmer drei? Der Schrei hallte immer noch nach, mischte sich mit dem Musikgedudel, dass sie glaubte, ihr Kopf würde davon explodieren. Und es roch, sie überlegte, es roch komisch, sie konnte es nicht zuordnen.
Der Gang gabelte sich. Verdammt, wohin jetzt? Eine Hand an die Stirn gelegt, versuchte sie sich zu erinnern. Die kleine, silberne Buddha-Figur. Ging es von ihr aus links oder rechts? Die Statue antwortete nicht. Gelassenheit, haha. Berenike hielt lauschend den Atem an. Nichts. Kein Schrei, kein Atmen, gar nichts. Als wäre der Tod schon hier gewesen, als hätte er alles beendet. Für einen Moment wirkte alles unwirklich, als wäre es ein Traum, als wäre sie mit dem Püppchen in der Hand eingeschlafen, und gleich würde Tiffany fragen, was los war, sie würde was essen und ihren Tee austrinken und nach Hause gehen.
Ein Wimmern riss sie aus ihren abgedrifteten Gedanken. Das Wimmern von jemandem, der verletzt war. Weiter, sie musste Selenes Zimmer finden. Dem Geräusch des Wimmerns nach! Sie hastete die Wände mit Tuschzeichnungen von Steinen oder Bäumen entlang, die dezente indirekte Beleuchtung nervte, weil man kaum was erkennen konnte. Tür Nummer 11 – dahinter war es still. 12 – auch kein Laut. 13 – interessant, dass es diese Nummer hier gab. Sie stürzte auf die Tür zu, die Hand nach der Klinke ausgestreckt, stolperte, wäre fast gefallen, bemerkte ein lose auf dem Boden liegendes Kabel, in dem sich ihr Fuß verfangen hatte, kickte es ungeduldig weg. Ein loses Kabel, sonst nichts. Sonderbar. Kein Staubsauger, kein sonstiges Gerät. Sie schaute ungläubig ein zweites Mal. Ein Kabel, das irgendwo herausgerissen worden sein musste, die Drähte lagen nackt da.