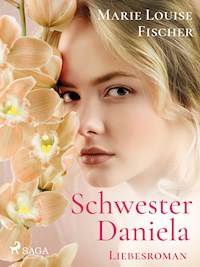
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannender Roman, sensibel und ergreifend erzählt!An Weihnachten wird Schwester Daniela in die Klinik gerufen, um bei einer Frau, die versucht hat sich das Leben zu nehmen, Nachtwache zu halten. Entsetzt stellt Daniela fest, dass es sich bei der Patientin um die Ehefrau ihres Geliebten, Harald, handelt. Daniela wird von Schuldgefühlen geplagt. Hat sie etwa von der Untreue ihres Mannes gewusst und deshalb versucht, sich das Leben zu nehmen? Daniela fasst daraufhin einen radikalen Entschluss. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Schwester Daniela - Liebesroman
Saga
Schwester Daniela – LiebesromanCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1979, 2020 Marie Louise Fischer und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726444865
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
1
Das Bruder-Klaus-Krankenhaus liegt am Rande der Stadt, ein modernes, langgestrecktes Gebäude, dessen große Fenster nach Westen hin den Blick über die Dächer der Stadt freigeben.
Gisela Remagen, die am Telefonschrank saß, hob immer wieder den Blick, um hinauszusehen. Erst gegen fünf Uhr, beim Einbruch der Dämmerung, hörte es auf zu schneien. Die Lichter in den Häusern hoben sich golden gegen das helle Weiß ab; auch aus dem Turm des Münsters drang ein warmer Schein. Gisela Remagen erwartete, daß jetzt jede Sekunde die Glocken zu läuten beginnen würden – nicht nur vom Münster, sondern von allen Kirchen der Stadt.
Es war Heiliger Abend.
Bald würden in den Stuben Tannenbäume angezündet werden, Kinder würden zur Bescherung gestürmt kommen, man würde sich küssen, gratulieren, Weihnachtslieder singen.
Gisela Remagen wußte, daß sie nichts von alledem heute erleben würde, aber es tat ihr nicht leid. Sie hatte das Weihnachtsfest, das allen anderen Freude, ihr selber aber immer nur Enttäuschung gebracht hatte, von jeher gehaßt. Sie hatte sich geradezu danach gedrängt, heute nacht den Telefondienst im Krankenhaus zu versehen. Sie liebte ihre Eltern sehr, und deswegen kränkte es sie, daß keine Familienfeier zu Hause ohne Streit, ohne Bitterkeit, ohne Vorwürfe abgehen konnte.
Einen Augenblick durchzuckte sie Bedauern, daß Schwester Daniela heute keinen Nachtdienst hatte. Gewöhnlich fanden sie beide irgendwann Zeit, um eine Tasse Kaffee miteinander zu trinken und zu plaudern. Aber am Heiligen Abend hatte sich die Nachtschwester beurlauben lassen.
Nun, die Zeit würde auch so vergehen. Gisela warf einen verlangenden Blick auf den dicken Roman, der vor ihr auf dem Tisch lag. Aber noch war es zu früh. Sicher würde sie erst nach zehn Uhr Gelegenheit finden zu lesen.
Die Kapelle des Krankenhauses lag im vierten Stock — ein großer, ein wenig nüchterner Raum, der heute verschwenderisch mit Tannenzweigen ausgeschmückt war.
Auf der einen Seite des Altares stand eine schlank gewachsene Fichte, mit Lametta und bunten Kugeln behangen, an der elektrische Kerzen brannten, auf der anderen Seite war eine holzgeschnitzte Krippe aufgebaut. Wie jedes Jahr war die Ausschmükkung der Kapelle für das Weihnachtsfest den Lehrschwestern überlassen worden, und sie hatten sich auch diesmal mit kindlicher Freude auf diese Arbeit gestürzt.
Schwester Leonie saß an der Hausorgel und intonierte »Ihr Kinderlein kommet«. Ihr klares Profil hob sich gegen das bunte Glasfenster im Hintergrund sehr eindrucksvoll ab. Eine rote Locke hatte sich unter dem Häubchen gelöst und fiel ihr in die weiße Stirn. Es war kein Wunder, daß einige der jüngeren Ärzte mehr zu Schwester Leonie hinblickten als zum Weihnachtsbaum oder zur Krippe.
Jetzt erhob Schwester Leonie ihre helle Stimme zu dem alten Weihnachtslied. Professor Kortners Baß fiel dröhnend ein. Auch die anderen versuchten recht und schlecht, es ihnen gleichzutun.
Das Lied war noch nicht beendet, als durch eine Seitentür hinter dem Altar der junge Dr. Georgi hereinstapfte, im roten, weißverbrämten Kapuzenmantel als Weihnachtsmann verkleidet. Er hatte sich sogar einen weißen Schnurrbart unter die Nase geklebt und weiße Watteaugenbrauen auf die Stirn, mit einem Kohlestift Fältchen um die Augen gezogen — dennoch wußte natürlich jeder der Anwesenden, daß es Dr. Georgi war. Er spielte schon im dritten Jahr den Weihnachtsmann, und Schwestern und Ärzte waren begeistert. Manche seiner älteren Kollegen fanden allerdings etwas an ihm auszusetzen — zum Beispiel, daß seine Späße oft allzu weltlich waren —, aber wenn es soweit war, wagte doch niemand ihn abzulösen.
Der Weihnachtsmann schleppte einen riesigen Sack auf seinem Rücken in die Kapelle, setzte ihn mit einem hörbaren Aufatmen auf den Boden, wischte sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn. Obwohl er seine Erschöpfung ein wenig übertrieb, wußten doch alle, daß dieser Sack tatsächlich schwer genug sein mußte.
Professor Kortner, Oberschwester Notburga und die Chefsekretärin machten sich jedes Jahr die Arbeit, Geschenke für jeden der Krankenhausangestellten einzeln auszusuchen und sorgfältig zu verpacken. Alle diese Weihnachtspaketchen wanderten in den großen Sack, und wer sonst noch von den Ärzten, Schwestern oder Patienten des Krankenhauses jemandem, der an der Weihnachtsfeier teilnahm, eine Freude, ein Geschenk oder eine Überraschung machen wollte, pflegte sein Päckchen mit hineinzutun.
»Ihr Kinderlein kommet« war gerade verklungen, der Weihnachtsmann hatte die Bescherung mit seinem klassischen Satz: »Na, wart ihr auch dieses Jahr alle brav?« eröffnet, als Dr. Wörgel, der diensthabende Arzt, mit raschen, lautlosen Schritten den mittleren Gang hinuntereilte.
Niemand der Anwesenden beachtete ihn.
Professor Kortner fuhr erst herum, als Dr. Wörgel ihm die Hand auf die Schulter legte. »Was zum Teufel ...!« platzte er heraus, dann mäßigte er sich und sagte: »Was ist los, Wörgel?«
»Eine Einlieferung«, flüsterte Dr. Wörgel zurück. »Ich habe sie untersucht. Es scheint sich um einen Schädelbruch zu handeln!«
Professor Kortner hob die kräftigen dunklen Augenbrauen. »Sind Sie sicher?«
»Leider, Herr Professor.«
»Na, dann müssen wir wohl!« Professor Kortner drehte sich um, trat auf den Gang hinaus, warf seiner Oberschwester, die ihn fragend anschaute, einen bestätigenden Blick zu und verließ auf leisen Sohlen die Kapelle, dicht gefolgt von seinem Assistenzarzt Dr. Wörgel und Oberschwester Notburga.
»Ausgerechnet am Heiligen Abend!« sagte er draußen. »Daß die Leute nicht aufpassen können! Wie ist denn das passiert?«
»Verkehrsunfall.«
»So? Na, ich bin ja immer dagegen gewesen, daß Frauen Auto fahren. Sie sind zu emotionell veranlagt, Wörgel, glauben Sie mir ... was Schwester Notburga und die anderen Damen Ihnen auch als Gegenargument anführen mögen. Es handelt sich doch um eine Frau, wie?«
»Jawohl, Herr Professor, Anfang Dreißig, aber keine gute Konstitution. Wahrscheinlich ... nun, der Polizist, der sie einlieferte, sagte mir, daß sie mit ihrem Wagen geradewegs gegen einen Pfeiler der Unterführung gerast ist.«
»Aha. Unfall in Eigenproduktion. Es sieht ganz so aus, als ob ...« Der Professor vollendete seinen Satz nicht.
Dr. Wörgel verstand ihn auch so. »Jawohl, Herr Professor. Möglicherweise war das seelische Gleichgewicht schon vor dem Unfall gestört. Gerade das befürchte ich auch.«
Sie schritten den langen, spiegelblank gebohnerten Gang entlang zum Aufzug, traten in die Kabine und ließen sich ins Erdgeschoß hinunterfahren.
Die Verunglückte lag auf einer Trage im Nebenraum der Notaufnahmestation. Sie hatte ein sehr schmales, längliches Gesicht mit scharfen Zügen und einer spitzen Nase. Ihre grünliche Blässe hob sich stark gegen das kohlschwarze, wahrscheinlich nachgefärbte Haar ab. Mit dem bloßen Auge war nicht einmal zu erkennen, daß sie atmete.
Professor Kortner beugte sich über die Patientin, faßte das Gelenk der schlaff herabhängenden Hand. Der Puls ging kaum fühlbar.
»Bluttransfusion«, sagte er, »so schnell wie möglich.«
»Dr. Schmidt ist schon dabei, die Blutgruppe festzustellen. Im Labor ist heute leider niemand mehr!«
»Schmidt? Ich dachte, er wollte so rasch wie möglich nach Hause. Nicht mal die Weihnachtsfeier ...«
Der Assistenzarzt lächelte unbewußt ein wenig schadenfroh. »Ich habe ihn gerade noch erwischen können ... zwischen Tür und Angel. Er war nicht sehr begeistert.«
»Kann ich mir vorstellen!« Professor Kortner befühlte mit seinen langen, geschickten Fingern den Kopf der Patientin. »Gefällt mir nicht«, sagte er, »gefällt mir ganz und gar nicht. Ein Glück, daß wenigstens Schmidt hier ist. Ohne Anästhesisten wäre die Sache nicht zu machen.« Er wandte sich an Schwester Notburga: »Sie muß sofort nach oben. Alles zur Operation vorbereiten!«
Dr. Gotthold Schmidt, einen Zettel in der Hand, auf den er die Bestimmung der Blutgruppe geschrieben hatte, kam ins Zimmer. Ohne aufzusehen sagte er: »Das hätten wir. Kann ich jetzt endlich ...«
Professor Kortner unterbrach ihn: »Gut, daß du da bist, alter Junge! Ich nehme an, du hast Gerinnungszeit und so weiter auch schon festgestellt, wie?«
»Wollt ihr operieren?«
»Was denn sonst? Du kannst die Patientin gleich in den Anästhesieraum begleiten. Je eher wir eingreifen können, desto besser.«
Dr. Schmidt machte ein unglückliches Gesicht. »Ich habe so was schon auf mich zukommen sehen«, sagte er, »und dabei habe ich Gisela fest versprochen, heute abend pünktlich zur Bescherung zu Hause zu sein. Die Kinder ...«
»Evelyn wird mir auch was erzählen, da kannst du dich drauf verlassen!« sagte der Professor ungerührt. »Aber da gibt es nur eines ... nicht hinhören!«
Bernhard Kortner und Gotthold Schmidt waren Kommilitonen gewesen, und sie hatten sich diese Jugendfreundschaft über die Jahre hinweg bewahrt, wenn auch ihre Frauen, die sehr verwöhnte und schwierige Evelyn und die hausbackene, ein wenig unordentliche Gisela Schmidt, niemals einen wirklichen Kontakt zueinander hatten finden können.
Zwei Sanitäter hoben die Trage mit der Schwerverletzten vorsichtig auf und balancierten sie behutsam aus dem Zimmer. Die Oberschwester und der Anästhesist folgten.
Professor Kortner zündete sich eine Zigarette an. »Außer der Schädelfraktur?« fragte er.
»Oberschenkelbruch«, berichtete Dr. Wörgel, »scheint auch nicht ganz einfach zu sein. Dazu verschiedene Abschürfungen und Prellungen, die sofort versorgt worden sind.«
»Schlimm«, sagte der Professor, »sehr schlimm. Hat sie Angehörige?«
»Verheiratet. Die Polizei wird ihren Mann benachrichtigen.«
»Schöne Weihnachtsbescherung. Na ja, wir werden sehen, was wir machen können.« Professor Kortner drückte, wie es seine Angewohnheit war, die halb aufgerauchte Zigarette aus, und sagte: »Wenn alles gut geht, brauchen wir eine Dauerwache! Schwester Daniela ...«
»... ist für heute nacht beurlaubt, Herr Professor!«
Professor Kortner hob die dunklen Augenbrauen. »So? Ach, ich weiß schon. War da nicht irgend etwas mit einem Kind?«
»Ja, Schwester Daniela wollte an diesem Abend mit ihrer kleinen Tochter zusammen sein!«
»Sehr verständlich. Nur zu verständlich. Trotzdem ... tut mir leid. Sie muß her!«
Als sein Assistent schwieg, fragte er ungeduldig: »Na, was ist? Paßt Ihnen das etwa nicht?«
»Könnte man nicht ...«, sagte Dr. Wörgel unsicher, »ich meine, besteht nicht die Möglichkeit ...«
»Sie wissen sehr gut, daß wir die Zahl der diensthabenden Schwestern heute auf ein Minimum beschränkt haben. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als eine zu holen. Warum also nicht Schwester Daniela? Ich weiß, daß sie absolut zuverlässig ist.«
»Ich hätte ihr das gern erspart.«
»Ich mir auch und Ihnen ... und dem guten Gotthold Schmidt. Aber was kann man da machen? Es ist unser Beruf, und wir haben ihn freiwillig gewählt. Denken Sie an Ihren Kant!« Mit halber Ironie zitierte der Professor: »Wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere Pflicht zu tun!« —
»Ich hätte nie gedacht, daß das Leben noch einmal so schön sein könnte!« sagte Daniela Kreuzer aus vollem Herzen.
Goldgelbe Kerzen brannten in den grünen Zweigen des Weihnachtsbaumes. Im Zimmer roch es nach Honig, Tannen und Backwerk. Auf dem Teppich kniete die kleine Eva und spielte mit ihrer neuen Babypuppe. Neben Daniela auf der Couch saß Harald Spielmann, der Mann, den sie liebte.
Vor einer halben Stunde hatte er ihr den Verlobungsring übergestreift — einen schmalen Ring aus Platin mit einem schimmernden kleinen Diamanten.
»Wenn wir erst in Kanada sind«, sagte er jetzt, »du wirst sehen ... es wird noch viel schöner!«
»Warst du schon einmal drüben?« fragte sie arglos.
Er wurde rot, und sie begriff sofort, daß sie einen Fehler gemacht hatte.
»Harald!« Sie strich ihm mit der Hand durch das blonde, widerspenstige Haar. »Du weißt, daß ich dich liebe. Ich meine es ja auch nur gut mit dir! Als ich dich kennenlernte ... wann war das überhaupt? Im August, nicht wahr? Es ist nun also doch noch kein halbes Jahr her ... da wolltest du nach Afrika. Du hast mir immerzu erzählt, daß Afrika das Land der Zukunft wäre! Und ich habe dir geglaubt, wie ich alles glaube, was du mir sagst. Dann war Afrika von einem Tag auf den anderen vergessen. Kanada war das gelobte Land. Was soll ich davon denken?«
»Daß ich ’raus will us Europa, ganz gleich wohin!«
Ohne daß sie es bemerkt hatten, war die kleine Eva aufgestanden und legte ihre Babypuppe auf Danielas Schoß. »Mutti«, sagte sie, »Onkel Harald ... warum sprecht ihr nicht mit mir?«
Harald Spielmann beugte sich vor, faßte die Kleine unter das Kinn. »Über was denn? Was sollen wir mit dir reden, Eva?«
»Über meine Puppen natürlich.«
Daniela lachte. »Eva hat ganz recht, Harald. Auswanderung und das alles sind keine Gespräche für den Heiligen Abend. Warum mußt du immer alles so ... so belasten? Warum kannst du nicht einfach glücklich sein wie ich?«
Er stand auf. »Weil ich ein Mann bin, Daniela! Männer haben das so an sich, vorauszuschauen, sich zu sorgen. Ich denke ja immer nur an euch ... an Eva und dich. Ich möchte einfach, daß ihr beide ein glückliches und sorgloses Leben führt.«
»Aber das tun wir doch!«
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen zärtlichen kleinen Kuß auf die Nase. »Aber jetzt unterhalte dich lieber mal ein bißchen mit Eva. Ich muß in die Küche und nachschauen ...«
»Du hast doch nicht extra etwas gekocht, Daniela?«
»Bisher nur das Wasser. Es soll Karpfen blau geben mit Meerrettichsahne, wie es sich für einen richtigen Heiligen Abend gehört.«
»Tut mir leid, Daniela«, sagte er betroffen, »tut mir entsetzlich leid.«
Ihre blauen Augen wurden fast dunkel vor Enttäuschung. »Mußt du fort?«
»Ja, ich war sicher, ich hätte es dir erzählt.«
»Kein Wort!«
»Dann muß ich es einfach vergessen haben. Weißt du, ich habe mir angewöhnt, mich dauernd in Gedanken mit dir zu unterhalten ... deshalb kann ich gar nicht mehr genau feststellen ...«
»Weshalb mußt du fort?«
»Mister Hythe ...«
»Ich weiß schon. Der Freund deines Geschäftsfreundes aus Toronto! Ich dachte, der wäre schon vorgestern nach München gefahren!«
»Wollte er auch. Aber dann ist ihm eingefallen, daß er in München erst nach den Feiertagen arbeiten kann. Deshalb ... es ist mir sowieso schon unangenehm, aber ich bin einfach verpflichtet, mich ein bißchen um ihn zu kümmern.«
»Ja ... aber warum hast du ihn dann nicht mitgebracht?«
»Hierher?«
»Warum nicht? Ich könnte mir vorstellen, daß er ganz gern ein deutsches Weihnachten im Familienkreis erlebt hätte.«
»Er schon. Da bin ich sicher. Aber mir hätte es nicht gepaßt. Ich weiß, du wirst mich jetzt auslachen, Daniela ... aber ich kann es nicht ändern, ich bin nun einmal rasend eifersüchtig.«
»Du machst Spaß«, sagte Daniela. »Hast du mir nicht erzählt, daß dieser Mister Hythe alt und langweilig wäre?«
»Ist er auch. Für meinen Geschmack jedenfalls. Immerhin sieht er blendend aus.«
»Hast du keinen Augenblick daran gedacht, daß ich damit gerechnet haben könnte, du würdest zum Essen bleiben?«
»Ich war überzeugt, ich hätte dir erzählt, daß ich fort muß!«
»Dann geh einfach hin und sage ihm, daß du eingeladen bist ... daß du vergessen hast, es ihm zu sagen!«
»Nein, das geht auch nicht. Ich kann ihn doch nicht so enttäuschen.«
»Aber mich! Bei mir macht es dir gar nichts aus!«
»Daniela!« Er packte sie bei den Schultern. »Bitte, nun nimm doch mal Vernunft an! Du weißt genau, wie gern ich heute abend bei dir bleiben würde! Ich würde wer weiß was darum geben, wenn es möglich sein würde! Aber es ist ausgeschlossen. Kannst du mir das nicht glauben?«
»Nein«, sagte sie hartnäckig, »ich sehe das nicht ein. Gerade am Heiligen Abend gehört man zu den Menschen, die man liebt.«
»Stimmt nicht«, sagte er, »am Heiligen Abend ist man mit den Menschen zusammen, zu denen man offiziell gehört. Das ist ein großer Unterschied. Offiziell gehören wir noch nicht zusammen, mein Liebes, deshalb haben wir kein Recht ...«
»Das sind doch Haarspaltereien! Oder ... willst du mir etwa sagen, daß der Ring ... daß dein Versprechen nichts zu bedeuten hat? Dann ...« Sie machte eine hastige Bewegung, als wenn sie den Ring abstreifen wollte.
»Daniela«, sagte er heftig. »Bitte ... ich bitte dich! Natürlich gilt der Ring, und natürlich gilt, was ich dir versprochen habe. Ich liebe dich ... ich liebe dich mehr, als ich je einen Menschen geliebt habe. Wir werden heiraten, sobald es möglich ist ... das ganze Leben liegt vor uns. Gerade deshalb kommt es doch nicht auf den einen Abend an. Ausgerechnet diesen Abend!«
»Du hast ja recht«, sagte sie zerknirscht. »Es tut mir leid, wenn ich mich albern benommen habe, aber ... ich hatte mich schon so gefreut!«
Er zog sie in seine Arme. »Jetzt bist du mir böse!«
»Überhaupt nicht.« Sie schüttelte den Kopf, daß ihr weiches, kastanienbraunes Haar flog.
»Komm her, Eva!« Daniela wandte sich um. »Gib Onkel Harald die Hand und mach einen schönen Knicks ... bedank dich noch einmal für die herrliche Puppenküche, ja?«
»Vielen Dank, Onkel Harald!« sagte Eva wohlerzogen, aber ohne Überzeugung.
»Ich hoffe, du hast Spaß damit, Eva«, sagte er und tätschelte ihre Wange.
Im Flur half Daniela ihm zärtlich in den schweren Wintermantel, band ihm den maisgelben, grobgestrickten Wollschal — ihr Weihnachtsgeschenk — um den Hals. Sie küßten sich noch einmal mit jäher Leidenschaft.
Als er gegangen war, stand sie eine Sekunde wie benommen. Dann atmete sie tief, sah in den großen Flurspiegel, nahm einen Lippenstift, zog sich die Konturen ihres Mundes nach. Sie bürstete sich mit raschen Strichen über die braunen Locken, glättete mit einer kleinen Wendung das blaue Kleid und trat ins Zimmer zurück.
Eva hatte die neue Babypuppe inzwischen vollkommen ausgezogen. »Gut, daß er weg ist«, sagte sie, ohne aufzusehen.
»Eva! Wie kannst du denn so reden? Du hast keinen Grund, häßlich über Onkel Harald zu sprechen. Sieh dir doch bloß mal die schöne Puppenküche an, die er dir geschenkt hat.«
»Ich will sie gar nicht haben!«
»Eva! Du hast sie dir doch immer gewünscht!«
»Ja, aber vom Christkind!«
»Nun sei nur nicht albern, du weißt ...« Daniela kam nicht dazu, ihren Satz zu Ende zu sprechen.
Das Telefon klingelte. —
Als Daniela Kreuzer eine knappe Stunde später im Krankenhaus eintraf — sie hatte sich in aller Eile umgezogen, Eva, die gewohnt war, allein zu schlafen, ins Bett gebracht und der Nachbarin Bescheid gesagt, war dann mit einem Taxi zum
Stadtrand gefahren —, erwartete sie eine Überraschung. Im Schwesternzimmer der Privatstation hatte Schwester Berta, die sie heute als Nachtschwester vertrat, ein Tannenbäumchen angezündet. Darunter stapelten sich kleine, hübsch eingepackte Pakete.
»Für mich?« sagte Daniela überwältigt. »O nein, das hättet ihr aber nicht tun sollen!«
»Es war nicht meine Idee«, sagte Schwester Berta lächelnd. »Ich habe lediglich den Auftrag bekommen, die Kerzen anzuzünden!«
»Von wem?«
»Darf ich nicht verraten!«
»Bitte, Berta, seien Sie doch nicht so ... sagen Sie mir ...«
»Nun ja, wenn Sie’s unbedingt wissen wollen ... also, passen Sie auf!« Schwester Berta machte ein geheimnisvolles Gesicht. »Vom Weihnachtsmann!«
Daniela war aus dem dunkelblauen Schwesternmantel geschlüpft, jetzt steckte sie vor dem Spiegel noch rasch ein paar widerspenstige Löckchen unter die Haube. Wie immer fand sie sich in der Tracht ganz verändert. Sie sah strenger und zugleich auch gütiger aus.
»Wollen Sie die Päckchen nicht wenigstens öffnen?« fragte Berta.
Daniela schüttelte lächelnd den Kopf. »Geht nicht. Leider. Ich muß sofort ins Wachzimmer.« Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Die Operation ist sicher schon beendet.«
»Dann nehmen Sie Ihre Geschenke mit.« Schwester Bertas Stimme klang bedauernd; sicher hätte sie selbst gerne gewußt, was ihre Kollegin geschenkt bekommen hatte.
Mit eiligen Schritten ging Schwester Daniela den breiten Gang entlang, an dem links und rechts die Einzel- und Doppelzimmer der Privatstation lagen. Sie wußte, daß nur drei Zimmer belegt waren — in Nummer sieben lag Roy Erichson, der Filmschauspieler, in Neun ein Kind mit einer Blinddarmoperation, in Fünfzehn, auf der anderen Seite, eine alte Dame, deren linke Niere entfernt werden mußte.
Daniela dachte plötzlich, ob die Patienten sich nicht freuen würden, wenn sie rasch den Kopf hineinstecken und guten Abend sagen würde. Sie hätte gern gewußt, wie diese armen Menschen sich heute, am Heiligen Abend, fern von ihren Angehörigen, im Krankenhaus fühlten.
Sie verzichtete nicht ohne ein leises Schuldgefühl. Der Fall, dessentwegen sie in die Klinik gerufen worden war, ging vor.
Das Wachzimmer lag außerhalb der Privatstation, aber nur wenige Schritte entfernt, um eine Ecke herum.
Als Schwester Daniela nach kurzem Anklopfen eintrat, erhob sich Dr. Schmidt, der am Bett der Patientin gesessen hatte, sofort.
»Na endlich!« sagte er erleichtert.
»Ich bin erst vor einer knappen Stunde angerufen worden, Herr Doktor.«
»Ich weiß, ich weiß, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Schwester! Es ist nur ... meine Familie wartet auf mich.« Er warf einen Blick auf die Patientin, die mit geschlossenen Augen dalag, mit offenem Mund schwer atmete. »Sie wissen, was Sie zu tun haben?«
»Blutdruck, Puls, Atmung und Temperatur kontrollieren«, sagte Schwester Daniela.
»Sehr richtig. Der Fall ist höchst kritisch. Sobald Sie eine Verschlechterung des Zustandes merken, müssen Sie Doktor Wörgel informieren. Er hat heute Nachtdienst.«
»Ja, danke ... ich werde daran denken!«
»In zwei Stunden sollten Sie der Patientin auf alle Fälle noch eine Blutkonserve zuführen ... sie ist sehr geschwächt.«
»Wenn sie erwacht ...«
»Wahrscheinlich wird sie sich an nichts erinnern können. Möglicherweise nicht einmal an ihren Namen. Sie müssen sehr behutsam mit ihr umgehen, ja? Aber es ist gut möglich, daß sie die ganze Nacht ohne Bewußtsein bleibt.« Dr. Schmidt ging zur Tür. »Ich werde den Kollegen Wörgel bitten, sobald er Zeit hat, einmal bei Ihnen hereinzuschauen. Sie wissen, daß Sie, was auch immer geschieht, das Zimmer nicht verlassen dürfen!«
»Selbstverständlich nicht, Herr Doktor.«
»Also dann, gute Nacht, Schwester Daniela.«
»Frohe Weihnachten, Herr Doktor.«
»Wahrhaftig, das hätte ich fast vergessen! Danke, Schwester, ich wünsche Ihnen dasselbe. Hat uns sehr leid getan, daß wir Sie ausgerechnet am Heiligen Abend Ihrer kleinen Tochter entreißen mußten.«
Schwester Daniela lächelte. »Halb so schlimm. Für Eva war’s sowieso Zeit, zu Bett zu gehen.«
Schwester Daniela ging zu dem weißgedeckten Tisch, nahm den Karton mit der Fiebertabelle und dem Krankenbericht zur Hand, las den Namen: Irene Spielmann.
Eine Sekunde lang war es ihr, als wenn eine kalte Hand nach ihrem Herzen griffe, dann hatte sie das kurze Entsetzen schon überwunden, mußte über sich selbst lächeln. Warum sollte die Patientin nicht Spielmann heißen? Es war ein Zufall, nichts als ein lächerlicher Zufall, nicht der geringste Grund, erschrocken zu sein.
Hinter dem Namen stand die Diagnose — sie war in lateinischen Fachausdrücken festgehalten, aber Schwester Daniela hatte Erfahrung genug, um sofort zu wissen, um was es sich handelte. Ein komplizierter Schädelbruch — das war schlimm, sogar lebensgefährlich.
Schwester Daniela sah auf das bleiche, spitze Gesicht. Ob diese Frau Kinder hatte? Unwillkürlich suchten ihre Augen die wächsernen Hände, die leblos auf der Decke lagen. Die Patientin trug keinen Ring, doch das hatte Schwester Daniela auch nicht erwartet. Schmuck pflegte vor der Operation entfernt zu werden. Aber es schien ihr, als wenn sich am Ringfinger der rechten Hand ein etwas hellerer Streifen auf der Haut abzeichnete, dort, wo ein Ring gesessen hatte, wahrscheinlich der Ehering.
Daniela wußte, daß Dr. Schmidt die Routineuntersuchungen kurz vor seinem Fortgang durchgeführt hatte. Dennoch hielt sie es für richtig, sich selbst ins Bild zu setzen. Sie kontrollierte Blutdruck, Puls, Atmung und Temperatur, trug die Ergebnisse auf der Tabelle ein. Mit Besorgnis stellte sie fest, daß der Zustand der Patientin sich wiederum verschlechtert zu haben schien. Alle Lebensvorgänge waren stark geschwächt.
Schwester Daniela knipste die kleine Lampe mit dem runden Pergamentschirm an, drehte das Deckenlicht ab. Sie setzte sich und holte ein Buch aus der Tasche.
Obwohl sie weit fort war mit ihren Gedanken, registrierte sie dennoch sofort das Geräusch, das sie vom Krankenbett her vernahm. Es war ein rasselndes Atemholen, fast ein Röcheln.
Schwester Daniela stand auf, legte ihr Buch fort und trat ans Krankenbett. Der Atem der Patientin ging ganz schwach, der Puls war kaum fühlbar. Konnte sie noch länger abwarten, oder war es nicht doch besser, sich sofort mit dem diensthabenden Arzt in Verbindung zu setzen? — Sie hielt schon den Telefonhörer in der Hand, als die Doppeltüren des Krankenzimmers geöffnet wurden.
»Gut, daß Sie kommen, Herr Doktor«, sagte sie aufatmend, »die Patientin ...«
»Steht schlecht, wie?«
Sie gab dem Arzt die Tabelle. »Meine letzten Messungen liegen noch tiefer«, sagte sie.
»Hm!« Dr. Wörgel ließ sich am Bettrand nieder, schob das Nachthemd an der Brust auseinander, horchte die Herztöne ab.
»Sauerstoffdusche?« fragte Schwester Daniela.
Dr. Wörgel lächelte schwach. »Sie hätten Medizin studieren sollen, wie?«
Daniela wurde rot. »Entschuldigen Sie, bitte.«
»Da gibt es nichts zu entschuldigen, Sie haben ganz recht. Sauerstoffdusche.«
Mit Hilfe des Arztes stellte Schwester Daniela den Apparat ein, legte der Patientin das Mundstück an. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie endlich mit Erleichterung bemerkten, daß die Atmung tiefer wurde, der Brustkorb sich zu heben und zu senken begann. Gerade in diesem Augenblick wurde an die Tür geklopft.
Dr. Wörgel knurrte ungehalten.
»Soll ich ...«
»Gehen Sie schon!«
Noch ein zweites Mal war das Pochen zu hören, diesmal ungeduldiger und heftiger, bevor Schwester Daniela die Tür öffnen konnte. Sie trat sofort hinaus, schloß die Doppeltür hinter sich, nicht gewillt, jemanden ins Krankenzimmer zu lassen.
Sie stand mit dem Rücken zur Tür, ein wenig geblendet von dem sehr viel helleren Licht im Gang. Es dauerte eine Sekunde, bis sie den unerwünschten Eindringling erkannte. Es war Harald Spielmann.
2
Wenn Schwester Daniela später an jene schicksalhafte nächtliche Begegnung im Krankenhaus zurückdachte, dann war sie niemals imstande zu begreifen, wie sie alles hatte ertragen können, ohne ohnmächtig zu werden, ohne zu schreien, ohne in Tränen auszubrechen.
Der Schmerz, das Entsetzen, die Qual waren so groß, daß sie nicht in der Lage war, ein Wort hervorzubringen. Sie stand wie versteinert und starrte ihn an.
»Du?« sagte er töricht. »Aber ich dachte ...«
Er schien nichts von ihrem Entsetzen zu spüren. Sein Gesicht wirkte verblüfft, nicht verstört — eher wie das eines ertappten Schuljungen. Er strich sich mit einer verlegenen Geste über das widerspenstige Haar. »Wie geht es ihr?«
Schwester Daniela war immer noch unfähig, sich zu rühren. Sie starrte ihn nur an, klammerte sich innerlich an die verzweifelt winzige Hoffnung, daß alles ein Irrtum sein möge, ein Trug.
»Hör mal«, sagte er, »nun red schon! Was ist los mit ihr?« Mühsam gelang es ihr, ihre Lippen zu bewegen. »Harald ...«, sagte sie und noch einmal: »Harald.«
»Tut mir leid«, sagte er nervös, »ich kann mir vorstellen, es war ein Schock für dich ... aber schließlich ... ich habe es dir ja nur nicht erzählt, um dich zu schonen. Was hätte es für einen Sinn gehabt, dich zu beunruhigen.«
»Sie ... ist ... also ... deine Frau?« — Jedes Wort war wie ein Stein, der in einen Tümpel fiel und einen Ring nach dem anderen kreisen ließ.
»Ja«, sagte er gedehnt, dann fügte er rasch hinzu: »Aber ich liebe sie nicht, Daniela. Du darfst nicht glauben, daß ich sie liebe. Sie ist mir längst gleichgültig geworden. Ich habe mir niemals etwas aus ihr gemacht.«
»Sie ist verunglückt ...«, sagte Daniela und begriff es erst ganz, als sie es aussprach, »sie ist verunglückt, während du bei mir warst!«
»Na also. Du siehst, ich hatte nicht das geringste damit zu tun.«
Wie sinnlos das alles ist, dachte Daniela, wie sinnlos jedes Wort, das wir miteinander wechseln. »Ich muß zurück«, sagte sie laut.
»Wie geht es ihr?« fragte er noch einmal.
»Schlecht. Sehr schlecht.«
»Wird sie ...« Er hielt Daniela am Arm fest.
»Ich weiß es nicht. Niemand weiß es.«
»Daniela, bitte, sei doch ehrlich, du hast viel Erfahrung, du hast mir selbst oft gesagt, wieviel Erfahrung du hast! Du wirst feststellen können, ob jemand ... oder nicht ...«
»Man muß warten!«
»Verdammt!« Er fuhr mit der Hand in die Hosentasche, zog sie mit einem Päckchen Zigaretten zurück. »Darf man hier ...?«
Sie deutete stumm auf einen der großen Aschenbecher, die den Gang entlang verteilt waren.
Er zündete sich eine Zigarette an. »Also hör mal, Daniela«, sagte er, »nun laß uns doch mal ganz vernünftig ...«
Sie unterbrach ihn. »Ich habe dir nichts mehr zu sagen, Harald.« Sie holte Luft. »Als Krankenschwester möchte ich dir mitteilen, daß deine Frau operiert worden ist, aber das weißt du wohl schon. Sie ist noch nicht aus ihrer Bewußtlosigkeit erwacht. Wahrscheinlich wird sie’s auch nicht so bald. Du kannst warten oder nach Hause gehen, ganz wie du willst. Auf alle Fälle wird man dich benachrichtigen, sobald sich eine entscheidende Veränderung im Krankheitsbild der Patientin ergibt.«
Ohne seine Reaktion abzuwarten, öffnete sie die Tür und ging ins Krankenzimmer zurück. Sie wunderte sich darüber, daß sie so flüssig und mit fester Stimme hatte reden können. Routine war das einzige, an das man sich klammern konnte, wenn alles andere schwankte.
Erst als sie wieder am Bett der Schwerverletzten stand, spürte sie die übermenschliche Anstrengung, die sie die letzten Minuten gekostet hatten.
Ihre Knie zitterten vor Schwäche. Sie mußte sich am Fußende des Bettes festhalten, um nicht zu stürzen.
»Da sind Sie ja«, sagte Dr. Wörgel, der der Kranken die Sauerstoffmaske inzwischen wieder abgenommen und den Apparat ausgeschaltet hatte. »Was war los?«
»Ein ... Angehöriger«, sagte Daniela mit steifen Lippen.
Dr. Wörgel sah sie an, war mit wenigen Schritten bei ihr, packte sie von hinten bei den Schultern. »Schwester ... was haben Sie? Sie wollen doch nicht etwa schlappmachen, wie?«
Schwester Daniela schüttelte den Kopf.
»Na, sehen Sie. Ich hab’s doch gewußt. Übermüdet, wie? Das kommt davon, wenn man Nachtschwestern unausgeschlafen zum Dienst zitiert. Warten Sie mal, ich gebe Ihnen was, das wird Ihnen auf die Beine helfen!« Er holte eine Medizinpackung aus der Tasche seines weißen Kittels und drückte sie Daniela in die Hand. »Ein stärkendes Präparat ... ausgezeichnet ... Sie werden sehen ...«
»Danke«, sagte Schwester Daniela und lächelte mühsam, »vielen Dank, Herr Doktor!«
»Angehörige«, sagte Dr. Wörgel, »das kennen wir. Wahrscheinlich der Gatte, wie? Hat verrückt gespielt, ich kann es mir vorstellen. So sind die Menschen. Solange alles gut geht, fühlen sie sich stark ... sind sie sicher, daß es ihr Verdienst ist. Aber wenn das Schicksal mal zuschlägt... dann geraten sie gleich aus der Fassung. Dann sind sie sicher, daß sie das, gerade das nicht verdient haben!«
Schwester Daniela schwieg. Sie genoß die Fürsorge des Arztes, war dankbar, daß er keine Erklärung oder Entschuldigung von ihr erwartet hatte. Er redete noch eine ganze Weile, und sie begriff, daß er sie ablenken, ihr Zeit geben wollte, sich zu erholen.
»So, jetzt haben Sie wieder Farbe in die Wangen bekommen!« sagte er endlich. »Ich glaube, jetzt kann ich Sie wohl allein lassen, wie? Wenn irgend etwas sein sollte, Sie wissen, ich bin im Haus.«
Als die Glocken des Münsters den ersten Weihnachtsfeiertag einläuteten, als die fahle Dämmerung eines schneeigen Wintertages das kleine Krankenzimmer erfüllte und Schwester Daniela das Licht löschen konnte, spürte sie, daß sie in dieser Nacht um Jahre gealtert, ja, um Jahre gereift war. Selbst ihr Gesicht schien ihr verändert; es hatte die weichen Rundungen verloren, war härter geworden, die Augen schienen größer, wissender.
Als Schwester Lucie, ihre Ablösung, mollig und vergnügt, in Wäsche, die vor Stärke knisterte, ins Zimmer rauschte, hatte Daniela sich wieder ganz gefangen. Sie konnte sachlich den Bericht über die Nacht geben, sie konnte sogar lächeln, fröhliche Weihnachten wünschen.
Dennoch war sie froh, als niemand im Schwesternzimmer war. Mit raschen Händen packte sie die Weihnachtspäckchen in ihre Tasche. Der Weg aus dem Krankenhaus glich fast einer Flucht.
Dann war alles wie immer, nur ein wenig schwieriger. Der Kindergarten fiel aus, und Eva mußte zu Hause spielen. Daniela machte rasch ein weihnachtliches Frühstück für sich und die Kleine, brachte das Schlafzimmer in Ordnung. Dann legte sie sich, in eine weiche wollene Decke gepackt, auf die Couch, sah zu, wie Eva ihrer Babypuppe Fläschchen gab, sie wickelte, ihr Schlaflieder sang.
Die liebevolle Mütterlichkeit des Kindes rührte sie sehr. Zärtlichkeit für dieses kleine Wesen, das ganz und gar und ohne Falsch zu ihr gehörte, löste den Krampf des Herzens.
Sie weinte.
Sie bemühte sich lange, die Tränen zurückzuhalten, ihr Schluchzen zu dämpfen, um das Kind nicht zu beunruhigen. Aber Eva warf ihr nur einen Blick zu, fragend und wissend zugleich, wandte sich dann wieder ihrem Spiel zu.
Daniela schluchzte hemmungslos, und mit jeder Träne wurde ihr Herz leichter.
»Willst du, bitte, ein Taschentuch?« fragte Eva und stand plötzlich neben ihr. Daniela nickte, schluckte, rieb sich mit der Hand über die Augen.
Eva kam mit einer Puppenwindel an. »Da, nimm!«
Daniela schneuzte sich und wischte sich das Gesicht ab. »Es tut mir so leid, Liebling«, sagte sie.
»Warum?«
»Am ersten Weihnachtsfeiertag sollte man nicht weinen.«
»Och, ich habe gedacht, es ist dir was kaputtgegangen. Oder hat der Onkel Doktor mit dir geschimpft?«
»Ja, so ähnlich!«
»Und jetzt ist alles wieder gut, nicht wahr?«
Sie zog das Kind in ihre Arme. »Richtig, Liebling. Woher weißt du das?«
»Wenn man erst tüchtig geweint hat, ist nachher immer alles gut, das weiß ich doch schon.«
»Mein kluger Schatz. Ich habe dich sehr, sehr lieb, weißt du das?«
»Lieber als Onkel Harald?«
»Viel, viel lieber.«
»Das ist gut«, sagte Eva unbekümmert. »Ich habe dich auch viel lieber... noch lieber als meine neue Puppe!«
»Das ist wunderbar von dir. Hör mal, Eva ... meinst du, daß du jetzt mal eine Zeitlang ganz still spielen kannst? Ich will nämlich versuchen, ein bißchen zu schlafen. Wenn die beiden Uhrzeiger dann auf zwölf stehen, dann weckst du mich, ja?«
»Ich weiß schon Bescheid, Mutti!«
Daniela drehte sich zur Wand hin. Sie versuchte an alles andere zu denken, nur nicht an Harald. Sie bemühte sich, ihre Gedanken auf Eva zu konzentrieren, auf den Augenblick, wo sie zum erstenmal in ihrem Arm gelegen hatte. Sie erinnerte sich, wie sie später, erst wenige Monate alt, ihren ersten Schnupfen gehabt hatte. Kindliche, spaßhafte Bemerkungen fielen ihr ein, alles, was mit Eva zusammenhing. Wie immer hatten diese Erinnerungen ihre tröstlichen Wirkungen. Sie schlief ein.
Schon bei ihrem Eintritt hatte Schwester Daniela einen scheuen Blick zum Krankenbett hingeworfen. Die Schwerverletzte lag, wie sie sie heute morgen verlassen hatte, mit geschlossenen Augen und offenem Mund.
»Schläft sie?« fragte sie wider ihr besseres Wissen.
»Nein. Sie ist noch immer ohne Bewußtsein. Wir haben ihr vor zwei Stunden eine Infusion gegeben. Doktor Wörgel hat übrigens versprochen, einmal hereinzuschauen. Stellen Sie sich vor, er hat sich den Dienst für die ganzen Feiertage andrehen lassen! Manchmal ist es doch ein Glück, daß es Junggesellen gibt.«
Daniela mußte fast lächeln. Jeder im Krankenhaus wußte, wie gern Schwester Lucie die Schwesterntracht mit dem Ehering vertauscht hätte. Sie pflegte jedem Junggesellen, der ihr über den Weg lief, schöne Augen zu machen und begriff nicht, warum man sie nicht ernst nahm.
Der Zustand der Patientin besserte sich nicht. Stunde um Stunde verging. Selbst wenn Daniela die Augen schloß, sah sie das blasse, zerquälte Gesicht der Kranken vor sich. Der geöffnete Mund schien eine Anklage auszustoßen, die doch nur in Danielas Herzen hörbar wurde.
Kurz vor Mitternacht kam Dr. Wörgel, besuchte die Patientin, gab ihr eine Spritze mit einem herzstärkenden Mittel.
»Bitte, Herr Doktor«, sagte Daniela, als er aufstand, »sagen Sie mir ganz ehrlich ... was denken Sie?«
»Ist schwer zu sagen!«
»War die Hirnhaut verletzt?«





























