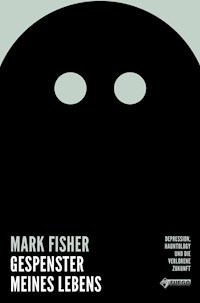21,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Brumaire Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In »Sehnsucht nach dem Kapitalismus« geht der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher unseren Wünschen und Begierden im und nach dem Kapitalismus auf den Grund.
Das Buch ist Mark Fishers letztes Werk: Seine Vorlesungen am Goldsmiths College vom November 2016 bis zu seinem tragischen Tod im Januar 2017. Es erschien anschließend auf Englisch bei Repeater Books unter dem Buchtitel »Postcapitalist Desire: The Final Lectures« – und liegt nun erstmalig ins Deutsche übersetzt bei Brumaire vor.
Inhaltsverzeichnis
Nie wieder triste Montagmorgen
Vorwort von Matt Colquhoun
Was ist Postkapitalismus?
Die Bohème der Gegenkultur als Präfiguration
Vom Klassenbewusstsein zum Gruppenbewusstsein
Union Power und Soul Power
Libidinöser Marxismus
Anhang I: Seminarplan
Anhang II: Songliste »No More Miserable Monday Mornings«
Meinungen zu Buch und Autor
»Kaum jemand hat den Verlust der Zukunft so brillant beschrieben wie der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher.«
— Harald Staun (FAZ)
»Mark Fisher was a brilliant public speaker. He found new connections between music, psychoanalysis, and politics. His lectures opened the world, making it available not just for critique but for comradeship.«
— Jodi Dean
»Der Neoliberalismus schlägt sich symbolisch auf die Seite der Gegenkultur, der Kapitalismus verleibt sich die Kritik von 1968 ein (…) All das und mehr präsentiert der Text im Duktus des freien Vortrags, der ungeschliffen und provisorisch wirkt, aber gerade darin seinen Sog entwickelt.«
— Pablo Dominguez Andersen (taz)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Ähnliche
»Kaum jemand hat den Verlust der Zukunft so brillant beschrieben wie der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher.«
— Harald Staun (FAZ)
»Mark Fisher war ein brillanter öffentlicher Redner. Er fand neue Verbindungen zwischen Musik, Psychoanalyse und Politik. Seine Vorträge eröffneten eine Welt – nicht nur der Kritik, sondern auch der Genossenschaft.«
— Jodi Dean
ÜBER DEN AUTOR
Mark Fisher
Nur wenige Autoren haben die ›Millenial‹-Linke so nachhaltig inspiriert wie Mark Fisher selbst. In den 2000er Jahren war der Blog »K-PUNK« ein Hort des kritischen Denkens in einem Miasma aus neoliberalem und akademischem Gruppendenken, ein Vorposten einer reifen, digitalen Gegenkultur.
Sein Buch Kapitalistischer Realismus ohne Alternative? (2013) bot eine Momentaufnahme der politischen und sozialen Landschaft, die die Weltwirtschaftskrise hinterlassen hatte, kurz nachdem die konservative Regierung Cameron ihren jahrzehntelangen Sparkurs eingeleitet hatte. Spätere Bücher – Gespenster meines Lebens (2015), Das Seltsame und Gespenstische (2017) – erwiesen sich als verspätete Klassiker. Seine Schriften inspirierten die britische Studentenbewegung in den Jahren 2010 und 2011, die daraufhin die Tory-Zentrale im Zentrum Londons stürmte.
Fishers Einfluss war jedoch nie ausschließlich britisch, sondern speiste sich stetig aus der tieferen Dynamik des Protests, der sich in den langen 2010er Jahren weltweit ausbreitete. Mark Fisher beging am 13.01.2017 tragischerweise Suizid: »Sein Werk erreicht uns wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit, die doch auch die unsere ist« (Anton Jäger in JACOBIN #7).
SEHNSUCHT NACH DEM KAPITALISMUS
MARK FISHER
Erste Auflage 2023
Copyright © Brumaire Verlag GmbH
Brumaire Verlag, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin
www.brumaireverlag.de
Eine Übersetzung aus dem englischen Original:
Postcapitalist Desire: The Final Lectures
Edited and with an introduction by Matt Colquhoun
Published by Repeater Books An Imprint of Watkins Media Ltd
Unit 11 Shepperton House 89-93 Shepperton Road London N1 3DF UK
www.repeaterbooks.com
A Repeater Books paperback original 2021
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Herausgeber: Matt Colquhoun
Übersetzung: Alexander Brentler
Lektorat: Marlen van den Ecker
Coverillustration: Andy King
Gestaltung und Satz: Andy King, Andreas Faust, Laura Stoppkotte
Schriftarten: Lyon von Kai Bernau, Wand von Andreas Faust und Stefan Endress
Printed in Germany
Erstellt mit Vellum
INHALT
Einführung
Atrocity Exhibition – Jahrmarkt der Scheußlichkeiten
Die abstrakte Ekstase der psychedelischen Vernunft
New Year, New You
Bewusstseinsbildung
Hang on Tight and Spit on Me
Den Prozess beschleunigen
Wiedereinstieg in die Geschichte
Was würde Mark Fisher tun?
Anmerkung zum Text
Erster Vortrag
Was ist Postkapitalismus?
7. November 2016
Zweiter Vortrag
»Eine gesellschaftliche und psychische Revolution schier unfassbaren Ausmaßes«: Die Bohème der Gegenkultur als Präfiguration
14. November 2016
Dritter Vortrag
Vom Klassen-bewusstsein zum Gruppenbewusstsein
21. November 2016
Vierter Vortrag
»Union Power und Soul Power«
28. November 2016
Fünfter Vortrag
Libidinaler Marxismus
5. Dezember 2016
Anhang I
Seminarplan
Erster Vortrag: Was ist Postkapitalismus?
Vortrag Zwei: »Eine gesellschaftliche und psychische Revolution schier unfassbaren Ausmaßes«: Die Bohème der Gegenkultur als Präfiguration
Vortrag drei: Vom Klassenbewusstsein zum Gruppenbewusstsein
Vierte Sitzung. »Union Power und Soul Power«
Fünfter Vortrag Libidinöser Marxismus
Sechster Vortrag: Autonomia und Arbeitsverweigerung
Siebter Vortrag: Die Zerstörung des demokratischen Sozialismus und die Ursprünge des Neoliberalismus: Der Fall Chile
Achter Vortrag: Die Erfindung der Mitte
Neunter Vortrag: Postfordismus und New Times
Zehnter Vortrag: Technofeminismus / Cyber-Feminismus
Elfter Vortrag: Akzelerationismus
Zwölfter Vortrag: Das Unbehagen am Netzwerk
Dreizehnter Vortrag: Das Unbehagen am Netzwerk (2): Peer-to-Peer
Vierzehnter Vortrag: Die Gefangenschaft des Touchscreens
Fünfzehnter Vortrag: Die Wiederentdeckung des Prometheus
Anhang II
Songliste »No More Miserable Monday Mornings«
Anmerkungen
EINFÜHRUNG
Nie wieder triste Montagmorgen
von Matt Colquhoun
* * *
Atrocity Exhibition – Jahrmarkt der Scheußlichkeiten
In der Einführung zu seinem unvollendeten Buch Acid Communism überraschte Mark Fisher – bekannt für seinen Hang zu Post-Punk, Jungle und einer Reihe an gegenwärtigen Pop-Experimentalisten – seine Freunde und Anhängerinnen, indem er sich positiv über die Gegenkultur der 1960er und 1970er äußerte.
Fisher hatte, was ihr Erbe anbelangt, zuvor ganz andere Töne angeschlagen. So schrieb er etwa in seinem Blog, k-punk, »der Hippie [sei] durch und durch eine männliche Mittelschichtsfigur«, definiert durch seine »hedonische Kindlichkeit« gewesen.1 Für ihn war die charakteristische Ungepflegtheit, die »schlecht sitzende Kleidung, zerzaustes Erscheinungsbild und wirrköpfig-psychedelisches faschistisches Gelaber unter Drogeneinfluss Ausdruck eines Ekels vor Sinnlichkeit«.2 Für Mark Fisher gab es kein größeres Verbrechen. Die Hippies, als wären sie dem Film Die Dämonischen entsprungen, folgten passiv und willenlos dem Lustprinzip, und der »Preis dieses ›Glücks‹ – ein Zustand der entkernten Affektlosigkeit der ›Pods‹ – [war die] Aufgabe jeglicher Autonomie«.3
Fischer war der Ansicht, dass, wer sich in einen Rauschzustand versetzt, sei es durch chemische oder andere Mittel, das Werk des Kapitalismus selbst verrichte, ganz als stünde man unter dem Einfluss eines freudschen »Wiederholungszwangs«, die kognitive Gefangenschaft im Kapitalismus selbst künstlich von innen zu replizieren, worin sich für ihn die menschliche »Tendenz, Parasiten zu finden, die uns schwächen, aber niemals ganz zerstören, und sich mit ihnen zu identifizieren«4 zeigte.
Stattdessen, und dies trifft insbesondere auf sein Blog k-punk zu, wollte Fisher einen anderen Weg beschreiten. Dieser setzte nicht voraus, sich einen oberflächlichen Primitivismus anzueignen, der darin bestand, weniger zu duschen und mehr zu rauchen, noch sich den positiven, aber entleerten Affirmationen der New-Age-Spiritualität hinzugeben. Wenn wir unseren psychedelischen Traum der Befreiung ernst nehmen, und er seine Relevanz für die Gegenwart behalten soll, müssen wir einsehen, dass wir nichts erreichen, indem wir uns chemisch den Kopf vernebeln. Für ihn war dies keine Frage der Moral, sondern eine ausgesprochen politische Einsicht. Das Ziel bestand darin, »durch seinen Kopf auszubrechen«, durch die Anwendung einer »psychedelischen Vernunft«, durch welche sich »das Gehirn selbst in einen Zustand der Ekstase versetzt.«5
Fisher entlehnte seine Alternative der Philosophie Baruch Spinozas aus dem siebzehnten Jahrhundert, wo diese »psychedelische Vernunft« bereits angelegt war und nur darauf wartete, entdeckt zu werden: »Spinoza ist der Prinz der Philosophen; der einzige, den man wirklich braucht«, so Fisher.6
Lange vor Deleuze und Guattari, Freud und Lacan war es Spinoza, der uns zeigte, wie man sich selbst den parasitären Dämonen der Moderne, das kapitalistische Ego, austreiben kann. Fisher schreibt, dass Spinoza »als selbstverständlich erachtete, was später Marx’ wichtigstes Prinzip werden sollte – dass es wichtiger war, die Welt zu verändern als zu interpretieren.« Spinoza versuchte dies durch die Konstruktion eines reflexiven ethischen Projekts, das »effektiv die Psychoanalyse um dreihundert Jahre vorweg nahm.«7
Fisher schreibt weiter:
Die Pop-Psychologie will uns weismachen, dass Emotionen mysteriös und unergründlich seien, zu verschwommen und vage, um sie ab einer bestimmten Tiefe zu analysieren. Spinoza hingegen vertritt, dass Glück eine Frage der emotionalen Optimierung ist: Eine präzise Wissenschaft, welche erlernt und praktiziert werden kann … Übereinstimmend mit allgemeinen Weisheiten macht uns Spinoza klar, dass was einem Wesen Glück bringt, für ein anderes Gift sein kann. Der erste und wichtigste Trieb jedes Wesens, so Spinoza, sei die Selbsterhaltung. Wenn ein Wesen gegen seine eigenen Interessen handelt und sich selbst zerstört – wozu, wie Spinoza feststellt, Menschen leider neigen – bedeutet dies, dass es von externen Kräften gesteuert wird. Frei und glücklich zu sein bedeutet, diese externen Eindringlinge zu vertreiben und in Übereinkunft mit der Vernunft zu handeln.8
In diesem Sinn können wir Fishers Aufruf aus der Blogosphäre also als Argument verstehen, dass wir bereits alles haben, was wir brauchen, um den Fesseln des kapitalistischen Realismus zu entkommen – der ideologischen Zwangsjacke, welche uns gefügig hält und unsere Vorstellungskraft lähmt; dem externen Eindringling, der unseren Geist und unseren Körper eingrenzt und uns heute davon abhält, wir selbst zu sein. Drogen wie LSD oder Ecstasy können unseren Geist zwar etwas lockerer machen, aber sie vernachlässigen die anderen, klarer existentiellen Teile der menschlichen Subjektivität (unsere Begabung zur Vernunft, unser politisches Handlungsvermögen) und lassen sie verkümmern und verrotten. So gesehen ist das Problem an Drogen, laut Fisher, dass sie »wie ein Bündel an Fluchtwerkzeugen ohne Bedienungsanleitung« seien.9
»MDMA zu nehmen, ist wie [Microsoft] Windows zu verbessern: Es ist ganz gleich, wie viel $ Bill [Gates] daran herumschrauben lässt, es wird immer Mist sein, weil es auf der wackeligen Grundlage von DOS aufbaut.«10 Alle Drogen sind letztlich zu flüchtig – »Ecstasy wird immer schief laufen, weil [das] menschliche Betriebssystem nicht ausgebaut und auseinandergenommen wurde.«11
So viel Spaß wir auch an ihnen haben mögen, so gilt doch im Großen und Ganzen, was The Verve schon in ihrem Song meinten: »The drugs don’t work, they just make things worse.« [Die Drogen bringen nichts, sie machen alles nur noch schlimmer.]
Doch als »die Hippies aus ihrem trägen hedonistischen Halbschlaf erwachten, um die Macht zu übernehmen« – so bemerkt Fisher zu Allgegenwärtigkeit und kulturellen Macht der Counterculture, welche den politischen Nutzen der Bewegung lang überdauert hat – »so brachten sie ihre Verachtung der Sinnlichkeit mit sich.«12 Im kulturellen Sinn warf die Bewegung einen langen Schatten. Die neue Sinnlichkeit des Post-Punk sollte schließlich unterliegen, und Fisher stellt eine Verbindung zwischen dieser »anti-sinnlichen Einstellung« zu den kulturellen Yuppies der 1990er her, für die niemand so sehr stand wie die Young British Artists, aber auch zum gleichzeitigen Aufstieg der flegelhaften laddishness des Britpop.
So betrachtet lässt sich der Einfluss der überwiegend negativen Entwicklung der Counterculture schwer verneinen. Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht so, als hätten John Lennon und Liam Gallagher von Oasis nicht viel mehr gemeinsam als eine Vorliebe für runde Teashade-Sonnenbrillen, doch die Sackgasse der Passivität, in welche die Counterculture mündete – oder in den Worten von Fisher, ihre Attitüde des »Hey man, es kommt alles auf den Gehirnzustand an« – war eine Triebfeder hinter der »bräsigen, verwaschenen, bierseeligen, argwöhnischen und verschlagenen« Ausstrahlung des Britpop-Hedonismus wie hinter den LSD-Experimenten der ungewaschenen Bohème.13
Dies wird klar, sobald wir den Blick auf die ganze Stumpfsinnigkeit des Acid-Trips richten, die sich in zwei Songs niederschlägt – »Lucy in the Sky with Diamonds« (1967) von den Beatles und »Champagne Supernova« (1995) von Oasis. Zwischen beiden Titeln liegen dreißig Jahre, und sie stammen aus zwei (politisch) grundverschiedenen Welten, doch sie verbindet die gleiche psychedelische Melancholie. Dieselbe Logik der »Hauntology« und melancholischen Übertragung ist erkennbar, wenn man John Lennons und Yoko Onos performatives Sit-In »Bed-Ins for Peace« betrachtet, dessen verrotteter Kadaver 1998 aus dem weißen Sarg der Tate Gallery in Form von Tracey Emins Installation »My Bed« wieder auftauchte.
Das oberflächliche Wiederkäuen der Themen der 1960er unter der Melancholie des Kapitalismus der 1990er ähnelt der Dekadenz des fin de siècle des vorangegangen Jahrhunderts – eine alptraumhafte und ungeschickte Autopsie eines schon längst gestorbenen Traums, bar jedes proto-modernistischen Bewusstseins der eigenen Position. Britpop war also eine wahrhaftige atrocity exhibition, ein Jahrmarkt der Scheußlichkeiten, ein Laufsteg neoliberaler Gespenster und Zombies, welche die Psyche heimsuchten und verfolgten.
Die abstrakte Ekstase der psychedelischen Vernunft
Man kann durchaus sagen, dass Fisher in dieser Zeit – dem besonders produktiven August 2004 – in seinem Blog kein Blatt vor den Mund nahm. Seine Kritik ist scharf und oft ganz und gar negativ. Wie wurde also aus diesem Mark Fisher der Mark Fisher von Acid Communism? Entgegen seinem harten Urteil aus der Mitte der Nullerjahre scheint es, dass Fisher später begann, die Counterculture etwas ambivalenter zu betrachten. Doch der Schein sollte uns nicht trügen: Sein Sinneswandel war keinesfalls extrem. Fisher setzte sich schlicht die Aufgabe, über seine scharfen Polemiken hinaus am Aufbau eines positiven politischen Projekts zu arbeiten – ein Projekt, in dessen Zentrum immer noch die von Spinoza inspirierte »psychedelische Vernunft« stand.
Es scheint, als habe Fisher durch dieses Projekt eine neue Wertschätzung für das politische Potential der besten kulturellen und ästhetischen Errungenschaften der Counterculture entdeckt – zumindest in ihrem ursprünglichen soziopolitischen Kontext. Dieses Potential findet man nicht in den surrealen Abstraktionen eines gutbürgerlichen Konzerts von Pink Floyd, einer nostalgischen und apolitischen Wiederaneignung der Vergangenheit für die Gegenwart. Stattdessen sei es explizit in jenen kulturellen Artefakten zu finden, welche Brücken zwischen Klassenbewusstsein und psychedelischem Bewusstsein, zwischen Klassenbewusstsein und Gruppenbewusstsein schlagen, doch welche vor ihrer Zeit erstickt oder aufgegeben wurden.14
In der Einleitung zu Acid Communism nennt Fisher zum Beispiel »Sunny Afternoon« von den Kinks und »I’m Only Sleeping« von den Beatles als zwei Songs aus dem Jahr 1966, welche den Angsttraum des Schuftens, aus dem das Alltagsleben besteht, aus einer Perspektive betrachten konnten, die gewissermaßen daneben, darüber oder darunter schwebt: Ob es die geschäftige Straße ist, die vom hoch gelegenen Fenster eines späten Schläfers betrachtet wird, dessen Bett ein sanft vor sich her dümpelndes Ruderboot wird oder der Nebel und Frost eines Montagmorgens, von dem man sich an einem sonnigen Sonntagnachmittag, der nicht enden muss, lossagt; oder die Dringlichkeiten des kommerziellen Alltags, betrachtet vom Adlerhorst eines aristokratischen Hochsitzes, welcher von Träumern aus der Arbeiterklasse besetzt ist, die niemals wieder die Stechuhr bedienen werden.15
An dieser politischen Provokation hängt mehr als der Traum einer typischen Hörerin des [Kultursenders] BBC Radio 4 von einem stillen Sonntagnachmittag, der niemals endet. Generell interessiert sich Fisher – und hatte sich immer dafür interessiert – für die Möglichkeiten, eine radikale politische Botschaft durch die Popkultur ins öffentliche Bewusstsein zu schmuggeln. Auch für das Potential der Popkultur, uns nicht nur durch ihre ansteckende Euphorie zu umgarnen, sondern auch die kapitalistische Vereinnahmung des Lustprinzips in etwas Tieferes, etwas ganz und gar Unbewusstes, zu verwandeln und es mit aller Kraft wieder ans Licht zu ziehen.
Und doch bleiben eine ganze Reihe Fragen offen. Am wichtigsten war es Mark, herauszufinden, wohin dieses Potential verschwunden ist und warum. Es ist offensichtlich, dass sich das Establishment vor nichts mehr fürchtete als davor, dass die Arbeiterklasse Hippies werden könnten, wie er es formulierte – aber warum war das der Fall? Was an der Counterculture bedrohte die Herrschenden so sehr, dass eine aufkeimende neoliberale Ordnung es als notwendig empfand, eine feindliche Übernahme des neuen kollektiven Bewusstseins zu organisieren? Und könnte durch eine erneute Manifestation dieser verhinderten Potentiale das Establishment und der kapitalistische Realismus erneut herausgefordert werden? Diese Fragestellungen eröffnen eine neue Sichtweise auf die psychedelische Subkultur, die immer noch betont werden muss. Das ist der verborgene Zweck der psychedelischen Bewegung, nicht ihre wohl bekannte ästhetische Form, die für den gegenwärtigen Moment relevant bleibt: Die Art und Weise, in welcher die Welt selbst, neben allen ästhetischen Assoziationen, die Manifestation dessen konnotiert, was tief im menschlichen Denken verdeckt liegt und von der Oberfläche aus nicht zu erkennen ist.
Eine irreguläre Verbindung aus dem ins moderne Englische übernommenen Präfix »psyche« und dem griechisch verbliebenen Stamm »dēlos« – welcher »offenbaren« oder »manifestieren« bedeutet – ist das Psychedelische also das, was den Geist manifestiert. Hier klingt wieder Marx’ an Spinoza angelehntes Motto an, dass es nicht ausreicht, die Welt zu interpretieren, sondern dass wir sie verändern müssen. Es wird hier jedoch kein Widerspruch zwischen Interpretation und Manifestation eröffnet – stattdessen muss erstere stets bestrebt sein, zu letzterer zu werden.
Benötigt wird also eine psychedelische Kultur, welche auf neue Art in die Politik einfließt, aber ganz anders aussieht, als wir es vielleicht erwarten. Tatsächlich sollten wir uns vor allem hüten, was sich zu vertraut anfühlt. Wir könnten gar argumentieren, dass die ästhetischen Konnotationen der psychedelischen Subkultur ganz und gar abgelehnt werden sollten. Wie Fisher einmal über den Surrealismus, einer der eindeutigsten Vorgänger der psychedelischen Counterculture, schrieb: »Wie Punk stirbt Surrealismus in dem Moment, in dem er auf einen ästhetischen Stil reduziert wird. Er kehrt als Untoter wieder, wenn er als ein delirisches Programm wiederbelebt wird (ähnlich wie Punk, wenn er zum antiautoritären, kopflosen Netzwerk der Ansteckung wird)«.16
Deswegen sollten wir die Counterculture mit Umsicht behandeln. Trotz oder vielleicht sogar gerade wegen ihrer zeitgenössischen Romantisierung scheint sie doch das letzte Beispiel dafür zu sein, dass eine kulturelle Revolution den Punkt erreicht hat, an dem sie fast eine politische ausgelöst hätte. Die Kultur hat sich dennoch weiterentwickelt, aber die Politik scheint Schwierigkeiten zu haben, nachzuziehen. Dennoch gibt es, trotz des gegenwärtigen Zustands des politischen Establishments, immer noch viel, über das man sich freuen kann. Fisher schreibt am Ende seiner Einführung zu Acid Communism: »Natürlich wissen wir alle, dass die Revolution ausgeblieben ist. Aber die materiellen Bedingungen für diese Revolution liegen heute eher vor als im Jahr 1977.«17 Statt das Potential der Counterculture einfach zu feiern, stellt Fisher ernsthafte Fragen darüber, warum die Bewegung gescheitert ist, und was wir heute daraus lernen können. Er fährt fort:
»Was sich seitdem bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, ist die existentielle und emotionale Atmosphäre. Die Bevölkerung ist heute resigniert, was die Trübsal der Arbeit anbelangt, während ihr gleichzeitig erzählt wird, dass Maschinen sie bald überflüssig machen werden. Wir müssen den Optimismus der Siebziger wiederentdecken und die Maschinerie, die das Kapital eingesetzt hat, um Zuversicht in Verzweiflung zu verwandeln, genau untersuchen. Zu verstehen, wie dieser Prozess der Bewusstseinsentschärfung funktionierte, ist der erste Schritt auf dem Weg dahin, ihn umzukehren.«18
Das Essay endet auf dieser unbeantworteten Frage, und die Aufforderung, diesen Prozess zu verstehen, verhallt, scheinbar ohne einen Hinweis, wie ein weiteres Vorgehen aussehen könnte. Mit dem Tod von Fisher im Januar 2017 schien es, als ob der besondere Ansatz des Acid Communism mit dem Autor verschieden sei. Und trotzdem verbleiben zahlreiche Brotkrumen, denen eine interessierte Leserin folgen könnte. Vielleicht ist die beste Vorgehensweise, die wir verfolgen können, die von Fisher propagierte Strategie auf sein eigenes Werk anzuwenden: Zu verstehen, wie das Projekt des Acid Communism überhaupt erst entstanden ist als ersten Schritt auf dem Weg dahin, es zu rekonstituieren.
Eine solche Strategie erfordert weniger Spekulation, als man zunächst annehmen könnte. Neben einer abwechslungsreichen Sammlung von Essays, die während seiner gesamten Laufbahn als Schriftsteller und Kritiker entstanden sind, und die sich mit vielen der Fragen befassen, mit denen er sich immer wieder auseinandergesetzt hatte, bleibt auch die Struktur von Fishers letztem Graduiertenseminar, »Postkapitalist Desire«, welches er für das Lehrjahr 2016/17 am Goldsmiths College der University of London konzipierte.
New Year, New You
Mit dem Beginn des akademischen Jahrs 2016/17 ergaben sich am Fachbereich Visual Cultures am Goldsmiths College verschiedene Änderungen. Dies traf auf die gesamte Abteilung zu, aber vor allem auf Mark Fisher und Kodwo Eshun. In vorherigen Lehrjahren hatten die beiden zusammen einen Masterstudiengang in Aural & Visual Cultures [Akustische und Visuelle Kulturen] konzipiert und angeboten – der, kurz gesagt, die Frage stellte: »Wie denken wir über die Relation von Ton und Bild in einer Ära der Allgegenwart von Medien nach?« Doch eine Reihe von administrativen Umstrukturierungen innerhalb der Universität hatte zur Folge, dass dieser Abschluss – zusammen mit einigen anderen, relativ kleinen Master-Programmen – mit einem bereits existierenden und nun allgemeineren Studiengang namens Contemporary Art Theory [Zeitgenössische Kunsttheorie] zusammengefasst wurde.
Diese Veränderungen hätten für Fisher und Eshun einen Verlust bedeuten können, doch sie nahmen dies zur Gelegenheit, um etwas Neues auszuprobieren. Sie ließen den Fokus des Programms Aural & Visual Cultures hinter sich und entwickelten zwei separate Module, die ihren damaligen Interessengebieten entsprachen. Während Eshun ein Seminar für »Geopoetik« entwickelte – ein fünfzehnwöchiges sehr intensives close reading von Reza Negarestanis sehr schwer zugänglichem Werk der Theoriefiktion, Cyclonopedia,19aus dem Jahr 2008 –, begann Fisher mit seiner Veranstaltung »Postcapitalist Desire« ein Seminar, in dem er die verhängnisvolle Verquickung zwischen Begehren und Kapitalismus untersuchte. Fishers Aufmerksamkeit galt dem Umfang, in welchem uns das Begehren bei unseren Versuchen hilft, dem Kapitalismus zu entfliehen, uns aber gleichzeitig zurückhält. Auch könnte man die Veranstaltung als Workshop zu seinem nächsten Buch verstehen: das inzwischen veröffentlichte, unvollendete Werk, das nun den Titel Acid Communism trägt.
Der Titel des Seminars ist gleichlautend mit dem eines Essays, das Fisher 2020 veröffentlicht hat und welches sich mit »dem Verhältnis von Begehren und Politik im postfordistischen Kontext«20 beschäftigt. Fisher nimmt hierbei eine Bemerkung der konservativen Politikerin Louise Mensch aus dem britischen Fernsehen ernst, über die sich viele andere lustig gemacht hatten. Während der Occupy-Proteste von 2010 – bei denen Menschen gegen den Kapitalismus agitierten, während sie bei Starbucks in der Schlange standen und von ihren iPhones über Politik tweeteten – hatte sich Mensch über die Heuchelei der Protestierenden echauffiert. Fisher vertrat die Meinung, dass Menschs Einwand durchaus eine Antwort verdient habe. Er wollte damit sagen, dass uns, abgesehen von ihrem oberflächlichen Zynismus, die Implikationen ihrer Kritik an den Protestierenden beschäftigen sollten. Zu welchem Grad ist unsere Sehnsucht nach dem Postkapitalismus immer bereits vom Kapitalismus vereinnahmt und neutralisiert? Wie kann es uns gelingen, die »Steigerung des Begehrens nach Konsumgütern, bezahlt auf Kredit«21 zu bekämpfen? Sollten wir überhaupt versuchen, dies zu tun? Für Fisher kann die Antwort auf dieses Problem nicht lauten, wie Mensch suggeriert, einem reaktionären Verlangen nach präkapitalistischem Primitivismus nachzugeben. »Der libidinösen Anziehungskraft des Konsumkapitalismus«, so Fisher, »muss eine Gegenlibido begegnen, nicht einfach eine antilibidinöse Abstumpfung.«22
Um aufzuzeigen, warum dies notwendig ist, setzt sich Fisher intensiv mit den »antimarxistischen« Schriften seines umstrittenen ehemaligen Dozenten Nick Land auseinander – insbesondere Lands Essay »Machinic Desire«. Land plädiert hier, ganz im Sinn der Cyberpunk-Bewegung der Neunziger, dafür, wir sollten gewissermaßen selbst zu Replikanten und dadurch den Kräften des Kapitalismus immanent werden. Für Land ist es nicht mehr »plausibel, dass das Verhältnis zwischen Kapital und Begehren entweder extern oder durch einen immanenten Widerspruch getragen ist, selbst wenn es noch einige schräge Ästheten gibt, die behaupten, dass ein libidinöses Verhältnis zur Ware durch kritische Vernunft überwunden werden kann.« Das Kapital ist hier »keine Essenz, sondern Tendenz.«23 Ähnlich der lacanschen Auffassung des Todestriebs, die den inhärenten Nihilismus der menschlichen Existenz für einen Drang nach der präödipalen Ruhe des Mutterleibs hält, glaubt Land, dass der Kapitalismus heute nur überlebt, weil der Cyberspace bereits »unter unsere Haut« gelangt ist, und dass ein Rückzug hiervon nur als Rückkehr zu einer nicht existenten, präkapitalistischen Vorstellungswelt möglich wäre.24 Die Chancen, dass wir dem Kapitalismus entfliehen können, stehen ungefähr so gut, wie in den Mutterleib zurückzukriechen. Deshalb ist der Versuch, unser Begehren vom Kapitalismus zu lösen, gleichbedeutend mit der Vivisektion des modernen Subjekts: Bei einem so gänzlich irrationalen Unterfangen das Mittel der Vernunft anzuwenden, muss scheitern.
Obwohl Land der Anwendung der Vernunft eine Absage erteilt, und sein Projekt so in scheinbarem Widerspruch zu Fishers steht, und so alptraumhaft uns Lands Einschätzung der gegenwärtigen Linken vorkommen mag, so wäre es für Fisher dennoch ein Fehler, sie zu ignorieren.
Fishers Hauptmotivation war die Frage, wie wir diese Kritik erwidern oder ethisch miteinbeziehen könnten, indem wir zum kapitalistischen Begehren eine Gegenlibido entwickeln – ein postkapitalistisches Begehren. In der ersten Sitzung zum Beispiel behandelt er diese Fragestellung, indem er die Provokation von Mensch aufgreift und gleichzeitig seine eigenen früheren Erwiderungen miteinbezieht – etwa aus Acid Communism – , die immer noch ungelöste Probleme aufweisen. Doch bevor er oder seine Studierenden in eine mögliche gegenlibidinale Zukunft blicken können, war es zunächst notwendig, zu untersuchen, warum jeder vorige Versuch einer Gegenlibido keinen echten gesellschaftlichen Wandel hervorrufen konnte.
Die ersten beiden Sitzungen versuchen, diese Fragen anhand einer Reihe von Texten zu beantworten, die von schwieriger Theorie bis zum Journalismus und der populärwissenschaftlichen Geschichtsschreibung reichen. In der zweiten Sitzung beschäftigt sich Fisher etwa mit dem vielleicht überraschenden Einfluss der freudschen Psychoanalyse auf die frühe, im entstehen befindliche Counterculture. Fisher präsentiert zwei verschiedene Ansichten auf diese Zeit: Zum einen die von Herbert Marcuse aus dem Jahr 1955, zum anderen die der feministischen Essayistin und Musikkritikerin Ellen Willis aus dem Jahr 1981. Zusammengenommmen gewähren sie Einblicke in die Zeit unmittelbar vor dem Aufflammen der Gegenkultur sowie eine vernichtende Kritik und Schilderung ihres letztendlichen Scheiterns.
Die Gegenüberstellung ist beunruhigend. Marcuses Text ist so erquicklich wie vor sechzig Jahren, doch auch Willis’ Kritik erscheint heute so zutreffend wie nie. Wie Fisher 2013 in einem Essay für e-flux schrieb:
Die Counterculture der Sechziger mag nun auf eine Reihe an »ikonischen« – übermäßig vertrauten, endlos zirkulierenden, geschichtslosen – ästhetischen Relikten reduziert worden sein, die jeglichen politischen Inhalts beraubt sind, doch Willis’ Werk steht daneben wie ein peinliches Mahnmal des linken Scheiterns. Wie Willis in der Einführung zu ihrem Buch Beginning to See the Light [von 1981] klarstellt, fand sie sich oft in Konflikt mit dem autoritären Staatsglauben des damaligen sozialistischen Mainstreams. Während in der Musik, die sie hörte, von Freiheit gesungen wurde, schien es beim Sozialismus um Zentralisierung und staatliche Kontrolle zu gehen. Die Geschichte der Aneignung der Counterculture durch die neoliberale Rechte ist uns nun wohl vertraut, doch die Unfähigkeit der Linken, sich angesichts der neuen Formen des Begehrens, die in ihr Ausdruck fanden, zu wandeln, ist die andere Seite der Geschichte.25
Diese Kritik findet man auch in anderen Werken von Fisher aus dieser Zeit: 2013 veröffentlichte er zum Beispiel auch sein nun berüchtigtes Essay »Exiting the Vampire Castle« [»Raus aus dem Vampirschloss«]. Was Willis als dunkle Seite der 1970er beschreibt, stellte für Fisher eine kontinuierliche Gefahr für die Hoffnungen und Träume der Linken im 21. Jahrhundert dar.
Vom Bruch zwischen den Gewerkschaften und der Counterculture Mitte der Siebziger in den USA bis zur Aussage des stellvertretenden britischen Premierministers John Prescott aus dem Jahr 1997, dass »wir nun alle zur Mittelklasse gehören«, lässt sich die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts für Fisher als Periode der fast vollständigen Entkopplung der Klasse vom kulturellen und politischen Diskurs definieren. Im 21. Jahrhundert kehrt die Klasse allerdings zurück. Der Aufstieg von Grime in den Mainstream in den frühen Nullerjahren und die Veröffentlichung von Owen Jones’ Buch Chavs [dt.: Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse.] im Jahr 2011 signalisierten, dass sich in Großbritannien ein neues Klassenbewusstsein herausbildete, das sich auf vielfältige Weise präsentierte. Leider hatte dieses Bewusstsein weiterhin Schwierigkeiten, die, so Fisher, »fieberhafte Atmosphäre auf der moralisierenden Linken, die sich wie McCarthy aufführte«26, zu durchbrechen.
Fisher schlägt in »Exiting the Vampire Castle« einen wütenden und ungeduldigen, enttäuschten und frustrierten Ton an. Schließlich war es die Ankündigung eines Ausstiegs – aber nur aus den sozialen Medien. Die Antwort auf das Essay, jedenfalls aus bestimmten Richtungen, hätte eine beiläufige Beobachterin glauben machen können, Fisher hätte sich von der Linken, die ihm so viel bedeutete, gänzlich verabschiedet. Man könnte auch anmerken, dass Fisher genau diesen Umstand von der Gegenseite aus kritisierte. Indem Klasse von den identitären Kämpfen der Zeit entkoppelt wurde, schien es, als sei der Kapitalismus nicht mehr der Feind. Stattdessen fallen wir in unserer Machtlosigkeit bereitwillig übereinander her.
Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens wirkte diese Kritik des politischen Terrains durch und durch negativ. Für Fisher war es von einer vampirhaften Ansammlung energiefressender Trolle bewohnt, die die sozialen Medien, und Twitter im Besonderen, dazu benutzten, um jegliches politisches Gruppenbewusstsein im Keim zu ersticken. Fisher ruft hier die verschiedenen Beschreibungen von Grey Vampires aus seinem Blog k-punk wach – Freibeuter der Kommentarspalte, die »nicht direkt Energie fressen, sondern davon zehren, Projekte zu verhindern.«27 –Fisher konnte das selbstgefällige identitäre Milieu der sozialen Medien, welches wild entschlossen schien, die aufregendste Verschiebung der Popkultur seit Jahrzehnten zu verhindern, nicht ausstehen. Obwohl viele Fishers Einschätzung von Anfang an für falsch hielten, so behielt er in den Jahren des Brexit-Referendums und Jeremy Corbyns Zeit als Vorsitzender der Labour Party doch recht – vor allem letztere stellte eine potentielle Transformation linker Politik in Großbritannien dar: ein Wandel, der konsequent von außen wie von innen torpediert wurde.
Der Schaden, den diese politische Autoimmunkrankheit angerichtet hat, ist immens – und das Klassenbewusstsein hat nicht zuletzt auch darunter gelitten. »Das Klassenbewusstsein ist fragil und flüchtig«, argumentierte Fisher, aber der beste Weg, es aufrechtzuerhalten, war für ihn, es als Thema im Gespräch zu halten. Er fährt fort: »Das Kleinbürgertum, welches den akademischen und den Kulturbetrieb dominiert, hat alle möglichen subtilen Ablenkungs- und Störungsmanöver parat, die verhindern sollen, dass man über dieses Thema überhaupt spricht, und wenn man es doch zur Sprache bringt, stellt es sicher, dass man sich fühlt, als hätte man eine unverfrorene Frechheit, einen eklatanten Verstoß gegen die Etikette begangen.«28
Diese Art der Empörung ist weiter verbreitet als jemals zuvor. Doch allein die Tatsache, dass es notwendig ist, das Klassenbewusstsein andauernd zu untergraben, zeigt, welch enormes politisches Potential in ihm steckt. Dass Fishers »Vampire Castle« in der englischsprachigen Welt in den sozialen Medien die Runde machte und zum viralen Massenphänomen wurde, führte dazu, dass die gleiche Empörungsmaschinerie, die er eigentlich kritisieren wollte, auf ihn selbst ansprang und dafür sorgte, dass ihm genau das unterstellt wurde, vor dem er ausdrücklich warnte: eine Trennung des Klassenbewusstsein vom Bewusstsein über Gender, race, und andere minoritäre Kategorien der Selbstidentifikation. In Wirklichkeit hielt er, wie er später immer wieder betonen würde, eine ganz andere Position inne.
Bewusstseinsbildung
Fisher schärfte seine Polemik aus »Exiting the Vampire Castle« später nach, indem er seine rein negative Kritik in ein positives Projekt der Bewusstseinsbildung verwandelte. Diesem Projekt wandte er sich in der dritten Sitzung von »Postkapitalist Desire« zu.
»Bewusstseinsbildung« erlangte durch den Feminismus der zweiten Welle in den 1960ern und 1970ern Popularität und bezeichnet die Praxis gemeinsamer Diskussionen über die verschiedenen Ausprägungen von Ungleichheit und ihrer kollektiven Erfahrung im Leben von Menschen. Dieser Prozess war notwendig, so Fisher in seiner Veranstaltung zu »Postcapitalist Desire«, denn das Bewusstsein der eigenen materiellen Existenz ist, trotz allem, nicht unmittelbar und selbstverständlich greifbar. Stattdessen muss das Bewusstsein für die eigene Position innerhalb einer Struktur der Ungleichheit – sei es Kapitalismus, Patriarchat oder weiße Vorherrschaft – konstruiert werden, es ist nie einfach so gegeben. Der beste Weg, ein solches Bewusstsein herauszubilden, ist unter Mitwirkung von anderen, die eine ähnliche materielle Existenz teilen.
Für die politische Organisation Plan C schrieb Fisher über das psychedelische Potential, das immer noch in der Praxis der Bewusstseinsbildung in Gruppen schlummerte:
Ein anderes Bewusstsein zu erlangen, bedeutet weit mehr, als sich bestimmte Fakten klarzumachen, von denen man vorher nichts wusste: Das ganze Verhältnis zur Welt verändert sich. Das Bewusstsein, von dem hier die Rede ist, ist kein Wissen über einen bereits anhaltenden Zustand. Stattdessen ist Bewusstseinsbildung ein produktiver Akt. Sie erzeugt ein neues Subjekt – ein Wir, das sowohl zum Akteur im Kampf wird, um das aber auch selbst gekämpft wird. Gleichzeitig interveniert Bewusstseinsbildung am »Objekt« selbst, der Welt, welche nun nicht mehr als statisch gesetzt, undurchsichtig und von einem unveränderlichen Wesenskern bestimmt, sondern als etwas Veränderliches wahrgenommen wird. Um in der Welt etwas zu verändern, ist Wissen notwendig; dieses wird jedoch nicht durch Spontaneität oder Voluntarismus, durch die Erfahrung von Momenten des Durchbruchs oder durch reine Marginalität entstehen.29
In der Gegenwart mangelt es zwar nicht an »Subjekten des Kampfs«, doch worum gekämpft wird, ist unklar oder schwer vereinbar. Es scheint sogar, als dienten bestimmte Formen des politischen Bewusstseins, die sich der Kapitalismus selbst angeeignet hat, inzwischen dazu, Solidarität zu fragmentieren, statt sie zu schaffen. Während sich Individuen auf Twitter darüber kabbeln, wer privilegierter ist, lacht sich der wahre Feind, der Kapitalismus, ins Fäustchen.
Fisher hatte die Hoffnung, dass diese neu gebildeten und doch fragmentierten Formen des Bewusstseins, die sich unter dem Banner der sogenannten »Identitätspolitik« tummelten, trotzdem Gemeinsamkeiten finden könnten, und dass darunter auch das zuvor von ihnen entkoppelte Klassenbewusstsein fallen könnte. Das Resultat könnte ein kollektives Bewusstsein sein, das ein Verständnis über die Verschränktheit von minoritären Kämpfen entwickelt, um das System als ganzes, den Kapitalismus, aufzufassen. Dies wäre die Voraussetzung dafür, dass die Linke das »notwendige Subjekt – ein kollektives Subjekt«30 herausbildet, wie es Fisher in seinem Buch Capitalist Realism [dt: kapitalistischer Realismus ohne Alternative? Eine Flugschrift.] formulierte. Im Laufe des knappen Jahrzehnts, das auf die Veröffentlichung seines überraschenden Bestsellers folgen sollte, entwickelte Fisher seine Idee einer kollektiven Subjektivität weiter, für die er mehr und mehr den Begriff des »Gruppenbewusstseins« bevorzugte.
In seinem Essay für Plan C führt Fisher seine Argumente für die Notwendigkeit eines Bewusstseins, das über das Individuum hinausgeht, am ausführlichsten aus. Er schreibt:
Da Bewusstseinsbildung von einer Vielzahl von unterdrückten Gruppen verwendet wurde, wäre es vielleicht besser, allgemein vom Bewusstsein unterdrückter Gruppen statt von Klassenbewusstsein zu sprechen. Das Bewusstsein dieser Gruppen ist zunächst einmal das Bewusstsein über die (kulturellen, politischen, existentiellen) Maschinerien, welche ihre Unterdrückung sicherstellen – die Mechanismen, die die dominante Gruppe normalisieren und in der unterjochten Gruppe ein Gefühl der Minderwertigkeit erzeugen. Doch zweitens ist es auch immer ein Bewusstsein der potentiellen Macht der unterdrückten Gruppe – einer Wirkmächtigkeit, deren Realisierung von genau dieser Bewusstseinsbildung abhängt.31
In den Jahren, die auf die vernichtende Rezeption von »Exiting the Vampire Castle« folgten, zerfiel dieses unterdrückte Gruppenbewusstsein leider weiter. Erst schien es, als verspräche die Ära Corbyn eine Wiederbelebung, doch das Brexit-Debakel zerbarst jegliche Hoffnung darauf, dass es sich wieder durchsetzen könnte. Fisher sollte die neuen Tiefen des kollektiven Bewusstseins, in welche das Land durch die Auseinandersetzung um den Brexit fallen sollte, nicht miterleben – so stellte er bis zuletzt die Fortschritte heraus, die auf diesem Feld vorher gelungen waren. Fisher hoffte, dass es ihm – ähnlich wie Owen Jones 2011 – gelingen könnte, ein Schlaglicht auf die richtigen Beispiele zur richtigen Zeit zu werfen und das Land dadurch aus seinem neoliberalen Rausch zu erwecken.
2014 wandte Fisher seine Aufmerksamkeit der kontroversen Dokuserie Benefits Street zu, welche das Leben der Einwohnerinnen und Einwohner der James Turner Street in Birmingham begleitete, wo angeblich mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen waren als irgendwo sonst in Großbritannien. Im New Humanist Magazine argumentierte Fisher, dass das Programm durch seine ganze Machart einen »bürgerlichen Blick, welcher Angehörige der Arbeiterklasse als defizitär im Vergleich zu Menschen aus der Mittelklasse betrachtet«, einnehme. »Außerdem«, wie Fisher schreibt, »wird dieses Defizit auf hoch moralisierte Weise aufgeladen, es lässt sich nicht durch den Mangel an Ressourcen oder Lebenschancen erklären, sondern durch einen Defekt der Willenskraft und ein Manko an Anstrengung.«32
In diesem Sinn war Benefits Street eine noch gefährlichere Mutation des sich stetig weiterentwickelnden kapitalistischen Realismus. Nicht nur wurde der Kapitalismus von den »Realisten« als alternativlos angesehen, der Blick des zentralen phantasmatischen Subjekts, der unerschütterlichen »Mittelklasse«, wurde nun als Default-Position angenommen. Fisher lehnte die in den Neunzigern geäußerte Behauptung, dass »wir nun alle zur Mittelklasse gehören«, zwar ab, doch unsere Fernseher verkünden dies weiterhin, ohne groß Aufhebens darum zu machen. Die Botschaft, obwohl implizit, ist uns dennoch vertraut: Es gibt keine Alternative.33
Hang on Tight and Spit on Me
In der letzten Sitzung von »Postcapitalist Desire« vor den Weihnachtsferien nahm sich Fisher das Phänomen der Mittelklasse als subjektiver Default-Position vor. Hierbei wird die Möglichkeit, dass die Arbeiterklasse ihre eigene Unterdrückung heimlich genießen könnte, zu einer Herausforderung, der mit schwarzem Humor und morbider Faszination begegnet wird (hierbei klingt das Echo von Nick Lands Fragestellungen nach).
Fisher liest aus dem äußerst schwierig zugänglichen, 1974 erschienenen Buch Ökonomie des Wunsches von Jean-François Lyotard vor und kostet hierbei dessen kontroverseste Passagen aus. In Lyotard findet Fisher eine Prophezeiung des herablassenden Blicks auf die James Turner Street und stellt die Macher der Serie bloß, die es nicht wagen, »das einzig Wichtige [...] zu sagen [...]: man kann auch Lust empfinden, wenn man das Sperma des Kapitals, die Materialien des Kapitals verschlingt, die Metallbarren, die Polystyrene, die Groschenhefte, die Hot Dogs, wenn man das Zeug tonnenweise bis zum Platzen verschlingt«.34
Wenn man Lyotard glaubt:
[sind] die arbeitslosen Engländer [...] nicht zu Arbeitern geworden, um zu überleben, sie haben – haltet euch gut fest und verachtet mich meinetwegen [hang on tight and spit on me] – diese hysterische, masochistische (und ich weiß nicht, was sonst noch) Erschöpfung genossen, sie haben es genossen, es in den Minen, den Gießereien, den Fabriksälen, in der Hölle auszuhalten, sie haben die verrückte Zerstörung ihrer organischen Körper genossen, die ihnen sicher aufgezwungen wurde, sie haben die Auflösung ihrer persönlichen Identität genossen, derjenigen, die die bäuerliche Tradition ihnen geschaffen hatte, sie haben die Auflösung der Familien und Dörfer genossen, sie haben die entsetzliche neue Anonymität der Vorstädte und der Pubs in den Morgen- und Abendstunden genossen.35
Fisher nimmt Lyotards Herausforderung und ihren schwarzen Humor sehr ernst. In seinem Essay »Terminator Versus Avatar« etwa passt er sie für das 21. Jahrhundert an:
Es melde sich, wer suburbane Anonymität und Bars gegen das organisch-schlammige Kleinbauernleben eintauschen möchte. Es melde sich also, wer wirklich zum präkapitalistischen Raum, zum Familien- und Dorfleben der Vergangenheit zurückkehren möchte. Und es melde sich auch, wer wirklich glaubt, dass die Sehnsucht nach der Wiederherstellung eines organischen Ganzen nichts mit der spätkapitalistischen Kultur zu tun hat, statt eine vollständig integrierte Komponente der libidinösen Infrastruktur des Kapitalismus zu sein.36
Die Arbeiterklasse des 21. Jahrhunderts ist in ihrem unterdrückten Begehren und Begehren nach Unterdrückung genauso verstrickt wie im zwanzigsten. Doch dieses scheinbare Paradox sadomasochistischer Wünsche hat seinen Nutzen. Wie Fisher weiter anmerkt: »Nicht weit unter Lyotards ›Ja der Trunkenheit des Begehrens‹ liegt das Nein des Hasses, der Wut und der Frustration: Keine Befriedigung, kein Spaß, keine Zukunft. Dies sind die Ressourcen der Negativität, mit denen, wie ich glaube, die Linke wieder in Kontakt kommen muss.«37
Es mag sein, dass die Linke insgesamt dafür noch nicht bereit ist – und Fisher mag sein Verlangen nach Negativität in späteren Jahren etwas gezügelt haben. Doch genau wie die im Entstehen befindliche Counterculture den kommenden politischen Wandel immer wieder ankündigte, so lassen sich Lyotards Provokationen in der Musik und Kultur der Gegenwart wiederfinden. Denn was ist eine Gegenkultur, wenn nicht eine kulturelle Hegemonie, negativ aufgefasst?
Während viele gegenwärtige Beispiele zur Auswahl stehen, so sind vielleicht die Sleaford Mods die offensichtlichsten spirituellen Nachfolger dieser Tradition. Ihre Musik trieft vor Wut, dem Zusammenfluss sexueller und ökonomischer Frustration, die Lyotard in seiner kontroversen, transgressiven Theorie der Ökonomie der Libido untersucht hatte. In ihrem Song »Jobseeker« hält uns der Sänger Jason Williamson fest und spuckt uns durch den Lautsprecher an, indem er sich in einem inneren Monolog den Frust von der Seele schreit und die Worte ausspricht, die er den oberflächlich freundlichen Bürokraten beim Jobcenter gerne an den Kopf werfen würde:
»Also, Mr. Williamson, was haben Sie denn seit unserem letzten Termin unternommen, um Arbeit zu finden?« Einen Scheiß! Ich habe zuhause rumgesessen und habe mir einen runtergeholt. Und ich wüsste gerne, warum es hier keinen Kaffee gibt. Und mein Termin war um zehn nach elf. Jetzt ist es zwölf. Und manche von euch stinkenden Schweine sollte man hinrichten. ... »Mr. Williamson, Ihr Lebenslauf sieht ziemlich imposant aus. Sie hatten schon drei leitende Positionen bei bekannten Unternehmen inne. Ist das nichts, was Sie gerne wieder machen würden?« Nee, würde nur damit enden, dass ich sie beklauen würde. Man sitzt den ganzen Tag vor einer Kasse voller Zwanziger. Auf mich ist da kein Verlass.38
Der Arbeitssuchende lehnt hier die ihm zugeschriebene moralisierte Rolle des glücklosen armen Schluckers ab. Es ist die Umkehr einer Figur wie etwa Daniel Blake aus Ken Loachs vielfach gelobten Film I, Daniel Blake von 2016. Bewusstseinsbildung findet hier nicht über den Weg des Mitgefühls statt, indem die brutale Realität des britischen Sozialstaats durch eine fiktionale Figur erzählt wird. Stattdessen erfolgt sie bei Williamson durch Aggression und Konfrontation, indem die Scham der Erniedrigung seiner Klasse in konzentrierter Form zur Waffe wird. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Sleaford Mods Ken Loachs Methode der Bewusstseinsbildung ablehnen würden; sie zeigen uns lediglich ein invertiertes Bild der proletarischen Subjektivität auf: ausgeschlossen aus dem System, und dadurch ganz und gar in ihrem Element. »Jobseeker« füllt Lyotards »Ja der Trunkenheit des Begehrens« mit neuem Leben und unterstreicht aufs Neue, dass es ihre spannungsgeladene Unterdrückung ist, welche die Arbeiterklasse zu einer Gefahr für das System macht. Fickt euren gutbürgerlichen Anstand! Ich habe Triebe, und ich werde ihnen folgen!
Fishers psychedelische Vernunft ist hier weiterhin relevant. Was hier unterstellt wird, ist, dass die Ablehnung der Arbeit, wie sie etwa bei den Beatles (»stay in bed, float upstream«) Ausdruck findet, für die Arbeiterklasse heute leichter zu erreichen ist als jemals zuvor. Was gut für John und Yoko war, ist allemal gut genug für den arbeitslosen »Jobseeker«. Und ist es nicht umso besser, in seiner Wohnung in Grantham im Bett liegen zu bleiben statt in einer Privatsuite im Hilton Hotel?
Fisher bemerkt 2014 über die Zugänglichkeit dieses potenten Affekts in einer Rezension von zwei Alben der Sleaford Mods für The Wire, dass die Form der Unzufriedenheit, welche Williamson ausdrückt, »heute überall in Großbritannien zu finden ist, aber meistens privat und verborgen bleibt: Abgestumpft durch Alkohol und Drogen, oder umgeleitet in die impotente Wut von Kommentarspalten und Empörung in den sozialen Medien.«39 Doch trotz allem ist sie »getragen von einem Klassenbewusstsein, das schmerzhaft realisiert hat, dass es nichts gibt, was diese Malaise in politische Handlungsfähigkeit verwandeln könnte.«40 Viele Fragen bleiben offen: »Wem wird es gelingen, den Frust, den sich Williamson von der Seele schreit, aufzufangen? Wer könnte diesen negativen Affekt in ein neues politisches Projekt ummünzen?«41 Wer könnte die chemisch abgestumpfte Unzufriedenheit bündeln und sie auf das Establishment richten?
Der hier beschriebene Frust ist jedoch nur der Zunder für eine größere Bewegung. Ist sie zur Machtlosigkeit verdammt, wenn das Feuer nicht die ganze gesellschaftliche Gruppe erfasst, für die sie spricht? Ende 2016, als Fisher mit seinen Studierenden über Lyotard spricht, über die »fabelhaft verklemmte Qualität« des Philosophen, fragt er sich jedoch, ob Lyotards wüstes Schimpfen der »fabelhaften Autonomie und Suffizienz des Textes, oder seiner Impotenz und Nutzlosigkeit« geschuldet ist. Diese Fragen suchen uns in kultureller Hinsicht heim – und dadurch unweigerlich auch in politischer. Politische Stärke muss aus kultureller Stärke erwachsen, oder wir riskieren, uns wieder in derselben negativen Rückkopplungsschleife zu finden.
Den Prozess beschleunigen
Fishers Seminar »Postcapitalist Desire«, ähnlich wie seine Einführung zu Acid Communism, sind vom Versuch geprägt, diese Vereinnahmung zu umgehen. Fisher stellt sich in beiden Fällen die Frage, was wirklich notwendig wäre, um endlich mit dem Kapitalismus zu brechen.
Die fünfte Sitzung legt folgende Antwort nahe: Es muss uns eine Beschleunigung jenseits des Lustprinzips gelingen, jenseits unserer Kultur der Retrospektive und Pastiche, jenseits der fortwährenden Entschärfung des Gruppenbewusstseins, jenseits des kapitalistischen Realismus. So verstanden versucht Fisher hier, seinen Studierenden eine von Grund auf neue Praxis des linken Akzelerationismus näherzubringen.
Überhaupt wird der Akzelerationismus im Seminar oft erwähnt – Fisher geht sogar so weit zu behaupten, dass der Diskurs hierzu »wahrscheinlich der größte Einfluss auf den Kurs« gewesen sei, doch aus der Perspektive von 2020 muss man anmerken, dass hier sein weiterer Kontext betrachtet werden sollte.
Der Akzelerationismus hat heute einen schlechten Ruf. Ihm haftet heute eine (vielleicht vernichtende) Assoziation mit der extremen Rechten an – am abstoßendsten ist seine Verwendung im 2019 verfassten Manifest des rassistischen Massenmörders Brenton Tarrant. Dem allgemeinen Verständnis nach besagt diese Ideologie, dass der Kapitalismus (oder der »Status quo« generell) zu einem kaum funktionalen, unhaltbaren Geflecht an Widersprüchen geworden sei. Deshalb sollten wir die Mechanismen des Kapitalismus (oder des »Status quo«) beschleunigen und sie damit ihrem unausweichlichen Zusammenbruch näherbringen. Oft wird diese Position noch vereinfachender als »es muss erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann« wiedergegeben. Wie der Philosoph Pete Wolfendale 2015 feststellte, ist dies aber »keine Position, die jemals irgendjemand vertreten hat.«42
In Wahrheit übte sich der Akzelerationismus in Kritik an dem Umstand, dass alles ständig nur noch schlimmer wurde. Krisen – seien sie nun solche des Kapitalismus (wie der Crash am Finanzmarkt von 2007/08) oder politische Massenproteste (wie die Occupy-Bewegung, die darauf folgte) – führen nicht mehr zum Wandel; Negativität zerstört das Alte, aber ist nicht mehr in der Lage, Neues hervorzubringen.