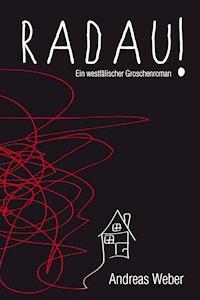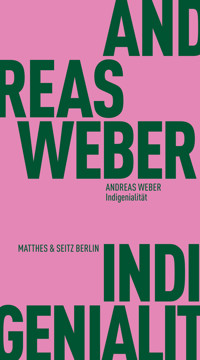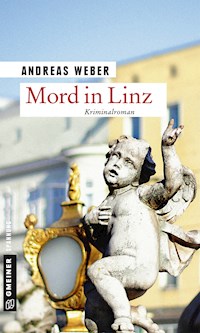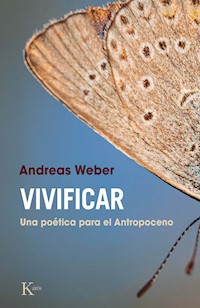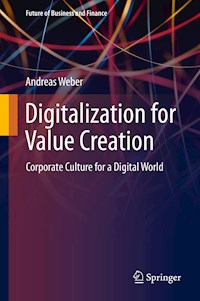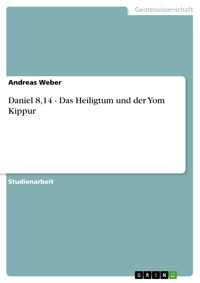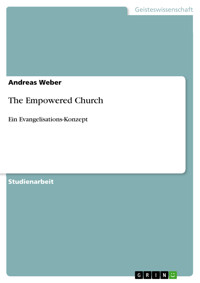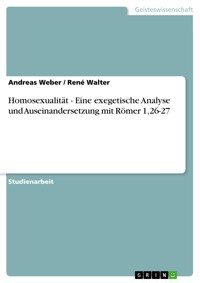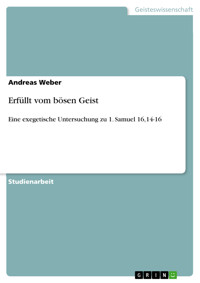12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Sein heißt Teilen. Teilen heißt Sein, auf allen Ebenen, vom Atom bis zu unserer Erfahrung von Glück. Lebendigsein folgt der Sehnsucht, ganz Individuum zu werden – und diese erfüllt sich nur in Austausch und Verwandlung. Erst aus Teilhabe entsteht Stimmigkeit, das Gefühl, ein eigenes Selbst, Zentrum der eigenen Erfahrung zu sein. Unser Stoffwechsel, gelingende Beziehungen, Sinnerfahrungen, aber auch der Austausch von Gütern und Leistungen können nur gedeihen, wenn wir sie als gemeinsame Teilhabe an einer schöpferischen Wirklichkeit erschaffen. Diese ist Stoff, und sie ist Fantasie. Atmen heißt Teilen, Körpersein ist Teilen und Lieben bedeutet Teilen. Sein durch Teilen ist die Seele der lebendigen Wirklichkeit. In dieser durchdringen sich Innen und Außen. Sie ist ein leidenschaftlicher Beziehungsprozess, in dem das Begehren nach Identität erst im Leuchten des Anderen eingelöst wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ANDREAS WEBER
Sein und Teilen
Eine Praxis schöpferischer Existenz
Diese Arbeit wurde durch die Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis gefördert.
The creation of this book has been made possible through a fellowship at the Bogliasco Foundation.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2017 transcript Verlag, Bielefeld
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Coverabbildung: mosaiko / Photocase.de Lektorat: Demian Niehaus, Nürnberg Print-ISBN 978-3-8376-3527-0 PDF-ISBN 978-3-8394-3527-4 EPUB-ISBN 978-3-7328-3527-0
Besuchen Sie uns im Internet: http://www.transcript-verlag.de
Inhalt
Vorwort – Verbinden
Kapitel 1 – Teilen
Kapitel 2 – Atmen
Kapitel 3 – Fühlen
Kapitel 4 – Lieben
Kapitel 5 – Tauschen
Kapitel 6 – Schöpfen
Kapitel 7 – Sein
Dank
Anmerkungen
»Die Frucht der Welt ist die Frucht meines Lebens. Die Frucht gehört mir in dem Maße, in dem sie meiner Pflege und Aufmerksamkeit anvertraut ist; mein Leben ist das der Welt in dem Maße, wie es aus mir herausgepresst wird, indem es in alles hinausfließt und einen Gleichklang mit Wesen bildet, die nicht Ich sind.«
MICHAEL MARDER1
»Die Hölle der Lebenden ist nicht etwas, das erst noch kommt. Wenn es sie gibt, dann ist sie bereits hier. Es ist die Hölle, die wir alle Tage bewohnen, die wir herstellen, indem wir zusammen sind. Es gibt zwei Arten, nicht unter ihr zu leiden. Die erste gelingt vielen leicht: die Hölle akzeptieren und so sehr Teil von ihr werden, dass sie nicht mehr zu sehen ist. Die zweite ist riskant und verlangt dauernde Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft: das, was mitten in der Hölle keine Hölle ist, suchen, es zu erkennen wissen und ihm Dauer verleihen und Platz einräumen.«
ITALO CALVINO2
Vorwort – Verbinden
»Wissenschaft beruht auf Wissen. Kunst beruht auf Wissen. Magie beruht auf Wissen und so weiter und so fort. Es gibt dagegen nur eine Form von Weisheit, und sie beruht auf Liebe.«
FRANCISCO VARELA3
Sein heißt Teilen. Teilen heißt Sein, auf allen Ebenen, vom Atom bis zu unserer Erfahrung von Glück. Das soll dieses Buch zeigen. Es soll dabei erklären, was wir fühlen, wenn wir uns glücklich und »richtig« fühlen – und es soll uns helfen, mehr davon zu haben, als Einzelner*, als Paar, als Gesellschaft, als Biosphäre, als Kultur. Das Buch plädiert dafür, dass Teilen nicht heißt, weniger zu sein, sondern mehr. Jeder Spielart des Glücks, jeder Erfahrung der Seele im Aufschwung liegt ein Moment des Geteiltseins, der Veräußerung und der damit einhergehenden neuen Verbindung zugrunde.
Nur aus Teilhabe entsteht das Gefühl der Stimmigkeit, das Gefühl, ein eigenes Selbst, Zentrum der eigenen Erfahrung zu sein. Das Buch soll zeigen, dass Atmen Teilen heißt, Körpersein Teilen ist und Lieben Teilen bedeutet. Es soll zeigen, dass ein Ökosystem Sein durch Teilen ist, ja geradezu dessenground zero. Lebendigsein kann immer nur durch Lebendigkeit erreicht werden, jene, die ich nicht besitze, sondern verschenke, und jene, die mir gespendet wird. Ich will in diesem Buch verstehen, warum bereits das Ich Teilen ist und warum jedes Subjekt in Wahrheit ein »Inter-Subjekt« darstellt, also gemeinschaftlich erzeugtes Sein. Das gesunde Selbst schließt den anderen ein. Erlebte Lebendigkeit ist expansiv. Sie will den Anderen lebendiger machen.
Das Buch ist damit so etwas wie eine erneuerte Gebrauchsanweisung für die Welt mit ihren Beziehungen, ihren Erfahrungen, ihren Schöpfungen, dem Wirtschaften in ihr und als sie, ihrer Kultur. Seine Botschaft lautet: Nicht das Individuum und sein Sieg im Wettstreit bewirkt, dass sich die Welt dreht. Umgekehrt stehen Individuen nicht allein im Dienst des großen Ganzen. Das Ganze kann vielmehr nur sein, wenn es sich selbst in einem Einzelnen erfährt.
Das Prinzip der Wirklichkeit besteht weder in universeller Konkurrenz noch in allgemeiner Symbiose. Es liegt vielmehr darin, dass sich das Ganze danach sehnt, in vollendeter Individualität zu erscheinen. Es ist ein Prinzip, das in anderen Kulturen immer schon galt und das Afrika südlich der Sahara als »Ubuntu« bekannt ist: Ich kann nur sein, weil du bist.4Hier möchte ich verfolgen, warum dieses Prinzip den Kern unserer Wirklichkeit bildet, und wie wir uns mit ihm in Verbindung setzen können.
Wirklichkeit ist nicht nur »das, was ist«, sondern immer auch schlummerndes Potential. Was wirklich ist, drängt danach, sich intensiver zu erfahren, dichtere Verbindungen einzugehen, inniger geteilt zu werden. Die Geschichte des Kosmos lässt sich als eine Geschichte der Differenzierung von einer Singularität zur Komplexität lesen, und schließlich – wie wir aus eigener Erfahrung wissen – als das Aufscheinen von Innerlichkeit. So kann die französische Sozialistin und Mystikerin Simone Weil sagen: »Gut ist, was wirklicher macht.«5
Dieses Buch ist somit der Versuch, etwas wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, was als die alltägliche Lüge vom »notwendigen Egoismus«, von Wettbewerb, Effizienz und kalter Separation unsere Welt und unser Fühlen zerstört. Der englische Maler und Dichter John Berger sagt: »Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Trennung.«6Teilen ist gerade nicht Trennung. Das soll auf diesen Seiten deutlich werden. Teilen ist im Gegenteil die Weise, wie alles, was lebt, sich durchdringt, um so zusein. Trennung aber, die als »analytische Herangehensweise« und als Wettkampf aller gegen alle unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit vergiftet, verhindert Teilen, und darum verhindert sie Sein.
Natürlich kennen wir »Teile!« als moralischen Weckruf. Als christlich-humanistische Kultur des Abendlandes sind uns die Appelle an ein höheres und ziemlich abstraktes Prinzip der Großzügigkeit geläufig, wenn sie uns auch ermüden. Solche uns übergestülpte Moral behauptet sich nur mehr schlecht als recht gegen die dem Kapitalismus eingebaute Devise: »Teile nicht! Vernichte!« Wir lassen uns immer noch von altruistischen Appellen berieseln, während das Ethos des Teilens nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern auch seine Praktikabilität verloren hat.
Konnte die Wissenschaft denn nicht beweisen, dass Vielfalt gerade dadurch entsteht, dass wir – alle Wesen, die Evolution selbst – nicht teilen, sondern raffen? »Teile!« ist in der Welt, die wir bewohnen und durch unsere Taten beständig erschaffen, eine hohle Phrase und kaum noch an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Wir müssen uns schon etwas Besonderes überlegen, um Teilen attraktiv zu machen und daran zu erinnern, dass es das Zentrum unserer Identität bildet. Dass ohne Teilen auch kein Sein ist.
Diesen Versuch will das Buch antreten. Aber nicht durch eine weitere moralische Beschwörung, sondern indem ich zeige, dass Teilen dem gesunden Sein bereits eingebaut ist. Wer zu sein versteht, wer er selbst sein kann, wer lebendig zu sein vermag, dem gelingt das stets nur im Teilen. Gesund sein heißt somit echt sein. Es bezieht sich nicht auf einen Maßstab des Funktionierens, sondern auf eine Erfahrung, nämlich die, eigene Identität durch Verbundenheit herzustellen. Wie uns diese Erfahrung gelingen kann – als Gesellschaft, aber auch im eigenen Leben – soll auf den folgenden Seiten ergründet werden.
Unsere Gesellschaft der zerstörerischen Egoismen muss daher nicht besser – oder gar effizienter – teilen lernen, sondern zum Sein fähig werden. Teilen lässt sich einem Egoisten nicht beibringen. Zu sehr ist es das Gegenteil von dem, was das ausmacht, womit er sich schützt. Sein hingegen ist, wonach sich auch der Egoist im Stillen verzehrt. Seinkönnen. Loslassen. Nicht bewertet werden. Nicht funktionieren müssen. Sich angenommen wissen. Das gilt auch für die Gesellschaft als Ganzes: Wenn in ihr die Einzelnen, die Menschen, die Tiere, alle Wesen, zu sein vermögen, ist bereits genug geteilt.
Ich behaupte, dass wir das wahre Problem nicht sehen, während wir über die Wege zu einer Gesellschaft mit weniger Eigensucht und Gewalt diskutieren.7Wie bei der Maßregelung eines »schwer erziehbaren« Kindes versuchen wir mit Strafen und Symptomkuren das richtige – zukunftsfähige – Verhalten zu erzwingen. Doch in Wahrheit sehnt sich ein Großteil der Menschen danach, so in sich selbst verankert zu sein, dass sie dieses Verhalten von allein hervorbringen können. Niemand wünscht nicht, ganz er oder sie selbst sein zu können und dieses Selbstsein so zu genießen, wie es uns angeboren ist. Das Gefühl, sein zu können, folgt dabei keinen objektivierbaren Kriterien, ist aber gleichwohl unverwechselbar: Es ist die emotionale Erfahrung der eigenen Lebendigkeit im Kontakt mit der Welt.
»Sei!« freilich hatte in unserer Kultur nie eine moralische Konjunktur. »Sei!«, das klingt nach Ineffizienz, Schwärmerei, Romantik und anderen Formen der Taugenichtserei. Sein ist uns suspekt. Wir lehnen es als ineffizient ab, gerade weil es uns so schwer möglich ist. So ist das Gefühl, nicht sein zu können, oder in abgeschwächter Form, nicht das sein zu dürfen, was man eigentlich ist, der gemeinsame Nenner psychischer Störungen und seelischen Leidens. Wer sich am Sinnverlust quält, vermag nicht zu sein. Ihm gelingt es nicht, lebendig zu sein. Diese Erfahrung zeigt sich immer als Einschränkung auf beiden Seiten: der Möglichkeit, im vollen Sinne »ich« zu sein, und dem Gefühl, in Verbindung zu sein, in Kontakt mit der Welt, also mit den anderen.
Eine Gesellschaft, die vornehmlich aus Menschen besteht, die nicht zu sein vermögen, ist ungesund. Es ist eine Gesellschaft, welche die Wirklichkeit ignoriert. Denn deren Charakter ist es, übervoll von Seinkönnen zu sein und sich beständig in Wesen zu differenzieren, denen ihr Sein am Herzen liegt. Die Wirklichkeit zu ignorieren aber ist immer Zeichen einer Pathologie. Eine solche Gesellschaft überträgt ihre Störung auf alle Mitglieder. Das schwerste Symptom dieser Störung besteht darin, dass sie allem, was zu sein vermag, Kindern, Pflanzen, Tieren und dem Geschenk, daseinfach soda ist und nicht weil es nützt, die Möglichkeit zu diesem Sein abspricht.
Diese Buch soll zeigen, dass »Sei!« das wichtigere moralische Gebot ist – und dass Teilen, und zwar so radikal, wie wir uns das ethisch immer wünschen, automatisch nachfolgt, wenn Sein erlaubt ist. Sich Sein zu geben heißt sich zu gestatten, unmittelbar – mit dem Körper und als Gefühl – die Wirklichkeit zu sein, sodass sie mit allen geteilt ist.
Die wahre Moral ist die Moral des pochenden Fleisches, die uns immer schon trägt, selbst dann, wenn wir nicht an sie glauben. Sie funktioniert genau entgegengesetzt der Forderung, die wir mühsam und allzu fruchtlos zu befolgen versuchen, nämlich uns selbst auszulöschen, um dem gerecht zu werden, was rational erforderlich erscheint. Die wahre Moral aber folgt nicht dem, was als notwendig erklärt wird und erlaubt dann noch ein Stück weit Sein, sondern sie akzeptiert immer zunächst, was ist. Sie geht rückhaltlos von der Wirklichkeit aus und beginnt nicht mit dem Urteil über einen vorgeblichen Idealzustand. Das ist ihre Notwendigkeit, die Notwendigkeit der Wahrheit. Sie bildet sich gemäß der Empfehlung des buddhistischen Lehrers Thich Nhat Han, der sagt: »Lieben heißt daran zu arbeiten, sein Glück zu nähren.«8Lieben, meint Han, bedeutet zunächst, sich das eigene Sein zu gestatten. Daraus folgt dann von allein die Fähigkeit, auch den anderen willkommen zu heißen. Es folgt der Moral einer Wirklichkeit, die wir nur wahrnehmen können, wenn wir uns selbst zu sein gestatten.
Aus dem Glück dieses Seinkönnens eröffnet sich uns die Wirklichkeit als eine Allmende. Wenn wir selbst zu sein vermögen, wünschen wir dieses Sein auch den anderen. Echtes Sein ist unmittelbar geteilt. Um die Menschen zum Teilen zu bringen, müssen wir ihnen das Sein gestatten.
*|Ich verwende im folgenden Text weitgehend die maskuline grammatische Form. Das geschieht lediglich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.
Kapitel 1 – Teilen
»Um über die Liebe zum Leben zu sprechen, müssen wir uns zuerst darüber verständigen, was wir unter Leben verstehen.«
ERICH FROMM9
Ich habe diese Zeilen am Meer geschrieben, an der Ligurischen See. Ich wohnte für einige Wochen in einem Haus mit gelb getünchten Mauern auf einem Felsvorsprung zwischen der geschäftigen Via Aurelia und den stillen Schirmen alter Pinien. Ich habe geschrieben, das Fenster zum Meer geöffnet, wenn der Wind nicht zu kalt war. Dann habe ich das Meer eingeatmet, seinen jodhaltigen Geruch aus Geburt und Verfall, seine salzigen Erinnerungen aus Süße und Bitterkeit, denn ich kenne die Ligurische See schon lange.
Das Meer war für ein paar Wochen im Spätherbst meine Wiege. Es hielt mich, es sah mich, es gab mir Licht. Es ließ sich sacht auf mich ein und erlaubte mir jeden Tag, ein Stück näher zu kommen, nicht physisch, aber emotional. Es verwandelte sich in den Grund meiner Seele, der dadurch nicht mehr festes Land war, sondern weich wie Wasser, bewegt durch den Atem der Wellen. Meine Haut erschauerte wie die Oberfläche unter den Berührungen des Windes.
»Die Freiheit ist eine Gabe des Meeres«, schrieb der utopische Sozialist Pierre-Joseph Proudhon 1875.10Proudhons Sinnbild ist gut gewählt. Freiheit heißt, sein zu können. Wer frei ist, kann akzeptieren, was er zu sein bedarf, und kann dieses Sein mit den Mitteln seiner Wahl ausdrücken, mit den Mitteln, welche die Wahrheit ermöglichen. Wer frei ist, kann wahr sein. So wahr wie der Ozean, der sich nicht verstellt, der dem Scirocco antwortet, indem sich seine Oberfläche rhythmisch kontrahiert und wieder entspannt. Das Meer kann nicht anders, als dem Scirocco mit seinem Körper zu antworten. Darin liegt seine Freiheit, die seine Wahrheit ist.
Diese Wahrheit ist das Ziel unserer Sehnsucht, wenn es uns, wie viele Menschen, an die Küste treibt. Auch wir erfahren das Meer als eine Quelle des Seins, wenn wir uns von seinem Licht anblicken lassen, das an manchen Tagen nicht auf die Wellen zu fallen scheint, sondern aus ihnen hervorstrahlt, als wäre der Ozean die eigentliche Quelle der Energie, nicht die Sonne.
Zum Charakter der Wirklichkeit gehört sowohl, dass sie eine Totalität ist, die uns umfasst, als auch, dass sie aus unzähligen Individuen besteht, von denen wir eines sind. Jeder Teilnehmer existiert zugleich als Einzelner und als Ganzes. Das Meer, der Ozean mit seinen kleinsten und gigantischen Wesen, der das Klima reguliert und die Kontinente mit Wasser versorgt, ist der Inbegriff eines Seins, das sich nur im Teilen realisiert. Wenn das Wasser die Felsen begrüßt, an ihnen als Schaum aufleuchtet und zu Spritzern zerplatzt, zeigt es seine viskose Schwere, die zugleich unendliche Formbarkeit ist. Wasser ist sein eigener Widerspruch: Es ist fest und durchlässig zugleich. Seine Moleküle sind nicht wie Salz im Kristall gebunden, aber sie ziehen einander an. Gemeinsam sind sie Meer. Gemeinsam können sie uns tragen, wie die Malerin Sofia Nordmann beobachtet: »Das Meer ist eine Ansammlung von Tropfen, die nur zusammen, Hand in Hand, die Seele berühren.«11
Aber mit dem Wasser ist das Meer noch kaum verstanden. Denn seine Substanz besteht aus Wesen, aus Algen und Plankton, aus Sekreten, Sperma und Eiern, aus den Säften des Verfalls und den Nährstoffen der Geburt. Man kann den Ozean als ins Gigantische vergrößertes Zellplasma betrachten. Alle Meereswesen tragen etwas zu dieser Nährflüssigkeit bei und alle leben von ihr. Und doch sind sie letztlich die Übersetzung eines einzigen umfassenden Geschenks, nämlich der Sonnenenergie, in Individualität.
Die Liebe als Grundproblem des Seins
Die folgenden Seiten handeln von der Erfahrung, Teil zu sein und dadurch Selbst zu werden. Sie handeln davon, wie sich Gemeinsamkeit herstellt, indem sich Individualität entfaltet – und woran das scheitern kann und in unserer Gesellschaft meistens scheitert. Ich möchte verstehen, wie wir, also wir Menschen und in einem weiteren Sinn wir Lebewesen und wir irdischen Körper, uns erschaffen und erfahren, indem wir Verbindungen eingehen. Die folgenden Seiten handeln also von der Liebe als Grundproblem des Seins. Denn lieben heißt, durch Verbindung so zu wachsen, dass diese Verbindung selbst auch wächst.
Nur durch Verbindungen können wir selbst sein. Meine Leitfragen sind daher: Wie ist Beziehung denkbar, die für beide Seiten produktiv ist? Wie lässt sich Beziehung so gestalten, dass in ihr beide Seiten wirklich sein können, die damit also gewaltfrei ist? Das ist nicht nur die zentrale Frage der persönlichen Heilung (wie kann ich mir selbst erlauben zu sein?), sondern auch der gesellschaftlichen Veränderung. Ich frage nach den Möglichkeiten der Liebe auf der Ebene des Körpers, der von der Materie der Welt geliebt wird, auf der Ebene der Bindung zwischen Menschen, in denen Liebe ermöglichen kann, dass ein anderer sein darf, und auf der Ebene der Gesellschaft, in der nicht Trennung (und Wettkampf) den Einzelnen Dasein verleiht, sondern in der jeder dadurch sein kann, dass er in wechselseitiger Verbindung mit dem Ganzen ist.
Die Lebendigkeit, die wir ersehnen, ist nicht nur ein privater seelischer Zustand, den man sich womöglich auf dem Weg des Konsums (von Partnern, Modeartikeln, Balkons mit Meerblick) sichert. Lebendigkeit schließt den anderen ein. Sie ist ein Anliegen, welches sich nicht erfassen lässt, ohne zu verstehen, wie Lebewesen Verbindungen herstellen, um sie selbst zu sein – und dem wir ohne dieses Verständnis nicht entsprechen können. Jedes Stückchen funktionierendes Selbst, auf das wir zurückgreifen, ist das Produkt einer Verbindung, und damit immer jeweils Sein durch Teilen. Darum gilt es, die Wege zu erforschen, auf denen sich Identität entfaltet und durch die Verbindung mit dem, was noch nicht in ihr selbst liegt, zu einem Selbst wird.
Unsere Ohnmacht, zu sein
Während ich an diesem Buch arbeite, lasse ich meine Playlist laufen. Sie besteht aus einer Wanderung durch die Musik der italienischen Liedermacher, der »Cantautori« der 1960er und 1970er. Und mir wird klar, wie sehr unsere populäre Musik, die Lieder, denen wir seit Jahrzehnten lauschen, die Verzweiflung angesichts der Liebe auferstehen lassen. Sie beklagen die Unmöglichkeit, in Verbindung zu sein.
»Die Liebe, für die wir uns die Haare ausrauften / ist längst verloren. / Es bleiben nur ein paar lustlose Liebkosungen / und ein Rest von Zärtlichkeit«, singt Fabrizio di André in seiner »Storia dell’amore perduto«, der Geschichte der Liebe, die abhanden gekommen ist, 1966.12Dieses Abhandenkommen könnte geradezu das Label unserer Gesellschaft sein. Uns quält die Unfähigkeit zur Liebe. Wir sind eine Kultur, in der ganze Sparten – die populäre Musik, die Literatur, die Bühne – quasi unisono die Unmöglichkeit des Liebens beklagen. Die tragische Liebe ist die Wunde schlechthin des Abendlandes. Schon auf der Hochzeit wird zu Liebesliedern mit schmerzhaftem Ausgang getanzt.
Das ist nicht trivial. Es heißt nicht, dass wir eine infantile Gesellschaft sind, die sich vor allem mit Nabel-(und Genitalien-)schau beschäftigt. Es zeigt vielmehr die tiefe Verzweiflung, mit der wir versuchen, in Verbindung zu treten. Wir mehr oder weniger Erwachsenen suchen Verbindung vor allem durch die erotische Liebe. Aber diese ist nur die Spitze eines Eisberges. Ihr vielfaches Misslingen ist Symptom einer tiefer liegenden Unfähigkeit, in Verbindung zu sein. Und damit ist es Ausdruck einer Ohnmacht, zusein.
Die Verzweiflung über die Liebe, die immer schon »längst verloren« ist, ist in Wahrheit die Trauer darüber, dass wir nicht wirklich sein können, dass wir die Wirklichkeit verloren haben. Wir leben im Exil, aber wir wissen es nicht, weil wir darin nach dem suchen, was uns nicht retten kann. Das Exil lässt sich nur ertragen, indem wir uns in Rauschzustände versetzen – sei es durch die Besessenheit mit Ekstase oder mit Effizienz. Solche Anästhesie ist wie jede Krankheit ein Ausdruck verhinderten Wachstums: eine »unvollendete Schöpfungstat« (Victor von Weizsäcker) und somit Begehren, das sich anhand von Verzweiflung zeigt. Es ist ein Zeichen, dass wir es als Gesellschaft und als Einzelne auf eine tragische und vielfach suizidale Weise verfehlen, zusein.
Und so wird mir am eigenen Leibe klar, wie sehr unsere privaten Handlungen Symptome einer allgemeinen Verblendung sind. Sie sind aus dem Rauschen einer Hintergrundmetaphysik gebildet, die wir für so normal halten, dass sie den Grundton bildet, auf den unsere Weltwahrnehmung gestimmt ist. Dieser Grundton ist die Verbindungslosigkeit, der Abriss, die Trennung, die nicht anders sein kann.
Das Bild der Wirklichkeit, welches in der Schule gelehrt wird, sagt nichts darüber, wie es sich anfühlt, am Leben zu sein, warum Beziehungen wichtig sind und wie man sie aufbauen kann – Beziehungen zu mir selbst, zu anderen Menschen, und zu allen, die keine Menschen sind, zu Tieren, Pflanzen, Pilzen, Bakterien, Steinen und Flüssen, der Luft, dem Meer. Das Bild, das wir unseren Kindern beibringen, ist das einer leblosen Welt. Deren Mechanik kommt es allein auf Erfolg an: Das, was da ist, hat sich durchgesetzt, indem es andere aus dem Weg räumte. Wir lassen uns von einer Ideologie des Toten leiten. Doch diese Ideologie beschreibt nicht die Wirklichkeit. Sie versteht sie gar nicht. Und gerade weil sie die Wirklichkeit nicht versteht, ist sie dabei, sie zu zerstören.
Die Ideologie des Toten zerschneidet die unsichtbaren Bänder der Lebendigkeit. Diese Bänder heißen nicht nur Biodiversität und Rücksicht auf andere Lebewesen. Sie heißen auch Sinn-Erfahrung, Erlebnis von Zugehörigkeit, Spüren der eigenen Bedürfnisse, das Gefühl, gewollt zu sein. Es sind Erfahrungen, die in unserer Welt zunehmend weniger werden.
Freiheit heißt, lebendig zu werden
Wenn wir leiden, haben wir zu wenig Lebendigkeit. Zuwenig Lebendigkeit heißt immer: Wir erleben uns nicht aus unserer Mitte heraus mit der Welt in Verbindung. Das Tragische ist, dass wir diesen Mangel heute oft nicht einmal empfinden. Weil wir die Natur des Leidens nicht verstehen, finden wir kein Gegenmittel. Die Natur des Leidens darf in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht vorkommen. Darum ignorieren wir es. Wir benehmen uns wie Menschen, die zwar sehen können, aber sich einreden, dass das meiste, was sie erblicken, nicht wirklich ist, und die es daher achtlos zerstören. Darüber sind wir zwar traurig, können uns aber nicht erklären, wie wir die Zerstörung verhindern sollen, denn das, was wir sehen, gibt es ja nicht.
Wir sind uns selbst verdächtig. Wie trauen nicht unserem Gefühl. Wir glauben uns in unserer Wahrnehmung dessen, was wir sehen und was wir selbst sind, zu irren, und möchten darum lieber einen Experten entscheiden lassen. Dessen Urteil ist freilich immer das gleiche: »Nimm deine Gefühle nicht so wichtig!«, lautet er. »Was du zu wissen glaubst, ist nichts als Projektion.« Aber unsere Gefühle sind die Stimme der Wirklichkeit in uns. Sie bezeugen, dass wir selbst und diese ganze Welt, von der wir eine Erscheinungsform darstellen, etwas zutiefst Lebendiges sind.
Die Trennung ist kein Verhängnis. Sie ist uns nicht angeboren. Sie ist vielmehr die tragische Außerkraftsetzung einer angeborenen Fähigkeit, zu sein. »Unser größtes Begehren ist es, uns lebendig zu fühlen. Sinnlosigkeit, Depression und viele andere Symptome spiegeln wider, dass wir mit dem Kern unserer Lebendigkeit nicht in Kontakt stehen. Wenn wir uns lebendig fühlen, fühlen wir uns verbunden, und wenn wir uns verbunden fühlen, fühlen wir uns lebendig […]. Lebendigkeit […] ist ein Zustand des energetischen Fließens und der Kohärenz in allen Systemen des Körpers, des Gehirns und der Seele«, sagen die US-amerikanischen Psychologen Laurence Heller und Alina La Pierre.13Wir streben nach Sein, und wir haben ein Organ dafür, zu erkennen, ob wir am Sein teilhaben, ob wir sind. Dieses Organ ist unsere Fähigkeit zum Glück.
Wir spüren, wenn unser Existieren uns schwächt, weil etwas nicht stimmt. Wir fühlen, wenn etwas falsch ist, so wie die Blume fühlt, dass sie nicht genug Wasser bekommt, indem sie welkt. Sie welkt, weil sie nicht anders kann. Genauso können auch wir nicht anders, innerlich, und als Fleisch und Blut. Aber wir können uns einreden, dass wir anders könnten, und solange so tun, bis wir brechen: krank werden, unglücklich werden, andere unglücklich machen, eine ganze Gesellschaft des Unglücks und der Fälschung hervorbringen.