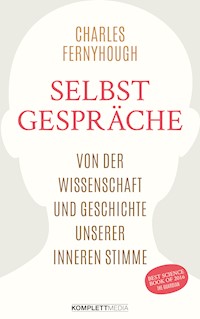
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Komplett-Media Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn jemand sagt "Ich höre Stimmen", denken wir zunächst an eine Geisteskrankheit. Tatsächlich verbringen wir aber ein Viertel unserer Zeit mit lautlosen Debatten und Monologen im Kopf. Wir alle reden mit uns selbst, die ganze Zeit. Unsere inneren Stimmen sind da - ob wir wollen oder nicht. Sie können selbstbewusst, lustig, zögernd oder gemein sein; Sie können in verschiedenen Akzenten und sogar in Gebärdensprache erscheinen. Wir alle hören sie - und wir brauchen sie nicht zu fürchten. Im Gegenteil: Das Geplapper im Kopf kann sogar sehr hilfreich sein. Aber wann ist ein Selbstgespräch noch normal - und wann wird es zum Problem? Der Psychologe Charles Fernyhough nähert sich in seinem Buch "Selbstgespräche" dem Thema unter kulturellen und zeitgeschichtlichen Aspekten und erklärt, dass diese inneren Stimmen eines der Hauptmerkmale des menschlichen Denkens sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Fernyhough
Selbstgespräche
Charles Fernyhough
Selbstgespräche
Von der Wissenschaft und Geschichte unserer inneren Stimme
Aus dem Englischen übersetzt von Theresia Übelhör
Die englische Erstausgabe ist 2016 bei PROFILE BOOKS in Zusammenarbeit mit wellcome collection erschienen.
Titel der Originalausgabe: The voices within. The history and science of how we talk to ourselves
© Charles Fernyhough, 2016, 2017
Copyright der deutschen Erstausgabe
© Verlag Komplett-Media GmbH
2018, München/Grünwald
1. Auflage
www.komplett-media.de
ISBN E-Book: 978-3-8312-6952-5
Umschlaggestaltung: X-Design München
Lektorat: Redaktionsbüro Diana Napolitano, Augsburg
Korrektorat: Redaktionsbüro Julia Feldbaum, Augsburg
Satz und Layout: Daniel Förster, Belgern
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.
»Wir denken nicht in Worten, sondern in Schatten von Worten.«1
VLADIMIR NABOKOV
INHALT
KAPITEL 1
LUSTIGE KÄSESCHEIBEN
KAPITEL 2
DAS GAS AUFDREHEN
KAPITEL 3
DIE QUASSELSTRIPPE
KAPITEL 4
ZWEI AUTOS
KAPITEL 5
EINE NATURGESCHICHTE DES DENKENS
KAPITEL 6
STIMMEN AUF PAPIER
KAPITEL 7
DER CHOR IN MIR
KAPITEL 8
NICHT ICH
KAPITEL 9
VERSCHIEDENE STIMMEN
KAPITEL 10
DIE STIMME EINER TAUBE
KAPITEL 11
EIN GEHIRN, DAS SICH SELBST ZUHÖRT
KAPITEL 12
EINE GESPRÄCHIGE MUSE
KAPITEL 13
BOTSCHAFTEN AUS DER VERGANGENHEIT
KAPITEL 14
EINE STIMME, DIE NICHT SPRICHT
KAPITEL 15
SELBSTGESPRÄCHE
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN UND LITERATUR
STICHWORT- UND NAMENSVERZEICHNIS
KAPITEL 1
LUSTIGE KÄSESCHEIBEN
Es ist ein Herbsttag in Westlondon. Ich bin auf dem Weg zu einem Arbeitsessen und sitze in der U-Bahn Central Line. Der mittägliche Hochbetrieb hat noch nicht eingesetzt, und ich habe es geschafft, einen Platz in einem jener Waggons zu ergattern, in denen man sich in zwei Reihen gegenübersitzt, nahe genug, um die Titelseiten der Zeitungen zu überfliegen, die das Gegenüber liest. Die U-Bahn hat zwischen zwei Stationen angehalten, und wir warten auf eine Durchsage. Die Leute lesen Taschenbücher, die Klatschblätter, jene seltsamen technischen Bedienungsanleitungen, die allem Anschein nach nur in der U-Bahn studiert werden. Alle Übrigen starren auf die rätselhaft farbig gekennzeichneten Kabel, die im Tunnel direkt vor dem Abteilfenster entlangführen. Holland Park ist vermutlich noch 400 Meter entfernt. Ich tue nichts Ungewöhnliches, genau genommen tue ich überhaupt nichts. Es ist ein Moment der nur schwach bewussten Beschaulichkeit. Ich bin ein ganz normaler Mann Ende vierzig in gesunder mentaler und körperlicher Verfassung. Ich habe ein klein wenig zu lange geschlafen, ein bisschen zu wenig gegessen und freue mich mit einem guten, noch nicht befriedigten Appetit auf das Mittagessen in Notting Hill.
Auf einmal lache ich los. Noch einen Augenblick zuvor war ich ein anonymer Fahrgast mit elektronischer Oyster-Fahrkarte. Jetzt gebe ich meine Tarnung mit einem mehr als hörbaren Gekicher auf. Ich komme häufig nach London, aber ich bin es nicht gewohnt, dass mich so viele Fremde gleichzeitig anstarren. Ich besitze genügend Geistesgegenwart und bin mir meines Publikums ausreichend bewusst, um mein Gelächter in Schach zu halten, bevor ein privater Witz in allgemeine Verlegenheit ausartet. Interessant ist dabei nicht, worüber ich lache, sondern die Tatsache, dass ich überhaupt lache. Ich habe weder dem Witz eines anderen gelauscht noch einen lustigen Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Ich habe etwas viel Banaleres getan. Man könnte sagen, dass ich gerade die allernormalste Erfahrung gemacht habe, die ein Mensch in einer U-Bahn erleben kann: Mir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen.
Es handelte sich um einen ziemlich bedeutungslosen Gedanken, der mich an jenem Tag loslachen ließ. Es war keiner jener Momente, in denen ein Denker endlich auf die Lösung eines wichtigen Problems stößt, eine Idee hervorbringt, die die Industrie revolutionieren wird, oder die Anfangsverse eines großartigen Gedichts vollendet. Gedanken können Geschichte schreiben, doch das ist gewöhnlich nicht der Fall. Damals dachte ich zwischen den zwei U-Bahn-Stationen an eine Kurzgeschichte, an der ich gerade arbeitete. Es ging um die Geschichte einer ländlichen Gemeinde und um Zwietracht im post-agrarwirtschaftlichen Zeitalter, und ich wollte, dass mein Held, ein ehemaliger Bauer, eine außereheliche Beziehung führt. Ich hatte die Möglichkeiten erwogen, dass er eine Affäre mit der Frau eingeht, die den mobilen Postlaster fährt, und diese Affäre spielt sich hinter den geschlossenen Jalousien eines speziell umgebauten Ford Transit ab. Die beiden treffen sich jeden Donnerstagnachmittag nach den wöchentlichen Geschäftszeiten im Dorf. Die Türen werden verschlossen, das Sprechfunkgerät ausgeschaltet, und die beiden erkunden einander auf der von Hunderten von Kleingeldtransaktionen verkratzten Schaltertheke. Während ich die Szene in Gedanken konstruierte, hatte ich das Bild eines am Rand der Landstraße geparkten leuchtend roten Postlasters vor Augen, der auf mögliche Passanten wie stillgelegt und leer wirkt, dann aber mit einem hartnäckigen Quietschen der Federung zu schaukeln beginnt, als die Körper im Inneren anfangen, Reibung zu suchen …
Genau an diesem Punkt musste ich laut loslachen. Diese Wörter gingen mir durch den Kopf und amüsierten mich. Auf keinen der anderen Fahrgäste zeigten sie diese Wirkung, weil keiner die Pointe hörte. Aber meine Mitfahrenden wussten, dass es eine Pointe gab. Sie lachten nicht über meinen privaten Spaß (weil sie ihn nicht hören konnten), aber sie lachten mich auch nicht aus. Sie wussten, dass ich, wie die meisten Menschen in diesem U-Bahn-Wagen, mit Gedanken beschäftigt war, und sie verstanden, dass Gedanken – wilde Gedanken, banale Gedanken, heilige oder profane Überlegungen – gelegentlich Gelächter hervorrufen können. Selbstgespräche zu führen ist etwas ganz Normales, und die Menschen erkennen es, wenn sie es sehen. Nicht nur das, sie erkennen auch deren Privatheit an. Ihre Gedanken gehören nur Ihnen, und was immer sich dort auch abspielt, es findet in einem Bereich statt, zu dem andere Menschen keinen Zugang haben.
Ich bin jedes Mal über dieses Bewusstsein erstaunt. Unsere Erfahrung ist nicht nur für uns selbst faszinierend und lebhaft, sie ist es ausschließlich für uns. In der Sekunde oder in den zwei Sekunden nach meinem Lachanfall wurde mir klar, dass ich versuchte, soziale Signale auszusenden, die mein Verhalten entschuldigten. Man lacht in einem beinahe voll besetzten Zugabteil nicht laut los, ohne zumindest ein wenig Verlegenheit zu empfinden. Ich wollte nicht so tun, als hätte ich nicht gelacht, vielleicht indem ich versucht hätte, mein Lachen mit einem Hustenanfall zu kaschieren, aber ich bemühte mich dennoch, gewisse Botschaften auszusenden: Dass ich nicht verrückt bin, dass ich mich schnell wieder unter Kontrolle hatte, ja, dass es tatsächlich schon vorbei war – dass der Augenblick der Erheiterung jetzt vorüber war. Ich ertappte mich dabei, dass ich eine Miene aufsetzte, die so etwas wie ein Lächeln und eine Mischung aus Klugheit, Komplizenschaft und Verlegenheit ausdrückte. Ein anderer Gedanke ging mir durch den Kopf, eine Stimme, die sagte: »Die glauben doch nicht etwa, dass ich über sie lache, oder?« Lachen ist ein soziales Signal, aber dieser Spaß war privat. Ich hatte eine der Regeln des menschlichen Miteinanders verletzt und musste diese Tatsache durch irgendeine Bekundung einräumen.
Ich brauchte mir keine Sorgen zu machen. Die Menschen in dem Abteil würden das verstehen, es sei denn, es handelte sich um kleine Kinder, Außerirdische oder eine bestimmte Art von Psychiatriepatienten. Unsere Überzeugung, dass unser Innenleben privat ist, ist so ausgeprägt, dass Alternativen dazu – Gedankenlesen, Telepathie und Gedankeninvasion – Anlass für Erheiterung oder Entsetzen bieten können. Fremde in einem U-Bahn-Wagen werden die Auswirkungen dieses Merkmals von Gedanken rasch erkennen. Schließlich werden sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich wurde lediglich verblüffend an die Privatheit meiner Gedanken erinnert und mir ihrer direkten Wirkung auf mich deutlich bewusst. In diesem Augenblick war mein Gehirn in jedem Fall aktiv – anders hätte ich das Bild des schaukelnden Postlastwagens nicht heraufbeschwören können –, aber ich war mir darüber hinaus des inneren Ideenfeuerwerks bewusst. Und genau das bietet Ihnen das Gehirn: einen Logenplatz für eine Show nur für Sie allein.
Es war diese lebhafte innere Vorstellung, die mich hatte laut loslachen lassen. Zwar läuft ein großer Teil unserer mentalen Aktivität unterhalb der Bewusstseinsschwelle ab, doch vieles wird der Person bewusst, in der es sich abspielt. Wenn wir mit einem Problem zu kämpfen haben, uns eine Telefonnummer ins Gedächtnis rufen oder an eine romantische Begegnung zurückdenken, ist uns klar, dass wir dies tun. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei um ein komplettes oder korrektes Bild der daran beteiligten kognitiven Mechanismen handelt – wir sind bei Weitem keine verlässlichen Zeugen dessen, was unser Gehirn vollbringt –, aber es führt zumindest zu einer stimmigen Erfahrung. In der von Philosophen bevorzugten Sprache ist »etwas vorhanden, dem es ähnelt«2, wenn man sich des arbeitenden Gehirns bewusst ist. Sich mit einer Gedankenfolge zu beschäftigen ist ein Erlebnis, das spezielle Qualitäten besitzt, wie das Eintauchen in einen Swimmingpool oder die Trauer um einen geliebten Angehörigen.
Aber wir können noch etwas anderes Wichtiges über unsere innere Erfahrung3 sagen. In zahlreichen populärwissenschaftlichen Büchern wurde – häufig mit bewundernswerter Klarheit – dargestellt, was wir über das Funktionieren des Bewusstseins wissen. Allerdings neigen die Autoren dazu, sich auf das Wunder der perzeptuellen und affektiven Erfahrung zu konzentrieren: warum diese weiße Lilie diesen charakteristischen Duft verströmen kann; warum die Nachwirkungen eines Familienstreits so viele bittersüße emotionale Möglichkeiten eröffnen können. Mit anderen Worten: Die Betrachtung der mentalen Erfahrung konzentriert sich in diesen Büchern gewöhnlich auf die Reaktion des Gehirns auf Ereignisse der Außenwelt. Wenn wir anfangen, über das Denken nachzudenken, müssen wir erklären, wie das Bewusstsein seine eigene Show aufführen kann. Wir sind für unsere Gedanken verantwortlich, zumindest haben wir das starke Gefühl, dass es so ist. Das Denken ist eine Aktivität; es ist etwas, was wir tun. Das Denken treibt sich selbst an, erschafft etwas, wo zuvor nichts war, ohne von der Außenwelt irgendeine Richtungsvorgabe zu benötigen. Dies ist ein Teil dessen, was uns eindeutig zum Menschen macht: die Tatsache, dass ein Mensch sich in einem leeren Raum ohne jede äußere Stimulation zum Lachen oder Weinen bringen kann.
Wie ist es, solche Erfahrungen zu machen? Die Tatsache, dass das Denken etwas so Gewöhnliches ist, könnte paradoxerweise bedeuten, dass wir nicht groß darüber nachdenken, wie es funktioniert. Die Gesetze der geistigen Privatsphäre sorgen darüber hinaus dafür, dass das Erlebnis dem Blick der anderen verborgen bleibt. Wir können anderen den Inhalt unserer Gedanken mitteilen – wir können ihnen erzählen, worüber wir nachdenken –, aber es fällt uns deutlich schwerer, anderen die Qualität eines Phänomens zu vermitteln, das nur für uns selbst bestimmt ist. Wenn wir den Gedankengängen anderer Menschen lauschen könnten, würden wir dann feststellen, dass sie unseren eigenen ähnlich sind? Oder besitzen Gedanken einen persönlichen Stil oder eine emotionale Atmosphäre, die für den Denker charakteristisch sind? Was wäre gewesen, wenn die Leute an jenem Tag in der U-Bahn meine Gedanken tatsächlich hätten lesen können? Was würde ein mentaler Lauscher in diesem Moment hören, wenn er in der Lage wäre, Ihre Gedanken zu belauschen? Der Philosoph Ludwig Wittgenstein stellte fest, dass wir nicht in der Lage wären, einen Löwen zu verstehen, wenn er sprechen könnte.4 Ich vermute, dass etwas Ähnliches für unseren alltäglichen
Bewusstseinsstrom gilt. Selbst wenn wir unsere Gedanken irgendwie hörbar machen könnten, würden andere Menschen wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen.
Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass wir beim Denken Wörter auf eine sehr spezielle Art und Weise nutzen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich würde Sie fragen, in welcher Sprache Sie denken. Ich vermute, dass Sie möglicherweise nicht in der Lage sein könnten, die Frage für jeden Ihrer Gedanken ehrlich zu beantworten, aber Sie würden einräumen, dass diese Frage sinnvoll ist. Viele von uns würden zustimmen, dass das Denken eine sprachliche Qualität5 besitzt. Falls Sie zweisprachig sind, könnten Sie sogar wählen können, in welcher Sprache Sie denken wollen. Nichtsdestotrotz gibt es vielerlei Gedanken, deren sprachliche Eigenschaften nicht immer offensichtlich sind. Es gibt Dinge, die Sie sich beim Denken nicht selbst mitteilen müssen, weil Sie diese bereits kennen. Die Sprache kann stark vereinfacht werden, weil die Botschaft nur für Sie selbst bestimmt ist.
Ein weiterer Grund, weshalb unser Denken für andere Menschen unverständlich sein könnte, ist die Tatsache, dass daran gewöhnlich nicht nur Wörter beteiligt sind. In jenem Augenblick in der U-Bahn hatte ich neben allen anderen körperlichen und emotionalen Eindrücken einen Song aus dem Film High School Musical im Kopf. Während mein Blick ziellos auf die Kabel im Tunnel vor dem Abteilfenster geheftet war, war mein inneres Auge damit beschäftigt, das Bild des roten Postlastwagens heraufzubeschwören. Einige dieser Empfindungen hingen mit dem Denken zusammen, andere bildeten lediglich den geistigen Hintergrund. Entscheidend ist, dass das Denken ein multimediales Erlebnis ist. Die Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle, aber sie ist bei Weitem nicht alles.
In diesem Buch möchte ich der Frage nachgehen, wie es ist, wenn sich so etwas in Ihrem Kopf abspielt. Ich möchte herausfinden, wie es sich anfühlt, bei jener Flut von Eindrücken, Ideen und inneren Äußerungen ertappt zu werden, die unseren Bewusstseinsstrom bildet. Nicht alles, wozu unser Geist und Gehirn fähig sind, wird sich als diese Art von Erfahrung qualifizieren. Viele der wirklich klugen Dinge, die ein Mensch leisten kann, wie zum Beispiel, einen Kricketball zu fangen oder mithilfe des Sternenhimmels über den Pazifik zu navigieren, können ohne bewusste Wahrnehmung, wie sie zu vollbringen sind, erfolgreich durchgeführt werden. In gewissem Sinne bezieht sich »Denken« auf alles, was unser Bewusstsein (im Gegensatz zum Unterbewusstsein) tut. Aber diese Definition ist noch zu weit gefasst. Ich würde jene unglamourösen geistigen Leistungen, wie zum Beispiel das Zählen einer Handvoll Kieselsteine oder den Wechsel mentaler Bilder, die im Wesentlichen auf stark automatisierten, speziell entwickelten kognitiven Subsystemen basieren, nicht dazuzählen wollen. Ein Grund, weshalb diese Prozesse nicht einbezogen werden, ist die Tatsache, dass ihre Start- und Endpunkte eindeutig definiert sind. Der Zauber des Denkens liegt zum Teil darin begründet, dass es ziellos, im Kreis oder auf ein kaum definiertes Ziel gerichtet erfolgen kann.6 An jenem Tag in der U-Bahn wusste ich nicht, wie ich mit meiner Geschichte weitermachen sollte. Manchmal ist das Denken tatsächlich »zielgerichtet«, beispielsweise wenn es darum geht, eine bestimmte Art von intellektuellem Problem zu lösen. Aber der Bewusstseinsstrom kann sich auch ziellos dahinwinden. Häufig hat das Denken keinen offenkundigen Startpunkt, und oft verlangt es von uns, am Ziel anzukommen, bevor wir wirklich verstehen, was dieses ist.
Und das ist die Art von Denken, die mich interessiert. Dieses ist in dem Sinne bewusst, dass wir wissen, was wir gerade denken, aber auch in dem Sinne, dass es das besitzt, was Philosophen als phänomenologische Eigenschaft bezeichnen: Es gibt etwas Ähnliches, womit man es vergleichen kann. Es erfolgt sprachlich, und wie wir sehen werden, hängt das Denken häufig direkter mit der Sprache zusammen, als es anfänglich den Anschein hat. Auch die Bildsprache spielt eine Rolle, ebenso wie andere sensorische und emotionale Elemente, aber diese sind nur ein Teil des Ganzen. Darüber hinaus ist das Denken (in Wörtern oder auf andere Weise) privat: Was wir denken, denken wir im Kontext der bestimmten festen Annahme, dass es für andere nicht wahrnehmbar ist. Gedanken sind in der Regel kohärent: Sie fügen sich in Ideenstränge ein, die mit dem, was zuvor geschehen ist, in Verbindung stehen, egal, wie zufällig sie erfolgen. Und schließlich sind Gedanken aktiv: Denken ist etwas, was wir tun, und gewöhnlich erkennen wir es als unser eigenes Werk.
Ich bin nicht der Erste, der sich für die Rolle interessiert, die Wörter bei unseren mentalen Prozessen spielen. Seit Jahrhunderten streiten sich Philosophen über die Frage, ob Sprache für das Denken notwendig ist (während sie häufig ein bisschen vage bleiben, was sie mit »Denken« überhaupt meinen)7. Und Tierverhaltensforscher haben einfallsreiche Experimente durchgeführt, um herauszufinden, zu welcher Art von Denken Tiere fähig sind und ob ihnen eine Sprache beigebracht werden kann. All diese Erkenntnisse sind für meine Untersuchung relevant. Aber ich verfolge einen etwas anderen Ansatz. Ich möchte mit einer schlichten Tatsache beginnen: nämlich dass wir feststellen, dass unser Kopf voller Wörter ist, wenn wir über unsere eigenen Erfahrungen nachdenken oder wenn wir andere Menschen bitten, davon zu berichten, was bei ihnen im Kopf gerade vor sich geht. Das bedeutet nicht, dass jeder von solchen gedanklichen Wortströmen berichtet: Die Tatsache, dass es manche von uns nicht tun, bedarf einer Erklärung. Wird diese Frage richtiggestellt, dann kann sie sich über das Verhältnis von Sprache und Denken als sehr informativ erweisen.
Könnten wir Gedanken lesen, dann wären wir in der Lage, diese Frage einfach dadurch zu klären, dass wir die Gedanken der Menschen um uns herum lesen würden. Aber die geistige Privatsphäre ist nun einmal Realität, deshalb müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Wir können zum Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, mit welchen die Menschen ihre Gedanken mitteilen, indem sie erzählen, schreiben, bloggen, tweeten und texten, was bei ihnen im Kopf gerade vor sich geht. Wir können betrachten, was Autoren über innere Erfahrungen geschrieben und was Psychologen von den Beschreibungen der Menschen dokumentiert haben. Und wir werden von der Neurowissenschaft Hilfe erhalten, die uns die Bilder eines Scanners davon liefern wird, wie sich Gedanken im Gehirn formen. Wir können beobachten, wie sich das Denken in der Kindheit entwickelt, und was passiert, wenn es schiefläuft. Doch mein Ausgangspunkt ist näherliegend. Ich möchte ja nichts Fremdes oder Unbekanntes darstellen, wie zum Beispiel das Bewusstsein des Haustiers oder wie es ist, ein Neugeborenes zu sein. Ich weiß, wie es ist, wenn sich die Sache in meinem Kopf abspielt. Ich muss lediglich eine Möglichkeit finden, sie in Worte zu fassen.
In Terminal eins erhalten Sie lustige Käsescheiben. Es handelt sich nicht um den bedeutendsten Gedankengang, für den ich je verantwortlich war. Ich picke ihn aufs Geratewohl heraus, biete ihn nicht etwa als lebensverändernde Weisheit an, sondern als Beispiel für den Bewusstseinsstrom am heutigen Morgen. Als ich aufwachte, war er in meinem Kopf, aber ich war mir nicht bewusst, dass ich unmittelbar davor geträumt hatte oder dass der Gedanke in irgendeiner Weise mit etwas anderem zusammenhing. In Terminal eins erhalten Sie lustige Käsescheiben. Das ist alles. Ich weiß noch immer nicht, um welchen Flughafen es sich handelte oder was Käse überhaupt damit zu tun hat. Aber ich weiß, dass der Gedanke da war, wie die Äußerung einer schwachen inneren Stimme, und dass sie sich für mich real anfühlte. Ich behaupte, nicht zu wissen, woher sie kam, aber in gewisser Weise weiß ich es doch. Sie kam von mir. Als rationaler Psychologe würde ich sagen, dass es sich um einen jener Sätze handelte, die mir gewöhnlich in den Sinn kommen und Teil der geistigen Produktion sind, die den Bewusstseinsstrom am Laufen halten.
Auch bei Claire tauchen Sätze im Kopf auf. Ihre inneren Stimmen sprechen leise und eindringlich und sagen ihr Dinge wie »Du bist ein Stück Scheiße« oder »Du wirst nie irgendetwas erreichen«. Claire leidet an einer Depression. Sie unterzieht sich gerade einer kognitiven Verhaltenstherapie, um diese aufdringlichen und unerwünschten sprachlichen Gedanken zu bekämpfen: sie zu dokumentieren, sie wissenschaftlich zu untersuchen und sie damit insoweit zu untergraben, dass sie am Ende (hoffentlich) verschwinden werden.
Auch in Jays Kopf tauchen Wörter auf. Diese unterscheiden sich deutlich von Claires. In den meisten Fällen klingen sie so, als würde jemand mit ihm reden. Sie können einen Akzent haben, eine Tonhöhe und einen Tonfall. Manchmal sprechen sie in ganzen Sätzen, manchmal sind ihre Äußerungen eher bruchstückhaft. Sie kommentieren Jays Handlungen und weisen ihn an, bestimmte Dinge zu tun: harmlose Dinge, wie zum Beispiel in den Laden zu gehen und Milch zu kaufen. Bei anderen Gelegenheiten sind sie deutlich schwieriger zu erkennen. Jay hat mir erzählt, er wisse, dass eine Stimme da ist, selbst wenn sie nicht spricht. Bei diesen Gelegenheiten handelt es sich nicht um eine Stimme, sondern vielmehr um eine Präsenz in seinem Kopf. Aber was ist eine Stimme, die nicht spricht? Vor ein paar Jahren wurde bei Jay eine psychische Erkrankung diagnostiziert, und er erlebt jetzt das, was man eine »Genesungsgeschichte« nennt. Er erholt sich von einem Zustand, den manche Leute für eine degenerative Gehirnerkrankung8 halten. Er hört die Stimmen noch immer, aber jetzt hat er eine andere Einstellung ihnen gegenüber angenommen. Er lebt mit ihnen und fürchtet sich nicht mehr vor ihnen.
Eine Stimmenhörerin, die wortgewandt von ihrer Erfahrung berichtete, hat ebenfalls zu einer neuen Einstellung ihren Stimmen gegenüber gefunden. In einer Videokonferenz aus dem Jahr 2013, die mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde, beschreibt Eleanor Longden, die Stimmen seien in der Zeit, als sie ihr Buch verfasste, so aggressiv geworden, dass sie plante, ein Loch in ihren Kopf zu bohren, um sie herauszulassen. Im Laufe mehrerer Jahre hat sich Eleanors Einstellung gegenüber ihren Stimmen ebenso wie Jays radikal verändert. Sie sind zwar noch immer gelegentlich sehr lästig, aber Eleanor betrachtet sie inzwischen als die Relikte eines »psychischen Bürgerkriegs«9, der von wiederholten Kindheitstraumata herrühre.
Es hat den Anschein, als könnten viele Menschen, wenn sie angemessene Unterstützung erhalten, das Verhältnis zu ihren Stimmen verändern und lernen, recht gut mit ihnen zu leben. Die Ansicht, dass Stimmen immer ein Zeichen einer ernsten geistigen Erkrankung sind, ist einschränkend und abträglich, weshalb ich den neutraleren Begriff Stimmenhören den negativen Konnotationen der Bezeichnung Halluzination vorziehe.10
Falls die Erfahrungen von Jay und Eleanor sich tatsächlich von meinen eigenen inneren Stimmen unterscheiden, dann stellt sich die Frage: Wie genau unterscheiden sie sich? Meine »Stimmen« haben häufig einen Akzent und eine Tonhöhe. Sie sind privat und nur für mich hörbar, und dennoch klingen sie häufig wie reale Personen. Doch auf einer bestimmten Ebene erkenne ich die Stimmen in meinem Kopf als meine eigenen, während Jay die seinen fremd zu sein scheinen. Er sagt, dass er gewöhnlich zwischen seinen Gedanken, die sich anfühlen, als wären sie seine eigenen Schöpfungen, und diesen anderen Erfahrungen unterscheiden kann, die von woanders zu kommen scheinen. Bei anderen Gelegenheiten ist die Unterscheidung deutlich verschwommener.
Ein weiterer Stimmenhörer, Adam, dessen Hauptstimme eine sehr klare, autoritäre Persönlichkeit besitzt (so sehr, dass Adam ihr den Spitznamen »der Captain« gegeben hat), erzählte mir, dass er trotzdem manchmal in Verwirrung geraten kann, ob es sich gerade um seine eigenen Gedanken oder um diejenigen seiner Stimme handelt. Ich habe erlebt, dass Stimmenhörer den Beginn ihrer ungewöhnlichen Erfahrungen beschrieben, als habe man einen Soundtrack eingeschaltet, der schon immer da gewesen sei, und als stelle er ein Hintergrundgeräusch des Bewusstseins dar, dem der Betroffene aus irgendeinem Grund auf einmal Aufmerksamkeit schenke.
Eine Ursache, weshalb Stimmenhörer ihre Erfahrungen einem äußeren Akteur zuschreiben, ist die Tatsache, dass die Stimmen Dinge sagen, die der Hörende meint, selbst niemals gesagt haben zu können. Eine Frau erzählte mir, ihre Stimme sage so schreckliche und widerliche Dinge, dass sie wisse, sie könnten unmöglich von ihr stammen.
Aber es kann auch genau umgekehrt sein. Ich habe Stimmenhörer über etwas, was ihre Stimme ihnen gerade ganz im Geheimen gesagt hatte, laut loslachen hören. Eine andere Stimmenhörerin erklärte mir, weshalb sie wisse, dass ihre witzelnde innere Stimme nicht »sie selbst« sein konnte: »Ich kann es nicht sein. Mir selbst würde niemals etwas so Lustiges einfallen.«
Es ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen besser verstehen lernen. Bei meinen sprachlichen Gedanken und den Stimmen, die Stimmenhörer vernehmen, kann es sich um ganz unterschiedliche Erfahrungen handeln, doch sie können wichtige Merkmale gemein haben. Auf einer bestimmten Ebene könnte es sich sogar um das Gleiche handeln. Wie immer in der Wissenschaft der menschlichen Erfahrung sind die Dinge komplizierter, als sie zunächst erscheinen. Es ist wichtig, nicht von der Annahme auszugehen, dass eine Art von Stimme die andere abwertet. In Wahrheit sollten wir uns vor der Mutmaßung hüten, dass irgendwas etwas anderes abwerten soll. Menschen machen diese Erfahrungen, und Menschen sind verschieden (ich kann zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass meine eigenen Selbstgespräche auch nur im Entferntesten den Ihren ähnlich sind).
In diesem Buch interessiere ich mich für all diese Stimmen: die freundlichen, die richtungweisenden, die ermunternden und gebieterischen, die Stimmen der Moral und Erinnerung und die manchmal schrecklichen, manchmal wohltuenden Stimmen derjenigen, die andere sprechen hören, obwohl niemand in der Nähe ist.
Als ich in den 1990er-Jahren nach Abschluss meines Studiums anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, wirkte es nicht wie ein empfehlenswerter Forschungsgegenstand. Meine Vorgesetzten hätten mich warnen können, dass die Untersuchung von etwas so Privatem und Unbeschreiblichem wie unsere inneren Stimmen wohl kaum den Grundstein für eine erfolgreiche Forscherkarriere legen würde. Erstens hatte es den Anschein, als sei sie von einer fast unmöglichen Aufgabe der Introspektion abhängig (des Nachdenkens über die eigenen Gedankenprozesse), die als wissenschaftliche Methode schon lange in Ungnade gefallen war. Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Vorstellung von einer »inneren Stimme« häufig vage und metaphorisch mit Bezug auf alles genutzt wird, vom Bauchgefühl bis hin zum schöpferischen Instinkt, ohne ernsthaft den Versuch einer klaren Definition zu unternehmen, die ja Voraussetzung für eine fundierte Untersuchung ist.
Es gab allerdings gute Gründe, an diesem Projekt festzuhalten, und in den letzten Jahren hat sich der Stand der Wissenschaft tief greifend verändert. Eines hat diese Forschung jedenfalls hervorgebracht, nämlich die Erkenntnis, dass die Wörter, die in unserem Kopf widerhallen, bei unserem Denken eine wichtige Rolle spielen. Psychologen demonstrieren, dass die innere Sprache, wie sie es nennen, uns hilft, unser Verhalten zu regulieren, uns zum Handeln zu motivieren, unsere Taten zu bewerten und uns unseres eigenen Selbst bewusst zu werden. Neurowissenschaftler belegen, dass innere Stimmen sich einiger der gleichen neuralen Systeme bedienen, die für das externe Sprechen verantwortlich sind, was mit wichtigen Konzepten ihrer Entstehung übereinstimmt.
Inzwischen wissen wir, dass die innere Sprache in unterschiedlichen Formen daherkommt und mit verschiedenen Zungen spricht; dass die Stimme einen Akzent und einen emotionalen Tonfall besitzt und dass wir ihre Fehler in etwa auf die gleiche Weise wie normale Versprecher korrigieren. Viele von uns denken tatsächlich in Wörtern, und es gibt gute und schlechte Formen bei dieser Art von Denken. Negative, von der inneren Sprache fortgesetzte Gedanken tragen zu dem von gewissen mentalen Störungen verursachten Leiden bei, aber sie können auch der Schlüssel zu deren Linderung sein.
Abseits des wissenschaftlichen Labors haben Fragen rund um die innere Sprache die Menschen fasziniert, seit sie über ihre eigenen Gedanken nachdenken. Eine Tatsache können wir über das Denken feststellen, nämlich dass es uns häufig wie eine Art Unterhaltung zwischen verschiedenen Stimmen erscheint, die gegensätzliche Auffassungen vertreten. Aber wie klingen diese Stimmen? Welche Sprache sprechen sie? Spricht Ihr denkendes Selbst in ganzen grammatikalischen Sätzen, oder ist es eher so, als hörten Sie etwas in Notizform Niedergeschriebenes? Sprechen Ihre Gedanken leise, oder erheben sie manchmal die Stimme? Und überhaupt, wer hört zu, wenn Ihr denkendes Selbst spricht? Wo befinden »Sie« sich bei alledem? Solche Fragen mögen seltsam klingen, und dennoch müssen diese Qualitäten des Denkens definieren, wie es ist, mit unserem eigenen Geist zu leben.
All diese Rätsel könnten geklärt werden, wenn wir das Konzept von Denken als Stimme (das für unsere Innenschau so überzeugend ist) beziehungsweise von Stimmen im Kopf ernst nehmen. Ich möchte dieses Konzept erkunden und es bis an seine Grenzen austesten. Dieser Ansatz, den ich als Modell des Dialogischen Denkens bezeichnen möchte, hat auf die ein oder andere Weise einen großen Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Psychologie inspiriert und wird der Schwerpunkt dieses Buchs sein. Es ergibt sich aus einer speziellen Theorie der Entwicklung des Denkens in der frühen Kindheit und wird von psychologischen und neurowissenschaftlichen Untersuchungen der normalen und gestörten Kognition bestätigt. Doch es ist ungeachtet der Tatsache, wie viele Beweise für das Modell vorliegen, klar, dass es viele Aspekte unserer inneren Erfahrungen gibt, die nicht verbal und stimmenähnlich sind, und ich werde untersuchen, ob die Hypothese aufgestellt und auch auf das Denken von Menschen angewendet werden kann, die keine Sprache haben, um damit zu denken, aber auch jene Belege berücksichtigen, dass ein großer Teil unseres inneren Erlebens visuell ist und auf Bildern basiert.
Ich habe das Glück, mich auf ein sehr breites Spektrum von Beweisen stützen zu können. Einige Aspekte des Rätsels rund um die inneren Stimmen fanden seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden Beachtung. Philosophen haben mit den schwierigen Problemen hinsichtlich der Frage gekämpft, wie der Geist Wissen darstellen kann. Und sie haben von Prinzipien geleitete Thesen über die Frage aufgestellt, ob das Denken zum Beispiel in natürlicher Sprache möglich ist. Psychologen haben Untersuchungsteilnehmern Denkaufgaben gestellt und sie aufgefordert, ihre Gedankenprozesse für eine eingehende Analyse laut auszusprechen. Neurowissenschaftler haben die innere Sprache untersucht, indem sie die elektrischen Signale der Sprachmuskulatur von Menschen aufzeichneten, die stumm dachten, oder indem sie Teile des Gehirns stimulierten und verfolgten, wie sich dies auf sprachliche Prozesse auswirkt. Seit Jahrhunderten haben Schriftsteller ihre Romane und Gedichte mit verbalen Gedanken gefüllt, und die Schilderungen ihres Bewusstseinsstroms, ihrer Gedankengänge und gedanklichen Sprünge liefern eine beispiellose Menge an Hinweisen, wie unsere geistigen Stimmen ihre Arbeit verrichten.
In den folgenden Kapiteln werde ich auf all diese Beweisquellen zurückgreifen. Wir werden von kleinen Kindern und von älteren Menschen erfahren, von Sportlern, Schriftstellern, Meditierenden, von bildenden Künstlern und Menschen, die Stimmen hören. Ist es zutreffend, dass kleine Kinder nicht in Wörtern denken? Verschwinden die Stimmen mancher Psychiatriepatienten tatsächlich, wenn sie ihren Mund aufmachen? Ist es möglich, in der inneren Sprache das eine zu denken und zugleich laut das genaue Gegenteil zu sagen? Was geschah im Kopf, Gehirn und Körper der Jeanne d’Arc, als sie eine »schöne, liebliche und leise Stimme« vernahm, die sie ermahnte, die Belagerung von Orléans zu beenden? Wie kommt es, dass die innere Sprache schneller sein kann als das normale Sprechen, ohne dem denkenden Menschen keineswegs gehetzt zu erscheinen? Warum sagen die Stimmen mancher Stimmenhörer so lustige Dinge? Ich werde untersuchen, wie literarische und andere künstlerische Darstellungen des Phänomens mit den Fakten übereinstimmen, die von der wissenschaftlichen Forschung herausgefunden wurden, und wie solch »objektive« Betrachtungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Introspektion abschneiden. Ich werde ein MRT meines Gehirns machen lassen und beobachten, wie es die Gedanken auf seinem Zauberwebstuhl11 hervorbringt. Ich werde die Flüchtigkeit der Stimmen in unserem Kopf beschreiben, aber auch ihre bedeutenderen Bahnen verfolgen. Außerdem werde ich genauer auf die Geschichten mehrerer Menschen eingehen, die Stimmen hören, und herauszufinden versuchen, wie sich das Erlebnis anfühlt, wie man damit umgehen kann und was es über das Wesen des Selbst enthüllt.
Ich hoffe, Sie am Ende dieses Buchs von mehreren Dingen überzeugen zu können. Nämlich dass Selbstgespräche ein Teil der menschlichen Existenz sind und – auch wenn sie keineswegs universell sind – in unserem geistigen Leben viele verschiedene Rollen zu spielen scheinen. Laut einer wichtigen Theorie fungieren die Wörter in unserem Kopf als psychologische »Werkzeuge«, die uns helfen, bei unserem Denken Dinge zu tun, so, wie die Werkzeuge eines Handwerkers Arbeiten ermöglichen, die ansonsten nicht durchgeführt werden könnten. Unsere Selbstgespräche können planen, anweisen, ermutigen, fragen, bedrängen, hindern und reflektieren. Die Menschen, von Kricketspielern bis hin zu Dichtern, führen auf viele verschiedene Arten und mit einer ganzen Reihe sehr unterschiedlicher Absichten Selbstgespräche.
Es leuchtet also ein, dass die Erfahrung viele Formen annimmt. Manchmal scheint die innere Sprache lediglich wie die laut ausgesprochene Sprache zu sein. Bei anderen Gelegenheiten ist sie telegrafischer und komprimierter, eine verkürzte
Version dessen, was wir laut äußern würden. Erst seit Kurzem haben Wissenschaftler begonnen, das Konzept ernst zu nehmen, dass die innere Sprache in verschiedenen Formen daherkommen kann, dass diese verschiedenen Formen der inneren Sprache sich unterschiedlichen Funktionen anpassen können und dass die Varianten des Phänomens auf verschiedene Grundlagen im Gehirn zurückzuführen sind.
Die vielfältigen Formen und Funktionen der inneren Sprache sind absolut sinnvoll, wenn wir betrachten, wie sie sich in der Kindheit entwickelt. Es gibt gute Gründe, davon auszugehen, dass die innere Sprache sich entwickelt, während die Gespräche von Kindern mit anderen Menschen »untertauchen« beziehungsweise verinnerlicht werden, um eine stumme Version dieser externen Gespräche zu bilden. Das bedeutet, dass das Denken, das wir in Worten vornehmen, einige der Eigenschaften der Konversationen annehmen wird, die wir mit anderen Menschen führen und die wiederum durch die Interaktionsstile und sozialen Normen unserer Kultur geprägt sind. In den 1930er-Jahren schrieb der spanische Philosoph und Schriftsteller Miguel de Unamuno: »Denken ist, mit sich selbst zu sprechen, und jeder von uns führt aufgrund der Tatsache, dass wir miteinander sprechen müssen, Selbstgespräche.« Ich werde versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass einige der Geheimnisse der inneren Sprache gelüftet werden, wenn wir erkennen, dass sie die Eigenschaften eines Dialogs besitzt.
Der soziale Ursprung der inneren Sprache hilft uns darüber hinaus, die vertraute Vielstimmigkeit des menschlichen Bewusstseins zu verstehen. Wenn wir anerkennen, dass die innere Sprache eine Art Dialog ist, wird klar, weshalb in unserem Geist viele verschiedene Stimmen auftauchen können, genau wie ein Roman die Stimmen verschiedener Figuren mit verschiedenen Perspektiven enthält. Ich werde darlegen, dass diese Annahme uns hilft, einige wichtige Eigenschaften des menschlichen Bewusstseins zu verstehen, auch die Offenheit für alternative Perspektiven, die eines der Kennzeichen für Kreativität sein könnte. Ich werde dieses Konzept unter Bezugnahme auf die Arbeiten sowohl sprachlicher als auch bildender Künstler untersuchen und erörtern, ob eine wichtige Voraussetzung für Kreativität darin besteht, Selbstgespräche zu führen.
Außerdem möchte ich Sie davon überzeugen, dass diese Auffassung von der inneren Sprache uns hilft, die ungewöhnlicheren Stimmen zu verstehen, die manche Menschen hören. Das Phänomen des Stimmenhörens (beziehungsweise der auditiven verbalen Halluzination) wird gewöhnlich mit Schizophrenie in Verbindung gebracht, tritt aber auch bei vielen anderen psychischen Störungen und bei einer signifikanten Minderheit von geistig gesunden Personen auf. Viele Psychiater und Psychologen sind der Meinung, dass es auf eine Störung der inneren Sprache zurückzuführen ist, durch die die Person dazu veranlasst wird, ihre eigenen inneren Äußerungen fälschlicherweise als Aussagen eines anderen zu interpretieren. Ein Problem besteht darin, dass die Wissenschaft die innere Sprache bis heute als Phänomen nicht ernst genug nimmt. Wenn wir mit einem korrekteren Bild der normalen Stimmen in unserem Kopf beginnen, werden wir am Ende vielleicht besser verstehen, warum manche Menschen Stimmen hören, obwohl niemand in der Nähe ist.
Doch die Chance ist gering, ein solides wissenschaftliches Verständnis dieser Erfahrung zu gewinnen, wenn wir nicht anerkennen, dass auch sie viele verschiedene Formen annimmt. Über die Jahrhunderte hinweg haben die Menschen – von den Mystikern des Mittelalters bis zu den Schöpfern literarischer Fiktion – ihre Erfahrungen mit dem Stimmenhören beschrieben. All diese Erfahrungsberichte müssen im Kontext der Lebensverhältnisse, der Epoche und Kulturen ihrer Entstehung untersucht werden. Das Verständnis für das Stimmenhören setzt voraus, dass wir die sehr starken Beziehungen zwischen dem Stimmenhören und frühen Leiderfahrungen sowie die Folge berücksichtigen, dass das Hören von Stimmen mit Erinnerungen an schreckliche Ereignisse zusammenhängt. Ich werde mit einigen Stimmenhörern sprechen, die der Meinung sind, dass ihre Stimmen als Botschaften aus ihrer Vergangenheit und der ungelösten emotionalen Konflikte verstanden werden sollten, nicht als wertlose Äußerungen eines verwirrten Geistes.
Inzwischen beginnt die Wissenschaft, das Stimmenhören als Phänomen zu verstehen, das von dem Gefühl begleitet ist, mit einer anderen Entität in Verbindung zu treten. Und das hat tief greifende Auswirkungen auf unsere Theorien darüber, wie wir soziale Beziehungen einkalkulieren, sowie auf unser Verständnis der normalen inneren Sprache.
Diese Betrachtungsweise der inneren Stimmen birgt selbstverständlich gewisse Probleme, und für die zukünftige Forschung sind die Wege bestens bereitet. Eine der Herausforderungen bei der Untersuchung der inneren Stimmen ist die Tatsache, dass manche Personen von überhaupt keiner inneren Sprache berichten. Wie funktioniert das Denken in diesen Fällen? Wie kommt es in Gang, wenn keine Sprache vorhanden ist, die es formen kann? Wie verbinden sich die Wörter mit den geistigen Bildern, um die lebhaften, multisensorischen Perspektiven des Denkens zu erzeugen? Es hat den Anschein, als könnten die Stimmen in unserem Kopf sich sowohl positiv als auch negativ auswirken, und die Untersuchung ihrer Entstehung kann aufschlussreich sein im Hinblick auf die Kräfte, die bei der Entstehung unseres Bewusstseins Sprache und Gedanken zusammengefügt haben könnten. Die Auswirkungen sind für alle von uns tief greifend. Könnten wir uns eines Tages zusammentun, um die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, zu verbessern und zu kontrollieren, sodass psychische Erkrankungen der Vergangenheit angehören werden? Können wir uns als Spezies weiterentwickeln und uns von aufdringlichen Gedanken, Irrationalität und Ablenkbarkeit befreien? Möglicherweise, aber dann könnte auch die Kreativität der Vergangenheit angehören.
Doch eines ist sicher, nämlich dass ein besseres Verständnis unserer inneren Stimmen uns mit einer größeren Wertschätzung dafür, wie unser Geist funktioniert, erfüllen und uns klarmachen kann, wie wir mit dem manchmal glücklichen, manchmal lästigen – aber immer flexiblen und kreativen – Gemurmel in unserem Kopf produktiver umgehen können.
KAPITEL 2
DAS GAS AUFDREHEN
Schließen Sie die Augen, und denken Sie. Es spielt keine Rolle, worüber Sie nachdenken: Es kann sich um ein tiefschürfendes oder banales Thema handeln. Halten Sie den Gedanken fest, kosten Sie ihn aus. Spielen Sie ihn in Ihrem Kopf durch. Und jetzt stellen Sie sich eine Frage: Wie war es, diesen Gedanken zu denken? Wir wissen, wie sich bestimmte Arten von geistiger Aktivität anfühlen: das Träumen zum Beispiel oder eine Summe im Kopf auszurechnen. Aber was für eine Aktivität ist das Denken?12 In welchen Varianten kommt es vor? Wie fühlt es sich an, diese normale, aber dennoch absolut bemerkenswerte Leistung zu vollbringen?
Erstens gehe ich nicht davon aus, dass Sie irgendwelche Schwierigkeiten hatten, Ihren Kopf ein oder zwei Sekunden lang zu beschäftigen. (Es wäre deutlich schwieriger gewesen, wenn ich Sie aufgefordert hätte, an nichts zu denken.) Wir denken unentwegt, nicht nur wenn wir Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen haben. Selbst wenn Ihr Gehirn allem Anschein nach eine Pause einlegt, ist Ihr Geist wahrscheinlich alles andere als inaktiv.13 Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, was unsere eigene Innenschau nahelegt: In den meisten unserer wachen Momente werden wir von einem inneren Strom von Gedanken und Eindrücken erfüllt, der unser Handeln steuert, unsere Erinnerungen speichert und den roten Faden unserer Erfahrungen bildet.
Jetzt stellen Sie sich noch ein paar weitere Fragen über den Gedanken, den Sie gerade hatten. Klang es so, als würde eine andere Person sprechen? Falls ja, waren »Sie« diese Person? Fühlte er sich wie irgendetwas an, oder war er nur das Nebenprodukt eines aktiven Gehirns, ohne überragende Qualitäten, die ihn von anderen Gedanken unterscheiden würden? Würden Sie den Gedanken wiedererkennen, wenn er erneut auftauchen sollte? Woher wissen Sie, dass er Ihr eigener war?
Ich bin der Meinung, dass all diese Fragen sinnvoll sind, aber dass man sie nur sehr schwer beantworten kann. Wir haben einen einzigartigen direkten Zugang zu unseren eigenen Gedanken, aber nur zu unseren eigenen. Das führt dazu, dass sie nur sehr schwer untersucht werden können. Es ist vor allem schwierig, sicher zu sein, dass Sie Ihre Erfahrungen verlässlich bewerten, weil Sie Ihre Einschätzungen nicht mit denjenigen anderer Menschen vergleichen können. Im vorherigen Kapitel habe ich einige Gründe für die Annahme aufgeführt, dass die innere Erfahrung vieler Menschen mit jeder Menge Wörtern einhergeht. Aber ist das wirklich der Fall? Wie können wir diese Frage beantworten – und was bedeutet diese Frage überhaupt, wenn es darum geht, nach unserer Innenwelt zu fragen? Wie können wir vorgehen, um den Inhalt unseres Kopfes zu untersuchen?
Der naheliegende Ansatz ist der Versuch, den direkten Zugang zu unserer eigenen Erfahrung zu nutzen. »Warum«, fragt der Philosoph Sokrates in Platons Theaitetos, »sollten wir nicht ruhig und beharrlich unsere eigenen Gedanken prüfen und erwägen, was diese Erscheinungen in uns tatsächlich sind?« Der französische Philosoph René Descartes hatte im 17. Jahrhundert mit dieser Vorstellung keine Probleme. Als er in seinem Winterschlafrock neben dem im Kamin brennenden Feuer saß, befasste er sich mit seinen eigenen Gedankenprozessen und erkannte, dass ihre Existenz das Einzige war, was er nicht infrage stellen konnte. Cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. Die Reflexion über seine eigenen geistigen Zustände war das »erste Prinzip« der kartesischen Methode. Der amerikanische Philosoph und Psychologe William James schrieb im Jahr 1890, dass die Existenz von Bewusstseinszuständen zwar unbestreitbar, sie in uns selbst zu beobachten, aber »schwierig und fehlbar«14 sei. Doch diese Art von Beobachtung sei dennoch möglich. Sie unterscheide sich im Prinzip nicht von jeder anderen Methode, die Welt zu beschreiben. Wenn der Mensch angeleitet werde, sorgfältig vorzugehen, könne er dazu gebracht werden, es besser zu machen.
Es war das Werk des deutschen Psychologen Wilhelm Wundt, das die Innenschau aus dem Philosophensessel ins wissenschaftliche Labor verlagerte. Wundt war der Gründer des ersten wissenschaftlichen psychologischen Labors, 1879 in Leipzig eingerichtet, aber er erlangte auch als Autor des ersten psychologischen Lehrbuchs Berühmtheit.
Wundt unterschied bei seinen Überlegungen über innere Erlebnisse zwischen zwei Arten der Introspektion.15 Zunächst gebe es das, was er als Selbstbeobachtung bezeichnete: jene Art von beiläufiger Beobachtung der eigenen geistigen Prozesse, die jeder Mensch in Angriff nehmen kann. Man braucht kein Descartes zu sein, um am Kamin zu sitzen und über die eigenen Gedanken nachzudenken. Aber es stellt sich die Frage, ob das wissenschaftlich fundiert ist?
Etwas ganz anderes war für Wundt die formalere Kategorie der inneren Wahrnehmung. Die wissenschaftliche Methodik verlangt, dass der Beobachter versucht, sich, wann immer möglich, aus dem Prozess der Beobachtung herauszuhalten, und dies hatte Wundt bei seinem zweiten Ansatz im Sinn, der eine gewissenhafte Trennung des Beobachters vom beobachteten Objekt voraussetzte. Bei Wundts Technik der inneren Wahrnehmung nahm der Wissenschaftler tatsächlich eine klinisch distanzierte Haltung seinen eigenen Gedanken gegenüber ein. Die innere Wahrnehmung war laut Wundt keine solide wissenschaftliche Methode. Doch sie könne nach einer gründlichen Ausbildung der Teilnehmer eine solche werden.
Und Wundt bildete seine Teilnehmer aus. Kritiker der Innenschau vermittelten gelegentlich den Eindruck, dass es sich bei der Leipziger Introspektion um eine ziemlich legere – in Wahrheit kartesische – Reflektion im Lehnstuhl über die eigenen geistigen Prozesse handele. Aber Wundts Selbstbeobachter waren ausgebildete Fachkräfte. Es wurde berichtet, dass ein Mitglied von Wundts Labor nicht weniger als 10.000 introspektive »Erscheinungen«16 gehabt haben musste, um Daten für Forschungsveröffentlichungen beitragen zu dürfen.
Bei der Analyse von William James unterschied sich die Introspektion nicht von jeder anderen Art der Beobachtung; sie konnte gut oder schlecht durchgeführt werden. Man musste eben lernen, es gut zu machen. Nur die Erfahrung zu haben reichte nicht aus, um zu garantieren, dass man irgendeine Fähigkeit besaß, um diese Erfahrung zu beobachten oder zu beschreiben. Andernfalls, so stellte James fest, wären Babys ausgezeichnete Selbstbeobachter.17
Wundts Bemühungen führten zu einer neuen Methodik für die Untersuchung innerer Erfahrungen, die schließlich über den Atlantik nach Amerika gelangte. In den Händen von Wundts Anhängern, wie zum Beispiel Edward B. Titchener, wurde die introspektive Methode begrenzter und mechanistischer, und ihre Schwächen – insbesondere ihre Abhängigkeit von einer nicht nachweisbaren Selbstbeobachtung – gerieten deutlicher in den Fokus.
Mitte des 20. Jahrhunderts stand die anglo-amerikanische Psychologie ganz im Bann der behavioristischen Theorien von John B. Watson und Burrhus F. Skinner und deren Behauptung, dass nur die Messung beobachtbaren Verhaltens eine solide Erforschung des Geistes garantieren könne. Die Selbstbeobachtung schien bereits der Vergangenheit anzugehören. Ein von William James angesprochenes Problem bestand darin, dass Introspektionen immer bis zu einem gewissen Grad Erinnerungen an Erfahrungen waren, nicht etwa die Erfahrungen selbst – und Erinnerungen sind bekanntermaßen mit Fehlern behaftet. Vor allem wurde man sich zunehmend bewusst, dass Erfahrungen nicht beschrieben werden konnten, ohne durch den Akt der Beobachtung selbst verändert zu werden. Der Versuch, über die eigenen Gedanken zu reflektieren, sei, mit den denkwürdigen Worten von James, als »würde man versuchen, das Gas [der Lampe] schnell genug aufzudrehen, um zu sehen, wie die Dunkelheit aussieht«18.
Für viele war die kognitive Revolution, die in den 1950er-Jahren begann und in den folgenden zwei Jahrzehnten an Fahrt gewann, der letzte Sargnagel der Selbstbeobachtung.19 Richard Nisbett und Timothy Wilson überprüften 1977 die Beweislage bezüglich der Korrektheit der Berichte von Menschen über ihre komplizierteren kognitiven Prozesse. Eines der Experimente, die sie unter die Lupe nahmen, war mit Menschen durchgeführt worden, die an Schlafproblemen gelitten hatten. Einigen der Teilnehmer wurde eine »anregende« Tablette verabreicht, ein Placebo, von dem es hieß, es würde die körperlichen und emotionalen Symptome von Schlaflosigkeit hervorrufen, in Wahrheit jedoch keine physiologische Wirkung hatte. Einer anderen Gruppe wurde mitgeteilt, ihre Tabletten (ebenfalls wirkstofffrei) würden sie entspannen. In beiden Fällen enthielten die Tabletten keinerlei aktive Wirkstoffe, aber die Erwartungen der Untersuchungsteilnehmer gegenüber deren Wirkung wurden manipuliert, sodass die Ergebnisse ganz unterschiedlich ausfielen.20
Die Forscher beobachteten, wie jede Gruppe mit ihrer Schlaflosigkeit umging. Wie erwartet, schliefen diejenigen Teilnehmer, denen gesagt worden war, ihre Tabletten würden sie wach halten, schneller ein als gewöhnlich, weil sie ihre erhöhte Wachheit der Wirkung der Tabletten statt ihrer eigenen Schlaflosigkeit zuschrieben. Bei der Gruppe mit den entspannenden Tabletten wurde das Gegenteil beobachtet. Die Teilnehmer dieser Gruppe brauchten tatsächlich länger, um einschlafen zu können. Vermutlich weil sie davon ausgingen, entspannt zu sein, sich aber ganz anders fühlten, was sie zu der Schlussfolgerung veranlasste, dass sie noch aufgedrehter sein mussten als gewöhnlich.
Doch bei der anschließenden Befragung zeigten die Teilnehmer sehr geringe Einsicht in die psychologische Wirkung der Tabletten und führten die Veränderung ihres Schlafmusters stattdessen auf äußere Faktoren zurück, wie zum Beispiel auf ihr Abschneiden bei einer Prüfung oder auf Probleme mit der Freundin.
Nisbett und Wilson gelangten zu dem Schluss, dass es wenig Sinn hatte, Untersuchungsteilnehmer aufzufordern, ihre eigenen kognitiven Prozesse zu erklären. Trotz der vielen sorgfältigen Beobachtungen der Anhänger der Introspektion ist festzustellen, dass wir erstaunlich wenig wissen, wie unser eigener Geist tatsächlich funktioniert.
Es ist ein schwüler Julitag in Berlin, und Lara überlegt sich, ob sie noch ein Bier trinken soll.
»Ich stellte die leere Flasche ab, und es war, als würde ich denken: Will ich noch eines? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Wörter dachte. Und in diesem Moment war der Piepston zu hören.«
Lara ist eine junge Amerikanerin chinesischer Abstammung aus Los Angeles, die ein Studienjahr in Berlin absolviert. Sie nimmt an einem Experiment teil, für das sie ein kleines Gerät an ihrer Kleidung befestigt bei sich trägt (etwa von der Größe einer Tonkassette). In Zufallsintervallen schaltet sich das Gerät ein und gibt durch einen Ohrstecker ein piepsendes Geräusch ab. Das ist für sie das Signal, darauf zu achten, welche Erfahrung sie in dem Augenblick unmittelbar vor dem Piepsen gemacht hat. Dann muss sie sich in irgendeiner Form, die ihr günstig erscheint, auf einem ihr zu diesem Zweck ausgehändigten Notepad Notizen über den Augenblick der Erfahrung machen. Das tut sie, bis sie Notizen über sechs Signaltöne und sechs Momente der Wahrnehmung gesammelt hat, dann darf sie den Ohrstecker herausnehmen und weglegen.
Am folgenden Tag kommt sie ins Labor und wird ausführlich über diese sechs Augenblicke befragt. Der Vorfall mit dem Bier betraf das dritte Piepsen am ersten Tag ihrer Teilnahme an diesem Experiment. Über diese Bewusstseinsmomente wird sie von Russell T. Hurlburt befragt, dem Entwickler der Methode.
»Genau mit diesen Wörtern?«, fragt Russ.
»Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das meine genauen Wörter waren, weil ich sie mir nicht genau notiert habe … Ich erinnere mich an diesen Augenblick und an das Gefühl, kühles Bier zu trinken, und dass ich es wirklich genossen und mich gefragt habe: Will ich noch eines?«
»Also eine erinnerte Empfindung, ein Bier zu trinken?«
»Ja, und der Gedanke: Will ich mehr von dieser Erfahrung?«
Russ fragt, ob sie noch ein Bier wollte, oder ging es vielmehr um die Erinnerung, das kühle Bier eben genossen zu haben?
»Ich denke, es geht definitiv um beides, weil ich mir diese Frage gestellt habe und anfing, mich daran zu erinnern, um diese Frage zu beantworten, vermute ich.«
Was waren in diesem Augenblick ihre genauen Worte bei diesem Erlebnis? Lara kann sich nicht erinnern. Russ sagt, dass sie sich in Zukunft diese Wörter schnell notieren soll, weil es auf die genauen Wörter ankommt. Wenn wir herausfinden wollen, wie wir in unserem Kopf mit uns selbst sprechen (neben den vielen anderen Dingen, die sich dort abspielen), kommt es auf den genauen Wortlaut an.
»Und hörst du diese Wörter mit einer Stimme?«, fährt Russ fort. »Oder liest du sie, oder siehst du sie, oder …?
»Ja, sie haben eine Stimme, und das ist meine eigene Stimme.«
»Okay. Und ist diese Stimme so, als würdest du die Wörter aussprechen oder als würdest du sie hören oder …«
»Hm, ich denke, es ist, als würde ich sie aussprechen? Aber ich sage sie zu mir selbst, so, als würde jemand eine Frage stellen. Die Sache ist die, dass ich, während ich diese Fragen beantworte, einfach beunruhigt bin, dass sich das, was ich über diese Augenblicke berichte, verändern könnte, weil ich gründlicher darüber nachdenke, verstehen Sie?«
Hurlburt ist einer jener Wissenschaftler, die die Introspektion neu durchdenken.21 Er, ein großer Mann Ende sechzig mit grauen Haaren und einer Brille, begann sein Berufsleben als Ingenieur und arbeitete für eine Firma, die Atomwaffen herstellte. Eigentlich wäre er gern Trompeter geworden. Es war zur Zeit des Vietnamkriegs, und Russ erhielt eine Einberufungsnummer, die mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hätte, dass er tatsächlich einberufen worden wäre, deshalb trat er freiwillig der Armeeband in Washington, D. C. bei. Dort fand sein Können als Trompetenspieler einen Einsatz, der einen indirekten und folgenreichen Einfluss auf seine spätere Karriere haben sollte. Er bekam nämlich die Aufgabe zugewiesen, den »Taps« (Zapfenstreich) zu spielen, jene zeremonielle Melodie, die bei Militärbegräbnissen gespielt wird. Seine Aufgabe bestand darin, am Nationalfriedhof Arlington zu warten, bis der Sarg ankam und die Gewehrsalven abgefeuert wurden, um dann den »Taps« über dem Sarg des armen in Vietnam Gefallenen zu spielen. Dann zog er sich diskret in sein Auto zurück, das er unter einem nahen Baum abgestellt hatte, um – noch immer in voller militärischer Montur – auf die nächste Beerdigung zu warten, die frühestens zwei Stunden später stattfand. Somit hatte er jede Menge Zeit, die er nutzte, um sein Auto mit Büchern aus der Bezirksbibliothek von Arlington zu füllen. Er las alles, was Ingenieure aus Zeitgründen gewöhnlich nicht lesen können: Literatur, Poesie, Bücher über die Geschichte und vor allem über die Psychologie. Innerhalb weniger Monate hatte er den gesamten Bestand der Bibliothek zum Thema Psychologie gelesen.
»Dabei habe ich herausgefunden, dass jedes Buch über Psychologie mit der Aussage beginnt: ›Ich werde Ihnen etwas Interessantes über die Menschen berichten‹, und wenn ich dann am Ende des Buchs angelangt bin, sage ich mir: Na ja, ich habe nichts erfahren, was ich für wirklich sehr interessant halte. Ich habe etwas über die Theorie gelernt, aber nichts über die Person.« Denn Russ wünschte sich, etwas über die Alltagserlebnisse der Menschen zu erfahren. »Ich dachte mir, wenn man über diese Dinge bloß Stichproben machen könnte, das wäre gut … Ich fuhr mit dem Truck durch die Wüste oder die ebenen Außenbezirke irgendeiner Stadt und sagte mir: Ich weiß, wie man einen Signaltongeber baut. Als ich bei der Universität von South Dakota ankam, an der ich mein Aufbaustudium absolvieren wollte, sagte der Direktor zu mir: ›Was möchten Sie machen, Russ?‹ Und ich antwortete: ›Ich möchte Stichproben von Gedanken sammeln, und auf dem Weg hierher habe ich herausgefunden, wie ich es machen kann.‹ Der Studienberater war von Russ‹ Idee beeindruckt, aber er war der Meinung, dass die Sache mit dem Signaltongeber technisch nicht durchführbar sei. Deshalb schlug er Russ einen Deal vor: Sollte Russ tatsächlich in der Lage sein, den Piepser zu bauen, würde er die Voraussetzung, dass Russ den Master in Psychologie erwerben müsste (er hatte bereits den Master in Ingenieurswissenschaft) in seinem Fall nicht anwenden und ihm gestatten, gleich das Promotionsprogramm zu absolvieren.
Im Herbst 1973 baute Russ den Piepser und gewann seine Wette. Er begann, sein neues technisches Gerät einzusetzen, und versuchte, die Gedanken seiner Untersuchungsteilnehmer zu erforschen, zunächst durch kurze Befragungen und die komplexen statistischen Analysen, die notwendig sind, damit der so gewonnene Berg an Daten Sinn ergibt. Schließlich wurde ihm klar, dass diese Methode nichts Interessanteres über die Gedanken oder die Menschen hervorgebracht hatte als die der Forscher, die er zuvor kritisiert hatte. Deshalb begann er, sich mehr auf die Qualität der Berichte zu konzentrieren: Auf die Beschreibungen der Gedankenprozesse seiner Teilnehmer und was diese für die jeweilige Person charakteristisch machte.
Seit nahezu vierzig Jahren ist Russ nun schon Fakultätsmitglied an der Universität von Nevada, Las Vegas (UNLV). Er hat seine Karriere der Verfeinerung und dem Testen seiner Methode für die Untersuchung des inneren Erlebens gewidmet, die er Descriptive Experience Sampling (DES) nennt.22 Als er an der UNLV anfing, trug er den DES-Piepser selbst ein ganzes Jahr lang, um herauszufinden, wie er anzuwenden ist. Aufgrund des unübersehbaren Ohrsteckers gingen seine Kollegen auf dem Campus davon aus, dass er schwerhörig sei, allerdings waren viele zu höflich, um ihn danach zu fragen. Bis heute neigen einige Leute auf dem Campus dazu, in seiner Gegenwart lauter zu sprechen.
Für Lara beginnt der Prozess genau an diesem Tag. Am ersten Tag kann sie ihre DES-Momente nicht gut beschreiben, weil das am ersten Tag niemandem gelingt. Russ erklärt, dass die Menschen ihre eigene Erfahrung in der Regel so schlecht beschreiben können, dass die Berichte des ersten Tages allesamt unbrauchbar sind. Aber Lara wird es immer besser machen. Bei der DES handelt es sich um einen iterativen Prozess, wie Russ ihn bezeichnet: Es geht darum, den Probanden und den Interviewer zu trainieren, um die »einzigartige innere Erfahrung des Subjekts mit zunehmender Genauigkeit« beschreiben zu können. Das gelingt nicht ohne Training und ohne die Bereitschaft, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Russ stellt fest, dass es den Menschen in der Regel besser gelingt, ihre Erlebnisse zu verbergen, als sie korrekt zu beschreiben.
Außerdem ist er der Meinung, dass die DES-Methode viele der Probleme umgeht, mit der das Unterfangen der Introspektion verbunden war. Zum einen hat Russ als Forscher kein anderes Ziel, als die Phänomene während ihres Auftretens zu erkunden, worum es sich auch immer handeln mag. Weder geht er die DES-Befragung mit einer Theorie befrachtet an noch steckt die DES ihre Interessenskategorien von vornherein ab, obwohl mit ihrer Hilfe festgestellt wurde, dass bestimmte Arten von Erfahrungen immer wieder auftauchen: Bildsprache, Körperempfindungen und innere Sprache. Russ Hurlburt bezeichnet letztere als »inneres Sprechen«, um den aktiven Charakter hervorzuheben. Aber er ist an der inneren Sprache nicht besonders interessiert, jedenfalls weniger als ich – eine Tatsache, die mich wahrscheinlich zu einem alles andere als idealen Nutzer dieser Methode macht.
Die DES ist vor allem von einer philosophischen Methode inspiriert, die als Phänomenologie bekannt ist. Phänomenologie bedeutet wörtlich die Erscheinungslehre, und durch ein kurioses Paradox war sie eine der Kräfte der Philosophie im 20. Jahrhundert, die zum Niedergang der Introspektion beitrug.
Als Russ mit den quantitativen Ergebnissen, die er durch den Piepser erhielt, unzufrieden war, beschäftigte er sich mit den Werken von Husserl und Heidegger und brachte sich selbst Deutsch bei, um ihre Schriften gründlicher studieren zu können. Für Russ besteht die wichtigste Lektion der Phänomenologie in dem, was als die »Einklammerung aller Vorurteile« bekannt ist: die Fähigkeit des Forschers, die eigenen vorgefassten Meinungen, wie die Dinge sein werden, beiseitezulassen und zu beobachten, wie sie tatsächlich sind. Will man herausfinden, was sich im Kopf eines anderen Menschen abspielt, sollte man nicht vor Beginn der Untersuchung mutmaßen, dass man es bereits wisse. Dies gilt insbesondere für die Untersuchung eines speziellen Phänomens wie der inneren Sprache. Wenn man zu Beginn davon ausgeht, dass die Menschen die ganze Zeit mit sich selbst sprechen, werden die Daten diese vorgefasste Meinung höchstwahrscheinlich wiedergeben.
Trotz der vielen Jahre, die Russ an der DES gearbeitet hat, betrachtet er die Methode nicht als perfekt. Zum einen sind die DES-Berichte stets durch die Erinnerung gefiltert – ein Problem, das William James bereits 1890 vorhersah –, und die Augenblicke des Bewusstseins werden nach dem Ereignis rekonstruiert. Das sind zwei der Gründe, weshalb Russ an den Details von Laras Gedanken über das Bier so interessiert ist. Sie hat festgestellt, dass sie sich unsicher war, was sie genau gedacht hat; es hat den Anschein, als führe der Prozess des intensiven Nachdenkens über die Erfahrung dazu, dass den Probanden Zweifel beschleichen. Das ist ganz normal, stellt Russ fest. »Wir machen den Job so gut, wie wir können«, versichert er ihr. »Wir erwarten nicht von dir, dass du perfekt bist, weil wir das für unmöglich halten. Wir wollen lediglich versuchen, es gut zu machen.«
Ich frage Lara nach den Wörtern, aus denen der Gedanke bestand. War es: Will ich noch ein BIER haben? Oder: Will ichnoch EINES? »Ich würde sagen, eines«, antwortet Lara, »definitiv eines.« Das sind die Arten von Details, mit denen wir uns in den folgenden Wochen beschäftigen werden. Lara beschließt, sich im Augenblick, in dem das Piepen ertönt, mehr Notizen zu machen und genauere Angaben über die Momente des Bewusstseins, die sie beschreibt, zu liefern. Lara ist eine unserer ersten Studienteilnehmerinnen, sie ist intelligent und engagiert, beflissen, es zu probieren und zu versuchen, dass es funktioniert. Man kann sich auf so etwas nicht beiläufig oder halbherzig einlassen. Dafür bedeutet es zu viel Arbeit. Für Lara sind die Augenblicke, die sie beschreiben soll, so flüchtig, so fern dessen, was sie normalerweise als Fokus ihrer Gedanken betrachten würde, dass es ihr schwerfällt, darüber zu sprechen. »Weißt du, so, wie wenn man nach einem Traum aufwacht und ihn dann sofort vergisst? So ist das.« Russ ermuntert sie, am Ball zu bleiben. Es wird mit der Zeit einfacher werden. Es wird nie perfekt sein, aber so nahe an »perfekt« heranreichen, wie es die Wissenschaft aktuell vermag.
An diesem Abend kehre ich in mein Hotel zurück und übertrage die Notizen der Befragung. Ein Gewitter geht über Dahlem nieder, das grüne Stadtviertel, in dem sich das Max Planck Institut für Bildungsforschung befindet und in dem wir die Studie durchführen. Jenseits meiner Tätigkeit als Schriftsteller habe ich noch nie so viel Zeit damit verbracht, über die Details der Erlebnisse anderer Menschen nachzugrübeln. Ich schicke die Notizen per E-Mail an Russ, und er antwortet sofort und weist mich auf Fehler hin, die ich gemacht habe, auf Stellen, bei denen meine Erwartungen, wie Laras Erfahrung sein sollte, einer korrekten Wiedergabe im Weg standen. Die Einklammerung aller Vorurteile ist der Dreh- und Angelpunkt. Man muss lernen, diese detaillierten Berichte über die eigenen Erfahrungen zu erstellen, und man muss darüber hinaus lernen, wie man mit denen umzugehen hat, die andere Menschen einem liefern.
Das klingt nach sehr viel Arbeit, allerdings steht auch viel auf dem Spiel. Die Kritiker der Introspektion sind nicht verstummt. Ein Behaviorist könnte behaupten, dass es zu fehlerbehaftet, zu unwissenschaftlich ist, in den Kopf anderer zu spähen, und dass wir Gedanken und Gefühle insgesamt umgehen und uns stattdessen mit Ereignissen befassen sollten, von denen wir »objektiv« berichten können. Ein Anhänger der Introspektion würde darauf antworten, dass eine Wissenschaft des Geistes, die dem subjektiven Erleben keine Beachtung schenkt, inhaltsleer und bedeutungslos ist und weit hinter dem zurückbleibt, was die Wissenschaft eigentlich leisten soll.
Dieses Problem scheint durch die Entwicklung neuer Techniken, mit denen man in das Gehirn blicken kann, noch verschärft zu werden. Das Gebiet der kognitiven Neurowissenschaft, die Methoden der Psychologie mit Techniken zur Untersuchung neuraler Systeme (mithilfe von Bildgebung, elektrischer Stimulation oder der Untersuchung von Gehirnschädigungen) kombiniert, hat in vielen Bereichen begonnen, ihr Versprechen einer einheitlichen Erforschung von Gehirn und Geist einzuhalten. Dennoch wissen wir noch immer nicht, was darin vor sich geht. Menschen können die Aktivierung ihres visuellen Kortex oder die Modulation der Amygdala durch Hippocampusaktivität nicht spüren: Sie erleben visuelle Bilder und emotionale Erinnerungen. Wenn wir uns eine integrierte Wissenschaft des Geistes wünschen, brauchen wir eine Möglichkeit, um an diese Erfahrungen heranzukommen. Wir brauchen die DES oder etwas Ähnliches.
Abgesehen davon stellt sich heraus, dass die Kritik an der Introspektion, die Nisbett und Wilson zugeschrieben wird, am Ziel ziemlich vorbeigeht. Man erinnere sich, dass ihre Abhandlung von 1977 viele Beispiele von Menschen enthielt, die nicht in der Lage waren, verlässlich zu beantworten, weshalb sie bestimmte Entscheidungen getroffen hatten. Menschen können tatsächlich sehr schlecht darin sein, die Gründe für ihr Verhalten zu benennen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht gut darin werden können, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Tatsächlich haben Nisbett und Wilson nach der Überprüfung vorhandener Studien die Tür für zukünftige Methoden offen gelassen, die die Aufgabe angehen könnten, mit ausreichender Sorgfalt Daten über das innere Erleben zu sammeln.
»Die Studien reichen nicht aus«, schrieben sie, »um zu beweisen, dass die Menschen über die damit verbundenen Prozesse niemals korrekt berichten können.«23 Wäre eine Methode in der Lage, einen Erlebnismoment in den Vordergrund zu rücken, ohne ihn zu stören, und sicherzustellen, dass die Teilnehmer sorgfältig darauf achten, was in diesem Moment in ihrem Kopf vor sich geht, und könnte sie außerdem dazu beitragen, dass sie im Nachdenken über dieses Erlebnis besser werden, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Für Hurlburt ist das eine recht gute Beschreibung der DES.
Doch auch diese Methode hat ihre Kritiker.24 Kognitionswissenschaftler bemängeln, dass die DES umständlich und mühsam und dass es darüber hinaus unmöglich sei, von einem einzelnen DES-Teilnehmer auf irgendetwas, was ein bedeutsamer Teil der psychologischen Theorie sein könnte, zu verallgemeinern. Philosophen argumentieren, dass Hurlburt sich zu sicher ist, seine eigenen Mutmaßungen über Erfahrungen ausklammern oder vermeiden zu können, und dass er durch seine Befragung die Prozesse, die er zu beschreiben hofft, beeinflusst. Russ reagiert darauf, indem er hervorhebt, dass man, will man seine Methode ernst nehmen, akzeptieren





























