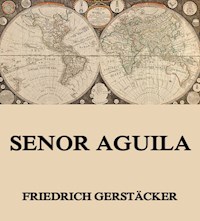
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein peruanisches Lebensbild. Friedrich Gerstäcker war ein deutscher Schriftsteller. Er ist vor allem durch seine Bücher und Reiseerzählungen über Nordamerika bekannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Señor Aguila
Friedrich Gerstäcker
Inhalt:
Friedrich Gerstäcker – Biografie und Bibliografie
Señor Aguila
In der Südsee
Der Kulihandel
An Bord des Guayaquil-Dampfers
Einige Überraschungen
Der Ritt nach den Hacienden
Die alte Pascua
Juanita
Präsident Castilla
Lydia
Fremde in Peru
Señor Perteña
Der Besuch
General Granero
Die Posada am Wege
Der Hinterhalt
Calle de Valladolid
Die Audienz
Die italienische Restauration
Verschiedene Beratungen
Im Karneval
Der Überfall
Der Polizeibesuch
Nach dem Karneval
Die Verschwörung
Der Handstreich
Ein neues Verbrechen
Das Negerdorf
Vorbereitungen
Die Diebeshöhle
Das französische Protektorat
Felipe
Der Arriero
Die Tertulia
Lydia und Juanita
Unter Palmen
Des Cholos Rache
Das Nachtquartier
Schluß
Senor Aguila, F. Gerstäcker
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849615635
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Gerstäcker – Biografie und Bibliografie
Roman- und Reiseschriftsteller, geb. 10. Mai 1816 in Hamburg, gest. 31. Mai 1872 in Braunschweig, Sohn eines seinerzeit beliebten Opernsängers, kam nach dessen frühzeitigem Tode (1825) zu Verwandten nach Braunschweig, besuchte später die Nikolaischule in Leipzig, widmete sich dann auf Döben bei Grimma der Landwirtschaft und wanderte 1837 nach Nordamerika aus, wo er mit Büchse und Jagdtasche das ganze Gebiet der Union durchstreifte. 1843 nach Deutschland zurückgekehrt, widmete er sich mit Erfolg literarischen Arbeiten. Er gab zunächst sein Tagebuch: »Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika« (Dresd. 1844, 2 Bde.; 5. Aufl., Jena 1891) heraus, schrieb kleine Sagen und Abenteuer aus Amerika nieder und wagte sich endlich an ein größeres Werk: »Die Regulatoren in Arkansas« (Leipz. 1845, 3 Bde.; 10. Aufl., Jena 1897), worauf in rascher Reihenfolge »Der deutschen Auswanderer Fahrten und Schicksale« (Leipz. 1847; 3. Aufl., Jena 1899), »Mississippibilder« (Leipz. 1847–48, 3 Bde.), »Reisen um die Welt« (das. 1847–48, 6 Bde.; 3. Aufl. 1870), »Die Flußpiraten des Mississippi« (das. 1848, 3 Bde.; 10. Aufl. 1890) und »Amerikanische Wald- und Strombilder« (das. 1849, 2 Bde.) neben verschiedenen Übersetzungen aus dem Englischen erschienen. 1849–52 führte G. eine Reise um die Welt, 1860–61 eine neue große Reise nach Südamerika aus; 1862 begleitete er den Herzog Ernst von Koburg-Gotha nach Ägypten und Abessinien. 1867 trat er eine neue Reise nach Nordamerika, Mexiko und Venezuela an, von der er im Juni 1868 zurückkehrte. Seine letzten Jahre verlebte er in Braunschweig. Seine spätern Reisen beschrieb er in den Werken: »Reisen« (Stuttg. 1853–1854, 5 Bde.); »Achtzehn Monate in Südamerika« (Jena 1862, 3. Aufl. 1895) und »Neue Reisen« (Leipz. 1868, 3 Bde.; 4. Aufl.). Gerstäckers Reisen galten nicht wissenschaftlichen oder sonstigen allgemeinen Zwecken, sondern der Befriedigung eines persönlichen Dranges ins Weite; seine Schilderungen sind daher vorwiegend um ihrer frischen Beobachtung willen schätzbar. Ebenso verfolgte der fruchtbare Autor bei seinen zahlreichen Romanen und Erzählungen schlechthin Unterhaltungszwecke. Wir nennen davon: »Der Wahnsinnige« (Berl. 1853); »Wie ist es denn nun eigentlich in Amerika?« (2. Aufl., Leipz. 1853); »Tahiti«, Roman aus der Südsee (5. Aufl., das. 1877); »Nach Amerika« (das. 1855, 6 Bde.); »Kalifornische Skizzen« (das. 1856); »Unter dem Äquator«, javanisches Sittenbild (7. Aufl., Jena 1902); »Gold« (4 Aufl., Leipz. 1878); »Inselwelt« (3. Aufl., das. 1878); »Die beiden Sträflinge« (5. Aufl., das. 1881); »Unter den Penchuenchen« (das. 1867, 3 Bde.; 4. Aufl. 1890); »Die Blauen und Gelben«, venezuelisches Charakterbild (das. 1870, 3 Bde.); »Der Floatbootsmann« (2. Aufl., Schwerin 1870); »In Mexiko« (Jena 1871, 4 Bde.) etc. Seine kleinern Erzählungen und Skizzen wurden unter den verschiedensten Titeln gesammelt: »Aus zwei Weltteilen« (Leipz. 1851, 2 Bde.; 6. Aufl. 1890); »Hell und Dunkel« (das. 1859, 2 Bde.; 6. Aufl. 1890); »Heimliche und unheimliche Geschichten« (das. 1862, 3. Aufl. 1884); »Unter Palmen und Buchen« (das. 1865–67, 3 Bde.; 3. Aufl. 1896); »Wilde Welt« (das. 1865–67, 3 Bde.); »Kreuz und Quer« (das. 1869, 3 Bde.); »Kleine Erzählungen und nachgelassene Schriften« (Jena 1879, 3 Bde.); »Humoristische Erzählungen« (Berl. 1898) u. a. Unter seinen Jugendschriften verdienen »Die Welt im Kleinen für die kleine Welt« (Leipz. 1857–61, 7 Bde.; 4. Aufl. 1893), unter seinen Humoresken besonders »Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer« (das. 1857, 11. Aufl. 1896) Auszeichnung. Gerstäckers »Gesammelte Schriften« erschienen in 44 Bänden (Jena 1872–79), eine Auswahl in 24 Bänden, hrsg. von Dietrich Theden (das. 1889–90); »Ausgewählte Erzählungen und Humoresken«, hrsg. von Holm in 8 Bänden (Leipz. 1903).
Señor Aguila
In der Südsee
Wunderbare Inselwelt! Wie still und friedlich schlummerst du da draußen im weiten Ozean, gegen dessen bäumende Wogen dich der Korallengürtel deiner Riffe schützt! Ein kleines Paradies ein jedes Eiland, von einem sonnigen Himmel überspannt, ein sorglos heiteres, zufriedenes Völkchen bergend.
Dort lebte ein Menschenstamm, der wirklich glücklich war, der alles hatte, was er zum Leben brauchte – nicht mehr, nicht weniger, und doch auch gerade wieder wenig genug, um nicht die Habgier anderer Menschen zu reizen.
Kokospalmen und Brotfruchtbäume deckten sein fruchtbares Land; das stille Binnenwasser zwischen den Riffen barg Fische im Überfluß, die wenigen Kleidungsstücke lieferte die zähe Rinde seiner Bäume, den Schmuck für seine jungen Mädchen der nächste Blütenbusch – und Sorgen? Sie hatten das Wort nicht einmal in ihrer Sprache, sie kannten die Bedeutung nicht, und wenn die Sonne abends ins Meer versank, sammelte sich das fröhliche, blumengeschmückte Volk zum Tanz – und träumte nachher dem anderen Tag entgegen.
Glückliches Volk! Glücklich, weil es ungekannt, unbeachtet und nur sich selber überlassen dort draußen auf seinen Palmeninseln hauste! Dann kamen die Schiffe der weißen Männer, dann kam die christliche Religion, dann kamen Kisten mit Tand, mit Glaskorallen und Spiegeln, die ihre Habgier weckten – dann kam fremdes, nichtsnutziges Gesindel, das sich zwischen ihnen niederließ, und wo war das Glück – wo der Friede geblieben?
Aber das leichte, sorglose Element schwamm dennoch oben. Besser waren sie durch den Verkehr mit den Fremden nicht geworden, glücklicher auch nicht, aber das Leben hatte einen neuen Reiz gewonnen – sie hatten hoffen und auch einen unbestimmten Drang nach außen kennengelernt. Früher waren die Riffe, die ihre Insel umgaben, die äußersten Grenzen ihrer Fahrten, ja, ihres ganzen Strebens gewesen – jetzt sehnten und dachten sie darüber hinaus, und ihr ungeduldiger Blick strich oft über den weiten Horizont, ob sie nicht ein Schiff der Fremden erspähen konnten, das ihnen neuen Tand und – neue Sünden, neue Bedürfnisse brachte. Kokosnuß und Brotfrucht, ja, das war alles recht schön und gut, aber Tabak und Branntwein gaben doch erst dem Leben die rechte Würze. Und die jungen Mädchen und Frauen, die früher draußen im schattigen Hain, von den jungen Leuten umlagert, gesessen hatten, um ihre Tapa zu klopfen, und die dabei aus der Arbeit ein Fest machten – was brauchten sie jetzt noch zu arbeiten, wo ihnen die Fremden viel weichere, prächtig bunte Stoffe brachten und nichts dafür forderten, als was an ihren Bäumen reichlich wuchs, Kokosnüsse und Brotfrucht!
Trotzdem aber sehnten sich die Eingeborenen nicht fort von ihren schönen Inseln, sooft sie auch dazu von dann und wann anlegenden Walfischfängern verlockt wurden. Was sollten sie auch draußen? Arbeiten? Die härteste Arbeit, die sie kannten, war, eine Kokospalme zu ersteigen und die saftgefüllten Früchte hinabzuwerfen, oder draußen auf dem stillen Binnenwasser in ihrem Kanu zu schaukeln, um mit dem nachschleifenden Perlmutterhaken Bonitos und Albicores zu fangen. Ja, die Frauen klopften wohl auch noch dann und wann einmal ein Stück Tapa aus, flochten eine Matte oder schliffen mit Korallensand unter Wasser ein paar Kokosschalen zu Trinkbechern aus – aber die Männer? Vielleicht daß sie einmal ihr Dach ausbesserten, wenn ihnen der durchdringende Regen zu unbequem wurde, oder eine kleine Grube auswarfen, um in ihr mit heißen Steinen ein von den Frauen abgebrühtes und gereinigtes Ferkel zu braten, das war alles, und was sie sonst brauchten, hatten sie ja, oder die Schiffe brachten es ihnen – wozu also arbeiten!
Fremde Nationen brauchten freilich Arbeiter, um ihre Felder zu bebauen, um ihr Land wertvoll zu machen. Aber was kümmerte das jenes sorglose Volk in der Südsee – was wußten sie überhaupt von fremden Ländern, von denen sie noch nicht einmal überzeugt waren, daß sie wirklich existierten, da ja die fremden Menschen, die zu ihnen kamen, ihre Heimat auf ihren Schiffen hatten?
Ein Festtag war es jedoch immer für sie, wenn solch ein Fahrzeug anlief, und obgleich sie die Fremden im Anfang immer nur als »weiße Männer« bezeichneten, so lernten sie nach und nach einen Unterschied ihrer Nationalitäten kennen.
Die Ingleses hatten ihnen zuerst ihre Missionare und mit ihnen eine fremde Religion gebracht, die allerdings manchen Mißbrauch bei ihnen abschaffte, ihnen aber doch nicht recht behagte, weil sie von fanatischen, streng orthodoxen Priestern gelehrt wurde. Sie bestand aus fast nichts als Verboten. Sie durften nicht mehr singen – ausgenommen fremde, wunderliche Lieder – sie durften nicht mehr tanzen; die Mädchen durften keine Blumen mehr im Haar tragen, die Männer an gewissen Tagen nicht mehr fischen. Das war alles unbequem, und das einzige, was ihnen dafür versprochen wurde, war eine nicht einmal recht begriffene Belohnung nach dem Tode.
Dann kamen die »Feranis« oder Wi-wis, wie sie die lebendigen Fremden nach ihrem oft und rasch herausgestoßenen »oui-oui« bald scherzhaft nannten. Die brachten ihnen auch eine andere Religion, und noch dazu eine viel bequemere. Da aber selbst die »Weißen« nicht einmal zu wissen schienen, wer von ihnen die richtige hätte, konnte man es ja einmal mit beiden versuchen.
Dazwischen legten manchmal auch andere Schiffe an, aus denen sie freilich gar nicht klug wurden. Diese aber gefielen ihnen trotzdem am besten, denn sie hatten viel Tabak und viel Branntwein bei sich, außerdem auch noch bunte Stoffe, Schmuck und tausenderlei andere Dinge, und mischten sich besonders nie in ihren Glauben, ja, sie fragten nicht einmal danach. Aber es war ein wildes Volk, und sie mußten die Frauen vor ihnen hüten, so ungern sich diese auch vor ihnen hüten ließen.
Den Insulanern konnte übrigens nicht entgehen, daß das bunte, wehende Tuch, die Flagge, das ankommende Schiffe aufzogen und ausflattern ließen, auch irgend etwas zu bedeuten habe, und bald hatten sie heraus, daß es die verschiedene»Völkerstämme bezeichnete, die sie besuchten. Es dauerte nicht lange, so kannten sie schon verschiedene Nationen, besonders Amerikaner, Engländer und Franzosen an ihrer Flagge und freuten sich wie die Kinder, wenn ihnen dann von den Landenden bestätigt wurde, daß sie recht hatten.
Aber nicht an allen diesen Inseln legten die fremden Schiffe an. Wo die Korallenriffe zu weit in die See hinausragten oder im Fahrwasser gefährliche Untiefen bildeten, da hüteten sich die Seefahrer wohl, einzulaufen. Andere Inseln wieder lagen aus dem Kurs der Schiffe oder in der Nachbarschaft von größeren Eilanden, an denen besonders Walfischfänger immer lieber anliefen, weil sie dort leichter erhalten konnten, was sie brauchten.
Eine Eigentümlichkeit haben diese Inseln außerdem noch durch ihre Korallenbildung. Die sogenannten »Riffe« liegen nämlich – etwa eine oder anderthalb englische Meilen, oft aber auch nicht so weit vom festen Land entfernt – wie eine Ringmauer um alle jene Eilande, und wenn auch die Koralle nur bis an die Oberfläche der See, nie darüber wächst, so steht doch an diesen unterseeischen Bänken eine ununterbrochene mächtige Brandung, die selbst für das leichteste Kanu unpassierbar ist. Nur wo natürliche Einfahrten sind, können Boote, oft auch Schiffe einpassieren und liegen dann innerhalb der Riffe in stillem Wasser wie auf einem Teich.
Größere Inseln bilden so oft wunderbar sichere Häfen mit festem Ankergrund; bei kleineren Inseln sind diese natürlichen Einfahrten, wie sich von selbst versteht, verhältnismäßig schmal, und laufen fremde Schiffe sie an, so müssen sie vor den Riffen auf und ab kreuzen und ihre Boote ans Land schicken, oder auch warten, bis Kanus zu ihnen herauskommen. Nicht einmal ankern können sie vor den Riffen, denn bis unmittelbar an die Korallenbank hinan, so dicht, daß man die Lotleine hinüberwerfen könnte, finden sich nicht selten noch Hunderte von Faden Wasser. Die Koralle steigt wie eine riesenhohe Mauer vom Boden des Meeres steil und senkrecht empor.
Mit der Umgebung bekannt, können wir uns nun auch einmal eine dieser wunderbar schönen Inseln betrachten: Vor uns aus dem Meer steigt Raiateo mit ihren waldigen Kuppen und kühn gerissenen Hängen und Schluchten, von einem breiten, palmenbedeckten Landgürtel umschlossen, um den sich wiederum weit draußen wie ein schneeweißes Band auf tiefblauem Grunde der weiße, schäumende, tobende, lebendige Brandungsstreifen der Riffe zieht.
Es war an der Westseite der Insel, wo ein Fahrzeug – eine ziemlich große Brigg – langsam gegen den Wind auflaviert kam und dadurch die Absicht zeigte, mit dem Land in Verkehr zu treten. Am Lande war das fremde Segel schon seit Tagesanbruch mit großem Interesse beobachtet und allerlei Vermutung laut geworden, welcher Nation es angehören könne. Die meisten entschieden sich für Amerikaner, und in Form und Takelage hatte die Brigg auch wirklich Ähnlichkeit mit diesen; als sie aber näher kam, trug sie die amerikanische Flagge nicht, denn die Sterne und Streifen kannten sie gut genug. – Welche Flagge war das überhaupt? Deutlich erkennen ließ sie sich noch lange nicht, aber diese bunte Färbung hatten sie noch nie gesehen, und nach und nach sammelte sich die ganze benachbarte Bevölkerung an der kleinen Landzunge, unter der die einzige Einfahrt in die Riffe für eine gute Strecke nach Norden und Süden lag.
Näher und näher kam das fremde Schiff, jetzt über den Starbordbug nach Süden, jetzt über den Backbordbug nach Norden aufkreuzend, immer gegen Wind und Strömung an, und daß es kein besonderer Segler war, hatten die Eingeborenen bald weg. Auch die Segel selber wurden bei den verschiedenen Manövern schlecht und schläfrig bedient, und die Ungeduld der Insulaner machte sich dabei in Spottreden über die ungeschickte Mannschaft Luft.
So war es fast zwei Uhr mittags geworden, bis der Fremde endlich die Einfahrt erreichte. Indessen war ein Bote nach einem mehr im Innern wohnenden Weißen abgesandt worden, um ihm die Anfahrt eines fremden Schiffes zu melden. Der Mann kam dann immer schon von selber, denn er diente den Fremden als Dolmetscher und bekam von ihnen gewöhnlich eine Menge Dinge, die er brauchen konnte – und er konnte alles brauchen – zum Lohn. Besonders aber lockte ihn der Branntwein, und wenngleich ein Gesetz auf der Insel bestand, nach dem keine einzige Flasche des berauschenden Getränkes eingeführt werden durfte, wußte er doch immer bei einer solchen Gelegenheit soviel ans Ufer zu schmuggeln, daß er sich damit eine volle Woche in halber Bewußtlosigkeit erhalten konnte.
Der Mann sprach drei oder vier verschiedene Sprachen, stammte, seiner Aussage nach, aus Italien, war von einem französischen Walfischfänger desertiert und jetzt hier Hausbesitzer und Familienvater auf Raiateo geworden, ohne sich in seiner Lebensweise auch nur im geringsten geändert zu haben. Er trieb es noch immer wie ein Matrose auf einem Walfischfänger, und die Insulaner wären ihn schon lange gern losgeworden, wenn sie nur eben gewußt hätten wie, denn er ging nicht fort. Der einzige Nutzen, den er ihnen brachte, war allein der Verkehr mit den fremden Schiffen; nach einem solchen Besuche mußte aber auch seine Frau mit ihren Kindern jedesmal für wenigstens eine Woche zu ihren Eltern flüchten, weil er sie im Trunk mißhandelte und selbst die Kinder blutig schlug.
Sowie übrigens das fremde Fahrzeug in den Bereich ihrer Kanus gekommen war, sprangen zehn oder zwölf der halbnackten braunen Gestalten nach dem Strand hinunter; aus Kokospalmblättern rasch geflochtene und mit Früchten gefüllte Körbe standen schon, der Fremden wartend, an der Landung, und wenige Minuten später glitten die schlanken, leichten Fahrzeuge über das Binnenwasser und hinaus durch die schmale Einfahrt der Riffe, während rechts und links von ihnen die schäumenden Brandungswellen so nahe ihre blitzenden, funkelnden Kronen überstürzten, daß sie den Wasserstaub bis in die Boote warfen.
Und was für eine wunderliche Flagge das war, die dort oben am Maste wehte! So eine hatten sie an ihrer Insel noch nie gesehen. Es war ein Schild, auf der linken Seite von einem Palmenzweige, auf der anderen von einem ähnlichen grünen Laube, mit roten Beeren daran, umgeben oder gehalten. Die obere Hälfte war dabei in zwei Teile geteilt, und rechts stand ein Baum, links aber ein wunderliches Tier mit langem Halse, das sie nicht kannten, denn eine Kuh war es nicht, ein Schwein auch nicht – vielleicht ein Hund? Aber was mußte das für ein Hund sein, dessen Kopf bis oben an den Wipfel des Baumes hinaufreichte! Die untere Hälfte nahm dann ein anderer Gegenstand ein, von dem sie aber ebenfalls keinen Begriff hatten. Er war sonderbar gebogen, fast wie ein Fisch mit weitem Rachen, und da heraus fiel eine Menge gelbes Geld, während oben über dem Ganzen noch ein Kranz stand.
Aber was kümmerte das die Eingeborenen, die jetzt nur daran dachten, ihre Früchte zu verwerten. Früchte brauchten alle Nationen, mochten sie von Osten oder Westen den Ozean durchsegelt haben, und etwas brachten sie auch dafür mit, was schon zu einem Lebensbedürfnis der Südseeländer geworden war: Tabak. – Also vorwärts, denn wer die ersten Früchte den danach verlangenden Seefahrern brachte, hatte auch den besten Handel zu gewärtigen. So war denn eine ordentliche Wettfahrt daraus geworden, bei der ein Kanu dem anderen vorzukommen suchte, und die Mannschaft des fremden Fahrzeuges, das noch keine Miene machte, Boote auszusetzen, lehnte sich über die Schanzkleidung und lachte dem Sieger entgegen.
Dort an Bord entstand jetzt ein lebhafter Verkehr, denn nachdem der Steward für den Bedarf der Kajüte genügend eingekauft hatte, wurde den Matrosen freigestellt, für das, was sie an Tauschartikeln besaßen, die lang ersehnten Früchte einzuhandeln; was für wunderliche Dinge kamen da zum Vorschein: alte Hemden und Hosen, Hosenträger, Kämme, Taschenmesser, Feuerstähle, Schuhe, Stücke rotes und blaues Band, Taschentücher, Rasierspiegel, kurz alles, was die Burschen nur irgend entbehren konnten, brachten sie zum Vorschein – nur das nicht, was die Insulaner verlangten: Tabak; denn das wenige, was sie wirklich davon besaßen, brauchten sie selber viel zu notwendig, um sich davon trennen zu können. Für den Plunder jedoch, den sie statt dessen aus allen Ecken hervorsuchten, fanden sie nur teilweise einen Abnehmer, denn die Insulaner von Raiateo waren schon zu häufig mit Europäern in Berührung gekommen, um nicht die Wertlosigkeit von derlei Dingen zu kennen. Hemden trugen sie allerdings und kauften sie gern, aber sie durften keine Löcher haben, mochten sie sonst bestehen, aus was sie wollten – das übrige schoben sie alles zurück. Nur ein paar Spiegel fanden einen Abnehmer, und der Besitzer eines alten Seidenhutes, in den sich ein Eingeborener verliebt hatte, machte ein gutes Geschäft.
Der Steuermann hatte sich indessen bei den Leuten erkundigt, ob niemand auf der Insel sei, der der Fremden Sprache redete – die Unterhaltung mußte natürlich durch Zeichen geführt werden, und die Insulaner verstanden, was er meinte, deuteten auf die Brandung und machten dem Fragenden begreiflich, daß von dort gleich jemand herausgerudert käme, der mit ihnen reden könne. Damit beruhigte sich der Mann und nahm jetzt das Fernglas von der Kajütentreppe auf, um die Einfahrt zwischen den Riffen beobachten zu können. Um den Fruchthandel kümmerte er sich nicht.
Eine wunderliche Bemannung war auf dem Schiff, und selbst den Eingeborenen von Raiateo, die doch sonst wahrlich nichts von der Seefahrt verstanden, fiel das auf. Das waren weder englische, noch französische, noch amerikanische Matrosen, so viel sahen sie auf den ersten Blick, und sie erinnerten sich nicht, je ein schmutzigeres, ruppigeres und vernachlässigteres Gesindel auf dem Deck eines Fahrzeuges gesehen zu haben. Das ganze Deck war schmutzig und unordentlich; die Segel bestanden eigentlich nur aus geflickten Fetzen, und in der Kambüse oder Küche sah es aus, daß jedem anderen als einem Südamerikaner der Appetit vergangen wäre – und gerade das machte auf die reinlichen Bewohner dieser Inseln einen fatalen Eindruck. – Aber was hatten sie mit dem Schiff zu tun? – Sie tauschten ihre Früchte und kehrten dann an Land zurück. Die an Bord mochten leben, wie sie's eben freute.
Jetzt kam der Dolmetscher, »Felipe«, wie er am Lande genannt wurde, und als er das Deck betrat, lachten die Insulaner untereinander und flüsterten sich zu, daß er eigentlich genau so aussähe, als ob er zu der Mannschaft hier gehöre. Er war fast ebenso braun und womöglich noch schmutziger, trug die. selben langen, schwarzen, etwas gelockten Haare, mit einem kurzen Schnurrbart auf der Oberlippe, und was seine Kleidung anbetraf, so gingen die Matrosen an Deck auch nicht zerlumpter als er selber.
Zur Entschuldigung mochte freilich dienen, daß er heute morgen seine Toilette noch nicht gemacht hatte, denn als er die Botschaft bekam, daß ein fremdes Schiff draußen vor den Riffen liege, war er in wilder Hast zu seinem Kanu hinabgestürzt und um die Insel herumgerudert, so rasch er nur die Arme regen konnte. Und wer wollte es ihm verdenken? Seit neun Wochen hatte er keinen Tropfen Branntwein gesehen und vor über vierzehn Tagen sein letztes Gramm Tabak zerkaut, so daß er jetzt einen ordentlichen Heißhunger nach beiden Genüssen fühlte – und beide sollten hier befriedigt werden.
Der Steuermann hatte ihn schon, ehe er nur langseit lief, mit seinem Fernrohr als eins jener Individuen erkannt, die zerstreut auf den meisten dieser Inseln leben und eigentlich zu der traurigsten Menschenklasse der Welt gehören. Sie alle sind, wie sich das von selbst versteht, weggelaufene Matrosen, die das bißchen Zivilisation, das sie besaßen, ohne viel Schwierigkeit abschüttelten – sie fiel ihnen eigentlich von selber ab – und nur ihre Untugenden, ihr Fluchen, Trinken und liederliches Leben beibehielten. Solche Burschen dienten dann den Insulanern als Probeexemplare des christlichen Glaubens, und es läßt sich denken, daß sie keinen übermäßig hohen Begriff von europäischer Gesittung bekommen konnten.
Den anlaufenden Schiffen bleiben sie aber immerhin nützlich nur allein ihrer Sprachkenntnisse wegen. Was kümmert diese ihre sonstige Moralität, und wenn sie es dabei mit einem entsprungenen Sträfling zu tun hätten!
An Bord der »Libertad«, wie die peruanische Brigg hieß, hatten sie diesmal aber auch noch besonderen Grund, das Nahen eines Dolmetschers gern zu sehen, und wenn dieser ein mehr als gewöhnlich verkommenes und verwildertes Individuum zu sein schien, so war es ihnen vielleicht sogar erwünscht. Es ist die Frage, ob sie einen englischen oder französischen Matrosen überredet hätten, ihren Zwecken dienstbar zu sein und sie zu unterstützen.
Felipe kannte die Flagge, und wenn er auch der spanischen Sprache nicht besonders mächtig war, verstand er doch genug davon, um sich mit seinem Italienisch wenigstens verständlich machen zu können. Er kletterte denn auch mit einem sehr zufriedenen »Como está, Señor« an Bord hinauf.
Der Steuermann, der ihn hier empfing, ließ sich nicht lange auf höfliche Redensarten ein und fragte: »Was für ein Landsmann?«
»Italiener, Señor.«
»Sprichst du Kastilianisch?«
»Ein wenig.«
»Hm – es sind Landsleute von dir an Bord«; und einen der nächststehenden Matrosen nach vorn schickend, beorderte er einen italienischen Matrosen nach dem Quarterdeck, um dort im Notfall als Aushilfe dienen zu können.
»Brauchen Sie Holz?« fragte jetzt der Landvagabund, indem er selber an der Seite des Steuermanns nach hinten schritt, und das Wasser lief ihm im Munde zusammen, wenn er an den Tabak dachte, den er bald zu bekommen hoffte. »Ich habe ein paar Klafter fertig geschlagen und kann es in ein paar Stunden an Bord schicken.«
»Nein, wir haben genug«, lautete die kurze Antwort.
»Also Früchte? Sie kommen gerade zur rechten Zeit; die Brotfrucht ist eben wieder reif geworden, und ich will den Burschen dort sagen, daß sie gleich noch ein paar Kanu-Ladungen herüberschaffen.«
»Das hat Zeit«, wies aber auch dies der Steuermann zurück. »Vor allen Dingen will dich erst einmal der Kapitän sprechen und einiges fragen, nachher machen wir den Fruchthandel in ein paar Minuten ab.«
»Und was ist es, wenn man fragen darf?« fragte der Bursche und sah den Steuermann von der Seite an. Möglich vielleicht, daß er nicht einmal ein reines Gewissen hatte, denn das Geheimnisvolle gefiel ihm nicht. Der Seemann aber ließ sich auf keine weiteren Antworten ein, denn sie hatten das Quarterdeck erreicht, zu dem er jetzt hinaufstieg und dem Italiener dabei winkte, ihm zu folgen. Dieser warf einen unruhigen Blick umher; was zum Henker hatte er denn mit dem Kapitän zu tun, und was konnte der von ihm wollen? – Und noch nicht einmal ein Stück Tabak hatte er bekommen! – Aber was konnten sie ihm auch tun – was kümmerten sie sich um ihn ober irgendeinen der weggelaufenen Matrosen auf diesen Inseln?
Außerdem kreuzten da draußen um das Schiff herum fünf oder sechs Kanus der Eingeborenen, während keins der Schiffsboote auf dem Wasser lag, und wenn er auch wußte, wie wenig Zeit es einem Walfischfänger nimmt, seine Boote niederzuwerfen, so kannte er dagegen auch die Schwerfälligkeit der Kauffahrer bei diesem Manöver. Hatten sie deshalb wirklich etwas gegen ihn im Sinn, so war er mit einem Satz über Bord und dann bald in Sicherheit – und mit diesem Bewußtsein folgte er etwas zuversichtlicher dem schon vorangegangenen Seemann.
Der Kulihandel
Auf dem Quarterdeck angekommen, fühlte Felipe sich indessen bald beruhigt, daß seine eigene Sicherheit hier nicht gefährdet war. Er traf lauter unbekannte Gesichter, was ihm doppelt angenehm war, denn alle Erinnerungen schienen ihm fatal zu sein.
Auf dem etwas erhöhten Deck stand nur noch der Kapitän der Brigg und ein anderer Peruaner, der Supercargo, wie sich später herausstellte, und beide hielten, als er nach oben kam, Ferngläser in der Hand, mit denen sie das Ufer bis dahin beobachtet hatten.
»Kapitän, hier ist der Mann«, meldete jetzt der Steuermann seinem Vorgesetzten, »ein Italiener, der etwas Spanisch spricht. Wenn Sie nicht mit ihm auskommen sollten, habe ich aber den Pablo von vorn rufen lassen. Er steht unten und kann zur Not aushelfen.«
»Gut, Steuermann. Haben Sie ihn schon um unsere Angelegenheit befragt?«
»Nein«, sagte der Seemann, und als er sich abdrehte und zur Seite trat, brummte er leise vor sich hin: »Geht mich auch nichts an! Das kannst du und dein Compañero mit ihm abmachen!«
Der Steuermann war unstreitig der am anständigsten Aussehende der ganzen Gruppe, ein Spanier vom alten Lande und ein tüchtiger Seemann, der sich seine Lebenszeit auf dem unruhigen Element herumgeschlagen hatte. Es war eine hohe, kräftige Gestalt, mit vollem, schwarzem Bart und nicht unschönen, ja selbst edlen Gesichtszügen, von Wind und Sonne dunkel gebräunt. Sein Anzug, ein rotwollenes Hemd und blaue Leinwandhosen, mit einem leichten Strohhut auf den dunkeln Locken, war ebenfalls sauber gehalten und stach dadurch um so merklicher gegen die unsaubere Schar seiner Untergebenen ab. Ihm sah man den Seemann auf den ersten Blick an, seinem Kapitän nicht, der, mit einer großen, goldenen Tuchnadel und einem ebensolchen Siegelring, weit eher in einen Kaufmannsladen gepaßt hätte und sich überhaupt wenig von seinem Supercargo unterschied.
Beide waren unstreitig peruanische Cholos, mit einem viel dunkler gefärbten Teint, als man sich von der Sonne gefallen läßt, und beide trugen jenen harten, schlauen Zug im Antlitz, der sich bei keinem Volke so scharf ausgeprägt findet, wie bei den Peruanern und Yankees. Dennoch war der »Kapitän« hierbei noch im Vorteil, denn seine freieren, lebendigeren Bewegungen gaben ihm etwas Offenes in seinem Wesen, während der Supercargo, weit stiller und zurückhaltender, dadurch den Fremden noch mehr abstieß, daß er die unangenehme Gewohnheit hatte, seine überdies schon dünne Unterlippe zwischen den Zähnen zu halten und zu kauen.
Hübsch waren sie übrigens alle beide nicht und hätten gut für Brüder gelten können.
Diesen sah sich jetzt unser Italiener gegenüber, und als nach des Steuermanns Anrede beide die Fernrohre von den Augen nahmen und zusammenschoben, blieb des Supercargos Blick fest und forschend auf den Burschen geheftet, während der Kapitän das Gespräch anscheinend gleichgültig einleitete.
»Lebt Ihr hier auf der Insel, Señor?«
»Si, Señor«, nickte der Mann mit einer halben Verbeugung, indem sein Blick rasch und suchend von einem zum andern der beiden flog. »Ich habe mich hier vor der Hand niedergelassen.«
»Vor der Hand nur?«
»Lieber Gott, unsereiner bindet sich nicht leicht an einen Fleck! Höchstens solange, bis man etwas Besseres findet.«
»Wie lange wohnt Ihr schon hier?«
»Sieben Jahre.«
»Ihr seid hier verheiratet?«
»Hm«, brummte der Bursche, »was man hier so verheiratet nennt, aber es hat eben nicht viel zu bedeuten; übrigens läßt sich's aushalten auf den Inseln, denn zu essen gibt's genug. Das einzige, was fehlt, ist Tabak; ich weiß schon gar nicht mehr, wie Tabak aussieht, und einen Schluck Branntwein habe ich seit Monaten nicht gerochen.«
Der Kapitän war auf derartige Anliegen vorbereitet, denn sie wiederholten sich, wohin er kam. Auf der einen Bank am Skylight stand auch schon ein zu drei Vierteln mit Branntwein gefülltes Wasserglas, und ein großes Stück amerikanischen Kautabaks lag daneben. Mit einer einladenden Bewegung deutete er dorthin, und des Burschen Augen funkelten vor Freude, als er den dort für ihn aufgespeicherten Schatz entdeckte. Lange nötigen ließ er sich übrigens nicht; mit einem Dios se lo pague! war er im Nu neben der Bank, und während er mit der Rechten das Glas faßte und an die Lippen hob, sicherte sich die Linke schon den Tabak und hob ihn in die Höhe, um zum Hineinbeißen gleich fertig zu sein, sowie nur der Branntwein beseitigt worden war. Er stürzte auch den Inhalt des Glases auf einen Zug hinunter, und der Supercargo wandte sich mit Ekel ab, denn welche Untugenden der Südamerikaner auch haben mag, unmäßig im Trinken ist er nur in Ausnahmefällen.
Der Kapitän war schon eher an etwas Derartiges gewöhnt. Um seine Lippen zuckte nur ein halb verächtliches Lächeln über die Gier des Menschen; er ließ ihn ruhig austrinken und dann noch ein Stück Tabak abbeißen, was Felipe in einer ähnlichen Art tat, wie eine halb verhungerte Hyäne ein plötzlich gefundenes Stück Beute anreißen würde. Erst dann, als er die Befriedigung über den Genuß auf dem Gesicht des Burschen las, fuhr er fort:
»Wie mir scheint, möchtet Ihr also wohl einmal wieder ein anderes Leben führen, Señor? Wie aber steht es mit den braunen Burschen auf der Insel? Sollte man die wohl einmal bereden können, ihr Glück für eine kurze Zeit in einem anderen Lande zu versuchen?«
Felipe warf ihm einen raschen, forschenden Blick zu; da aber der Kapitän bei dem Vorschlag keine Miene verzog, schüttelte er, indem er sich mit dem linken Hemdärmel den Mund wischte, langsam den Kopf und sagte:
»Nein, Señor, mit denen ist nichts anzufangen. Vor sechs oder acht Jahren hatte einmal ein Walfischfänger einen von ihnen mitgenommen und drei Jahre an Bord behalten, und als der arme Teufel, dem es wohl bei der schweren Arbeit oben im Eismeer nicht besonders gefallen haben mag, wieder zurückkam, erzählte er so schreckliche Geschichten von dem, was er ausgestanden hatte und wie er behandelt worden war, daß er den übrigen Angst genug einjagte. Seit der Zeit hat keiner wieder beredet werden können, die Insel zu verlassen; und verdenken kann ich's ihnen auch nicht, denn der Unterschied zwischen dem Leben an Bord eines Walfischfängers und dem hier unter Palmen und Brotfruchtbäumen ist doch ein wenig zu groß.«
»Aber wenn man sie nun auf gar keinen Walfischfänger haben, sondern nur in ein anderes Land bringen wollte, wo ebenfalls Palmen sind, und wo sie noch außerdem viel Geld verdienen könnten, – sollten sie darauf auch nicht eingehen?«
Der Italiener sah eine Weile schweigend und nachdenklich vor sich nieder.
»Nach Peru, meint Ihr, Señor?« sagte er endlich.
Der Kapitän nickte, aber Felipe schüttelte den Kopf und das Stück Tabak betrachtend, das er noch immer in der Hand hielt, als ob er es nicht einmal seiner Tasche anvertrauen wollte, meinte er endlich:
»Nein, sie tun's nicht.«
»Und wenn Ihr ihnen nun einmal in vernünftiger Weise den Vorschlag machtet und ihnen das Leben in Peru ein bißchen lebendig ausmaltet? Es sollte Euer Schaden nicht sein, Compañero, Ihr sollt für jeden gesunden Mann, den Ihr dazu bringt, fünf Dollars erhalten.«
»Es geht nicht«, sagte aber der Bursche, »und wenn Ihr mir fünfzig versprächet. Gutwillig gehen sie nicht fort von hier, denn was weiß das Lumpengesindel von Geld! Und was sie sonst brauchen, haben sie eben an Land und verlangen nicht mehr.«
»Schade«, meinte der Supercargo, der indessen wieder herangetreten war und dem es nicht entging, daß das Anerbieten auf den Italiener seinen Eindruck trotzdem nicht verfehlte, »Ihr hättet Euch dabei mit leichter Mühe eine hübsche Summe Geld verdienen können. Aber wenn's nicht ist, müssen wir es eben aufgeben.«
»Aber wenn nun –« wollte der Kapitän einwenden, als er dem Blick seines Supercargos begegnete, und er brach mitten in seiner Rede ab. Der Italiener sah zu ihm auf, aber er hatte sich von ihm fortgedreht und ging mit auf den Rücken gelegten Händen auf dem Quarterdeck auf und ab.
»Wie ist es, Kapitän«, nahm da Felipe das Gespräch nach einer kurzen Pause wieder auf, »haben Sie nicht ein paar Handelsartikel mitgebracht, um Früchte dafür einzutauschen? Wir könnten hier alles brauchen, besonders Tabak und Kattune. Es ist lange kein Schiff auf dieser Seite der Insel gewesen, und die Früchte wären billig.«
»Tut mir leid«, nahm der Supercargo für den Kapitän das Wort, »für uns selber haben wir schon mehr als genug, denn wir werden, wenn wir hier keine Arbeiter bekommen können, ein paar andere Inseln anfahren. Macht, daß Ihr wieder in Euer Kanu kommt, denn sowie die Brise ein bißchen auffrischt, gehen wir in See.« Damit stieg er, ohne sich umzusehen, in seine Kajüte hinunter.
»Wollt Ihr nicht einmal mit den Insulanern über meinen Vorschlag sprechen?« fragte der Kapitän jetzt den Italiener, der noch immer an Deck stand und nachdenklich auf die Planken niederstarrte.
»Wenn ich denen ein Wort davon sage«, meinte der Italiener aber kopfschüttelnd, »so sind sie im Augenblick in ihren Kanus unten, und keiner ist mehr herauszubringen. Nein, überreden lassen sich die Burschen dazu nicht, und wenn Ihr einen Haufen Gold vor sie hinleget. Ich kenne sie zu genau.«
»Schade«, sagte der Kapitän, indem er sich ebenfalls abwandte, »Ihr hättet dabei eine günstige Gelegenheit gehabt, wieder nach einem zivilisierten Land zu kommen, denn in Callao und Lima sind Massen von Euren Landsleuten, und eine bessere Gelegenheit, eine runde Summe Geld zu verdienen, findet Ihr auch im Leben nicht wieder; aber wenn es eben nicht geht, geht es nicht. Steuermann«, wandte er sich dann an diesen, der immer noch an der Starbord-Reeling lehnte und dem Gespräch zugehört hatte, ohne aber ein Wort zu reden oder eine Miene zu verziehen, »laßt den Tabak und Branntwein nur wieder wegstauen, wir brauchen jetzt nichts mehr davon«, und mit den Worten folgte er dem vorangegangenen Supercargo. Um den Italiener bekümmerte sich niemand mehr.
Felipe, ein so roher und wüster Bursche er auch sonst sein mochte, war doch schlau genug, zu fühlen, daß des Supercargos und Kapitäns Gleichgültigkeit bei dem abgebrochenen Handel keine natürliche sein konnte. Es steckte mehr dahinter. Auch der Befehl, Tabak und Branntwein wegzustauen, war mit Absicht in seiner Gegenwart gegeben worden, und hätte das Fahrzeug jetzt wirklich gleich wieder die Insel verlassen wollen, so hinderte es gar nichts daran. Die Brise war allerdings, besonders hier, vom Land gedeckt, nur sehr schwach, aber doch genügend, um die Segel zu füllen und mit der günstigen Strömung die Brigg bald wieder in offene See hinauszubringen. Weshalb wurde also der Befehl noch nicht gegeben? Weil die beiden jedenfalls noch etwas im Hinterhalt hatten – aber was war das?
Felipe ging nachdenklich auf das Mitteldeck hinunter, wo sein Kanu an einer der Pardunen befestigt hing. Indessen waren noch mehr Insulaner mit beladenen Kanus angekommen und riefen jetzt hinauf, ob sie an Bord kommen sollten und ob der fremde Kapitän handeln wollte. Felipes Schwiegervater und Schwager waren ebenfalls dabei. Er antwortete hinunter, sie sollten noch warten, er wüßte es noch nicht, und setzte sich dann auf die dort befestigten Notspieren unter das große Boot. Der Kapitän würde, wie er sich dachte, schon wieder zu ihm schicken. Aber niemand kam, und der Mann stand endlich wieder auf und ging ungeduldig an Deck auf und ab.
Keinen Branntwein weiter? – Er hatte eben den Geschmack davon bekommen – keinen Tabak mehr? Monate dauerte es vielleicht, bis wieder einmal ein anderes Schiff hier anlegte! Und was für ein Hundeleben führte er überhaupt hier auf der langweiligen Insel, zwischen lauter Brotfruchtbäumen und unter den ewigen Palmen? Satt hatte er's schon lange; und seine Familie? Bah! Was ihm im Anfang Vergnügen gemacht hatte, war ihm schon lange zum Überdruß geworden! Außerdem saß ihm die braune Obrigkeit, von den Missionären gehetzt und unterstützt, unablässig auf dem Kragen wegen Mißhandlung seiner Frau, und was ging seine Frau die Missionäre an! Bekümmerte er sich darum, wenn sie die ihrigen prügelten? Gewiß nicht!
Das Glas Branntwein, das er in den nicht mehr daran gewöhnten Körper so rasch hinuntergestürzt hatte, tat seine Wirkung. Der Kopf wirbelte ihm ordentlich von den darin sich kreuzenden Gedanken; er mußte mehr trinken, so konnte er das Schiff nicht wieder verlassen, und entschlossen wandte er sich jetzt nochmals dem Quarterdeck zu.
Weder der Kapitän noch der Supercargo hatten sich dort wieder blicken lassen, und als er den Steuermann nach ihnen fragte, lautete die Antwort nur: »Unten.« Weiter bekümmerte sich der Seemann nicht um ihn.
Felipe stieg nochmals auf das Quarterdeck hinauf und stand dort lange unschlüssig. Sein Blick streifte bald nach der Insel hinüber, die alles für ihn barg, was eigentlich den Inbegriff von Glück für einen Menschen hätte bilden sollen, bald nach den Segeln hinauf, die nur eben genug ausblähten, um das Schiff in der unmittelbaren Nähe der Einfahrt zu halten. Da klirrten Gläser unten in der Kajüte. Er sah durch das Skylight hinab, wie der Steward eine Flasche auf den Tisch setzte, und mit einem zwischen den Zähnen zerbissenen Fluch sprang er die Kajütentreppe hinab, um den Kapitän dort unten aufzusuchen.
Es dauerte lange, bis er wieder nach oben kam, und die Insulaner hätten indessen schon Ursache gehabt, ungeduldig zu werden, wenn jenen wunderlichen Menschen das Gefühl nur bekannt wäre. Ungeduld setzt immer einen Begriff von Zeit und deren Wert voraus, und den haben sie entschieden nicht. Ist der heutige Tag verschwunden, so kommt morgen ein anderer; zu versäumen ist natürlich nichts dabei; weshalb sollten sie also böse werden, wenn sie einmal ein paar Stunden an Bord eines Schiffes oder dicht daneben in ihren Kanus schaukelnd verträumen konnten – war es doch eine Abwechselung gegen das einförmige Leben an Land, das sie morgen und übermorgen, ja, das ganze Jahr zur Genüge haben konnten! Mit dem größten Vergnügen hätten sie tagelang so ausgehalten.
Endlich kam Felipe zurück, machte, ohne sich weiter an Deck umzusehen, sein Kanu los und stieg hinein.
»Nun, Felipe, wie ist es?« fragten ihn die paar Insulaner, die an Deck geklettert waren. »Kaufen die weißen Männer unsere Früchte?«
»Ja«, sagte der Bursche, »aber heute nicht. Sie müssen erst die Waren hervorsuchen, die sie dafür geben wollen. Morgen früh ist ein großer Markt, und ihr sollt Tapa, Kokosschalen, Matten und Früchte mitbringen, was ihr habt, und dafür oben euch aussuchen, was ihr mitnehmen wollt.«
»Und wohin gehst du?«
»Nach Hause, so schnell ich kann, um von dort alles herbeizuholen, was ich an die Fremden verkaufen kann. Das ist ein reiches Schiff, wie wir noch keins an unserer Küste hatten.«
Und damit saß er in seinem Kanu und ruderte durch die Einfahrt der Küste zu, um dort erst einmal den Leuten von dem morgen an Bord des fremden Schiffes zu haltenden Markt zu erzählen und dann so rasch er konnte nach seinem eigenen Haus zurückzukehren.
Blitzschnell lief indes die Kunde, daß das Schiff Matten und Tapa kaufe, von Haus zu Haus; besonders geschäftig waren jetzt die Frauen, an solchen Sachen vorzusuchen, was sie eben hatten; sie wußten, daß sie dafür bunte, prächtige Stoffe und blitzende Glasperlen eintauschen konnten.
Nur die Männer nahmen es kaltblütig. Ihre Früchte, die sie zum Handel hinüberbrachten, pflückten sie morgen früh; was sie sonst noch hatten an jungen Schweinen und Hühnern, war ebenfalls in kurzer Zeit in ihre Kanus gepackt; was sollten sie sich da heute noch bemühen? Und vor Sonnenuntergang schaukelten sie mit ihren Kanus wieder im Binnenwasser der Riffe, um Fische für ihr Abendbrot zu fangen, hingen die Knaben wieder in ihren Bastschaukeln an den Wipfeln der Palmen, hetzten sich die Mädchen wieder auf dem Korallensand umher, und tanzte das junge Volk wieder glücklich und sorglos bei dem Schalle einer alten, einmal von einem französischen Schiff eingetauschten Soldatentrommel, und lauschte dann später beim vollen Mondlicht dem donnernden Toben der Brandung, die unermüdlich ihren nutzlosen Kampf gegen die Riffe kämpfte und, tausendmal zurückgeschlagen, tausendmal den Angriff erneute.
Der Morgen kam, aber mit ihm dieses Mal ein ungewohnt geschäftiges Leben in die muntere Schar, überall waren junge Leute beschäftigt, ihre Kanus flott zu machen, und was sie am Ufer schon mit Tagesanbruch aufgespeichert hatten, hineinzutragen. Lachend und singend verrichtete jeder seine Arbeit, und mit Kichern und Jubeln stiegen heute auch hier und da einzelne in buntfarbige und sauber gewaschene Kattunkleider gehüllte Mädchen oder Frauen in die Kanus, um ihre Matten oder Tapastücke selber für Sachen einzutauschen, die sie gebrauchen konnten, denn aus Erfahrung wußten sie, daß die Männer kaum etwas anderes von den Schiffen zurückbrachten als Tabak oder vielleicht einmal ein Messer oder ein Beil.
Felipe mußte ebenfalls früh von Hause aufgebrochen sein, denn noch ehe das letzte Kanu zur Abfahrt gerüstet war, kam er schon in dem seinigen herangeschwommen, in dem er heute ausnahmsweise einen Burschen aus der Nachbarschaft mitgenommen hatte, der darin bleiben sollte, während er an Bord ging und den Handel für die Insulaner überwachte. Wo so viele Kanus dem Schiffe angehängt wurden, meinte er, könnte leicht eins gegen das andere gestoßen und beschädigt werden, und das wollte er doch zu verhüten suchen.
Und jetzt ruderten sie hinaus – ein ganzer Schwarm fröhlicher, glücklicher Menschen.
Langsamer, aber dicht hinter ihnen folgte Felipe. Still und düster lehnte er in seinem Kanu, und als die kleine Flotte mit schäumendem Bug über das Binnenwasser glitt, ruderte er wie zögernd hinter ihnen drein und schickte, endlich an Bord angelangt, sein Kanu mit dem Knaben an Land zurück. Es waren so viele beladene Boote herübergekommen, daß er nachher recht gut mit einem der geleerten wieder zurückkehren konnte.
An Bord sah es indessen heute lebendiger aus als gestern, denn »midships«, inmitten des Schiffes, zwischen den beiden Masten und um das große Boot her war eine Menge von Waren ausgebreitet, die von den Kajütsdienern und Steuerleuten überwacht wurden und gegen die mitgebrachten Artikel der Eingeborenen eingetauscht werden sollten.
Die Brigg, die über Nacht ein Stück von der Insel zurückgetrieben war, um aus der etwas zu gefährlichen Nähe der Riffe zu kommen, hatte jetzt wieder aufgekreuzt, lag aber noch immer, wie gestern den ganzen Tag, vor kleinen Segeln, bald über diesen, bald über jenen Bug. Aber die Insulaner achteten darauf schon gar nicht mehr, denn jetzt nahmen die kostbaren Waren, die vor ihren Blicken aufgespeichert lagen, ihre Aufmerksamkeit so vollständig in Anspruch, daß sie für weiter nichts Augen hatten und nur fortwährend darum herum gingen und sich bald für dies, bald für jenes entschieden, was sie für ihre Erzeugnisse verlangen wollten. Wie bei Kindern zog das Bunteste ihre Blicke auch immer zumeist an.
Felipe war indessen in die Kajüte gerufen worden und hatte dort eine lange Unterredung mit dem Kapitän. Als er wieder an Deck kam, kreuzte die Brigg eben aufs neue gegen die Einfahrt zu, bis die Brandung fast unter ihrem Bug schäumte.
Jetzt neigte sich der Bug des Fahrzeugs langsam von den gefahrdrohenden Korallenfelsen ab; die Brigg ging über Stag und lag nach Süden hinüber.
An Bord wurde indessen der Handel lustig betrieben, und der Untersteuermann, ein rauh genug aussehender Geselle von Panama, unterstützte dabei vorzüglich den Supercargo, um den Wert für die gebotenen Matten, für Kalabassen mit Kolosnußöl, für Stücke Tapa, für geflochtene Bastseile und andere Arbeiten dieser einfachen Menschen zu bestimmen. Und wie genügsam zeigten sie sich dabei und gaben gern um einen bunten, wertlosen Glasperlentand, um ein paar Ellen schlechten und nur bunt gefärbten Kattuns Sachen her, an denen sie Tage und Wochen gearbeitet hatten, während die Händler in immer wachsender Gier nie genug für ihren Plunder bekommen konnten, den sie hier zum Verkauf ausgelegt hatten. Und doch wußten sie, daß sie in Callao von fremden, heimkehrenden Schiffen das Zehn- und Zwanzigfache der ausgelegten Kosten mit Leichtigkeit erhalten konnten.
Jetzt wurde auch um die Früchte gehandelt und Tabak unter die Eingeborenen verteilt, dessen Genuß sie alle schon kannten. Sie säumten auch nicht, sich ihm so rasch wie möglich hinzugeben, und ein paar von ihnen schnitten sich ohne weiteres ein Stück ab, wickelten es in schon zu dem Zweck mitgebrachte und eigens zubereitete Bananenblätter und liefen dann nach der Kambüse, um sich dort Feuer geben zu lassen.
Jetzt brannte die Zigarre, und stolz und selbstzufrieden blies der Insulaner den blauen Rauch in die Luft und warf dann unwillkürlich einen Blick nach seiner Insel hinüber. Er dachte schon im stillen daran, mit welchem Behagen er sich dort heute abend vor seiner Hütte ausstrecken und den aufwirbelnden Dampf in die Luft blasen werde. – Aber wo war die Insel? Unwillkürlich stieß er einen Ausruf des Erstaunens aus, und wenige Augenblicke später standen sämtliche Insulaner wie ein geschrecktes Rudel Wild mit gereckten Hälsen und scheuen Blicken aufgerichtet an der Reling und schauten nach dem Land zurück, das sie mit einer frischen Brise schon weit, weit zurückgelassen hatten.
»Felipe! Felipe!« tönte ihr Ruf aber bald nach dem Dolmetscher, denn die rasch hintereinander folgenden Fragen, die sie an die Mannschaft richteten, blieben natürlich unbeantwortet. »Felipe, wohin fährt der Kapitän? Er geht weit ab, wir können mit unseren Kanus nicht mehr zurück!«
Felipe schritt zwischen ihnen durch, aber er war ruhig und unbefangen.
»Ich habe den Kapitän eben gefragt«, sagte er; »da die Brise frischer wurde, fürchtete er, so dicht unter der Insel liegenzubleiben. Er dreht jetzt gleich wieder um. Bis euer Handel beendigt ist, hält er wieder vor der Einfahrt.« Die Männer beruhigten sich damit, denn sie waren schon manchmal auf einem Schiffe vor ihrer Insel auf und ab gekreuzt; aber die Frauen schienen ängstlich geworden zu sein und das Interesse an ihrem Handel verloren zu haben. Die meisten Gegenstände waren überhaupt abgesetzt, und sie sehnten sich zurück nach ihrem Land, nach festem Boden, zu den Ihrigen.
Der Supercargo hatte ihnen indessen eine Überraschung aufgespart, und zwar ein grell rotes Stück Zeug mit schwefelgelben Streifen, das ihnen außerordentlich in die Augen stach. Für kurze Zeit fesselte er ihre Aufmerksamkeit dadurch auch wirklich vollkommen, und die wenigen, die noch etwas zu verkaufen hatten, konnten der Verlockung nicht widerstehen. An andere wurden schmale Stücke, die etwa zu einem pareu oder Lendentuch hinreichten, als Geschenke verteilt, und alles drängte sich um ihn her; aber das Schiff hatte noch immer nicht gewendet, um nach ihrer Insel zurückzukehren, und sich inzwischen so weit davon entfernt, daß unter dem Horizont schon das flache Palmenland verschwand und die grünen Berge eine bläuliche Färbung annahmen.
Wieder wurde Felipe gerufen und zu dem Kapitän gesandt, und kam nach einer Weile mit der Meldung zurück, daß der Kapitän einen Sturm fürchte und vor Nacht nicht wagen dürfe, die Insel wieder anzulaufen.
»Dort geht ein Kanu!« lief da ein Schrei über Bord, und als sich die Augen der Eingeborenen dorthin richteten, sahen sie eins der losgerissenen Kanus auf den Wogen schwimmen, und während sie auf die Reling sprangen, um nach den übrigen zu sehen, trieb wieder und wieder eins davon.
Die Brise, die bis jetzt nur schwach gewesen war, hatte bei den wenigen Segeln, welche die Brigg führte, diese nur langsam vorwärts getrieben, so daß sich die leichten Kanus wohl so lange halten konnten. Jetzt aber waren mehr Segel gesetzt, die Brise hatte ebenfalls an Kraft zugenommen, und die leichten Boote konnten sich nicht mehr über Wasser halten. Sie schlugen um, füllten sich mit Wasser, und die dünnen Baststricke vermochten dem Druck nicht mehr standzuhalten. Ein Kanu nach dem andern löste sich und trieb ab.
Wieder wurde jetzt Felipe nach dem Kapitän gesandt, dieses Mal aber mit der Drohung, daß sie sein Schiff selber zurücklenken würden, wenn er jetzt nicht umdrehe, um sie heimzufahren. Dieses Mal aber kehrte der Verräter nicht zurück, denn er hielt sich zwischen den gereizten Insulanern nicht mehr sicher. Jedenfalls mußten sie sich erst wieder beruhigen und in das Unvermeidliche fügen lernen.
Eine unbeschreibliche Szene der Verwirrung entstand jetzt an Bord, denn zum erstenmal ahnten die Männer, daß sie verraten worden waren. Aber die wenigsten waren noch imstande, sich auf den Füßen zu halten, denn sonderbarerweise übte fast auf alle diese Leute, die von Jugend auf gewohnt gewesen waren, in ihren Kanus auf den Wogen zu schaukeln, die ungewohnte fremde Bewegung des großen Fahrzeugs ihre unheilvolle Wirkung aus. Sie wurden ernstlich seekrank, und während sich die Frauen auf Deck warfen und im Gefühle ihrer Krankheit und ihres Elendes winselten und wehklagten, kauerten die meisten Männer in stummem Jammer auf den Planken nieder, und nur wenige, von der Krankheit verschont, griffen die eben eingehandelten Beile und Messer auf und wollten die Kajüte stürmen.
Jetzt erst zeigte der Peruaner seine wahre Farbe. Acht oder zehn mit Musketen bewaffnete Matrosen sprangen vor und drohten, jeden niederzuschießen, der nicht augenblicklich seine Waffe an Deck werfe. Die Insulaner aber, die diese Drohung einesteils gar nicht verstanden, andernteils nicht achteten, warfen sich in blinder Wut auf das Gesindel, und ehe die Burschen, die mit Feuergewehren ebenfalls nicht besonders umzugehen wußten, von ihren Waffen ordentlich Gebrauch machen konnten, stürzten schon zwei oder drei, von den wütenden Beilhieben der Wilden getroffen, nieder.
Aber der Kapitän und der Supercargo waren auch keine müßigen Zuschauer geblieben, denn sie wußten recht gut, daß ihr Leben besonders gefährdet blieb, wenn die zur Wut gereizten Eingeborenen das Schiff nahmen. Mit Doppelgewehren bewaffnet, schossen sie rechts und links unter die Unglücklichen, von denen mehrere unter den scharfen Schüssen stürzten; selbst viele von denen wurden verwundet, die sich an dem Kampf gar nicht beteiligt hatten und krank in einem Winkel lehnten.
Den gefürchteten Feuerwaffen waren die Insulaner nicht gewachsen. In wilder Angst flüchteten sie nach vorn, und die Matrosen hatten jetzt leichte Arbeit, alle wehrhaften Männer zu binden und in das schon für sie hergerichtete Zwischendeck zu schaffen. Was dort die Nacht aus ihnen wurde, blieb sich gleich; jetzt galt es vor allen Dingen, das Deck wieder von den Spuren des Kampfes zu reinigen.
Umstände mit den Toten konnte man in dem heißen Klima überhaupt nicht machen. Sowie nur die Insulaner nach unten geschafft und die Luke geschlossen worden war, warf man die Leichen der Insulaner sowohl wie die der beiden Matrosen einfach über Bord. Dann wurde das Deck wieder abgewaschen und jetzt bewaffnete Wachen verteilt, die vollkommen genügten, jeden erneuten Versuch der hilflosen Insulaner unschädlich zu machen.
Alle Segel waren dabei gesetzt, und die »Libertad« lag mit einem starken Seitenwinde vollen Südkurs an, um so bald als irgend möglich die Passate zu verlassen. Erst dann durften sie hoffen, die amerikanische Küste, und zwar in der Nähe von Chile, anzulaufen, wo sie nachher die scharfen und regelmäßigen Südwinde trafen, die sie bald an der Küste hinab zu dem Ort ihrer Bestimmung, nach Callao, brachten.
An Bord des Guayaquil-Dampfers
Der Dampfer von Panama hatte sich, wie das gar nicht selten geschieht, verspätet und lief zwölf Stunden nach seiner gewöhnlichen Zeit Guayaquil in Ecuador an, um dort die Passagiere für Lima an Bord zu nehmen.
In Guayaquil war auch gerade wieder einmal Revolution, oder die eigentlich rechtmäßige Regierung Ecuadors, die ihren Sitz in Quito hatte, war es müde geworden, den Usurpator Granero mit seiner nichtswürdigen Partei den Süden des Reiches besetzen und die Bevölkerung mißhandeln zu sehen, und General Flores war eben mit seiner Armee im Anrücken, nachdem er den Usurpator aus seinem letzten Halt im innern Land, aus Bodegas, vertrieben hatte.
Der »Callao«, wie der Dampfer hieß, ankerte im Strome unmittelbar vor der Stadt neben einem peruanischen Kriegsschiff, das General Castilla zur Disposition Graneros dort stationiert hatte, um seinen Schützling, im Fall er besiegt werden sollte, an Bord zu nehmen. Die Passagiere aber, denen der unruhige Boden hier unter den Füßen brannte, kamen in einem Schwarm von Booten vom Lande abgefahren und an Bord. Wußte man doch nicht, wie die Eroberer, wenn sie wirklich die Stadt nahmen, darin wirtschaften würden, und wer kein eigenes Interesse darin hatte, suchte natürlich einer solchen Katastrophe so rasch als irgend möglich aus dem Wege zu gehen.
Eine gute Stunde herrschte auch an Bord des Dampfers selber die entsetzlichste Verwirrung, und Koffer, Kisten und Hutschachteln lagen in Haufen überall unordentlich im Weg herum, während kein Mensch wußte, wohin er gehöre, wo er bleiben solle, und niemand sich um ihn bekümmerte. War es doch gerade Essenszeit an Bord, und die Aufwärter hatten mehr zu tun, als den Fremden jetzt ihre Plätze anzuweisen.
Mitten in die Verwirrung schmetterte ein Kanonenschuß hinein, der vom Bord des Dampfers abgefeuert worden war, um seine Wiederabfahrt anzuzeigen. Er schien aber dieses Mal die Landbewohner mehr zu schrecken, wie die an Bord Befindlichen. Die Einwohner von Guayaquil betrachteten nämlich das vor ihren Häusern ankernde peruanische Dampfschiff schon die ganze Zeit sehr mißtrauisch, weil sie recht gut wußten, daß Peru die von Granero angestiftete Revolution aus allen Kräften unterstützte. Gerüchte hatten deshalb auch schon lange die Stadt durchlaufen, daß das Kriegsschiff den Ort bombardieren und in Trümmer schießen würde.
Als jetzt der Schuß genau von der Richtung des peruanischen Schiffes her fiel, lief alles bestürzt durcheinander. Dieses Mal aber sollten die Guayaquilener noch mit dem bloßen Schreck davon kommen. Es war nur der »Callao« gewesen, und seine Räder arbeiteten jetzt gegen die gewaltige Strömung des Guayaquil an, um das peruanische Kriegsschiff zu umfahren.
Da kam noch ein Boot vom Land ab mit einer Regierungsflagge an Bord. Hinten in seinem Stern stand ein Offizier und schwenkte eine kleine Flagge zum Zeichen für den Kapitän des Dampfers, daß er an Bord wolle. Der Engländer hatte das Zeichen auch wahrscheinlich bemerkt, denn er stand gerade auf dem dem Land zugedrehten Quarterdeck, gab aber keinen Befehl, die Maschine anzuhalten.
»Kapitän«, meldete da der wachthabende Offizier, »ein Regierungsboot wünscht noch an Bord zu kommen.«
»Dank' Ihnen, Mr. Gellinek«, sagte der Kapitän trocken. »Erstlich wissen wir vor der Hand gar nicht, wer hier Regierung ist und wer nicht, und dann hätte der Herr da drüben eben eine Viertelstunde früher abfahren sollen, wenn er zu uns an Bord kommen wollte. Wie wir jetzt laufen, glaub' ich schwerlich, daß er uns einholt!«
»Hallo the Steamer!« rief in diesem Augenblick eine Stimme vom Quarterdeck des peruanischen Kriegsdampfers den »Callao« an, und der Kapitän drehte sich überrascht danach um.
»Hallo?« fragte er zurück.
»Stop that boat!« lautete der Befehl; »Regierungs-Depesche will noch an Bord!«
»Stop that boat?« rief aber der Engländer erstaunt zurück; »wer, zum Henker, hat hier an Bord zu befehlen, Sie oder ich?«
»Auf Ihre Verantwortung!« schallte es zurück, und deutlich konnten sie hören, wie auf dem jetzt ganz nahen Kriegsdampfer der Befehl gegeben wurde, eine Kanone zu richten.
»You be damned!« war aber die einzige Erwiderung, die sie von dem alten Seemann bekamen, den sie mit einer solchen Drohung noch lange nicht einschüchtern konnten. Er fuhr unter englischer Flagge und wußte recht gut, daß sich die Peruaner zweimal besinnen würden, ehe sie feuerten. Es geschah auch in der Tat nichts Derartiges. Der »Callao« schwenkte herum, mit dem Bug stromab, und auf ein Zeichen des Kapitäns mußte der Mann am Steuer jetzt sogar so dicht an dem Peruaner vorbeistreifen, als es nur die Vierkant gebraßten Rahen beider Dampfer gestatteten, ohne sich gegenseitig zu berühren. Das Regierungsboot folgte dabei noch immer, da es wahrscheinlich vermutete, der Engländer würde erst wieder unterhalb des Peruaners beidrehen. Der dachte aber gar nicht daran. Als er das Kriegsschiff passiert hatte, hielt er weiter in den Strom hinaus, in das richtige Fahrwasser hinein, und zehn Minuten später war er schon so weit entfernt, daß man nicht einmal mehr die einzelnen Personen an Deck mit bloßen Augen unterscheiden konnte.
Fluchend hielt der Steuermann des Regierungsboots nach dem Ufer hinüber, um dicht daran der gewaltigen Strömung etwas besser ausweichen und den Platz wieder erreichen zu können, von dem er abgefahren war. Seine Depeschen nahm er natürlich wieder mit zurück.
An Bord des Dampfers hatten indessen nur wenige von dem kleinen Zwischenspiel etwas bemerkt, niemand auch nur darauf geachtet, denn die alten Passagiere waren schon durch des Kochs Klingel zum Diner gerufen worden, und die neuen quälten sich noch mit ihrem Gepäck ab, um Leute zu finden, die es ihnen in irgendeine Koje schaffen konnten. Sie wollten vor der Hand nur einen Platz haben, dann mußten sie selber sehen, daß sie etwas zu essen bekamen.
Unter den in Guayaquil an Bord gekommenen Passagieren befand sich auch ein junger, schlank gewachsener Mann mit offenen, freien Zügen. Er hatte dunkle Augen und rabenschwarzes, gelocktes Haar, dazu einen durch die Sonne tiefgebräunten Teint, so daß er recht gut als Sohn dieses Landes gelten konnte. Sein ganzes Benehmen war dabei das eines Mannes, der sich in den höheren Schichten der Gesellschaft bewegt hat, und der breitrandige, außerordentlich feine Panamahut, den er trug, verriet auch, daß er wohlhabend sein müsse. Irgendeinen Schmuck trug er nicht, obgleich weder ein Peruaner noch ein Ekuadorianer gern ohne eine goldene Uhrkette getroffen wird; nur am vierten Finger der linken Hand trug er einen einfachen goldenen Reif mit einem Brillanten.
Er vor allen anderen Passagieren hatte sich auch rasch und behaglich an Bord eingerichtet. Er kannte, wie es schien, den Mayordomo, und mit einem Trinkgeld, das er einem der Kajütenwärter in die Hand drückte, fand er sich bald allein in einer Koje untergebracht, während die übrigen zu dreien und selbst vieren kampieren mußten; eine höchst fatale Sache in den geschlossenen Räumen und dem heißen Klima. – Der junge Mann war keinesfalls zum erstenmal auf Reisen. Der Kapitän kannte ihn ebenfalls.
»Ah, Senor Aguila«, rief er ihm entgegen, als er ihm nach Tisch zuerst auf dem Quarterdeck begegnete, »sieht man Sie auch einmal wieder? Wo haben Sie die ganze Zeit gesteckt? In Europa?«
»Zum Teil, Kapitän«, lachte der junge Mann, indem er dem Engländer die Hand schüttelte, »und nachher hab' ich mir noch ein Stück von der Welt besehen.«
»Bis es Ihnen in der Graneroschen Wirtschaft da drüben zu heiß wurde, heh? Es soll aber zu Ende gehen, denn wie mir unser Agent sagte, kann sich der verdammte Sambo keine Nacht mehr halten.«
»Er wünschte Ihnen noch eine Bestellung aufzutragen«, lachte Aguila.
»Er soll zum Henker gehen!« brummte der Kapitän – »aber waren Sie lange in Guayaquil?«
»Nur seit dem letzten Dampfer. Ich wollte einige Freunde besuchen, hätte mir aber die Mühe ersparen können, denn es ist alles nach Quito geflüchtet.«
»Sie kamen von Panama herunter?«
»Ja, und will nach Hause.«
»Ach du lieber Gott«, seufzte der Kapitän, »ich wollte, ich könnte das auch sagen! Statt dessen aber fahre ich Jahr nach Jahr an dieser verbrannten Küste auf und ab. Aber was kann's helfen! Meine Zeit kommt ja wohl doch auch einmal, und bis dahin heißt's eben aushalten! Sind Sie gut eingerichtet an Bord?«
»Vortrefflich.«
»Desto besser« – und der Kapitän trat mit einem freundlichen Kopfnicken wieder in seine Kajüte hinein.
Aguila, oder Don Rafael, wie er von seinen Freunden genannt wurde, hatte indessen seine Mitpassagiere gemustert, aber es waren teils Fremde, Engländer, Franzosen oder Deutsche, die mit der westindischen Mail von Europa kamen, teils nichtssagende Gesichter von Landeskindern, deren Bekanntschaft zu machen es ihn nicht drängte. Ein befreundetes Gesicht fand er nicht und begnügte sich deshalb, die Leute stillschweigend zu mustern, wie sie eben bei ihrem Nachmittag-Spaziergang an Deck hin und her an ihm vorübergingen.
Ein reizendes Wesen zog dabei seine Aufmerksamkeit vor allen anderen auf sich. Es war ein junges Mädchen von vielleicht zweiundzwanzig Jahren, bildschön, von tadellosem Wuchs, mit rabenschwarzen Haaren und Augen, einem wahrhaft griechischen Profil, und dabei die Züge voller Leben, die Augen voll Glut und Feuer.
Ein junger, sehr elegant gekleideter Mann begleitete sie auf Deck und unterhielt sich mit ihr. Es war jedenfalls ein Nordländer – wie sich später herausstellte, ein Schwede – mit blonden Haaren und blauen Augen, aber sie unterhielten sich französisch miteinander, wie denn die junge Dame ebenfalls Französin sein mußte.
»Fräulein, Sie sind grausam«, hörte Don Rafael einmal ein paar abgebrochene Sätze, als sie unsern von ihm in ihrem Gespräch stehengeblieben waren.
»Grausam?« lautete die Rückfrage, »etwa weil ich offen und ehrlich die Wahrheit sage? Sie wollen mir nur nicht glauben, daß es die Wahrheit ist, und sollten mir gerade dankbar dafür sein!«





























