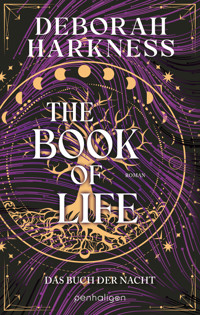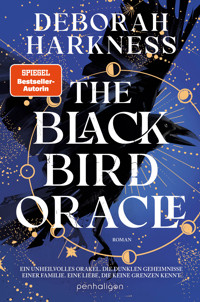12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: All Souls
- Sprache: Deutsch
Magie, Mystik, Liebe und Abenteuer: Hexe Diana und Vampir Matthew reisen in eine Ära der Spione und Intrigen …
Diana Bishop, Historikerin und Hexe, und Matthew Clairmont, Wissenschaftler und Vampir, haben es geschafft: Die Zeitreise in das historische London Elisabeths I. ist dank Dianas immer weiter erwachender Macht erfolgreich verlaufen. Doch kaum angekommen, wird die Liebe der beiden auf eine harte Probe gestellt, denn sie sind mitten in einer Welt der Intrigen, Spione und Geheimnisse gelandet. Geheimnisse, die auch Matthew betreffen und mit denen Diana lernen muss umzugehen. Ist ihre Verbindung stark genug, um dem standzuhalten? Und werden die beiden das Rätsel um das Manuskript Ashmole 782 nun endlich lösen?
Band 2 der opulenten Saga um die epische verbotene Liebe zwischen einer Hexe und einem Vampir.
Alle Bände der Reihe:
A Discovery of Witches – Die Seelen der Nacht
Shadow of Night – Wo die Nacht beginnt
The Book of Life – Das Buch der Nacht
Time’s Convert – Bis ans Ende der Ewigkeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1135
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Autorin
Deborah Harkness ist Professorin für europäische Geschichte an der University of Southern California in Los Angeles. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten erhielt sie bereits mehrfach Stipendien und Auszeichnungen. Ihre »All-Souls«-Reihe war ein großer internationaler Erfolg und wurde von den Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Der erste Band »Die Seelen der Nacht« ist unter dem Titel »A Discovery of Witches« für Sky verfilmt worden, die deutsche Fassung wurde im Frühjahr 2019 ausgestrahlt. Der neue Roman der SPIEGEL-Bestsellerautorin trägt den Titel »The Blackbird Oracle« und erscheint nach langen Jahren des Wartens weltweit im Sommer 2024.
DEBORAH HARKNESS
WO DIE NACHT BEGINNT
Roman
Deutsch von Christoph Göhler
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Shadow of Night« bei Viking, published by The Penguin Group, New York.Auszug aus John Keats: Endymion. Eine poetische Romanze: »John Keats, Werke und Briefe«, Stuttgart 1995, übertragen von Mirko Bonné Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Deborah Harkness
Copyright © 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock.com (bogadeva1983; Jozsef Bagota; ZinetroN)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
LH ∙ Herstellung: fe
ISBN 978-3-641-32726-2V001
www.penhaligon.de
Eine Hexe wider Willen. Ein 1500 Jahre alter Vampir. Ein geheimnisvolles Manuskript, bekannt als Ashmole 782. Die Geschichte beginnt mit einem Hexenfund.
Diana Bishop ist Historikerin mit Leib und Seele – und ihr Blut ist das eines großen Hexengeschlechts. Der rätselhafte Tod ihrer Eltern, zweier mächtiger Hexen, ließ sie jedoch einst der Magie abschwören und ihr mächtiges Erbe verleugnen. Ausgerechnet die Magie führt sie eines Tages in der berühmten Bodleian-Bibliothek von Oxford zu einem lang verschollenen, mysteriösen Manuskript, bekannt als Ashmole 782. Als sie spürt, welch große Macht in diesem Manuskript steckt, verbannt sie es sofort zurück in die Untiefen der Bibliothek. Aber bald findet Diana heraus, dass ihr Fund noch sehr viel außergewöhnlicher war, als sie dachte: Plötzlich ist jede Hexe, jeder Vampir und jeder Dämon der Stadt hinter ihr her, begierig auf die Geheimnisse des Manuskripts. Diese Wesen, die Seite an Seite mit den Menschen leben, glauben, dass Ashmole 782 wichtige Hinweise über die Entstehung der Arten, Menschen, Hexen, Vampire und Dämonen, die Vergangenheit und die Zukunft enthält. Ausgerechnet Matthew Clairmont, ebenfalls Akademiker, leidenschaftlicher Anhänger Darwins, äußerst attraktiv – und 1500 Jahre alter Vampir –, scheint ihr helfen zu wollen, die dunklen Gestalten, die sich um sie scharen, zu bekämpfen. Nachdem Diana ihre anfängliche Abneigung dem Vampir gegenüber abgelegt hat, machen sie sich gemeinsam auf, die Geheimnisse des Manuskripts zu enthüllen. Doch die Beziehung, die sich zwischen dem uralten Vampir und der gebannten Hexe entwickelt, macht die Situation nicht einfacher: Die Kongregation, der Konvent der Hexen, Vampire und Dämonen, hat strikte Regeln, was die Liebe betrifft, und der fragile Frieden zwischen den Arten und den Menschen wird durch die immer stärker werdende Anziehung zwischen den beiden noch geschwächt. Ist ihre Liebe stärker als die Regeln, stärker als die Zeit – vielleicht sogar stärker als das Leben selbst?
Die losen Fäden, die Geheimnisse des Manuskripts, führen sie schließlich in die Vergangenheit. Dank Dianas gewachsener Macht sind sie in der Lage, in der Zeit zurückzureisen, in das England Elisabeths I. …
Gemeinsam hoben wir die Füße und traten ein ins Ungewisse.
Teil 1 Woodstock: Die Old Lodge
Kapitel 1
Wir landeten wenig elegant in einem Haufen aus Hexe und Vampir. Matthew kam unter mir zu liegen, die Arme und Beine unnatürlich abgewinkelt. Ein dickes Buch klemmte zwischen uns, und durch den heftigen Aufschlag wurde mir die kleine Silberfigur aus der Hand geschlagen und schlitterte über den Boden davon.
»Haben wir es geschafft?« Ich kniff die Augen zu, aus Angst, wir könnten uns immer noch in Sarahs ländlicher Hopfenscheune im Amerika des 21. Jahrhunderts befinden und nicht im Oxfordshire des 16. Jahrhunderts. Allerdings sagten mir die ungewohnten Düfte, dass wir nicht mehr in meiner Zeit und meiner Heimat waren. Nach süßem Gras roch es hier und sommerlich nach Wachs. Gleichzeitig lag ein Anflug von Holzrauch in der Luft, und ich hörte ein Feuer knistern.
»Sieh dich um, Diana, und überzeuge dich selbst.« Federleicht strichen kühle Lippen über meine Wange, dann hörte ich ein leises Lachen. Augen, grau wie das Meer im Sturm, blickten mich aus einem Gesicht an, das so bleich war, dass es nur einem Vampir gehören konnte. Matthews Hände strichen von meinem Hals abwärts über meine Schultern. »Ist bei dir alles in Ordnung?«
Nach der weiten Reise in Matthews Vergangenheit fühlte ich mich, als würde mein Körper beim leisesten Windstoß in tausend Teile zerstieben. So hatte sich das nach unseren kurzen Zeitreise-Übungen im Haus meiner Tante ganz und gar nicht angefühlt.
»Es geht schon. Was ist mit dir?« Ich hatte immer noch Angst, mich umzusehen, und blickte weiterhin ausschließlich den unter mir liegenden Matthew an, der es seinerseits offensichtlich nicht eilig hatte, seine Last loszuwerden.
»Ich bin froh, wieder daheim zu sein.« Matthew ließ den Kopf auf den Holzboden sinken und sog gierig den Duft der darauf verstreuten Binsen und Lorbeerzweige ein. Auch im Jahr 1590 fühlte er sich in der Old Lodge sichtlich zu Hause.
Allmählich gewöhnten sich meine Augen an das matte Licht. Ein stabiles Bett, ein kleiner Tisch, schmale Bänke und ein einzelner Sessel schälten sich aus dem Dunkel heraus. Hinter den mit Schnitzereien verzierten Pfosten des Himmelbetts sah ich einen Durchgang in einen weiteren Raum. Von dort aus ergoss sich in einem verzerrten goldenen Rechteck Licht über den Boden und die Bettdecke. Die Wände waren mit denselben gefalteten Holzpaneelen vertäfelt, die mir schon im 21. Jahrhundert bei meinen Besuchen in Matthews Heim in Woodstock aufgefallen waren. Ich legte den Kopf in den Nacken und sah zur Decke hoch. Sie war dick verputzt, in Kassetten unterteilt, und jede Vertiefung war golden grundiert und mit einer strahlend rot-weißen Tudor-Rose verziert.
»Die Rosen waren eine Auflage, damit ich das Haus bauen durfte«, kommentierte Matthew spröde. »Ich finde sie schrecklich. Wir werden sie weiß überstreichen, sobald es sich machen lässt.«
Die Flammen über der Kerze auf dem Tisch flackerten in einem Luftzug, beleuchteten dabei die untere Ecke eines sattbunten Wandteppichs und brachten die dunklen, glänzenden Fäden zum Leuchten, mit denen das Blätter- und Früchtemuster der hellen Tagesdecke auf dem Bett eingefasst war. So schimmerten keine modernen Stoffe.
Plötzlich war ich sehr aufgeregt und musste unwillkürlich lächeln. »Ich habe es wirklich geschafft. Ich habe nicht gepatzt oder uns sonstwohin geschickt, nach Monticello zum Beispiel oder …«
»Nein.« Er lächelte ebenfalls. »Du hast das ganz wunderbar gemacht. Willkommen im England Elisabeths I.«
Zum ersten Mal in meinem Leben war ich überglücklich, eine Hexe zu sein. Als Historikerin hatte ich die Vergangenheit studiert. Als Hexe konnte ich sie tatsächlich besuchen. Wir waren ins Jahr 1590 gereist, weil ich in der vergessenen Kunst der Magie unterrichtet werden sollte, doch es gab hier für mich noch so viel mehr zu lernen. Ich wollte mich gerade vorbeugen, um das mit einem Kuss zu feiern, als eine Tür quietschte und mich innehalten ließ.
Matthew legte einen Finger auf meine Lippen. Er drehte den Kopf zur Seite, und seine Nasenflügel begannen zu beben. Im nächsten Moment entspannte er sich wieder, weil er erkannt hatte, wer sich nebenan aufhielt, wo inzwischen ein leises Rascheln zu hören war. In einer geschmeidigen Bewegung griff Matthew nach dem Buch, stand auf und zog mich hoch. Dann nahm er mich an der Hand und führte mich zur Tür.
Im Zimmer nebenan stand ein Mann mit zerzaustem braunem Haar an einem mit Briefen übersäten Tisch. Der Fremde, der uns den Rücken zukehrte, war durchschnittlich groß und schlank und trug teure, maßgeschneiderte Kleider. Er summte eine mir unbekannte Melodie und durchsetzte sie mit einzelnen Worten, die er allerdings zu leise sang, als dass ich sie hätte verstehen können. »Wo versteckt Ihr Euch nur, mein holder Matt?« Der Mann hielt ein Blatt Papier gegen das Licht.
»Sucht Ihr etwas, Kit?« Auf Matthews Frage hin ließ der junge Mann das Blatt fallen und wandte sich zu uns um. Sein Gesicht erstrahlte. Ich hatte dieses Gesicht schon einmal gesehen, auf meiner Taschenbuchausgabe von Christopher Marlowes Der Jude von Malta.
»Matt! Pierre sagte, Ihr wärt in Chester und würdet vielleicht nicht rechtzeitig heimkehren. Aber ich wusste, dass Ihr unsere jährliche Zusammenkunft nicht missen wolltet.« Die Worte klangen vertraut, wurden aber in einem so fremdartigen Tonfall vorgetragen, dass ich konzentriert zuhören musste, um alles zu verstehen. Das elisabethanische Englisch unterschied sich längst nicht so sehr von dem der Moderne wie allgemein angenommen, aber es war auch nicht so leicht zu verstehen, wie ich aufgrund meiner intensiven Beschäftigung mit den Stücken Shakespeares gehofft hatte.
»Wo ist Euer Bart abgeblieben? Wart Ihr krank?« Marlowes Blick fiel auf mich, und ich spürte jenen sanften Druck auf meiner Haut, der den Dämon verriet.
Ich musste mich beherrschen, um nicht auf einen der größten Dramatiker Englands zuzustürmen, seine Hand zu schütteln und ihn mit Fragen zu bombardieren. Selbst das Wenige, das ich über ihn wusste, war wie weggeblasen, als ich ihn so vor mir stehen sah. Waren seine Stücke im Jahr 1590 schon aufgeführt worden? Wie alt war er? Sicherlich jünger als Matthew und ich. Marlowe konnte noch keine dreißig sein. Ich lächelte ihn freundlich an.
»Wo in aller Welt habt Ihr das da aufgetrieben?« Marlowe streckte den Zeigefinger in unsere Richtung, und seine Stimme triefte vor Verachtung. Ich rechnete fest damit, hinter mir ein misslungenes Kunstwerk vorzufinden, und drehte mich um. Aber da war nur Leere.
Er meinte mich. Mein Lächeln erstarb.
»Sachte, Kit«, warnte Matthew ihn finster.
Marlowe tat die Ermahnung mit einem Achselzucken ab. »Spielt ja auch keine Rolle. Wenn Ihr müsst, dann tut Euch an ihr gütlich, bis die anderen kommen. George ist natürlich schon länger hier, verschlingt Euer Essen und Eure Bücher. Er ist immer noch auf der Suche nach einem Förderer und nach wie vor ohne einen roten Heller.«
»Selbstverständlich darf sich George an allem, was mir gehört, gütlich tun.« Mit ernster Miene und ohne den jungen Mann aus den Augen zu lassen, hob Matthew unsere verschränkten Finger an seine Lippen. »Diana, dies ist mein teurer Freund Christopher Marlowe.«
Matthews Bemerkung gab Marlowe Gelegenheit, mich offen zu taxieren. Sein Blick kroch von meinen Zehenspitzen aufwärts bis zum Scheitel. Die Verachtung war ihm deutlich anzusehen, seine Eifersucht dagegen verstand er zu verbergen. Marlowe war tatsächlich in meinen Gemahl verliebt. Der Verdacht war mir schon in Madison gekommen, als ich mit den Fingern über die Widmung in Matthews Ausgabe des Doktor Faustus gefahren war.
»Ich wusste gar nicht, dass es in Woodstock ein Bordell gibt, das sich auf Riesinnen spezialisiert hat. Sonst sind Eure Huren deutlich feingliedriger und attraktiver, Matthew. Die hier ist eindeutig eine Amazone.« Kit drehte sich schniefend zu den Papieren um, die sich auf dem Tisch häuften. »Der alte Fuchs hat berichtet, Euch hätte Geschäftliches und nicht die Lust gen Norden geführt. Wie habt Ihr die Zeit gefunden, Euch ihre Dienste zu sichern?«
»Es ist schon bemerkenswert, Kit, wie schnell Ihr jede Zuneigung zu ersticken versteht«, antwortete Matthew gedehnt, aber mit warnendem Unterton. Marlowe gab vor, sich ganz auf die Schriftstücke zu konzentrieren, schmunzelte in sich hinein und tat so, als wäre nichts gewesen. Matthews Finger schlossen sich fester um meine.
»Heißt sie wirklich Diana, oder hat sie diesen Namen angenommen, damit ihre Kunden sie reizvoller finden? Vielleicht sollte sie ihre rechte Brust entblößen oder sich mit Pfeil und Bogen ausstaffieren«, schlug Marlowe vor, während er nach einem Blatt griff. »Wisst Ihr noch, wie Bess aus Blackfriars von uns verlangte, sie Aphrodite zu nennen, bevor sie sich uns …«
»Diana ist meine Gemahlin.« Matthew hatte mich stehen lassen, und seine Hand umklammerte nicht mehr meine Finger, sondern Marlowes Kragen.
»Nein.« Kit war anzusehen, wie entsetzt er war.
»Doch. Das heißt, dass sie die Herrin dieses Hauses ist, meinen Namen trägt und unter meinem persönlichen Schutz steht. In Anbetracht all dessen – und unserer langjährigen Freundschaft natürlich – wird fortan kein unziemliches Wort und kein Zweifel an ihrer Tugend mehr über Eure Lippen kommen.«
Ich bewegte die schmerzenden Finger. Matthew hatte so wütend zugedrückt, dass sich der Ring an meiner linken Hand ins Fleisch gepresst und einen hellroten Abdruck hinterlassen hatte. Obwohl der Diamant in der Fassung facettenlos geschliffen war, fing er die Wärme des Kaminfeuers ein. Den Ring hatte ich ganz unerwartet von Matthews Mutter Ysabeau geschenkt bekommen. Vor wenigen Stunden – vor einigen hundert Jahren? – in einigen hundert Jahren? – hatte Matthew ein uraltes Ehegelöbnis gesprochen und den Diamantring auf meinen Ringfinger geschoben.
Wir hörten Geschirr klappern, und im selben Moment betraten zwei Vampire den Raum. Der eine war ein schlanker Mann mit ausdrucksvollem, wettergegerbtem Gesicht, schwarzem Haar und schwarzen Augen. In seinen haselnussbraunen Händen hielt er eine Weinkaraffe und ein Weinglas mit einem Delfin als Stiel, auf dessen Schwanzflosse der Kelch aufsaß. Begleitet wurde der Mann von einer grobknochigen Frau, die eine Platte mit Brot und Käse trug.
»Ihr seid zu Hause, Milord.« Der Mann war offenkundig überrascht. Merkwürdigerweise konnte ich ihn wegen seines französischen Akzents besser verstehen als Marlowe. »Der Bote sagte am Donnerstag noch …«
»Meine Pläne haben sich geändert, Pierre.« Matthew wandte sich an die Frau. »Meine Gemahlin verlor auf der Reise ihr ganzes Hab und Gut, Françoise, und die Kleider, die sie trug, waren so verschmutzt, dass ich sie verbrennen musste.« Er log dreist und ohne jeden Skrupel. Weder die Vampire noch Kit sahen aus, als würden sie ihm ein Wort glauben.
»Eure Gemahlin?« Françoises französischer Akzent war genauso ausgeprägt wie der von Pierre. »Aber sie ist eine …«
»Warmblüterin«, fiel ihr Matthew ins Wort und nahm Pierre den Weinkelch ab. »Sagt Charles, dass wir einen weiteren Magen zu füllen haben. Diana fühlt sich in letzter Zeit nicht recht wohl und muss auf Anraten ihres Arztes viel frisches Fleisch und frischen Fisch essen. Jemand wird auf den Markt gehen müssen, Pierre.«
Pierre blinzelte. »Sehr wohl, Milord.« Er sprach das englische »Mylord« mit französischem I aus.
»Außerdem wird sie etwas anzuziehen brauchen«, bemerkte Françoise und schätzte gleichzeitig meine Maße ab. Auf Matthews Nicken hin verschwand sie, dicht gefolgt von Pierre.
»Was ist mit deinem Haar passiert?« Matthew hielt eine rötliche Haarsträhne zwischen den Fingern.
»O nein«, murmelte ich und fasste mir an den Kopf. Statt in mein gewohntes schulterlanges, strohblondes Haar griff ich in rotgoldene Locken, die mir bis zur Taille reichten. Das letzte Mal hatten meine Haare ein solches Eigenleben entwickelt, als ich am College in einer Hamlet-Aufführung die Ophelia spielen sollte. Damals wie jetzt waren das plötzliche Wachstum und die Farbveränderung kein gutes Zeichen. Offenbar war auf unserer Reise in die Vergangenheit die Hexe in mir erwacht. Und niemand konnte wissen, welche Magie dabei entfesselt worden war.
Vampire hätten vielleicht das einschießende Adrenalin und meine plötzliche Angst gerochen, oder sie hätten gehört, wie mein Blut zu singen begann. Kit als Dämon hingegen spürte, wie meine Hexenenergie anstieg.
»Beim Grab unseres Erlösers.« Marlowe lächelte schadenfroh. »Ihr habt eine Hexe mitgebracht. Was hat sie denn angestellt?«
»Lasst es gut sein, Kit. Das soll nicht Eure Sorge sein.« Matthews Stimme klang sofort energisch, aber seine Finger strichen weiter liebevoll durch mein Haar. »Mach dir keine Sorgen, mon cœur. Das ist bestimmt nur die Erschöpfung.«
Mein sechster Sinn widersprach ihm heftig. Diese Veränderung ließ sich nicht mit schlichter Müdigkeit erklären. Ich war zwar von der Abstammung her eine Hexe, aber ich hatte nie Gelegenheit gehabt herauszufinden, welche Kräfte ich eigentlich von meinen Eltern geerbt hatte. Nicht einmal meine Tante Sarah und ihre Lebensgefährtin Emily Mather – beides Hexen – hatten mit Sicherheit sagen können, welche magischen Fähigkeiten ich besaß und wie ich sie beherrschen konnte. Matthew hatte zwar mein Blut analysiert und dabei die verschiedenen genetischen Marker für mein magisches Potential herausgefiltert, aber niemand konnte sagen, ob oder wann diese Erbanlagen aktiv würden.
Bevor ich mir noch mehr Sorgen machen konnte, kehrte Françoise mit etwas zurück, das wie eine lange Stopfnadel aussah. Zwischen ihren Lippen klemmten zahllose Stecknadeln. Begleitet wurde sie von einem wandelnden Berg an Samt, Wolle und Leinen, unter dem Pierres schlanke braune Beine hervorschauten.
»Wofür sind die?«, fragte ich misstrauisch und deutete auf die Nadeln.
»Dafür, dass wir Madame hier hineinbekommen natürlich.« Françoise zog eine Art braunen Mehlsack von dem Kleiderstapel. Das Gewand sah nicht gerade besonders vornehm oder elegant aus, aber da ich in Sachen elisabethanischer Mode nicht auf dem Laufenden war, verkniff ich mir jeglichen Kommentar.
»Geht nach unten, wo Ihr hingehört, Kit«, befahl Matthew seinem Freund. »Wir kommen in Kürze nach. Und hütet Eure Zunge. Es ist nicht an Euch, diese Geschichte zu erzählen.«
»Wie Ihr wünscht.« Marlowe zupfte am Saum seines rotbraunen Wamses, eine scheinbar lässige Geste, bei der ihn nur das Zittern seiner Hände verriet, und verbeugte sich knapp und ironisch.
Als der Dämon gegangen war, legte Françoise den Mehlsack über eine Bank, begann mich zu umkreisen und inspizierte mich, um festzustellen, wo sie ihren Angriff am besten starten sollte. Mit einem verärgerten Seufzen begann sie mich anzukleiden. Matthew trat an den Tisch und beugte sich über die Papiere, die darauf verstreut lagen. Er öffnete ein korrekt gefaltetes rechteckiges Päckchen, das mit einem rosa Wachsklecks versiegelt war, und überflog dann die eng beschriebenen Zeilen.
»Dieu. Das hatte ich ganz vergessen. Pierre!«
»Milord?«, drang eine gedämpfte Stimme aus dem Stoffberg.
»Leg das ab, und erzähl mir, worüber Lady Cromwell sich diesmal beschwert.« Matthew behandelte Pierre und Françoise mit einer perfekten Mischung aus Vertraulichkeit und Autorität. Wenn man im sechzehnten Jahrhundert so mit seinen Bediensteten umging, würde ich noch einige Zeit brauchen, bevor ich diese Kunst beherrschte.
Die beiden Männer unterhielten sich leise am Kamin, während ich in etwas Vorzeigbares gesteckt, geheftet und geschnürt wurde. Françoise schüttelte den Kopf, als sie meinen Ohrring mit den verschlungenen Golddrähten sah, an denen Edelsteine hingen, die ursprünglich Ysabeau gehört hatten. Zusammen mit Matthews Ausgabe des Doktor Faustus und der kleinen silbernen Dianastatue hatte der Ohrring uns in dieses Jahr zurückgelotst. Françoise kramte in einer Kommode und hatte im Handumdrehen das passende Gegenstück gefunden. Nachdem die Schmuckfrage geregelt war, rollte sie dicke Strümpfe über meine Knie und befestigte sie mit scharlachroten Bändern.
»Ich glaube, ich bin so weit.« Ich konnte es kaum erwarten, ins Erdgeschoss zu gehen und unseren Besuch im sechzehnten Jahrhundert zu beginnen. Bücher über die Vergangenheit zu lesen war etwas ganz anderes, als sie zu erleben, wie mein kurzer Kontakt mit Françoise und mein Crashkurs in elisabethanischer Kleidung bewiesen.
Matthew begutachtete meine Aufmachung. »Damit ist sie vorzeigbar – fürs Erste.«
»Damit ist sie nicht nur vorzeigbar, sondern vor allem so unauffällig, dass man sie gleich wieder vergisst«, verbesserte Françoise, »und genauso sollte eine Hexe in diesem Hause aussehen.«
Matthew überging Françoise’ Bemerkung und wandte sich mir zu. »Wenn wir gleich nach unten gehen, dann sprich nur das Nötigste, Diana. Kit ist ein Dämon, und George weiß, dass ich ein Vampir bin, aber selbst der aufgeschlossenste Geist wird argwöhnisch, wenn er unerwartet auf jemand Neuen und Andersartigen trifft.«
Unten im großen Saal wünschte ich George – Matthews groschen- und gönnerlosem Freund – formvollendet und, wie ich glaubte, in perfektem elisabethanischem Englisch einen guten Abend.
»Spricht die Frau Englisch?« George sah mich mit weit aufgerissenem Mund an und spähte dabei durch dicke runde Brillengläser, die seine blauen Augen grotesk verzerrten. Die eine Hand hatte er in die Hüfte gestemmt. So eine Pose hatte ich zum letzten Mal auf einem Gemälde im Victoria and Albert Museum gesehen.
»Sie kommt aus Chester«, erklärte Matthew eilig. George wirkte nicht überzeugt. Offenbar konnte nicht einmal die Wildnis Nordenglands meine merkwürdige Sprechweise erklären. Matthew hatte sich automatisch dem Tonfall und Sprachmuster der damaligen Zeit angepasst, aber ich klang unüberhörbar modern und amerikanisch.
»Sie ist eine Hexe«, korrigierte Kit und nahm einen Schluck Wein.
»Wahrhaftig?« George studierte mich mit neu erwachtem Interesse. Ich spürte keinen leisen Druck, der darauf hingedeutet hätte, dass der Mann ein Dämon war, kein hexentypisches Kribbeln und auch nicht die frostige Kälte eines Vampirblicks. George war ein ganz gewöhnlicher, warmblütiger Mensch – der schon etwas älter und müder war, offenbar hatte das Leben an ihm gezehrt. »Aber Ihr mögt Hexen genauso wenig wie Kit, Matthew. Ihr habt mir stets abgeraten, mich mit diesem Thema zu befassen. Als ich ein Gedicht über Hekate verfassen wollte, meintet Ihr …«
»Diese Hexe hier mag ich aber. Und zwar so sehr, dass ich sie geheiratet habe«, unterbrach ihn Matthew und setzte einen festen Kuss auf meine Lippen, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Geheiratet!« George warf Kit einen kurzen Blick zu. Dann räusperte er sich. »Demnach gibt es also gleich zwei unerwartete Ereignisse zu feiern: Ihr wurdet nicht in Geschäften aufgehalten, wie Pierre glaubte, und Ihr seid mit einer Gemahlin zu uns zurückgekehrt. Meine Glückwünsche!« Sein bräsiger Tonfall erinnerte mich an eine Abschlussrede an der Universität. Ich verkniff mir ein Schmunzeln, und George reagierte mit einem strahlenden Lächeln und einer Verbeugung. »Ich bin George Chapman, Mistress Roydon.«
Der Name klang vertraut. Ich durchforstete das unsortierte Wissen in meinem Historikerhirn. Chapman war jedenfalls kein Alchemist – das war mein Fachgebiet, und sein Name tauchte nicht in den Arealen auf, die mein Hirn für dieses obskure Fach reserviert hatte. Sicher war er Schriftsteller, genau wie Marlowe, aber mir wollte keines seiner Werke einfallen.
Nachdem wir einander vorgestellt worden waren, bat Matthew uns an den Kamin. Dort sprachen die Männer über Politik, wobei George sich redlich bemühte, mich in die Unterhaltung einzubeziehen, indem er sich nach dem Zustand der Straßen und dem Wetter auf meiner Reise erkundigte. Ich antwortete so ausweichend wie möglich und bemühte mich gleichzeitig, mir all die kleinen Gesten und Ausdrücke einzuprägen, die mir helfen würden, als Elisabethanerin durchzugehen. George sonnte sich in meiner Aufmerksamkeit und belohnte sie mit einer langen Abhandlung über seine neuesten literarischen Bemühungen. Kit, dem es gar nicht gefiel, in eine Nebenrolle gedrängt zu werden, fuhr George in die Parade, indem er anbot, aus seinem Doktor Faustus vorzulesen.
»Eine Lesung unter Freunden«, verkündete der Dämon mit glänzenden Augen. »Als Test gewissermaßen vor einer späteren Aufführung.«
»Nicht heute, Kit. Es ist schon nach Mitternacht, und Diana ist müde nach der langen Reise«, sagte Matthew und half mir aus meinem Sessel.
Kit ließ uns nicht aus den Augen, bis wir den Raum verlassen hatten. Er wusste, dass wir etwas verheimlichten. Bei jeder unzeitgemäßen Redewendung, die mir im Laufe des Gesprächs entschlüpft war, hatte er aufgehorcht, und besonders nachdenklich war er geworden, als Matthew sich nicht erinnern konnte, wo seine Laute lag.
Bevor wir aus Madison aufgebrochen waren, hatte Matthew mich gewarnt, dass Kit außergewöhnlich scharfsichtig war, sogar für einen Dämon. Ich fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis Marlowe herausfand, was wir tatsächlich verbargen. Meine Frage sollte innerhalb weniger Stunden beantwortet werden.
Am nächsten Morgen lagen wir plaudernd und geborgen in unserem warmen Bett, während der Haushalt allmählich erwachte.
Anfangs beantwortete Matthew bereitwillig meine Fragen nach Kit (dem Sohn eines Schusters, wie sich herausstellte) und George (der zu meiner Überraschung nicht viel älter war als Marlowe). Doch als ich mich nach den praktischen Aspekten der Haushaltsführung erkundigte und wissen wollte, wie sich eine elisabethanische Frau zu verhalten hatte, begann er sich schon bald zu langweilen.
»Was ist mit meinen Kleidern?« Ich gab mir alle Mühe, ihn für meine Sorgen zu interessieren.
»Ich glaube nicht, dass verheiratete Frauen in so etwas schlafen«, sagte Matthew und begann an dem feinen Leinen meines Nachthemds herumzuspielen. Er löste das Band des Rüschenkragens und wollte gerade einen Kuss unter mein Ohr setzen, um mich zu überzeugen, dass meine Kleidung nicht weiter wichtig war, als jemand den Vorhang unseres Himmelbettes zur Seite riss. Ich blinzelte gegen die Sonnenstrahlen an.
»Und?«, wollte Marlowe wissen.
Ein zweiter dunkelhäutiger Dämon schielte über Marlowes Schulter. Mit seinem dünnen Körper und dem spitzen Kinn, an dem ein ebenso spitzer brauner Bart spross, erinnerte er an einen energiegeladenen Kobold. Seine Haare hatten offensichtlich seit Wochen keinen Kamm gesehen. Notdürftig bedeckte ich meinen Körper mit den Händen, denn mir war schlagartig bewusst, wie dünn mein Nachthemd war und dass ich nichts darunter trug.
»Ihr habt Master Whites Zeichnungen aus Roanoke gesehen, Kit. Die Hexe sieht ganz und gar nicht aus wie eine Ureinwohnerin aus Virginia«, erwiderte der fremde Dämon enttäuscht. Erst jetzt bemerkte er Matthew, der ihn wutentbrannt fixierte. »Ah. Guten Morgen, Matthew. Gestattet Ihr, dass ich mir Euren geometrischen Kompass ausleihe? Ich verspreche auch, ihn diesmal nicht an den Fluss mitzunehmen.«
Matthew ließ die Stirn auf meine Schulter sinken und schloss stöhnend die Augen.
»Sie muss aus der Neuen Welt stammen – oder aus Afrika.« Marlowe weigerte sich beharrlich, meinen Namen in den Mund zu nehmen. »Sie kommt weder aus Chester, noch stammt sie aus Schottland, Irland, Wales, Frankreich oder den Kolonien. Und ich glaube nicht, dass sie eine Holländerin oder Spanierin ist.«
»Euch auch einen guten Morgen, Tom. Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb Ihr um diese Zeit und in meinem Schlafzimmer über Dianas Herkunft streiten müsst?« Matthew zog die Bänder meines Nachthemds wieder zu.
»Das Wetter ist viel zu schön, um im Bett zu liegen, selbst wenn einen der Schüttelfrost um den Verstand bringt. Kit behauptet, Ihr hättet die Hexe im Fieberwahn geheiratet. Anders ließe sich diese Torheit nicht erklären.« Tom plapperte auf Dämonenart los und machte keine Anstalten, Matthews Frage zu beantworten. »Die Straßen waren trocken, und wir sind bereits vor Stunden eingetroffen.«
»Und schon jetzt ist der Wein aus«, beschwerte sich Marlowe.
»Wir«? Es waren also noch mehr Gäste gekommen? Dabei hatte ich schon jetzt das Gefühl, dass es in der Old Lodge entschieden zu voll war.
»Raus! Madame muss sich waschen, bevor sie seine Lordschaft begrüßt.« Françoise betrat mit einer dampfenden Wasserschüssel den Raum. Wie üblich trottete Pierre ihr hinterher.
»Hat sich etwas von Bedeutung ereignet?«, wollte George durch die Vorhänge hindurch wissen. Still und leise hatte er den Raum betreten und damit Françoise’ Bemühungen, die anderen Männer aus dem Zimmer zu scheuchen, vereitelt. »Lord Northumberland wurde allein unten im großen Saal sitzen gelassen. Wäre er mein Förderer, würde ich ihn nicht so behandeln!«
»Hal liest gerade eine Abhandlung über die Konstruktion einer Waage, die mir ein Mathematiker aus Pisa gesandt hat. Damit ist er vollauf beschäftigt«, erwiderte Tom säuerlich und ließ sich auf der Bettkante nieder.
Offenbar sprach er über Galileo, begriff ich. Im Jahr 1590 hatte Galileo als Dozent an der Universität von Pisa gelehrt. Sein Werk über die Waage war da noch nicht veröffentlicht.
Tom. Lord Northumberland. Jemand, der mit Galileo korrespondierte.
Mein Kiefer klappte nach unten. Der Dämon, der auf unserer Steppdecke saß, musste Thomas Harriot sein.
»Françoise hat recht. Raus. Und zwar alle.« Matthew richtete sich auf.
»Was sollen wir Hal sagen?«, wollte Kit wissen und warf einen vielsagenden Blick in meine Richtung.
»Dass ich gleich hinunterkommen werde«, sagte Matthew. Er wälzte sich herum und zog mich an seine Seite.
Ich wartete, bis Matthews Freunde aus dem Raum defiliert waren, dann boxte ich ihn gegen die Brust.
»Wofür war das denn?« Er wand sich unter gespielten Schmerzen, dabei hatte ich mir bei dem Schlag nur die Faust geprellt.
»Dafür, dass du mir nicht erzählt hast, wer deine Freunde sind!« Ich stützte mich auf einen Ellbogen und sah ihn finster an. »Der berühmte Dramatiker Christopher Marlowe. Der Dichter und Gelehrte George Chapman. Der Mathematiker und Astronom Thomas Harriot, wenn ich mich nicht sehr irre. Und unten wartet der ›Hexenmeister‹, der Earl Henry Percy of Northumberland!«
»Ich weiß nicht, wann Henry diesen Spitznamen bekommen hat, aber so nennt ihn hier niemand.« Matthew sah mich amüsiert an, was mich noch wütender machte.
»Jetzt fehlt nur noch Sir Walter Raleigh, und schon haben wir die gesamte Schule der Nacht beisammen.« Matthew schaute aus dem Fenster, als ich die legendäre Gruppierung von Umstürzlern, Philosophen und Freidenkern erwähnte. Thomas Harriot, Christopher Marlowe, George Chapman, Walter Raleigh. Und …
»Wer genau bist du hier, Matthew?« Ich war gar nicht auf die Idee gekommen, ihn das vor unserer Abreise zu fragen.
»Matthew Roydon«, antwortete er mit einem freundlichen Nicken, als wären wir uns eben vorgestellt worden. »Der Dichterfreund.«
»Die Geschichtsschreiber wissen praktisch nichts über dich«, sagte ich verdattert. Matthew Roydon war die undurchsichtigste Gestalt aus dem Dunstkreis der mysteriösen Schule der Nacht.
»Jetzt, wo du weißt, wer Matthew Roydon in Wahrheit ist, überrascht dich das doch nicht?« Eine schwarze Braue hob sich.
»Ach, in den letzten Monaten wurde ich so oft überrascht, dass es für ein ganzes Leben reicht. Trotzdem hättest du mich warnen können, bevor du mich hier abgesetzt hast.«
»Was hättest du dann getan? Bevor wir aufgebrochen sind, hatten wir kaum die Muße, uns umzuziehen, und ganz bestimmt keine Zeit für ein Forschungsprojekt.« Er setzte sich auf und schwang die Beine auf den Boden. Unsere traute Zweisamkeit war von beklagenswert kurzer Dauer gewesen. »Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Das sind bloß gewöhnliche Männer, Diana.«
Ganz gleich, was Matthew sagte, an diesen Männern war nichts gewöhnlich. Die Schule der Nacht hatte häretische Ansichten vertreten, sich über die Korruption am Hof von Königin Elisabeth mokiert und den intellektuellen Größenwahn von Kirche und Universitäten entlarvt. »Verrückt, böse und ein gefährlicher Freundeskreis«, beschrieb diese Gruppe perfekt. Wir hatten uns nicht zu einer friedlichen Runde gesellt, die sich in aller Freundschaft an Halloween traf. Wir waren in ein Hornissennest elisabethanischer Unruhestifter gefallen.
»Mal abgesehen davon, dass deine Freunde wirklich rücksichtslos sein können und Vorsicht geboten ist, darfst du nicht von mir erwarten, dass ich völlig ungerührt bleibe, wenn du mich Leuten vorstellst, mit denen ich mich seit meinem ersten Semester an der Uni beschäftigt habe«, tadelte ich ihn. »Thomas Harriot ist einer der führenden Astronomen seiner Zeit. Dein Freund Henry Percy ist Alchemist.« Pierre, der offenbar spürte, wann einer Frau die Nerven durchzugehen drohten, streckte meinem Gemahl hastig eine schwarze Reithose hin, damit er nicht barbeinig dastand, wenn sich mein Zorn endgültig Luft machte.
»Genau wie Walter und Tom.« Matthew ignorierte die dargebotene Hose und kratzte sich am Kinn. »Sogar Kit versucht sich stümperhaft als Alchemist, allerdings ohne Erfolg. Du darfst dir nicht ständig vor Augen halten, was du über sie zu wissen glaubst. Wahrscheinlich stimmt es sowieso nicht. Und du solltest mit deinen modernen historischen Etiketten aufpassen.« Endlich griff er nach seiner Hose und stieg hinein. »Will hat sich den Ausdruck ›Schule der Nacht‹ ausgedacht, um Kit eins auszuwischen, aber bis dahin sind es noch ein paar Jahre.«
»Es interessiert mich nicht, was William Shakespeare getan hat, gerade tut oder irgendwann tun wird … Vorausgesetzt, er sitzt nicht mit dem Earl of Northumberland unten!«, gab ich zurück und stand auf.
»Natürlich sitzt Will nicht da unten.« Matthew wedelte wegwerfend mit der Hand. »Walter gibt nicht viel auf Wills dichterische Fähigkeiten, und Kit hält ihn für einen diebischen Schmierfinken.«
»Da bin ich aber erleichtert. Und was willst du ihnen über mich erzählen? Marlowe weiß genau, dass wir etwas verbergen.«
Matthews graugrüne Augen blickten mich ernst an. »Wahrscheinlich die Wahrheit.« Pierre reichte ihm ein Wams – schwarz, mit feinen Stickereien – und starrte währenddessen, das Musterbild eines Bediensteten, eisern auf einen Punkt oberhalb meiner Schulter. »Dass du eine Zeitwandlerin und Hexe aus der Neuen Welt bist.«
»Die Wahrheit«, wiederholte ich tonlos. Pierre hörte jedes Wort mit, zeigte aber keine Reaktion, und Matthew ignorierte ihn, als wäre er unsichtbar. Ich fragte mich, ob wir uns wohl so lange hier aufhalten würden, dass auch ich seine Anwesenheit nicht mehr bemerken würde.
»Warum nicht? Tom wird jedes Wort mitschreiben, das du von dir gibst, und es dann mit seinen Notizen über die Sprache der Algonquin vergleichen. Ansonsten wird dich niemand weiter beachten.« Was er anziehen sollte, schien Matthew mehr zu beschäftigen als die mögliche Reaktion seiner Freunde.
Françoise kehrte mit zwei warmblütigen jungen Frauen zurück, beide beladen mit sauberen Kleidern. Sie deutete auf mein Nachtgewand, und ich verzog mich hinter den Bettpfosten, um mich umzuziehen. Zum Glück hatte ich mich oft genug in Umkleideräumen ausgezogen und daher kaum Hemmungen, mich vor anderen zu entblößen. Ich hob das Leinen über meine Hüften und dann über meine Schultern.
»Kit wird mich sehr wohl beachten. Er sucht nur nach einem Grund, mich nicht zu mögen, und damit liefern wir ihm gleich mehrere.«
»Kit ist kein Problem«, versicherte Matthew mir zuversichtlich.
»Ist Marlowe dein Freund oder deine Marionette?« Ich kämpfte mich immer noch durch das Leinen meines Nachthemds, als ich ein erschrockenes Luftschnappen und ein ersticktes »Mon dieu« hörte.
Ich erstarrte. Françoise hatte auf meinem Rücken die mondsichelförmige Narbe gesehen, die sich von einer Seite der Rippen zur anderen erstreckte, gekrönt von dem Stern zwischen meinen Schulterblättern.
»Ich werde Madame ankleiden«, erklärte Françoise den beiden Mägden kühl. »Lasst die Kleider liegen und geht wieder an eure Arbeit.«
Die Mägde verschwanden nach einem kurzen Knicks und einem unverhohlen neugierigen Blick. Sie hatten die Narben nicht gesehen. Sobald sie die Tür ins Schloss gezogen hatten, prallte Françoise’ schockiertes »Wer hat das getan?« auf Matthews »Das darf niemand wissen« und mein eigenes, fast schüchternes »Das ist nur eine Narbe«.
»Jemand hat Euch mit dem Wappen der de Clermonts gebrandmarkt«, beharrte Françoise kopfschüttelnd. »Dem Wappen, das auch Milord verwendet.«
»Wir haben den Pakt gebrochen.« Ich kämpfte gegen die Übelkeit an, die jedes Mal in mir hochstieg, wenn ich an die Nacht dachte, in der mich eine andere Hexe als Verräterin gebrandmarkt hatte. »Und so hat mich die Kongregation dafür bestraft.«
»Darum also seid Ihr hergekommen.« Françoise schnaubte. »Der Pakt war von Anfang an eine dumme Idee. Philippe de Clermont hätte sich nie darauf einlassen dürfen.«
»Trotzdem sind wir dadurch sicher vor den Menschen.« Ich war kein großer Freund dieser Vereinbarung oder der neunköpfigen Kongregation, die über ihre Durchsetzung wachte, aber niemand konnte bestreiten, dass der Pakt langfristig erfolgreich sichergestellt hatte, dass wir nichtmenschlichen Kreaturen vor ungebetener Aufmerksamkeit geschützt blieben. Jenes Gelübde, das die Dämonen, Vampire und Hexen vor langer Zeit abgelegt hatten, verbat uns jede Einmischung in Politik oder Religion und untersagte jegliche persönliche Verbindung zwischen den drei verschiedenen Spezies. Die Hexen sollten unter sich bleiben, genau wie Vampire und Dämonen. Vor allem sollten wir uns keinesfalls in andere Wesen verlieben und sie heiraten.
»Sicher? Glaubt nur nicht, dass Ihr hier sicher seid, Madame. Sicher ist keiner von uns. Die Engländer sind ein abergläubisches Volk, sie sehen auf jedem Friedhof Gespenster und um jeden Suppenkessel Hexen tanzen. Die Kongregation ist das Einzige, was zwischen uns und der völligen Ausrottung steht. Ihr seid sehr klug, hier Zuflucht zu suchen. Nun kommt, Ihr müsst Euch anziehen, die anderen warten auf Euch.« Françoise half mir aus dem Nachthemd und reichte mir ein nasses Tuch sowie eine Schüssel mit einer Schmiere, die nach Rosmarin und Orange roch. Es war eigenartig, wie ein Kind behandelt zu werden, doch ich wusste, dass Menschen von Matthews Rang sich damals waschen, anziehen und füttern ließen wie kleine Kinder. Pierre reichte Matthew eine Schale mit etwas, das zu dunkel war, um Wein zu sein.
»Sie ist nicht nur eine Hexe, sondern noch dazu eine Fileuse de temps?«, fragte Françoise Matthew leise. Der unvertraute Begriff Zeitspinnerin beschwor die Erinnerung an die vielen bunten Fäden herauf, denen wir gefolgt waren, um an diesen Augenblick in der Vergangenheit zu gelangen.
»Das ist sie.« Matthew nickte, den Blick fest auf mich gerichtet, und nahm einen Schluck aus seiner Schale.
»Aber wenn sie aus einer anderen Zeit kommt, bedeutet das …«, setzte Françoise mit großen Augen an. Dann verstummte sie nachdenklich. Sie vermutet, dass er nicht derselbe Matthew ist, erkannte ich erschrocken.
»Es genügt, wenn wir wissen, dass sie unter dem Schutz von Milord steht«, ermahnte Pierre sie grob und mit warnendem Unterton. Er reichte Matthew einen Dolch. »Was das bedeutet, braucht uns nicht zu interessieren.«
»Es bedeutet, dass ich sie liebe und dass sie mich ebenfalls liebt.« Matthew sah seinen Diener eindringlich an. »Und dies ist die Wahrheit, ganz gleich, was ich zu allen anderen sage. Verstanden?«
»Ja«, erwiderte Pierre, obwohl sein Tonfall das Gegenteil vermuten ließ.
Auf Matthews fragenden Blick hin kniff auch Françoise die Lippen zusammen und nickte grimmig.
Sie widmete sich wieder mir und wickelte mich in ein dickes Leinenhandtuch. Dabei musste sie auch die anderen Wunden an meinem Körper bemerkt haben, die ich mir im Verlauf dieses einen unendlich langen Tages mit der Hexe Satu zugezogen hatte, sowie alle anderen Narben von später erlittenen Qualen. Trotzdem stellte sie mir keine weiteren Fragen, sondern setzte mich in einen Sessel am Kamin, um mich dort zu kämmen.
»Und hat man ihr diese Beleidigung zugefügt, nachdem Ihr Eure Liebe zu der Hexe erklärt hattet, Milord?«, fragte Françoise.
»Ja.« Matthew schnürte den Dolch an seiner Taille fest.
»Demnach war es kein Manjasang, der sie gezeichnet hat«, murmelte Pierre. Er verwendete das alte okzitanische Wort für Vampir – Blutesser. »Kein Vampir würde sich den Zorn der de Clermonts zuziehen wollen.«
»Nein, es war eine Hexe.« Obwohl ich direkt am Feuer saß, ließ mich dieses Bekenntnis schaudern.
»Allerdings waren zwei Manjasang dabei und ließen sie gewähren«, ergänzte Matthew grimmig. »Und dafür werden sie bezahlen.«
»Vorbei ist vorbei.« Ich wollte keine Fehde unter den Vampiren auslösen. Wir hatten auch so genug Probleme.
»Wenn MilordEuch zur Frau genommen hat, bevor die Hexe Euch angriff, dann ist nichts vorbei.« Geschickt flocht Françoise mein Haar zu festen Zöpfen, die sie um meinen Kopf schlang und dann feststeckte. »In diesem gottverfluchten Land, in dem man keine wahre Treue kennt, mögt Ihr vielleicht Roydon heißen, aber wir werden gewiss nicht vergessen, dass Ihr eine de Clermont seid.«
Matthews Mutter hatte mich gelehrt, dass die de Clermonts wie ein Wolfsrudel waren. Im einundzwanzigsten Jahrhundert hatte ich gegen die Verpflichtungen und Beschränkungen aufbegehrt, die mit der Zugehörigkeit zu diesem Rudel verbunden waren. Im Jahr 1590 hingegen war nicht vorherzusehen, wie sich meine Magie entfalten würde, ich verfügte über praktisch keine Kenntnisse der Hexerei, und meine frühesten bekannten Vorfahren waren noch nicht geboren. Hier konnte ich mich nur auf meinen Verstand und auf Matthew verlassen.
»Zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass wir zusammengehören. Trotzdem will ich jetzt keine Schwierigkeiten.« Ich senkte den Blick auf Ysabeaus Ring und strich mit dem Daumen über das Band. Meine Hoffnung, dass wir uns nahtlos in die Vergangenheit einfügen würden, erschien mir plötzlich ebenso abwegig wie naiv. Ich sah mich um. »Und das …«
»Wir sind nur aus zwei Gründen hier, Diana: um dir eine Lehrerin zu suchen und um das alchemistische Manuskript aufzuspüren.« Das mysteriöse, Ashmole 782 genannte Manuskript hatte uns damals zusammengeführt. Im einundzwanzigsten Jahrhundert ruhte es sicher unter Millionen von anderen Büchern in der Bodleian Library in Oxford. Beim Ausfüllen des Bestellzettels hatte ich nicht ahnen können, dass ich mit diesem einfachen Akt einen komplizierten Bannspruch lösen würde, der das Manuskript bis dahin in sein Regal gefesselt hatte, und dass derselbe Bann wieder in Kraft treten würde, sobald ich Ashmole 782 zurückgab. Genauso wenig hatte ich etwas von den vielen Geheimnissen über Hexen, Vampire und Dämonen geahnt, die angeblich in diesem Manuskript offenbart wurden. Statt den Versuch zu unternehmen, den Bannspruch ein zweites Mal in der modernen Welt zu lösen, hatte Matthew es für sicherer gehalten, Ashmole 782 in der Vergangenheit zu suchen.
»Bis wir zurückkehren, ist dies dein Zuhause«, versuchte er mich zu beruhigen.
Die massiven Möbel des Raumes waren mir aus Museen und Auktionskatalogen vertraut, trotzdem würde ich mich in der Old Lodge nie wirklich zu Hause fühlen. Ich betastete das feste Leinen des Handtuchs – nicht zu vergleichen mit den kratzigen Frotteetüchern, die Sarah und Em besaßen und die vom vielen Waschen fadenscheinig geworden waren. In einem anderen Raum mischten sich verschiedene Stimmen in einem befremdlichen Rhythmus. Ich sehnte mich nach ein wenig Vertrautheit, nach etwas Berechenbarem. Aber die Vergangenheit war unsere einzige Option. Das hatten wir während unserer letzten Tage in Madison deutlich vor Augen geführt bekommen, als uns Vampire gejagt hatten und Matthew um ein Haar getötet worden wäre. Wenn unser Plan aufgehen sollte, musste ich zuallererst darauf achten, dass ich als elisabethanische Ehefrau durchging.
»O schöne neue Welt.« Natürlich war es unhistorisch, aus Shakespeares Sturm zu zitieren, der erst in zwanzig Jahren geschrieben werden sollte, aber dies war wirklich kein einfacher Morgen für mich.
»Und«, erwiderte Matthew mit einem Lächeln, »bist du bereit, dich ihr zu stellen?«
»Natürlich. Ich muss mich nur noch anziehen lassen.« Ich streckte die Schultern durch und stand auf. »Wie begrüßt man eigentlich einen Earl?«
Kapitel 2
Ich hatte mir unnötig Sorgen gemacht, ich könnte gegen irgendeine Etikette verstoßen. Titel und Anrede waren nebensächlich, wenn es sich bei dem fraglichen Earl um einen sanften Riesen namens Henry Percy handelte.
Françoise hantierte kopfschüttelnd an mir herum, während sie mich in ein eilig zusammengesuchtes Ensemble steckte: einen fremden Unterrock; ein gestepptes Mieder, um meinen athletischen Körper in eine weiblichere Gestalt zu pressen; ein besticktes, nach Lavendel und Zeder duftendes Leibchen mit hoher Halskrause; einen Glockenrock aus schwarzem Samt und Pierres beste Jacke, das einzige Kleidungsstück, das wenigstens annähernd meine Größe hatte. Sosehr sich Françoise auch bemühte, sie schaffte es nicht, das letzte Stück über meiner Brust zuzuknöpfen. Ich hielt den Atem an, zog den Bauch ein und hoffte das Beste, während sie die Korsettbänder straffzog, aber höchstens ein göttliches Wunder hätte mir eine sylphengleiche Silhouette verschaffen können.
Während des komplexen Rituals traktierte ich Françoise mit Fragen. Aufgrund der zeitgenössischen Porträts hatte ich erwartet, ich würde einen Reifrock wie einen Vogelkäfig an die Hüfte gebunden bekommen, aber Françoise erklärte mir, dass man so etwas nur zu formellen Anlässen trug. Stattdessen band sie mir unter den diversen Röcken einen ausgestopften Stoffreifen um den Bauch. Das Einzige, was für dieses Ungetüm sprach, war die Tatsache, dass es mir die zahllosen Stoffschichten von den Beinen weghielt und mir dadurch das Gehen ermöglichte – vorausgesetzt, es stand kein Mobiliar im Weg, und ich konnte mein Ziel auf geradem Weg erreichen. Allerdings wurde von mir ein Hofknicks erwartet. Françoise brachte mir in aller Eile das Knicksen bei, während sie mir gleichzeitig erklärte, wie Henry Percys verschiedene Titel verwendet wurden – für mich war er Lord Northumberland, obwohl er mit Nachnamen Percy hieß und ein Earl war.
Doch mir sollte sich keine Gelegenheit bieten, mein frisch erworbenes Wissen anzuwenden. Sobald Matthew und ich den Saal betraten, sprang ein schlaksiger, junger Mann in schlammbespritzter Reisekleidung auf, um uns zu begrüßen. Sein breites Gesicht leuchtete neugierig auf, und seine schweren, aschgrauen Brauen hoben sich.
»Hal.« Matthew lächelte ihn mit der nachsichtigen Vertraulichkeit eines älteren Bruders an. Aber der Earl ignorierte seinen alten Freund und steuerte geradewegs auf mich zu.
»M-M-Mistress Roydon.« Er sprach in tiefem Bass, aber praktisch tonlos, betonungslos und akzentfrei. Auf der Treppe hatte Matthew mir erklärt, dass Henry schwerhörig war und seit seiner Kindheit stotterte. Dafür war er ein begnadeter Lippenleser. Mit ihm würde ich hoffentlich sprechen können, ohne mir um meinen Akzent Gedanken machen zu müssen.
»Wieder einmal ist mir Kit zuvorgekommen, wie ich sehe.« Matthew lächelte resigniert. »Ich hatte gehofft, ich könnte es Euch selbst erzählen.«
»Wen interessiert es schon, wer die frohe Botschaft verkündet?« Lord Northumberland verbeugte sich. »Ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft, Mistress, und bitte um Verzeihung, dass ich Euch so überfalle. Es ist höchst gnädig von Euch, die Freunde Eures Gemahls schon zu solch früher Stunde zu ertragen. Wir hätten auf der Stelle abreisen sollen, sobald wir von Eurer Ankunft erfuhren. Das Gasthaus hätte uns als Obdach genügt.«
»Ihr seid hier mehr als willkommen, Mylord.« Damit war der Moment für einen Knicks gekommen, aber meine schweren schwarzen Röcke waren kaum zu bändigen, und das Korsett war so eng geschnürt, dass mein Rücken völlig steif war. Ich wollte die Beine beugen, um auf diese Weise eine angemessen ehrerbietige Pose herzustellen, kam aber sofort ins Schwanken. Eine große Hand schoss vor und fing mich mit dicken Fingern ab.
»Einfach Henry, Mistress. Alle Welt nennt mich Hal, mein Taufname ist darum förmlich genug.« Wie so viele Schwerhörige sprach der Earl absichtlich leise. Er ließ mich los und drehte sich zu Matthew um. »Warum ohne Bart, Matthew? Wart Ihr krank?«
»Ein kurzer Schüttelfrost, mehr nicht. Die Ehe hat mich kuriert. Wo sind die anderen?« Matthew sah sich suchend nach Kit, George und Tom um.
Bei Tag sah der große Saal der Old Lodge ganz anders aus. Ich hatte ihn bisher nur nachts gesehen, aber bei Tageslicht stellte sich heraus, dass die schweren Vertäfelungen in Wahrheit Fensterläden waren, die nun allesamt weit offen standen. Dadurch bekam der Raum etwas Luftiges, trotz des monströsen Kamins am anderen Ende. Der Kamin war mit mittelalterlichen Steinmetzarbeiten verziert, die Matthew zweifelsohne aus der Abtei gerettet hatte, die einst hier gestanden hatte – das zerquälte Gesicht eines Heiligen, ein Wappen, ein gotischer Vierpass, das steinerne Kleeblatt.
»Diana?« Matthews fröhliche Stimme riss mich aus meinen Gedanken. »Hal sagt, die anderen sind im Salon und lesen oder spielen Karten. Er fand es unangebracht, sich zu ihnen zu gesellen, bevor ihn die Dame des Hauses in aller Form eingeladen hat.«
»Selbstverständlich muss der Earl bleiben, und wir können sofort zu deinen Freunden gehen.« Mein Magen knurrte.
»Oder wir könnten dir etwas zu essen besorgen«, schlug er mit einem Grinsen vor. Nachdem ich meine Begegnung mit Henry Percy ohne Malheur überstanden hatte, begann sich Matthew zu entspannen. »Habt Ihr schon Stärkung bekommen, Hal?«
»Pierre und Françoise waren aufmerksam wie immer«, versicherte er uns. »Natürlich, wenn Mistress Roydon mir Gesellschaft leisten würde …« Die Stimme des Earl versiegte, und sein Magen begann mit meinem im Duett zu gurgeln. Der Mann war groß wie eine Giraffe. Bestimmt brauchte er Unmengen an Kalorien, um seinen Stoffwechsel in Gang zu halten.
»Auch ich genieße gern ein ausgiebiges Frühstück, Mylord«, antwortete ich lachend.
»Henry«, korrigierte mich der Earl freundlich und lächelte dabei so breit, dass sich ein Grübchen in sein Kinn bohrte.
»Dann müsst Ihr mich Diana nennen. Ich kann unmöglich den Earl of Northumberland beim Vornamen nennen, wenn er mich weiterhin als Mistress Roydon anspricht.« Françoise hatte mich streng ermahnt, dem hohen Rang des Earl Respekt zu erweisen.
»Nun denn, Diana«, sagte Henry und reichte mir seinen Arm.
Er führte mich über einen zugigen Korridor in ein gemütliches Zimmer mit niedriger Decke, das von einer Reihe von Südfenstern erhellt wurde. Obwohl es relativ klein war, hatte man drei Tische mitsamt Schemeln und Bänken hineingequetscht. Leises Rumoren, akzentuiert von kurzem Topf- und Pfannenscheppern, verriet mir, dass die Küche in der Nähe war. Jemand hatte eine Seite aus einem Almanach an die Wand geheftet, und auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers lag eine Karte, deren eine Ecke von einem Kerzenständer, die andere von einer flachen Schale mit Obst niedergehalten wurde. Das Arrangement wirkte so anheimelnd, dass es aus einem holländischen Stillleben zu stammen schien. Ein betörender Duft schlug mir entgegen, der mich innehalten ließ.
»Die Quitten.« Ich strich mit den Fingern darüber. Sie sahen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte, als Matthew mir in Madison die Old Lodge beschrieb.
Dass ich auf eine ganz gewöhnliche Obstschale so heftig reagierte, schien Henry zu verwirren, aber er war zu wohlerzogen, um etwas zu sagen. Wir setzten uns an den Tisch, und ein Diener ergänzte das Stillleben vor uns um frisches Brot, einen Teller mit Trauben und eine Schale mit Äpfeln. Es war ein beruhigendes Gefühl, so vertraute Kost zu sehen. Henry bediente sich, und ich folgte seinem Beispiel, wobei ich mir genau merkte, was er sich nahm und wie viel er davon aß. Fremde verrieten sich meist durch Kleinigkeiten, und ich wollte so gewöhnlich wie möglich erscheinen. Während wir unsere Teller füllten, schenkte Matthew sich ein Glas Wein ein.
Während der gesamten Mahlzeit behandelte mich Henry mit ausgesuchter Höflichkeit. Er stellte mir keine einzige persönliche Frage und erkundigte sich nur sehr taktvoll nach Matthews Angelegenheiten. Stattdessen unterhielt er uns mit Anekdoten über seine Hunde, seine diversen Landgüter und seine strenge Mutter, wobei er uns ununterbrochen mit Nachschub an im Kamin geröstetem Brot versorgte. Er wollte gerade etwas von einem Umzug in London erzählen, als es im Hof laut wurde. Der Earl, der mit dem Rücken zur Tür saß, merkte nichts.
»Sie ist unmöglich! Ihr habt mich allesamt gewarnt, doch ich konnte nicht glauben, dass jemand so undankbar sein könnte. Nachdem ich ihre Schatzkammern mit solchen Reichtümern gefüllt habe, hätte sie doch wenigstens … Oh.« Die breiten Schultern unseres neuesten Gastes füllten den Türrahmen aus. Eine dieser Schultern war in ein Tuch gehüllt, das so dunkel war wie die Locken, die unter dem gefiederten Hut hervorquollen. »Matthew. Seid Ihr krank?«
Überrascht drehte sich Henry um. »Einen guten Tag, Walter. Warum seid Ihr nicht bei Hofe?«
Ich hätte mich um ein Haar an meinem Brot verschluckt. Der Neuankömmling war mit Sicherheit Sir Walter Raleigh, das fehlende Mitglied aus Matthews Schule der Nacht.
»Ich wurde aus dem Paradies verstoßen, weil ich nach Höherem strebte, Hal. Und wer ist das?« Bohrende blaue Augen richteten sich auf mich, und aus dem dunklen Bart strahlten mich weiße Zähne an. »Henry Percy, Ihr seid ein schlauer Bock. Kit hat mir erzählt, dass Ihr Euch in den Kopf gesetzt habt, Euch die schöne Arabella zu unterwerfen. Hätte ich jedoch geahnt, dass es Euch auch nach reiferem Fleisch als dem von fünfzehnjährigen Maiden gelüstet, hätte ich Euch schon längst an eine reife, lüsterne Witwe gekettet.«
Reif? Witwe? Ich war eben dreiunddreißig geworden.
»Sie hat Euch also betört, diesen Sonntag die Kirche zu schwänzen. Wir müssen der Lady dankbar sein, dass sie Euch von den Knien geholt und auf ein Pferd gesetzt hat, wo Ihr hingehört.« Raleighs Akzent war dick wie der Rahm in Devonshire.
Der Earl of Northumberland legte die Gabel ab und betrachtete seinen Freund. Dann schüttelte er den Kopf und wandte sich wieder seinem Teller zu. »Geht hinaus, kommt noch einmal herein und fragt Matt, was es Neues gibt. Und gebt Euch zerknirscht dabei.«
»Nein.« Walter starrte Matthew mit offenem Mund an. »Sie gehört zu Euch?«
»Und dieser Ring beweist es.« Matthew schubste mit einem langen, gestiefelten Bein einen Schemel unter dem Tisch hervor. »Setzt Euch, Walter, und trinkt ein Bier.«
»Ihr habt geschworen, Ihr würdet niemals heiraten«, sagte Walter verwirrt.
»Es bedurfte einiger Überredungskunst.«
»Das nehme ich doch an.« Wieder kam Walter Raleighs durchdringender Blick auf mir zu liegen. »Eine Schande, dass sie an einen Kaltblüter verschwendet wurde. Ich hätte keinen Moment gezögert.«
»Diana weiß um mein Wesen und stört sich nicht an meiner Kälte, wie Ihr es nennt. Außerdem war sie diejenige, die überredet werden musste. Ich hatte mich gleich auf den ersten Blick in sie verliebt«, sagte Matthew.
Walter schnaubte nur.
»Gebt Euch nicht so bärbeißig, alter Freund. Auch Euch könnte Cupidos Pfeil noch treffen.« Matthews graue Augen blitzten gut gelaunt, denn er wusste genau, was die Zukunft für Raleigh bereithielt.
»Cupido muss warten. Im Moment bin ich ganz damit beschäftigt, die unfreundlichen Avancen der Königin und ihres Admirals abzuwehren.« Walter warf seinen Hut lässig auf einen der anderen Tische, wo er über die glänzende Oberfläche eines Backgammon-Spieles schlitterte und die Steine durcheinanderschob. Stöhnend ließ er sich neben Henry in einen Stuhl fallen. »So wie es aussieht, will jeder an meinem Profit teilhaben, aber niemand will mir auch nur den kleinen Finger reichen, während diese Sache mit der Kolonie wie ein Damoklesschwert über mir hängt. Die Idee für die diesjährige Geburtstagsfeier stammt von mir, trotzdem hat dieses Weibsbild nicht mich, sondern Cumberland mit der Organisation der Zeremonie betraut.« Sofort brauste er wieder auf.
»Noch immer keine Neuigkeiten aus Roanoke?«, fragte Henry freundlich und reichte Walter dabei einen Krug mit dickflüssigem, braunem Bier. Mein Magen krampfte sich zusammen, als das Gespräch auf Raleighs zum Scheitern verurteilte Unternehmungen in der Neuen Welt kam. Es war das erste Mal, dass sich jemand laut Gedanken über den Ausgang eines zukünftigen Ereignisses machte, während ich ihn doch kannte, und es würde bestimmt nicht das letzte Mal sein.
»White traf letzte Woche in Plymouth ein, heimgetrieben vom üblen Wetter. Die Suche nach seiner Tochter und Enkeltochter musste er aufgeben.« Walter nahm einen tiefen Schluck und starrte ins Leere. »Weiß der Himmel, was aus ihnen allen wurde.«
»Sobald es Frühling wird, könnt Ihr zurückkehren und werdet sie finden.« Henry klang überzeugt, aber Matthew und ich wussten, dass die vermissten Siedler von Roanoke nie gefunden würden und dass Raleigh nie wieder den Boden North Carolinas betreten sollte.
»Ich bete, dass Ihr recht habt, Hal. Aber genug von meinen Sorgen. Aus welchem Teil des Landes stammt Ihr, Mistress Roydon?«
»Cambridge«, antwortete ich leise und gleichzeitig so knapp und wahrheitsgetreu wie möglich. Zwar lag mein Heimatort in Massachusetts und nicht in England, aber wenn ich jetzt anfing, mir eine neue Vergangenheit auszudenken, würde ich mir meine Geschichten nie merken können.
»Ihr seid also die Tochter eines Gelehrten. Oder war Euer Vater gar Theologe? Matt würde es genießen, jemanden zu haben, mit dem er über Glaubensfragen disputieren kann. Abgesehen von Hal sind seine Freunde hoffnungslos, wenn es um Fragen der rechten Lehre geht.« Walter nahm wieder einen Schluck Bier und wartete ab.
»Dianas Vater starb, als sie noch sehr jung war.« Matthew nahm meine Hand.
»Das tut mir für Euch leid, Diana. Der Verlust eines V-V-Vaters ist ein schrecklicher Schlag«, murmelte Henry.
»Und hat Euer erster Gemahl Euch zum Trost Söhne und Töchter hinterlassen?« Etwas wie Mitgefühl stahl sich in Walters Stimme.
Im sechzehnten Jahrhundert wäre eine Frau meines Alters mit Sicherheit bereits verheiratet gewesen und hätte drei oder vier Kinder. Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
Walter runzelte die Stirn, aber bevor er die Sache vertiefen konnte, betrat Kit den Raum, dicht gefolgt von George und Tom.
»Endlich. Ihr müsst ihn zur Vernunft bringen, Walter. Matthew darf nicht länger den Odysseus zu dieser Circe spielen.« Kit griff nach dem Kelch, der vor Henry stand. »Einen guten Tag, Hal.«
»Wen muss ich zur Vernunft bringen?«, fragte Walter unfreundlich.
»Matt natürlich. Die Frau ist eine Hexe. Und etwas an ihr ist faul.« Kit sah mich mit schmalen Augen an. »Sie verbirgt etwas.«
»Eine Hexe«, wiederholte Walter bedächtig.
Eine Magd, die eben einen Arm voll Brennholz anschleppte, erstarrte in der Tür.
»Wie gesagt«, bekräftigte Kit nickend, »Tom und ich haben die Zeichen sofort erkannt.«
Die Magd ließ das Holz in den bereitstehenden Korb fallen und huschte aus dem Zimmer.
»Für einen Stückeschreiber, Kit, habt Ihr ein bemerkenswert schlechtes Gespür für Ort und Zeit.« Walters blaue Augen richteten sich auf Matthew. »Sollen wir die Angelegenheit woanders besprechen, oder ist dies nur eine von Kits Phantastereien? Falls dem so ist, würde ich gern hier in der Wärme bleiben und in Frieden mein Bier austrinken.« Die beiden Männer musterten einander. Als Matthew keine Miene verzog, begann Walter leise zu fluchen. Als wäre das sein Stichwort, erschien Pierre.
»Im Salon brennt ein Feuer, Milord«, erklärte der Vampir Matthew, »und es stehen Wein und Speisen für Eure Gäste bereit. Dort seid Ihr ungestört.«
Der Salon war weder so gemütlich wie der Raum, in dem wir unser Frühstück eingenommen hatten, noch so grandios wie der große Saal. Die vielen mit Schnitzereien verzierten Stühle, die üppigen Wandbehänge und kunstvoll gerahmten Gemälde ließen darauf schließen, dass er vor allem dafür gedacht war, wichtige Gäste zu empfangen. Am Kamin hing ein phantastisches Holbein-Gemälde, auf dem der heilige Hieronymus mit seinem Löwen dargestellt war. Es war mir ebenso unbekannt wie das danebenhängende Holbein-Porträt eines schweinsäugigen Heinrich VIII., der, ein Buch und eine Brille in der Hand, den Betrachter nachdenklich über einen Tisch voller wertvoller Objekte hinweg anstarrte. Heinrichs Tochter, die erste und nun amtierende Königin Elisabeth, blickte ihn hoheitsvoll von der Wand gegenüber an. Die angespannte Atmosphäre zwischen den beiden hob auch nicht gerade die Stimmung, als wir unsere Plätze einnahmen. Matthew setzte sich an das Feuer, verschränkte die Arme vor der Brust und sah nicht weniger hoheitsvoll aus als die Tudors an den Wänden.
»Wirst du ihnen die Wahrheit sagen?«, flüsterte ich ihm zu.
»Das würde es allen einfacher machen, Mistress«, bemerkte Raleigh scharf, »ganz zu schweigen davon, dass es sich Freunden gegenüber geziemt.«
»Ihr vergesst Euch, Walter«, warnte Matthew ihn hitzig.
»Mich vergessen! Und das von einem, der sich mit einer Hexe eingelassen hat?« Walter hielt problemlos mit Matthew mit, wenn es um hitzige Reaktionen ging. Gleichzeitig hörte ich echte Angst in seiner Stimme.
»Sie ist meine Gemahlin«, gab Matthew zurück. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Und ja, sie ist eine Hexe, aber werden wir nicht alle, die wir hier versammelt sind, aus einem echten oder eingebildeten Grund verteufelt?«
»Aber sie zum Weib zu nehmen – was habt Ihr Euch dabei gedacht?«, fragte Walter benommen.
»Dass ich sie liebe«, sagte Matthew. Kit verdrehte die Augen und schenkte sich aus einer silbernen Karaffe frischen Wein ein. Meine Phantasien, mit ihm am Feuer zu sitzen und über Magie und Literatur zu diskutieren, lösten sich im klaren Licht dieses Novembertags in Luft auf. Ich war noch keine vierundzwanzig Stunden im Jahr 1590, doch schon jetzt ging mir Christopher Marlowe gründlich auf die Nerven.
Marlowe gegenüber zeigte sich Matthew nachsichtig und meist ein wenig gereizt. George und Tom gegenüber war er geduldig, und Henry begegnete er mit brüderlicher Zuneigung. Aber Raleigh war Matthew ebenbürtig – in Intelligenz, Macht, vielleicht auch Skrupellosigkeit –, und das bedeutete, dass für Matthew allein Walters Meinung zählte. Beide begegneten einander mit argwöhnischem Respekt, wie zwei Wölfe, die unter sich ausmachen, wer das Rudel führen soll.
»Dann soll es so sein«, sagte Walter langsam und gab sich damit Matthew geschlagen.
»So ist es.« Matthew stemmte seine Füße auf den Kaminrand.
»Ihr hütet zu viele Geheimnisse und habt zu viele Feinde, um Euch eine Frau zu nehmen. Dennoch habt Ihr es getan.« Walter wirkte aufrichtig verwundert. »Man hat Euch schon oft vorgeworfen, Ihr würdet Euch allein auf Euren Scharfsinn verlassen. Nun denn, Matthew. Wenn Ihr wirklich so scharfsinnig seid, dann verratet uns doch, was wir sagen sollen, wenn man uns Fragen stellt.«
Kits Kelch knallte auf den Tisch, und roter Wein spritzte über seine Hand. »Ihr könnt auf keinen Fall erwarten, dass wir …«
»Still.« Walter warf Marlowe einen bitterbösen Blick zu. »In Anbetracht der Lügen, die wir Euretwegen erzählen, überrascht es mich, dass Ihr etwas zu sagen wagt. Sprecht, Matthew.«
»Danke, Walter. Ihr seid die einzigen fünf Männer im gesamten Königreich, die mich möglicherweise nicht für irre halten werden, wenn sie hören, was ich zu erzählen habe.« Matthew pflügte sich mit der Hand durchs Haar. »Erinnert ihr euch noch an unser Gespräch über Giordano Brunos Idee einer unendlichen Anzahl von Welten, die weder durch Zeit noch Raum eingeschränkt werden?«
Die Männer sahen einander an.
»Ich weiß nicht recht«, setzte Henry vorsichtig an, »ob wir verstehen, was Ihr damit sagen wollt.«
»Diana stammt wirklich aus der Neuen Welt.« Matthew hielt inne und gab Marlowe damit Gelegenheit, die anderen der Reihe nach triumphierend anzusehen. »Aus der Neuen Welt der Zukunft.«
Schlagartig wurde es still, und alle Augen richteten sich auf mich.
»Sie hat gesagt, sie stamme aus Cambridge«, erklärte Walter verständnislos.
»Nicht aus diesem Cambridge. Mein Cambridge liegt in Massachusetts.« Meine Stimme klang brüchig. Ich räusperte mich. »Diese Kolonie wird in vierzig Jahren nördlich von Roanoke gegründet werden.«
Daraufhin erhob sich ein allgemeiner Tumult, und ich wurde von allen Seiten mit Fragen bombardiert. Harriot beugte sich vor und berührte zaghaft meine Schulter. Als sein Finger auf festes Fleisch stieß, richtete er sich verwundert auf.
»Ich habe von Wesen gehört, welche die Zeit ihrem Willen beugen können. Dies ist ein Tag des Wunders, nicht wahr, Kit? Hättet Ihr je geglaubt, dass Ihr eines Tages eine Zeitspinnerin kennenlernen würdet? Wir müssen uns in ihrer Anwesenheit in Acht nehmen, sonst könnten wir uns in ihrem Netz verheddern und darin verlorengehen.« Harriot klang fast sehnsüchtig, so als würde er ersehnen, in eine andere Welt verschlagen zu werden.
»Und was bringt Euch zu uns, Mistress Roydon?« Walters dröhnende Stimme durchschnitt das allgemeine Durcheinander.
»Dianas Vater war Gelehrter«, kam Matthew mir zuvor. Interessiertes Gemurmel kam auf, das Walter sofort mit einer erhobenen Hand zum Verstummen brachte. »Ihre Mutter auch. Beide waren Hexen und starben unter mysteriösen Umständen.«
»Dann ist das etwas, das uns beiden gemein ist, D-D-Diana«, erklärte Henry schaudernd. Bevor ich den Earl fragen konnte, wie er das meinte, gab Walter Matthew ein Zeichen fortzufahren.