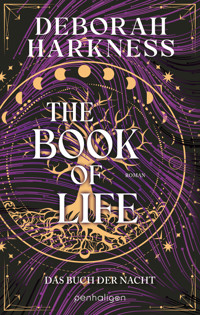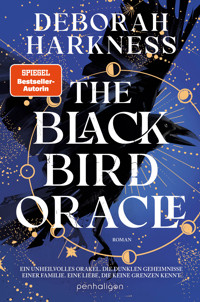12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: All Souls
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe für die Ewigkeit: Nach Diana und Matthew werden nun Marcus und Phoebe die Herzen der Leser*innen im Sturm erobern.
Aus Liebe entschließt sich die junge Phoebe, ihr sterbliches Leben hinter sich zu lassen, und Vampirin zu werden, denn Marcus, dem ihr Herz gehört, ist ein Unsterblicher. Doch alte Traditionen machen es ihnen nicht leicht – sie besagen, dass sie sich neunzig Tage nach der Verwandlung nicht sehen dürfen. Während Phoebe noch mit ihren neuen Kräften zurechtkommen muss, erinnert sich Marcus an sein Dasein als Mensch und an ein dunkles, tief verwurzeltes Geheimnis. Er weiß, dass er Phoebe davon erzählen muss, bevor sie die Ehe eingehen – doch wird ihre Liebe stark genug sein, die Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen?
Band 4 der opulenten Saga, aus der Sicht des Vampirs Marcus und seiner geliebten Sterblichen Phoebe – fesselnd und voller Leidenschaft.
Alle Bände der Reihe:
A Discovery of Witches – Die Seelen der Nacht.
Shadow of Night – Wo die Nacht beginnt.
The Book of Life – Das Buch der Nacht.
Time’s Convert – Bis ans Ende der Ewigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Autorin
Deborah Harkness ist Professorin für europäische Geschichte an der University of Southern California in Los Angeles. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten erhielt sie bereits mehrfach Stipendien und Auszeichnungen. Ihre »All-Souls«-Reihe war ein großer internationaler Erfolg und wurde von den Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Der erste Band »Die Seelen der Nacht« ist unter dem Titel »A Discovery of Witches« für Sky verfilmt worden, die deutsche Fassung wurde im Frühjahr 2019 ausgestrahlt. Der neue Roman der SPIEGEL-Bestsellerautorin trägt den Titel »The Blackbird Oracle« und erscheint nach langen Jahren des Wartens weltweit im Sommer 2024.
DEBORAH HARKNESS
BIS ANS ENDE DER EWIGKEIT
Roman
Deutsch von Christoph Göhler
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Time’s Convert« bei Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Deborah Harkness
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: Shutterstock.com (bogadeva1983; Jozsef Bagota; mountain beetle)
LH ∙ Herstellung: fe
ISBN 978-3-641-32729-3V001
www.penhaligon.de
… wenn man lange gewohnt war, eine Sache nicht für falsch zu halten, so erscheint sie einem, oberflächlich betrachtet, richtig, und es erhebt sich zuerst ein furchtbarer Aufschrei zugunsten des Gewohnten. Aber der Tumult legt sich bald. Die Zeit bekehrt mehr Menschen als die Vernunft.
Thomas Paine, Common Sense
Kapitel 1
Null
12. Mai
An ihrem letzten Abend als Warmblut war Phoebe eine brave Tochter. Freyja hatte auf einem Dinner bestanden, also gab es ein Dinner.
»Wir sollten keinen großen Wirbel um die Sache machen«, hatte Phoebe zunächst protestiert, so als würde sie nur ein paar Tage in Urlaub fahren, denn sie hatte gehofft, dass es bei einer kurzen Verabschiedung in dem Hotel, in dem ihre Familie sich einquartiert hatte, bleiben würde.
»Kommt gar nicht in Frage.« Freyja hatte die lange Nase gerümpft. »Ein de Clermont schleicht sich nicht heimlich aus dem Haus – bis auf Matthew natürlich. Wir werden das anständig machen. Das gehört sich so.«
Das Abschiedsessen, das Freyja dann für Phoebe und ihre Eltern veranstaltete, war schlicht, elegant und perfekt – das schloss auch das Wetter ein (es war ein makelloser Maiabend), die Musik (konnte eigentlich jeder Vampir in Paris Cello spielen?), die Blumen (mit den Mme-Hardy-Rosen aus dem Garten hätte man die ganze Stadt parfümieren können) und den Champagner (Freyja schwor auf Cristal).
Phoebes Vater, Mutter und Schwester erschienen wie erbeten um halb neun. Ihr Vater war in Abendgarderobe; ihre Mutter trug eine Lehenga Choli in Türkis und Gold; Stella war von Kopf bis Fuß in Chanel gehüllt. Phoebe trug Schwarz, dazu die Smaragdohrringe, die Marcus ihr vor seiner Abreise aus Paris geschenkt hatte, und turmhohe Highheels, die ihr – und Marcus – besonders gut gefielen.
Die versammelte Gruppe von Warmblütern und Vampiren nahm erst einen Aperitif im Garten hinter Freyjas luxuriösem Haus im 8. Arrondissement – einem privaten Paradies, wie man seit über einem Jahrhundert im beengten Paris keins mehr geschaffen hatte. Die Taylors waren eine prunkvolle Umgebung gewohnt – Phoebes Vater war im diplomatischen Dienst, und ihre Mutter entstammte einer indischen Familie, die seit den Zeiten Britisch-Indiens immer wieder in die britische Diplomatie eingeheiratet hatte –, doch der Reichtum der de Clermonts sprengte alle Dimensionen.
Sie saßen hinter bodentiefen Fenstern, die das Sommerlicht in den Raum ließen und freien Blick in den Garten boten, an einer mit Kristall und Porzellan gedeckten Tafel. Charles, der wortkarge Chefkoch, den die de Clermonts in ihren Pariser Häusern beschäftigten, wenn Warmblüter zum Essen eingeladen waren, liebte Phoebe und hatte weder Kosten noch Mühen gescheut.
»Rohe Austern sind der Beweis, dass Gott uns Vampire liebt und uns glücklich sehen will«, verkündete Freyja mit erhobenem Glas zu Beginn des Mahles. Sie verwendete, wie Phoebe auffiel, das Wort »Vampir« so oft wie möglich, so als würde das, was Phoebe vorhatte, durch die bloße Wiederholung zu etwas Gewöhnlichem. »Auf Phoebe. Glück und ein langes Leben.«
Nach diesem Trinkspruch hatte ihre Familie kaum noch Appetit. Phoebe war zwar bewusst, dass dies ihre letzte richtige Mahlzeit sein würde, trotzdem brachte sie kaum einen Bissen herunter. Weder die Austern konnten sie begeistern noch der Champagner, den es dazu gab, lustlos stocherte sie in den Köstlichkeiten herum. Freyjas reges Geplauder würzte die Hors d’Œuvres, die Suppe, den Fisch, die Ente und die Nachspeisen (»Die letzte Gelegenheit, Phoebe, Liebes!«), wobei sie, immer wieder am Wein nippend, zwischen Englisch und Hindi wechselte.
»Nein, Edward, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Ort gibt, an dem ich noch nicht war. Weißt du, ich halte es für möglich, dass mein Vater der Urvater aller Diplomaten war.« Diese überraschende Behauptung setzte Freyja ein, um Phoebes zurückhaltendem Vater ein paar Anekdoten über seine Anfangsjahre im Dienst Ihrer Majestät zu entlocken.
Ob Freyjas historische Einschätzung nun akkurat war oder nicht, auf jeden Fall hatte Philippe de Clermont seiner Tochter einiges darüber beigebracht, wie man eine Konversation durch schwierige Gewässer steuerte.
»Richard Mayhew, sagst du? Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Françoise, bin ich nicht einem Richard Mayhew begegnet, als wir in Indien waren?«
Die Bedienstete mit dem scharfen Blick war just in dem Moment erschienen, in dem ihre Herrin sie brauchte, herbeigerufen auf einer eigenen, für gewöhnliche Sterbliche unhörbaren Vampir-Frequenz.
»Wahrscheinlich.« Françoise war eine Frau von wenigen, doch stets bedeutungsschweren Worten.
»Ja, ich glaube, ich kannte ihn. Groß? Hellblond? Gut aussehenden, ein bisschen schulbubenhaft?« Freyja ließ sich weder durch Françoise’ mürrische Erwiderung aus dem Konzept bringen noch durch die Tatsache, dass sie eben etwa die Hälfte des diplomatischen Korps von Großbritannien beschrieben hatte. Bisher hatte Phoebe noch nicht erlebt, dass Freyjas unerschütterlicher Frohsinn ins Wanken geraten wäre.
»Dann einstweilen Adieu«, sagte Freyja munter, als der Abend zu Ende ging und sie die Taylors zum Abschied küsste. Ein kühler Lippendruck erst auf die eine, dann auf die andere Wange. »Padma, du bist hier stets willkommen. Lass es mich wissen, wenn du wieder nach Paris kommst. Stella, du musst während der Wintershows unbedingt bei uns wohnen. Die großen Modehäuser sind ganz in der Nähe, und Françoise und Charles werden sich gut um dich kümmern. Natürlich ist das Georges V. exzellent, aber es ist ja so beliebt bei den Touristen. Edward, ich werde mich bei dir melden.«
Phoebes Mutter hatte, wie es ihre Art war, den Abschied tränenlos und stoisch hingenommen, allerdings war die letzte Umarmung etwas fester ausgefallen als gewöhnlich.
»Du tust das Richtige«, flüsterte Padma Taylor ihrer Tochter ins Ohr, bevor sie Phoebe losließ. Sie wusste, was es bedeutete, jemanden so sehr zu lieben, dass man sein ganzes bisheriges Leben für das Versprechen auf eine gemeinsame Zukunft aufgab.
»Pass auf, dass der Ehevertrag wirklich so großzügig ausfällt, wie sie behaupten«, murmelte Stella Phoebe zu, als sie über die Schwelle trat. »Nur für alle Fälle. Dieses Haus ist ein verfluchtes Vermögen wert.« Stella konnte Phoebes Entscheidung ausschließlich in ihrem eigenen Bezugsrahmen einordnen, dessen Koordinaten von Glamour, Stil und exklusiver Mode gebildet wurden.
»Das?«, hatte Freyja gelacht, als Stella den unvergleichlichen Schnitt ihres bordeauxroten Kleids bewundert hatte, und sich elegant in Pose gestellt. »Balenciaga. Habe ich schon ewig. Das war mal ein Mann, der ein Mieder zu schneidern verstand!«
Ausgerechnet Phoebes sonst so reservierter Vater hatte beim Abschied mit den Tränen zu kämpfen, suchte mit verhangenem Blick in ihren Augen (die seinen ähnlich waren, wie Freyja früher am Abend angemerkt hatte) nach einem Hinweis darauf, dass sie in ihrem Entschluss wanken könnte. Nachdem ihre Mutter und Stella nach vorn zum Tor gegangen waren, zog er Phoebe von den Eingangsstufen und der wartenden Freyja weg.
»Wir bleiben nicht lange getrennt, Dad«, versuchte Phoebe ihn zu beruhigen. Doch beide wussten, dass Monate vergehen würden, ehe man ihr erlauben würde, ihre Angehörigen wiederzusehen – um deren Sicherheit und ihrer eigenen willen.
»Bist du dir sicher, Phoebe? Absolut sicher?«, fragte ihr Vater. »Du kannst es dir noch überlegen.«
»Ich bin mir sicher.«
»Sieh es eine Sekunde ganz nüchtern.« Ein Flehen lag in Edward Taylors Stimme. Er verstand sich auf sensible Verhandlungen und scheute nicht davor zurück, auf die Tränendrüse zu drücken, wenn ihn das ans Ziel brachte. »Warum wartest du nicht noch ein paar Jahre ab? Eine so große Entscheidung darf nicht übereilt gefällt werden.«
»Ich werde meine Meinung nicht ändern«, erwiderte Phoebe sanft, aber fest. »Dies ist keine Frage des Kopfes, Dad, sondern des Herzens.«
Nun war ihre Geburtsfamilie gegangen, und Phoebe blieb mit Charles und Françoise zurück, den loyalen Bediensteten der de Clermonts, sowie Freyja – der Stiefschwester des Schöpfers ihres Verlobten und somit in der Welt der Vampire eine enge Verwandte.
Direkt nach dem aufwühlenden Abschied hatte Phoebe Charles für das wunderbare Essen und Françoise dafür gedankt, dass sie sich um alle gekümmert hatte. Dann setzte sie sich in den Salon, wo Freyja ihre Mails las, bevor sie jede einzelne handschriftlich beantwortete, auf cremefarbenen, lavendelfarben umrahmten Karten, die sie in schwere Umschläge schob.
»Es besteht keine Notwendigkeit, sich dieser gottvergessenen neuen Sucht nach sofortigen Antworten zu beugen«, erklärte Freyja, als Phoebe fragte, warum sie nicht wie jeder andere auf Antworten klickte. »Du wirst schon bald feststellen, dass für einen Vampir Schnelligkeit belanglos ist. Es ist überaus menschlich und vulgär, sich zu beeilen, als wäre die Zeit knapp bemessen.«
Nachdem sie höflichkeitshalber eine Stunde mit Marcus’ Tante verbracht hatte, hatte Phoebe das Gefühl, ihre Pflicht erfüllt zu haben.
»Ich denke, ich werde mich jetzt zurückziehen.« Phoebe schützte ein Gähnen vor. Tatsächlich war an Schlaf nicht zu denken.
»Sag Marcus, dass ich ihn liebe.« Freyja leckte mit spitzer Zunge den Umschlag an, bevor sie ihn versiegelte.
»Woher weißt du …?« Phoebe sah Freyja verblüfft an. »Ich meine, wie hast du …?«
»Dies ist mein Haus. Ich weiß alles, was darin passiert.« Freyja klebte eine Marke in die Ecke des Umschlags, nachdem sie sich überzeugt hatte, dass sie exakt parallel zum Rand saß. »Ich weiß beispielsweise, dass Stella heute Abend drei dieser grässlichen kleinen Telefone in ihrer Tasche hereingeschmuggelt hat und dass du sie herausgenommen hast, als du auf der Toilette warst. Ich gehe davon aus, dass du sie in deinem Zimmer versteckt hast. Nicht unter deiner Unterwäsche – dafür bist du zu originell, nicht wahr, Phoebe? – und auch nicht unter der Matratze. Nein. Ich glaube, sie sind in dem Badesalzbehälter auf dem Fensterbrett. Oder in deinen Schuhen – jenen mit der Gummisohle, die du bei deinen Spaziergängen trägst. Oder vielleicht liegen sie oben auf dem Schrank in der blau-weißen Plastiktüte, die du am Mittwoch nach deinem letzten Ausflug ins Lebensmittelgeschäft aufgehoben hast?«
Mit ihrem dritten Tipp lag Freyja goldrichtig, und zwar bis hin zu der Plastiktüte, die immer noch dezent nach dem von Charles in seiner triumphalen Bouillabaisse verwendeten Knoblauch roch. Phoebe hatte gewusst, dass Marcus’ Plan, gegen alle Regeln in Verbindung zu bleiben, keine gute Idee war.
»Du verstößt damit gegen die Vereinbarungen, Phoebe, Liebste«, stellte Freyja sachlich fest. »Aber du bist eine erwachsene Frau mit freiem Willen und kannst deine eigenen Entscheidungen fällen.«
Theoretisch war es Marcus und Phoebe untersagt, vor Phoebes neunzigstem Tag als Vampirin miteinander zu sprechen. Sie hatten überlegt, wie sie diese Regel unterlaufen könnten. Bedauerlicherweise stand Freyjas einziges Telefon in der Eingangshalle. Außerdem funktionierte es praktisch nie. Hin und wieder stieß der uralte Apparat ein blechernes Läuten aus, wobei die Glocke so vehement schrillte, dass der Hörer auf der Messinggabel zu tanzen begann. Gewöhnlich war die Leitung tot, sobald man den Hörer in die Hand nahm. Freyja schrieb das den miserablen Leitungen zu, die jemand aus Hitlers innerstem Kreis während des letzten Krieges verlegt hatte, aber sie hatte kein Interesse, sie zu reparieren.
Unterstützt von Stella und seinem Freund Nathaniel, hatte Marcus auf alternative Kommunikationsmittel zurückgegriffen: billige Prepaid-Handys. Geräte, wie sie auch von international operierenden Kriminellen und Terroristen verwendet wurden – das hatte ihnen wenigstens Nathaniel versichert –, und die nicht zurückverfolgt werden konnten, falls Baldwin oder ein anderer Vampir ihnen nachspionieren wollte. Phoebe und Marcus hatten sie in einem zwielichtigen Handyladen in einer der geschäftigeren Straßen des 10. Arrondissements erstanden.
»Ich bin sicher, dass du angesichts der Situation eure Gespräche kurz halten wirst«, fuhr Freyja fort. Sie warf einen Blick auf den Computerbildschirm und beschriftete dann den nächsten Umschlag. »Du möchtest doch nicht, dass Miriam euch erwischt.«
Miriam war rund um Sacre Cœur auf der Jagd und würde wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden zurückkehren. Phoebe warf einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims – eine extravagante Komposition aus Blattgold und Marmor, mit den Skulpturen zweier nackter Männer, die das runde Ziffernblatt trugen wie einen Wasserball. Es war eine Minute vor Mitternacht.
»Dann noch einen schönen Abend.« Phoebe war froh, dass Freyja nicht nur ihr und Marcus drei Schritte voraus war, sondern auch mindestens einen vor Miriam.
»Hmm.« Freyja hatte sich schon wieder über das vor ihr liegende Blatt gebeugt.
Phoebe entfloh nach oben. Ihr Zimmer lag am Ende eines langen Flurs, in dem frühe französische Landschaftsmalereien hingen. Ein dicker Teppich schluckte ihre Schritte. Nachdem sie die Zimmertür geschlossen hatte, tastete Phoebe oben auf dem Schrank (Empire, um 1815) herum und zog die Plastiktüte herunter. Sie nahm eines der Handys heraus und schaltete es ein. Es war aufgeladen und einsatzbereit. Das Handy an ihr Herz gepresst, huschte Phoebe in das angeschlossene Bad und schloss auch diese Tür. Mehr als zwei geschlossene Türen und eine Lage dicker Porzellanfliesen bot dieser Vampirhaushalt nicht an Privatsphäre. Sie streifte die Schuhe von den Füßen und setzte sich auf den Rand der leeren Wanne, ehe sie Marcus’ Nummer wählte.
»Hallo, Liebste.« Marcus’ sonst so fröhliche, warme Stimme klang leicht angeraut vor Sorge – obwohl er das nach bestem Vermögen zu überspielen versuchte. »Wie war das Essen?«
»Köstlich«, log Phoebe. Sie ließ sich in die Belle-Epoque-Wanne sinken, deren elegant hochgezogene Rückenlehne ihrem Kopf Halt bot.
Marcus’ leises Lachen verriet ihr, dass er ihr nicht glaubte. »Zwei Löffel Nachspeise und ab und zu ein winziger Bissen?«, neckte er sie.
»Ein Löffel Nachspeise. Dabei hat Charles sich solche Mühe gegeben.« Sie würde das wiedergutmachen müssen. Wie die meisten kulinarischen Genies war Charles schnell beleidigt, wenn halb leergegessene Teller in die Küche zurückgebracht wurden.
»Niemand hat erwartet, dass du viel isst«, sagte Marcus. »Das Essen war für deine Familie bestimmt, nicht für dich.«
»Es ist so viel übrig geblieben. Freyja hat Mum alles mitgegeben.«
»Wie hat Edward sich geschlagen?« Marcus wusste um die Vorbehalte ihres Vaters.
»Dad hat versucht, mich umzustimmen. Wieder mal«, erwiderte Phoebe.
Es blieb lange still.
»Erfolglos«, ergänzte Phoebe für den Fall, dass Marcus sich das fragte.
»Dein Vater will nur, dass du dir absolut sicher bist«, sagte Marcus leise.
»Das bin ich. Warum fragen mich die Leute trotzdem ständig?«
»Weil sie dich lieben«, sagte Marcus.
»Dann sollten sie mir zuhören. Ich will mit dir zusammen sein – sonst nichts.« Natürlich war das bei Weitem nicht alles. Seit Phoebe auf Sept-Tours Ysabeau begegnet war, verzehrte sie sich nach dem unerschöpflichen Vorrat an Zeit, über den Vampire verfügten. Phoebe hatte beobachtet, wie Ysabeau sich in jede Aufgabe vertiefte. Nichts wurde schnell erledigt, nur damit sie es von einer endlosen Liste abhaken und zum nächsten Punkt übergehen konnte. Stattdessen zeugte bei Ysabeau jede Handlung von einer gewissen Ehrerbietung – wenn sie an den Blumen im Garten roch, die gemächliche Pause am Ende eines Buchkapitels, ehe sie mit dem nächsten begann. Ysabeau hatte keine Angst, dass ihr die Zeit knapp werden könnte, bevor sie jedes noch so kleine Erlebnis bis zur Neige ausgekostet hatte. Phoebe hingegen hatte ihrem Gefühl nach nie genug Zeit zum Durchatmen, sie flitzte vom Markt zur Arbeit, zur Apotheke, um Schnupfenmedizin zu kaufen, zum Schuster, um die Absätze erneuern zu lassen, und wieder zurück zur Arbeit.
Doch diese Beobachtungen hatte Phoebe nicht mit Marcus geteilt. Bald, wenn sie wieder vereint wären, würde er ohnehin erfahren, wie sie über dieses Thema dachte. Dann würde Marcus Blut aus ihrer Herzader trinken – dem dünnen blauen Strang, der die linke Brust kreuzte – und dabei ihre intimsten Geheimnisse, ihre dunkelsten Ängste und ihre größten Wünsche erfahren. Das Blut der Herzader offenbarte alles, was man eher für sich behalten wollte, und ihn daraus trinken zu lassen war ein Ausdruck des Vertrauens in ihre Beziehung.
»Wir machen einen Schritt nach dem anderen, vergiss das nicht.« Marcus’ Bemerkung riss sie aus ihren Gedanken. »Erst wirst du Vampirin. Und wenn du mich dann immer noch haben willst …«
»Das will ich.« Phoebe war sich ganz sicher.
»Falls du mich dann immer noch haben willst«, wiederholte Marcus, »werden wir heiraten, und dann gehörst du für alle Zeit zu mir. In guten wie in schlechten Tagen.«
Dies war eines ihrer Pärchen-Rituale – ihr Ehegelübde zu proben. Manchmal konzentrierten sie sich auf eine einzige Zeile und gaben vor, sie nicht im Kopf behalten zu können. Manchmal amüsierten sie sich darüber, wie lang die Liste war und wie unbedeutend die darin angesprochenen Komplikationen, gemessen an ihren Gefühlen füreinander.
»In Krankheit und Gesundheit.« Phoebe rutschte tiefer in die Wanne. Das kühle Email erinnerte sie an Marcus, und die unnachgiebige Kurve in ihrem Rücken weckte in ihr den Wunsch, er würde hinter ihr sitzen und Arme und Beine um sie legen. »Und keinen anderen zu begehren. Für alle Zeit.«
»Für alle Zeit ist ziemlich lange«, sagte Marcus.
»Und keinen anderen zu begehren«, wiederholte Phoebe.
»Das kannst du nicht sicher wissen. Erst wenn du mich bis ins Blut kennst«, erwiderte Marcus.
Sie stritten selten, eigentlich nur, wenn Marcus’ Worte anzudeuten schienen, dass er ihr nicht ganz vertraute, und Phoebe sich dagegen verwahrte. Bis jetzt hatten diese Wortgefechte zuverlässig in Marcus’ Bett geendet, wo sie einander gegenseitig und zur beiderseitigen Befriedigung demonstriert hatten, dass sie zwar (noch) nicht alles übereinander wussten, aber in entscheidenden Bereichen durchaus einiges übereinander erfahren hatten.
Doch jetzt war Phoebe in Paris, und Marcus war in der Auvergne. Physischer Kontakt war im Moment nicht möglich. Eine klügere, erfahrenere Person hätte die Sache vielleicht auf sich beruhen lassen – aber Phoebe war dreiundzwanzig, sie war nervös, und sie fürchtete sich vor dem, was sie erwartete.
»Ich weiß nicht, wieso du glaubst, dass bloß ich meine Meinung ändern könnte und du nicht. Immerhin kenne ich dich nur als Vampir. Du hingegen hast dich in mich verliebt, als ich ein Warmblut war.«
»Ich liebe dich.« Zum Glück kam Marcus’ Antwort sofort. »Daran wird sich nichts ändern, selbst wenn du dich änderst.«
»Vielleicht stößt dich ja mein Geschmack ab. Ich hätte dich probieren lassen sollen … vorher.« Phoebe merkte, dass sie auf Streit aus war. Vielleicht liebte Marcus sie nicht so sehr, wie er glaubte. Die Vernunft sagte Phoebe, dass das Unfug war, doch ihr irrationales Unbewusstes (das im Moment das Sagen hatte) war nicht überzeugt.
»Ich will, dass wir diese Erfahrung teilen – als zwei Gleiche. Ich habe noch nie mein Blut mit einer Partnerin getauscht – genauso wenig wie du. Es wird für uns beide das erste Mal sein.« Marcus’ Stimme blieb sanft, doch Phoebe hörte eine leise Frustration heraus.
Dies war vertrautes Terrain. Gleichheit lag Marcus am Herzen. Eine Bettlerin mit Kind, die rassistische Bemerkung eines Fremden in der U-Bahn, ein älterer Mann, der sich über die Straße mühte, während Jugendliche mit Kopfhörern und Handys an ihm vorbeieilten – all das brachte Marcus zum Kochen.
»Wir hätten einfach durchbrennen und untertauchen sollen«, sagte Marcus. »Wir hätten es so tun sollen, wie wir das für richtig halten, statt uns mit diesen uralten Traditionen und Zeremonien herumzuplagen.«
Aber auch die Entscheidung, es auf diese Weise zu tun, langsam und Schritt für Schritt, hatten sie gemeinsam getroffen. Ysabeau de Clermont, die Matriarchin der Familie und Marcus’ Großmutter, hatte ihnen, scharfsinnig wie stets, die Vor- und Nachteile aufgezählt, die es mit sich brachte, mit den Bräuchen der Vampire zu brechen. Sie begann mit dem jüngsten Familienskandal. Marcus’ Vater Matthew hatte eine Hexe geheiratet und damit gegen das fast tausend Jahre alte Verbot einer Verbindung zwischen Angehörigen verschiedener Spezies verstoßen. Wenig später wäre er deshalb um ein Haar gestorben, durch die Hand seines Sohnes Benjamin. Somit blieben Phoebe und Marcus zwei Möglichkeiten. Sie konnten Phoebes Transformation und ihre Hochzeit so lange wie möglich geheim halten, würden aber dafür bis in alle Ewigkeit Klatsch und Spekulationen darüber, was sich wohl hinter den Kulissen abgespielt hatte, ertragen müssen. Oder aber sie konnten Phoebe zur Vampirin machen, bevor sie Marcus mit dem gebotenen Pomp – und ganz offiziell – angetraut wurde. Falls sie sich dafür entschieden, würden Phoebe und Marcus wahrscheinlich ein Jahr lang Unannehmlichkeiten ertragen müssen, und ein, zwei Jahrzehnte würde man über sie reden, doch danach würden sie für alle Zeit ein relativ friedliches und unbehelligtes Leben führen.
Auch Marcus’ Ansehen hatte bei Phoebes Entscheidung eine Rolle gespielt. Er war unter den Vampiren für sein ungestümes Wesen berüchtigt, weil er gern losstürmte, um jedes Übel in der Welt zu richten, ohne dass er sich darum geschert hätte, was andere Kreaturen denken mochten. Phoebe hoffte, dass man Marcus mehr Respekt entgegenbringen würde, wenn sie bei ihrer Hochzeit der Tradition folgten.
»Traditionen haben ihren Sinn, vergiss das nicht«, ermahnte Phoebe ihn streng. »Außerdem befolgen wir nicht alle Regeln. Dein Plan mit den geheimen Handys ist übrigens schon aufgeflogen. Freyja weiß Bescheid.«
»Er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt«, seufzte Marcus. »Ich schwöre bei Gott, Freyja ist ein Bluthund. Ihr entgeht nichts. Aber mach dir keine Sorgen. Freyja stört es nicht besonders, wenn wir miteinander reden. Miriam ist die Pingelige.«
»Miriam ist in Montmartre.« Phoebe sah auf ihre Uhr. Inzwischen war es halb eins. Miriam würde bald zurückkehren. Sie mussten auflegen.
»Rund um Sacre Cœur lässt es sich gut jagen«, kommentierte Marcus.
»Das sagt Freyja auch«, bestätigte Phoebe.
Es wurde still. Ihr Schweigen war belastet von Dingen, die sie nicht aussprechen durften, nicht aussprechen wollten oder nicht auszusprechen vermochten. Letzten Endes waren nur drei Worte wichtig genug.
»Ich liebe dich, Marcus Whitmore.«
»Ich liebe dich, Phoebe Taylor«, erwiderte Marcus. »Wie du dich in neunzig Tagen auch entscheidest, du bist schon jetzt meine Gefährtin. Du bist unter meiner Haut, in meinem Blut, in meinen Träumen. Und keine Sorge. Du wirst eine fantastische Vampirin.«
Phoebe hatte keinen Zweifel, dass die Transformation funktionieren würde, und kaum einen, dass sie es genießen würde, alterslos und beinahe allmächtig zu sein. Aber würden sie und Marcus eine Beziehung aufbauen können, die alles überdauerte, so wie jene, die Marcus’ Großmutter damals mit ihrem Gemahl Philippe verbunden hatte?
»Ich denke an dich«, sagte Marcus. »Jede Sekunde.«
Dann hatte Marcus aufgelegt, und die Leitung war tot.
Phoebe drückte das Handy ans Ohr, bis die Stille durch ein Freizeichen ersetzt wurde. Sie kletterte aus der Wanne, zerschmetterte das Handy unter der Dose mit den Badesalzen, öffnete das Fenster und schleuderte den Klumpen aus Plastik und Elektronik so weit wie möglich in den Garten. Alle Beweise für ihre Regelverstöße zu vernichten war Marcus’ ursprünglicher Plan gewesen, und Phoebe würde ihn buchstabengetreu ausführen, auch wenn Freyja inzwischen von den verbotenen Handys wusste. Die Überreste des Geräts landeten mit einem beruhigenden Platsch in dem kleinen Teich.
Nachdem Phoebe alle Spuren beseitigt hatte, zog sie sich aus und hängte das Kleid in den Schrank – wobei sie peinlich darauf achtete, dass die gestreifte Plastiktüte oben auf dem Schrank nicht mehr zu sehen war. Dann streifte sie das schlichte weiße Nachthemd über, das Françoise ihr auf dem Bett bereitgelegt hatte.
Phoebe setzte sich auf den Rand der Matratze. Still und reglos saß sie da, entschlossen der Zukunft zugewandt und nur darauf wartend, dass die Zeit sie finden würde.
Teil 1
Wir haben es in der Hand, die Welt noch einmal von Neuem zu erschaffen.
Thomas Paine, Common Sense
Kapitel 2
Weniger als Null
13. Mai
Phoebe stieg auf die Waage.
»Mein Gott, bist du leicht.« Freyja las die Zahlen laut vor, und Miriam trug sie auf einem Bogen ein, der nach einem Krankenblatt aussah. »Zweiundfünfzig Kilogramm.«
»Ich habe dir doch gesagt, du sollst drei Kilo zunehmen, Phoebe«, sagte Miriam. »Laut der Waage sind es aber nur zwei.«
»Ich habe es wirklich versucht.« Phoebe verstand nicht, warum sie sich vor zwei Wesen rechtfertigen musste, die praktisch von einer Flüssigdiät mit Rohkostzugaben lebten. »Was kann ein einziges Kilo schon ausmachen?«
»Das Blutvolumen vergrößern.« Miriam gab sich redlich Mühe, geduldig zu klingen. »Je schwerer du bist, desto mehr Blut hast du auch.«
»Und je mehr Blut du hast, desto mehr wird Miriam dir spenden können«, fuhr Freyja fort. »Wir wollen sicherstellen, dass sie dir exakt so viel zurückgibt, wie sie dir nimmt. Wenn das menschliche Blut mengengleich gegen Vampirblut getauscht wird, verringert sich das Risiko einer Abstoßung. Und wir möchten, dass du so viel Vampirblut wie möglich erhältst.«
Die Berechnungen liefen schon seit Monaten. Blutvolumen. Herzleistung. Gewicht. Sauerstoffaufnahme. Hätte Phoebe es nicht besser gewusst, hätte sie geglaubt, sie sollte in die britische Fechterinnen-Nationalmannschaft aufgenommen werden, nicht in die Familie der de Clermonts.
»Und wegen der Schmerzen bist du sicher?«, fragte Freyja. »Wir können dir etwas dagegen geben. Dir die Beschwerden nehmen. Eine Wiedergeburt muss nicht mehr so schmerzhaft ablaufen wie einst.«
Auch darüber hatten sie ausgiebig diskutiert. Freyja und Miriam hatten ihr haarsträubende Geschichten von ihrer eigenen Transformation erzählt und beschrieben, wie qualvoll es war, mit dem Blut einer Kreatur mit übermenschlichen Fähigkeiten erfüllt zu werden. Vampirblut war aggressiv, es löschte jede Spur an Menschlichkeit aus, um ein perfektes Raubtier zu erschaffen. Ein neugeborener Vampir konnte sich relativ oder völlig schmerzfrei an die Invasion genetischen Materials anpassen, wenn er das neue Blut langsam aufnahm – doch es wies einiges darauf hin, dass der menschliche Körper dadurch auch mehr Zeit hatte, das Blut seines Schöpfers abzustoßen, und lieber den eigenen Tod in Kauf nahm als die Verwandlung in ein anderes Wesen. Der schnelle Austausch durch Vampirblut hatte den entgegengesetzten Effekt. Die Schmerzen waren kaum auszuhalten, doch der geschwächte menschliche Körper hatte keine Gelegenheit, Ressourcen für einen Gegenangriff zu sammeln.
»Die Schmerzen stören mich nicht. Ich will es erfahren.« Phoebe sagte es fest, in der Hoffnung, dass sie damit diesen Gesprächsfaden abschnitt – und zwar endgültig.
Freyja und Miriam wechselten einen Blick.
»Und eine örtliche Betäubung für den Biss?«, fragte Miriam.
»Herrgott, Miriam.« Wenn Phoebe sich nicht gerade wie eine potenzielle Olympionikin fühlte, dann wie in dem gründlichsten präoperativen Beratungsgespräch, das je durchgeführt wurde. »Ich will keine Betäubung. Ich will den Biss spüren. Ich will den Schmerz spüren. Dies ist der einzige Geburtsvorgang, den ich je bewusst erleben werde. Den will ich nicht verpassen. Kein Schöpfungsprozess war je schmerzlos. Wunder sollten Spuren hinterlassen, damit wir nie vergessen, wie kostbar sie sind.«
»Nun dann«, sagte Freyja. »Die Türen sind verschlossen. Die Fenster sind verriegelt. Françoise und Charles stehen für alle Fälle Gewehr bei Fuß.«
»Ich finde immer noch, wir hätten das in Dänemark tun sollen.« Selbst jetzt konnte Miriam nicht aufhören, den ganzen Prozess in Frage zu stellen. »In Paris schlagen zu viele Herzen.«
»In Lejre ist es zu dieser Jahreszeit fünfzehn Stunden am Tag hell. So viel Sonnenlicht würde Phoebe nicht ertragen«, widersprach Freyja.
»Ja, aber das Jagen …«, setzte Miriam an.
Was nun folgen würde, wusste Phoebe, wäre ein ausgedehnter Vergleich der französischen und dänischen Fauna, in dem die jeweiligen Vorzüge an nahrhafter Beute gegeneinander aufgewogen würden, mit besonderem Augenmerk auf Größe und Frische, der Frage, ob gezüchtete oder wilde Tiere sowie den unvorhersehbaren Gelüsten eines neugeborenen Vampirs.
»Es reicht«, sagte Phoebe und ging in Richtung Tür. »Vielleicht kann Charles mich verwandeln. Ich werde kein weiteres Mal über diese Arrangements diskutieren.«
»Sie ist bereit«, urteilten Miriam und Freyja im Chor.
Phoebe zog den losen Kragen des weißen Nachthemds beiseite und entblößte dabei kräftige Venen und Arterien. »Dann los.«
Sie hatte die Worte kaum ausgesprochen, als sie einen stechenden Schmerz spürte.
Taubheit.
Kribbeln.
Saugen.
Phoebes Knie knickten ein, und ihr wurde unter dem Schock des massiven Blutverlusts schwindlig. Ihr Gehirn registrierte einen Angriff, der sie in Todesgefahr brachte, und das Adrenalin schoss ein. Ihr Blickfeld wurde schmaler, der Raum dunkler. Starke Arme fingen sie auf.
Phoebe entschwebte in eine samtweiche Dunkelheit und sank in tiefe Stille.
Ätzende Kälte holte sie zurück.
Phoebe erfror, verbrannte.
Ihr Mund öffnete sich zu einem entsetzten Schrei, als ihr Körper von innen heraus entflammte. Jemand bot ihr ein Handgelenk dar, und sie roch etwas Feuchtes – Köstliches.
Kupfer und Eisen.
Salzig und süß.
Es roch nach Leben. Leben.
Wie ein Baby, das nach der Mutterbrust sucht, schnupperte Phoebe an dem Handgelenk, dessen Fleisch so verführerisch nah vor ihrem Mund schwebte, immer knapp über ihren Lippen.
»Du hast die Wahl«, sagte ihre Schöpferin. »Leben? Oder Tod?«
Mit all ihrer Energie näherte Phoebe sich dem Versprechen neuer Lebenskraft. In der Ferne war ein langsames, stetes Klopfen zu hören. Dann verstand sie.
Herzschlag.
Puls.
Blut.
Phoebe küsste das kalte Fleisch am Handgelenk ihrer Schöpferin, ehrfürchtig und in blinder Dankbarkeit für das Geschenk, das ihr zuteilwurde.
»Leben«, wisperte Phoebe, und dann nahm sie den ersten Mundvoll Vampirblut.
Sobald sich die machtvolle Substanz in ihre Adern ergoss, explodierte Phoebes Körper in Schmerz und Verlangen: nach allem, was verloren war, nach allem, was kommen würde, nach allem, was sie nie sein und was sie werden würde. Ihr Herz begann ein neues Lied anzustimmen, langsam und bedacht.
Ich bin, sang Phoebes Herz.
Nicht.
Und doch.
Jetzt.
Für alle Zeit.
Kapitel 3
Der verlorene Sohn kehrt zurück
13. Mai
»Falls die Geister diesen Krach veranstalten, dann bringe ich sie um«, murmelte ich, während ich mich gleichzeitig an der Orientierungslosigkeit des Schlafes festklammerte, in der Hoffnung, Zeit zu schinden. Ich litt immer noch unter Jetlag, nach unserem jüngsten Flug von Amerika nach Frankreich, und hatte jetzt am Ende des Frühjahrsemesters in Yale stapelweise Prüfungen und Arbeiten zu korrigieren. Ich zog die Decke unters Kinn, drehte mich um und betete um Stille.
Ein schweres Klopfen hallte durchs Haus und prallte an den dicken Steinmauern und -böden ab.
»Da ist jemand an der Haustür.« Matthew, der kaum je schlief, saß am offenen Fenster und schnupperte in der Nachtluft nach einem Hinweis auf den Neuankömmling. »Es ist Ysabeau.«
»Um drei Uhr morgens!« Stöhnend schob ich die Füße in die bereitstehenden Pantoffeln. Wir waren Krisen weiß Gott gewohnt, aber das war dann doch ungewöhnlich.
Matthew war in einem Wimpernschlag vom Schlafzimmerfenster an der Treppe und auf dem Weg nach unten.
»Mama!«, jammerte Becca im Kinderzimmer nebenan. »Au! Laut. Laut.«
»Ich komme schon, Süße.« Meine Tochter hatte das scharfe Gehör ihres Vaters. Ihr erstes Wort war »Mama« gewesen, das zweite »Papa«, das dritte »Pip« für ihren Bruder Philip. »Blut«, »laut« und »Wauwau« folgten kurz darauf.
»Glühwürmchen, Glühwürmchen, leuchte für mich.« Statt das Licht einzuschalten, brachte ich mit einem schlichten Spruch, zu dem mich eine alte, im Schrank aufgestöberte Schlagerschallplatte inspiriert hatte, meinen Zeigefinger zum Leuchten. Meine Obsekration – die Fähigkeit, meine gewobene Magie in Worte zu fassen – war schon erwacht.
Im Kinderzimmer saß Becca in ihrem Bett, die winzigen Hände über den kleinen Ohren, das Gesicht unter Schmerzen verzerrt. Cuthbert, der Plüschelefant, den Marcus ihr geschenkt hatte, und ein hölzernes Zebra namens Zee umtanzten ihr schweres, mittelalterliches Gitterbett. Philip stand in seinem eigenen Bettchen, hielt sich am Gitter fest und betrachtete besorgt seine Schwester.
Wenn die Zwillinge träumten, wallte die Magie im Hexen-Vampir-Blut der beiden auf und störte ihren leichten Schlaf. Ich fand ihre nächtlichen Aktivitäten zwar beunruhigend, doch Sarah meinte, wir könnten der Göttin dankbar sein, dass die Zwillinge ihre Zauberkräfte bislang darauf beschränkt hatten, die Möbel im Kinderzimmer umzustellen, weiße Wolken aus Babypuder aufsteigen zu lassen und ihre Stofftiere in improvisierten Mobiles anzuordnen.
»Aua.« Philip deutete auf Becca. Er trat schon jetzt in Matthews Fußstapfen als Arzt und untersuchte jede Kreatur – ob nun zweibeinig, vierbeinig, geflügelt oder mit Flossen ausstaffiert – peinlich genau auf Kratzer, blaue Flecken oder Insektenstiche hin.
»Danke, Philip.« Ich wich Cuthbert im letzten Moment aus und trat an Beccas Bett. »Soll ich dich in den Arm nehmen, Becca?«
»Cuthbert auch.« Dank der mit beiden Großmüttern verbrachten Zeit war Becca schon jetzt eine geschickte Verhandlerin. Ich fürchtete, dass Ysabeau und Sarah keinen guten Einfluss auf sie hatten.
»Nur du und Philip, wenn er möchte«, sagte ich fest und strich Becca dabei über den Rücken.
Cuthbert und Zee plumpsten eingeschnappt auf den Boden. Es war unmöglich festzustellen, wer von den beiden für die fliegenden Tiere verantwortlich gewesen war und warum der Zauber erloschen war. Hatte Becca sie aufsteigen lassen, und das Rückenstreicheln hatte sie so weit getröstet, dass sie die Tiere nicht mehr brauchte? Oder war es Philip gewesen, der sich nun, wo seine Schwester sich nicht mehr aufregte, ebenfalls beruhigt hatte? Oder waren sie gelandet, weil ich nein gesagt hatte?
Das ferne Klopfen verstummte. Ysabeau war im Haus.
»O…«, setzte Becca an. Dann hickste sie.
»…ma«, beendete Philip das Wort und erstrahlte.
Die Angst schnürte meinen Magen zu einem festen Knoten zusammen. Plötzlich begriff ich, dass etwas Einschneidendes passiert sein musste, wenn Ysabeau mitten in der Nacht auftauchte, ohne vorher angerufen zu haben. Das leise Gemurmel im Erdgeschoss war zu weit entfernt, als dass meine Hexenohren etwas verstehen konnten, dafür ließen die aufmerksam geneigten Köpfchen der Zwillinge darauf schließen, dass sie der Unterhaltung zwischen ihrem Vater und ihrer Großmutter folgen konnten. Bedauerlicherweise waren sie zu jung, um den Inhalt wiedergeben zu können.
Ich warf einen argwöhnischen Blick auf die glatten Stufen, während ich Becca auf meine Hüfte setzte und mit dem freien Arm Philip aus dem Bett hob. Normalerweise hielt ich mich an dem Seil fest, das Matthew an der gekrümmten Mauer befestigt hatte, um Warmblüter vor dem Absturz zu bewahren. Ich beschränkte meine Magie in Gegenwart der Kinder so weit wie möglich, weil ich fürchtete, dass sie versuchen könnten, mich nachzuahmen. Heute Abend würde ich eine Ausnahme machen müssen.
Komm mit, wisperte der Wind, der sanft wie ein Liebhaber meine Knöchel streichelte, und ich werde deinen Wunsch erfüllen.
Der Ruf des Windes war ärgerlich deutlich. Wieso konnte er nicht Ysabeaus Worte zu mir tragen? Warum wollte er, dass ich zu Matthew und ihr ging? Aber manchmal war die Macht wie eine Sphinx. Wenn man nicht die richtige Frage stellte, schwieg sie eigensinnig.
Die Kinder fest in den Armen, ergab ich mich dem Lockruf der Luft, und meine Füße hoben sich über den Boden. Ich hoffte, die Kinder würden nicht merken, dass wir eine Handbreit über dem Stein schwebten, doch in Philips grüngrauen Augen war etwas Uraltes, Weises erwacht.
Ein silberner Mondstrahl stach durch eines der hohen, schmalen Fenster und glitt über die Wand gegenüber, während wir die Stufen hinabschwebten.
»Schön«, gurrte Becca und streckte die Hand nach dem Lichtstreifen aus. »Babys schön.«
Einen Moment neigte sich das Licht ihr zu, im Widerspruch zu allen den Menschen bekannten physikalischen Gesetzen. Auf meinen Armen breitete sich eine Gänsehaut aus, gefolgt von Lettern, die rot und golden unter meiner Haut leuchteten. Das Mondlicht war voller Magie, doch auch wenn ich eine Hexe und eine Weberin war, konnte ich nicht immer sehen, was meine gemischtblütigen Kinder wahrnehmen konnten.
Froh, den Mondstrahl hinter uns zu lassen, ließ ich mich von der Luft an den Fuß der Treppe tragen. Sobald wir wieder terra firma unter uns hatten, legten meine Warmblüterfüße den Rest des Weges bis zur Haustür zurück.
Ein frostiges Kitzeln auf meiner Wange, das vom Blick eines Vampirs kündete, verriet mir, dass Matthew uns bemerkt hatte. Er stand mit Ysabeau in der offenen Tür. Das Spiel von Silber und Schatten hob seine Wangenknochen hervor und ließ sein Haar noch dunkler wirken, während dasselbe Licht Ysabeau wie durch Alchimie noch goldener glänzen ließ. Ihre hellbraunen Leggings waren verdreckt und das weiße Hemd von einem Zweig aufgeschlitzt worden. Sie begrüßte mich atemlos, mit einem knappen Nicken. Ysabeau war gerannt – schnell und weit.
Die Kinder spürten instinktiv, dass dies ein besonderer Moment war. Statt ihre Großmutter wie sonst begeistert zu begrüßen, klammerten sie sich an mich und kuschelten ihre Köpfe in meine Halsbeuge, als wollten sie sich vor der mysteriösen Dunkelheit verstecken, die ihren Schatten über unser Haus warf.
»Ich habe gerade mit Freyja telefoniert. Noch während wir uns unterhielten, sagte Marcus, er würde in den Ort gehen.« In Ysabeaus Stimme steckte ein Spreißel Panik. »Aber Alain machte sich Sorgen, darum folgten wir ihm. Anfangs war alles ganz normal. Aber dann stürmte Marcus davon.«
»Marcus ist von Sept-Tours geflüchtet?« Das war doch nicht möglich. Matthews Sohn vergötterte Ysabeau, und sie hatte eigens darum gebeten, dass er den Sommer über bei ihr blieb.
»Er war in Richtung Westen unterwegs, darum nahmen wir an, dass er hierherkommen wollte, aber etwas sagte mir, dass ich ihm lieber folgen sollte.« Wieder holte Ysabeau schwer Luft. »Dann schwenkte Marcus plötzlich nach Norden in Richtung Montluçon ab.«
»Zu Baldwin?« Mein Schwager besaß dort ein Haus, vor langer Zeit erbaut, als die Gegend schlicht unter dem Namen Mons Lucii bekannt war.
»Nein. Nicht zu Baldwin. In Richtung Paris.« Matthews Miene wurde düster.
Ysabeau nickte. »Er flüchtet nicht. Er eilt zu Phoebe.«
»Es ist etwas passiert.« Ich war fassungslos. Alle hatten mir versichert, dass Phoebe den Übergang vom Warmblut zum Vampir problemlos meistern würde. Wir hatten so viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Philip erspürte meine Ängste und verlangte zappelnd, abgesetzt zu werden.
»Freyja sagte, es sei alles nach Plan gelaufen. Phoebe ist jetzt eine Vampirin.« Matthew nahm mir Philip ab und stellte ihn auf den Boden. »Bleib bei Diana und den Kindern, Maman. Ich folge Marcus und finde heraus, was passiert ist.«
»Alain wartet draußen«, sagte Ysabeau. »Nimm ihn mit. Vier Augen sehen mehr als zwei, meinte dein Vater in solchen Fällen immer.«
Matthew gab mir einen Kuss. Wie meistens hatte sein Abschied etwas Ungestümes, so als wollte er mich ermahnen, wachsam zu bleiben, während er weg war. Er strich Becca übers Haar und drückte seine Lippen zärtlich auf ihre Stirn.
»Pass auf dich auf«, murmelte ich, eher aus Gewohnheit denn aus echter Sorge.
»Immer«, erwiderte Matthew und warf mir einen letzten, eindringlichen Blick zu.
Nach der Aufregung über den Besuch der Großmutter brauchten die Kinder fast eine Stunde, bis sie wieder eingeschlafen waren. Hellwach nach der Aufregung und mit zahllosen Fragen, ging ich hinunter in die Küche. Dort saßen, wie erwartet, Marthe und Ysabeau.
Sonst hielt ich mich gern in den weitläufigen, miteinander verbundenen Wirtschaftsräumen auf. Dort war es stets warm und gemütlich, meist brannte ein Feuer in dem alten, emaillierten Eisenherd, in dem fast immer etwas Köstliches backte, und Schalen voller frischer Früchte und Lebensmittel warteten darauf, von Marthe in ein Festmahl verwandelt zu werden. An diesem Morgen jedoch fühlte sich die Küche trotz der hellen Wandleuchten und der farbenfrohen holländischen Zierkacheln an den Wänden dunkel und kalt an.
»Wenn mir etwas nicht gefällt daran, mit einem Vampir verheiratet zu sein, dann ist es dieses ewige Warten, dass der andere sich mal meldet.« Ich ließ mich auf einen der Stühle rund um den riesigen, schartigen Holztisch plumpsen, der das Gravitationszentrum in dieser häuslichen Sphäre bildete. »Ich danke dem Himmel für das Mobiltelefon. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es gewesen sein muss, immer auf eine handschriftliche Nachricht warten zu müssen.«
»Das fand niemand schön.« Marthe stellte einen Becher mit dampfendem Tee vor mir ab und dazu ein mit Mandelpaste gefülltes und mit Puderzucker bestäubtes Croissant.
»Himmlisch.« Ich inhalierte das Aroma von dunklen Blättern und nussiger Süße, das von beidem aufstieg.
»Ich hätte mit ihnen gehen sollen.« Ysabeau hatte sich gar nicht erst bemüht, ihr Haar zu ordnen oder den Dreckspritzer von ihrer Wange zu wischen. Dabei achtete sie sonst immer auf ein makelloses Äußeres.
»Matthew wollte, dass Sie hierbleiben«, sagte Marthe und bemehlte mit einer geübten Handbewegung den Tisch. Sie nahm einen Teigklumpen aus einer Schüssel und begann, ihn mit den Handballen durchzuwalken.
»Was nicht heißt, dass ich mich danach zu richten habe«, erwiderte Ysabeau.
»Kann mir jemand sagen, was genau Marcus aus der Fassung gebracht hat?« Immer noch hatte ich das Gefühl, dass mir etwas Entscheidendes entging. Ich nahm einen Schluck Tee.
»Nichts.« Ysabeau konnte, genau wie ihr Sohn, extrem knauserig mit Informationen sein.
»Irgendetwas muss passiert sein«, sagte ich.
»Wirklich, es ist gar nichts passiert. Es gab ein Abendessen mit Phoebes Familie«, sagte Ysabeau. »Freyja hat mir versichert, dass alles wunderbar gelaufen ist.«
»Was hat Charles zubereitet?« Mir lief das Wasser im Mund zusammen. »Bestimmt war es köstlich.«
Marthes Hände kamen zur Ruhe, und sie sah mich böse an. Dann lachte sie.
»Was ist daran so komisch?«, wollte ich wissen und biss in das flockige Croissant. Der Teig war so buttrig, dass er auf der Zunge zerschmolz.
»Weil Phoebe eben zur Vampirin geworden ist und du wissen willst, was sie zuletzt gegessen hat. Uns Manjasang erscheint das nebensächlich und skurril bei einem so einschneidenden Akt«, erklärte Ysabeau.
»Natürlich erscheint es euch so. Ihr habt noch nie eins von Charles’ Brathähnchen gekostet«, sagte ich. »Dieser Knoblauch. Und die Zitrone. Göttlich.«
»Es gab aber Ente«, berichtete Marthe. »Und Lachs. Und Rindfleisch.«
»Hat Charles ein Siegle d’Auvergne gebacken?«, fragte ich, den Blick auf Marthes Teigklumpen gerichtet. Das dunkle Brot war Charles’ Spezialität – und Phoebes Lieblingsbrot. »Und gab es zum Nachtisch Pompe aux pommes?«
Phoebe liebte alles Süße, und ich hatte sie nur ein einziges Mal in ihrem Entschluss, Vampirin zu werden, wanken sehen – als Marcus mit ihr zur Bäckerei in Saint-Lucien gegangen war und ihr erklärt hatte, dass die Apfeltorte im Schaufenster widerlich schmecken würde, sobald sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzte.
»Beides«, erwiderte Marthe.
»Bestimmt war Phoebe überglücklich.«
»Freyja erzählt, dass sie in letzter Zeit kaum etwas gegessen hat.« Ysabeau zog die Unterlippe zwischen die Zähne.
»Wollte Marcus deshalb zu ihr?«
»Nein. Marcus wollte zu ihr, weil Phoebe ihn angerufen hatte, um sich ein weiteres Mal von ihm zu verabschieden.« Ysabeau schüttelte den Kopf. »Sie sind beide so impulsiv.«
»Sie sind modern, das ist alles«, sagte ich.
Es kam nicht überraschend, dass Phoebe und Marcus irgendwann beschlossen hatten, den Weg durch das komplexe Labyrinth der Vampirgebote und -verbote abzukürzen. Erst hatte man Baldwin, das Familienoberhaupt der de Clermonts, gebeten, formell die Verlobung von Marcus und Phoebe gutzuheißen und Phoebes Wunsch, Vampir zu werden, zu billigen. Angesichts Marcus’ bewegter Vergangenheit und Matthews skandalöser Entscheidung, sich mit mir – einer Hexe – zu vermählen, wurde dies als erster entscheidender Schritt betrachtet. Nur wenn Baldwin die Ehe guthieß, konnte sie als legitim gelten.
Danach mussten Marcus und Phoebe aus einer sehr kurzen Liste möglicher Kandidatinnen eine Schöpferin wählen. Es durfte kein Mitglied der Familie sein, denn Philippe de Clermont hatte sich vehement gegen alles ausgesprochen, was auch nur den leisesten Anschein von Inzest erwecken konnte. Um seine Kinder sorgte man sich wie um Kinder. Partner mussten außerhalb der Familie gefunden werden. Dazu kamen weitere Einschränkungen. Phoebes Schöpfer sollte eine sehr alte Vampirin sein, die die genetische Kraft hatte, gesunde Vampirkinder zu zeugen. Und weil die ausgewählte Vampirin für immer mit der Familie de Clermont verbunden bleiben würde, mussten auch Ruf und Vergangenheit über jeden Zweifel erhaben sein.
Nachdem Phoebe und Marcus entschieden hatten, wer Phoebe zur Vampirin transformieren würde, trafen Phoebes Schöpferin und Baldwin die Arrangements rund um den Akt selbst, während Ysabeau, unterstützt von Matthews Dämonenfreund Hamish Osborne, alle praktischen Fragen rund um Haushalt, Finanzen und Anstellung regelte. Das Leben als warmblütiger Mensch hinter sich zu lassen und zum Vampir zu werden war ein komplizierter Vorgang. Tod und Verschwinden mussten arrangiert werden, dazu kam ein unbezahlter Urlaub aus persönlichen Gründen, dem nach sechs Monaten die Kündigung folgen würde.
Jetzt, wo Phoebe zur Vampirin geworden war, wäre Baldwin einer ihrer ersten männlichen Besucher. Weil es starke Verbindungen zwischen physischem Hunger und sexuellem Begehren gab, wurden Phoebes Kontakte mit dem männlichen Geschlecht eingeschränkt. Und um übereilten Entscheidungen vorzubeugen, würde Marcus Phoebe erst zu sehen bekommen, wenn Baldwin überzeugt war, dass sie rational über ihre Zukunft an Marcus’ Seite entscheiden konnte. Traditionellerweise warteten Vampire mindestens neunzig Tage ab – die ein neu wiedergeborener Vampir durchschnittlich brauchte, bis er halbwegs flügge und zu einigermaßen unabhängigen Entscheidungen fähig war –, bevor sie sich mit ihren zukünftigen Partnern vereinten.
Zu unserer aller Überraschung hatte Marcus sich mit Ysabeaus ausgefeilten Plänen einverstanden erklärt. Er war der Revoluzzer in der Familie. Ich hatte fest damit gerechnet, dass er protestieren würde, doch er hatte keinen Ton von sich gegeben.
»Vor zwei Tagen waren alle noch ganz zuversichtlich wegen Phoebes Verwandlung«, sagte ich. »Warum macht ihr euch plötzlich solche Sorgen?«
»Wir machen uns keine Sorgen um Phoebe«, erwiderte Ysabeau, »sondern um Marcus. Er war noch nie gut im Warten oder darin, Regeln zu befolgen, die andere für ihn aufgestellt haben. Er folgt zu schnell seinem Herzen. Das bringt ihn regelmäßig in Schwierigkeiten.«
Jemand riss die Küchentür zum Garten auf und fegte in einem blau-weißen Wirbelwind ins Haus. Ich sah Vampire selten in ungebremster Bewegung, darum erschrak ich fast, als sich der wirbelnde Fleck in ein weißes T-Shirt, eine verblichene Jeans, blaue Augen und einen dichten Blondschopf auflöste.
»Ich sollte bei ihr sein!«, ereiferte sich Marcus. »Fast mein ganzes Leben habe ich mich danach gesehnt, irgendwo dazuzugehören, eine eigene Familie zu haben. Jetzt habe ich eine, und schon habe ich sie allein gelassen.«
Matthew folgte Marcus wie ein Schatten. Alain Le Merle, Philippes ehemaliger Schildknappe, bildete die Nachhut.
»Wie du weißt, will die Tradition …«, setzte Matthew an.
»Wann hätte ich mich je um Traditionen geschert?«, fiel Marcus ihm ins Wort. Die Spannung im Raum verstärkte sich weiter. Als Familienoberhaupt erwartete Matthew von seinem Sohn keine Widerworte, sondern Gehorsam und Respekt.
»Alles in Ordnung?« In meiner Laufbahn als Professorin hatte ich gelernt, wie hilfreich es sein konnte, wenn man mit einer rhetorischen Frage allen Beteiligten Gelegenheit zum Innehalten und Überlegen gab. Meine Frage reinigte die Luft, und sei es nur, weil ganz offensichtlich war, dass nicht alles in Ordnung war.
»Wir hätten nicht gedacht, dass du noch wach bist, mon cœur.« Matthew trat zu mir und gab mir einen Kuss. Er roch nach frischer Luft, Pinien und Heu, so als wäre er über freie Felder und durch dichten Wald gerannt. »Marcus ist lediglich um Phoebes Wohlergehen besorgt, das ist alles.«
»Besorgt?« Marcus’ Brauen senkten sich finster. »Ich bin außer mir vor Angst. Ich kann sie nicht sehen. Ich kann ihr nicht helfen …«
»Du musst Miriam vertrauen.« Matthews Stimme klang sanft, doch in seinem Kiefer zuckte ein Muskel.
»Ich hätte dieser mittelalterlichen Prozedur niemals zustimmen dürfen.« Marcus ereiferte sich immer mehr. »Jetzt sind wir getrennt, und sie kann auf niemanden bauen außer auf Freyja …«
»Du hast eigens darum gebeten, dass Freyja dabei sein soll«, bemerkte Matthew ruhig. »Du hättest auch jemand anderen aus der Familie wählen können, der Phoebe während der Verwandlung unterstützt. Du selbst hast dich für sie entschieden.«
»Gott, Matthew. Musst du immer so verflucht vernünftig sein?«
»Das treibt einen zum Wahnsinn, nicht wahr?«, fragte ich mitfühlend und legte dabei eine Hand an die Taille meines Mannes, um ihn in meiner Nähe zu halten.
»Ja, Diana, ganz eindeutig.« Marcus stakste zum Kühlschrank und riss die schwere Tür auf. »Und ich muss mich schon weit länger mit ihm herumschlagen als du. Mein Gott, Marthe. Was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Es ist kein Tropfen Blut im Haus.«
Ich hätte nicht sagen können, wer am meisten über diese Kritik an der allseits verehrten Marthe erschrak. Marthe kümmerte sich um die Bedürfnisse sämtlicher Familienmitglieder, bevor diese sie überhaupt wahrnahmen. Dafür war offensichtlich, wer am wütendsten war: Alain. Marthe war seine Erzeugerin.
Matthew und Alain sahen sich kurz an. Alain erkannte mit einem knappen Nicken an, dass Matthews Pflicht, seinen Sohn zu disziplinieren, über Alains Recht stand, seine Mutter zu verteidigen. Sanft löste Matthew meine Hand von seiner Taille.
Im nächsten Moment war Matthew am anderen Ende der Küche und schleuderte Marcus gegen die Küchenwand. Einem Menschen wären bei dem brutalen Aufprall sämtliche Rippen gebrochen.
»Es reicht, Marcus. Ich habe damit gerechnet, dass Phoebes Transformation Erinnerungen an deine eigene Wiedergeburt wach werden lässt.« Matthew hielt seinen Sohn eisern im Griff. »Trotzdem kannst du dich nicht so gehenlassen. Du gewinnst gar nichts, wenn du durch die Gegend rast und Unruhe stiftest.«
Matthew hielt den Blick seines Sohnes gefangen, wartete ab und ließ Marcus erst los, als der die Augen niederschlug. Marcus rutschte an der Wand abwärts, holte schaudernd Luft und schien erst jetzt zu erkennen, wo er war und was er getan hatte.
»Verzeih mir, Diana.« Marcus sah mich kurz betreten an und ging dann zu Marthe. »Gott, Marthe, ich wollte wirklich nicht …«
»Doch, das wollten Sie.« Marthe boxte ihn aufs Ohr – und das nicht sanft. »Das Blut ist in der Speisekammer, wo es immer ist. Holen Sie es sich selbst.«
»Versuch, dich nicht verrückt zu machen, Marcus. Niemand könnte sich besser um Phoebe kümmern als Freyja.« Ysabeau legte tröstend die Hand auf die Schulter ihres Enkels.
»Ich schon.« Marcus schüttelte ihre Hand ab und verschwand in der Speisekammer.
Marthe blickte himmelwärts, als würde sie um Erlösung von allen Vampiren im Liebestaumel flehen. Ysabeau hob warnend den Finger und brachte Matthew damit zum Schweigen. Ich hingegen, als Einzige im Raum, die die Regeln des de-Clermont-Rudels nicht über Jahrhunderte eingeimpft bekommen hatte, ignorierte den Befehl meiner Schwiegermutter.
»Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das stimmt, Marcus«, rief ich nach nebenan und schenkte mir frischen Tee ein.
»Was?« Marcus war wie der Blitz wieder an meiner Seite, in der Hand einen silbernen Julep-Becher, der, wie ich wusste, weder Bourbon noch Zucker, Wasser oder Minze enthielt. Er sah mich entrüstet an. »Natürlich kann ich mich am besten um sie kümmern. Ich liebe sie. Phoebe ist meine Gemahlin. Ich weiß besser als jeder andere, was sie braucht.«
»Besser als Phoebe?«, fragte ich.
»Manchmal schon.« Marcus’ Kinn ragte streitlustig vor.
»Unfug.« Ich klang wie Sarah – barsch und ungeduldig –, aber das war wohl eher auf die frühe Stunde zurückzuführen als auf eine genetische Prädisposition der Bishop-Frauen zu unverblümter Aufrichtigkeit. »Ihr Vampire seid alle gleich – ihr glaubt immer zu wissen, was wir armen Warmblüter wirklich wollen – besonders die Frauen. Tatsächlich wollte Phoebe genau das: Auf ganz altmodische Art zur Vampirin werden. Deine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass ihre Entscheidung umgesetzt wird und dass der Plan funktioniert.«
»Phoebe wusste nicht, worauf sie sich einließ. Nicht voll und ganz. Sie könnte blutkrank werden. Sie könnte Schwierigkeiten bei ihrer ersten Jagd bekommen. Ich könnte ihr helfen.«
Blutkrank? Ich hätte mich beinahe an meinem Tee verschluckt. Was in aller Welt war das?
»Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so gut auf die Verwandlung zur Manjasang vorbereitet wurde wie Phoebe«, versicherte Ysabeau Marcus.
»Aber es gibt keine Garantien«, beharrte Marcus.
»Nicht in diesem Leben, mein Kind.« Ysabeaus Miene verzog sich kummervoll bei der Erinnerung an glücklichere Zeiten, als das Leben noch ein Happy End versprochen hatte.
»Es ist schon spät. Wir unterhalten uns nach Sonnenaufgang weiter. Versuch, dich auszuruhen, Marcus.« Matthew legte seinem Sohn im Vorbeigehen die Hand auf die Schulter.
»Vielleicht gehe ich stattdessen laufen. Um Energie zu verbrauchen. Zu dieser Stunde sind höchstens ein paar Bauern wach.« Marcus schaute durch das Fenster auf den hellen Streifen am Horizont.
»Wahrscheinlich wird niemand dich bemerken«, bestätigte Matthew. »Soll ich mitkommen?«
»Nicht nötig«, erwiderte Marcus. »Ich ziehe mich nur um und laufe los. Vielleicht nehme ich die Route in Richtung Saint-Priest-sous-Aixe. Die hat ein paar gute Steigungen.«
»Bist du zum Frühstück zurück?« Matthews Tonfall war ein bisschen zu beiläufig. »Die Kinder werden früh wach. Und sie wollen sich die Gelegenheit, ihren älteren Bruder herumzukommandieren, bestimmt nicht entgehen lassen.«
»Keine Sorge, Matthew.« Das Gespenst eines Lächelns umspielte Marcus’ Lippen. »Deine Beine sind länger als meine. Ich laufe nicht weg. Ich muss nur den Kopf klar bekommen.«
Wir ließen die Tür zu unserem Zimmer angelehnt, falls Philip oder Becca wach würden, und gingen wieder ins Bett. Ich krabbelte unter die Decke und war an diesem warmen Maimorgen dankbar dafür, dass mein Mann ein Vampir war, an dessen kühlen Körper ich mich kuscheln konnte. Ich wusste genau, wann Marcus loslief, weil im selben Moment Matthews Schultern in die Matratze sanken. Bis zu diesem Zeitpunkt war er angespannt geblieben, um jederzeit aufstehen und seinem Sohn Beistand geben zu können.
»Willst du ihm hinterher?«, fragte ich. Matthews Beine waren tatsächlich länger als die von Marcus, und er war schnell. Er konnte seinen Sohn jederzeit einholen.
»Alain folgt ihm, nur für alle Fälle«, antwortete Matthew.
»Ysabeau sagte, sie würde sich mehr Sorgen um Marcus als um Phoebe machen.« Ich hob den Kopf und sah Matthew im fahlen Licht der Dämmerung an. »Wieso?«
»Marcus ist noch so jung«, seufzte Matthew.
»Ist das dein Ernst?« Marcus war 1781 als Vampir wiedergeboren worden. Über zweihundert Jahre erschienen mir reichlich Zeit, um erwachsen zu werden.
»Ich weiß, was du denkst, Diana, aber wenn ein Mensch zum Vampir wird, muss er den gesamten Reifungsprozess erneut durchlaufen. Manchmal brauchen wir sehr lange, bis wir wieder allein losziehen können«, sagte Matthew. »Unsere Urteilskraft kann eingeschränkt sein, wenn das erste Vampirblut durch unsere Adern fließt.«
»Aber Marcus hat sich doch schon die Hörner abgestoßen.«
»Und genau darum darf er Phoebes Transformation nicht überwachen. Marcus will eine frisch wiedergeborene Vampirin zur Gemahlin nehmen. Das wäre unter allen Umständen ein gewagter Schritt, aber angesichts seiner Jugend …« Matthew verstummte kurz. »Hoffentlich war es richtig von mir, ihn diesen Schritt tun zu lassen.«
»Die Familie tut genau das, was Marcus und Phoebe wollten«, stellte ich klar. »Sie sind alt genug – als kaltblütiger Vampir wie als warmblütiger Mensch –, um zu wissen, was sie wollen.«
»Wirklich?« Matthew wandte sich mir zu und sah mir ernst in die Augen. »Dass ein gerade erst vierundzwanzigjähriger Mann und eine Frau im selben Alter erfahren genug wären, um über ihren zukünftigen Lebensweg zu entscheiden, ist eine sehr moderne Auffassung.« Er wollte mich foppen, aber seine zusammengezogenen Brauen ließen erkennen, dass er das insgeheim wirklich glaubte.
»Wir schreiben das einundzwanzigste Jahrhundert, nicht das achtzehnte«, sagte ich. »Außerdem ist Marcus nicht ›gerade erst vierundzwanzig‹, wie du es so charmant ausdrückst, sondern über zweihundertfünfzig Jahre alt.«
»Marcus wird immer ein Kind der damaligen Zeit bleiben«, sagte Matthew. »Wenn wir das Jahr 1781 schreiben würden und Marcus statt Phoebe seinen ersten Tag als Vampir erleben würde, wären alle überzeugt, dass er weise Ratschläge bräuchte – und eine starke Hand.«
»Dein Sohn hat jedes Mitglied beider Familien um Erlaubnis gebeten«, rief ich ihm ins Gedächtnis. »Es wird Zeit, dass Marcus selbst über seine Zukunft bestimmen darf, Matthew.«
Marcus verstummte und fuhr mit der Hand über die blassen Narben, mit denen die Hexe Satu Järvinen meinen Rücken gezeichnet hatte. Immer wieder strich er darüber, als wären es Sühnezeichen, die ihn daran erinnern sollten, wie oft er jene, die er liebte, nicht hatte beschützen können.
»Alles wird gut«, versicherte ich ihm und schmiegte mich an ihn.
»Bist du dir sicher?« Matthew seufzte. »Hoffentlich behältst du recht.«
Später am Tag senkte sich eine angenehme Ruhe über Les Revenants. Schon beim Aufwachen freute ich mich immer auf diese seltenen Momente der Stille – die oft nur zwanzig Minuten, aber gelegentlich über eine kostbare Stunde hinweg andauerten.
Die Kinder waren im Kinderzimmer und hielten ihr Mittagsschläfchen. Matthew war in der Bibliothek und arbeitete an einem Papier, das er gemeinsam mit Chris Roberts, unserem Kollegen aus Yale, veröffentlichen würde. Die beiden sollten im Herbst auf diversen Konferenzen ihre jüngsten Forschungsergebnisse vorstellen und wollten in Kürze bei einem führenden wissenschaftlichen Magazin einen Artikel einreichen. Marthe war in der Küche, doste frische Bohnen in pfeffriger Salzlake ein und schaute dabei auf dem Fernseher, den Matthew aufgestellt hatte, Plus belle la vie. Marthe hatte abgewiegelt und behauptet, kein Interesse an solchem technologischen Firlefanz zu haben, aber schon bald hatten die Eskapaden der Bewohner von Le Mistral sie in Bann geschlagen. Und was mich anging, drückte ich mich vor dem Korrigieren und beschäftigte mich stattdessen lieber mit meinem neuen Forschungsgebiet – den Parallelen zwischen der Küche der Frühmoderne und der damaligen Laborpraxis. Allerdings konnte ich nicht lange über den Abbildungen in alchimistischen Manuskripten aus dem siebzehnten Jahrhundert schmökern. Nach einer Stunde Arbeit lockte mich das fantastische Maiwetter. Ich machte mir etwas Kaltes zu trinken und ging nach oben auf die Holzplattform, die Matthew zwischen den Wehrgängen auf einem der zinnengekrönten Türme von Les Revenants montiert hatte. Scheinbar war sie als Aussichtsplattform angelegt, aber jeder wusste, dass sie eigentlich zur Verteidigung diente. Sie bot einen guten Ausblick über das Land und ließ reichlich Vorwarnzeit, falls sich ein Fremder näherte. Mit unserem neuen Adlerhorst und dem frisch ausgehobenen und mit Wasser gefüllten Burggraben war Les Revenants inzwischen so sicher, wie Matthew es überhaupt machen konnte.
Oben stieß ich auf Marcus, der, die Sommersonne im glänzend blonden Haar, mit Sonnenbrille in der Mittagssonne badete.
»Hallo, Diana.« Marcus legte sein Buch beiseite. Es war ein schlankes Bändchen mit altersfleckigem und rissigem Ledereinband.
»Du siehst aus, als hättest du den nötiger als ich.« Ich reichte ihm mein Glas Eistee. »Viel Minze, keine Zitrone, kein Zucker.«
»Danke«, sagte Marcus. Er kostete. »Wunderbar.«
»Kann ich dir Gesellschaft leisten, oder wolltest du für dich sein?« Vampire waren Rudeltiere, trotzdem genossen sie das Alleinsein.
»Es ist dein Haus, Diana.« Marcus hob die Füße von der Sitzfläche des zweiten Holzstuhls.
»Es ist das Haus der Familie, und du bist hier jederzeit willkommen«, korrigierte ich ihn sofort. Die Trennung von Phoebe war schwer genug, auch ohne dass Marcus sich bei uns wie ein ungebetener Gast fühlte. »Neuigkeiten aus Paris?«
»Nein. Grand-mère sagt, ich sollte frühestens in drei Tagen mit einem weiteren Anruf von Freyja rechnen.« Marcus ließ die Finger durch die Kondensationstropfen an dem kalten Glas gleiten.
»Warum in drei Tagen?« Vielleicht war das eine Art vampirischer Apgar-Test.
»Weil man so lange wartet, bevor man einem neugeborenen Vampir Blut gibt, das nicht aus den Adern seines oder ihres Schöpfers kommt«, antwortete Marcus. »Neugeborene Vampire vom Blut ihres Schöpfers abzustillen ist heikel. Falls sie zu früh zu viel fremdes Blut aufnehmen, kann das tödliche genetische Mutationen auslösen. Und gleichzeitig ist es Phoebes erster Test, da wird sich erweisen, ob sie überleben kann, indem sie das Blut einer anderen Kreatur aufnimmt«, fuhr Marcus fort. »Natürlich fangen sie mit etwas Kleinem an – einem Vogel oder einer Katze.«
»M-hmm.« Ich gab mir alle Mühe, wohlwollend zu klingen, aber mir drehte sich beinahe der Magen um.
»Ich habe mich schon zuvor überzeugt, dass Phoebe töten kann.« Marcus starrte in die Ferne. »Manchmal ist es schwerer, ein Leben zu nehmen, wenn man keine andere Wahl hat.«
»Wirklich?«, wunderte ich mich.
Marcus nickte. »Instinkt hin oder her, es ist ein egoistischer Akt, auf Kosten einer anderen Kreatur zu überleben.« Nervös klopfte er mit dem Buch gegen seinen Schenkel.
»Was liest du da?«, versuchte ich das Thema zu wechseln.
»Eines meiner alten Lieblingsbücher.« Marcus warf mir den Band zu.
Gewöhnlich reagierte ich mit einem strengen Tadel auf den nonchalanten Umgang der Familie mit ihren Büchern, doch dieses Werk hatte offenkundig schon Schlimmeres mitgemacht. Etwas hatte eine Ecke angeknabbert. Das Leder war ramponiert, und die Vorderseite war mit ringförmigen Abdrücken von Gläsern, Kelchen und Bechern überzogen. In den Prägungen, deren Stil darauf schließen ließ, dass das Buch irgendwann Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gebunden worden war, hatten sich winzige Reste goldener Farbe gehalten. Marcus hatte es so oft gelesen, dass der Rücken gebrochen war, außerdem entdeckte ich zahllose Reparaturen – eine mit vergilbtem Zellophan-Film.
Ein hochgeschätzter Gegenstand wie dieser verfügte über eine Magie, die nichts mit seinem Zustand zu tun hatte, dafür aber sehr viel mit seiner Bedeutung für eine Person. Vorsichtig schlug ich das zerfledderte Buch auf. Zu meiner Überraschung war es Jahrzehnte älter, als der Umschlag vermuten ließ.
»Common Sense.« Es war einer der grundlegenden Texte der amerikanischen Revolution. Ich hatte erwartet, dass Marcus Byron lesen würde oder einen Roman – nicht ein politisch-philosophisches Werk.
»Hast du 1776 in Neuengland gedient?«, fragte ich nach einem Blick auf das Impressum des in Boston gedruckten Buches. Marcus war erst Soldat und dann Armeearzt in der Kontinentalarmee gewesen. So viel wusste ich.
»Nein. Da war ich noch zu Hause.« Marcus nahm mir das Buch ab. »Ich werde ein bisschen spazieren gehen. Danke für den Tee.«