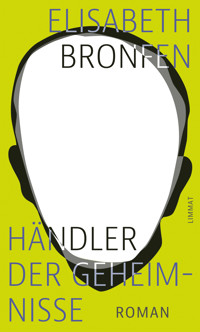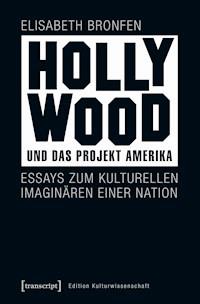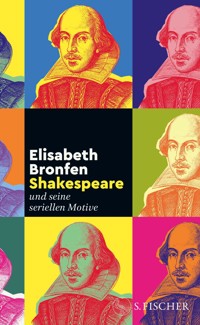
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine ganz neue Art, Shakespeare zu lesen Die bekannte Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen legt hier das definitive Buch über Shakespeare vor. Ihre lebenslange Beschäftigung mit einem der größten Autoren der Literaturgeschichte führt zu einem neuen Bild, das sein Werk anhand von Themen aufschlüsselt, die immer wiederkehren: Traumwelten, Kryptomanien, Liebesverdacht, Liebeskrieg, Tauschobjekte, Krieg als Fortsetzung der Politik, Politik als Fortsetzung des Krieges, Herrscherinnen, sprechende Körper, Männerleichen und Frauenleichen, und: die letzte Szene. Diese Elemente werden in allen Stücken aufgesucht und als »Serie« verstanden, also als fortlaufenden Gestaltung eines Themas durch alle Werke hindurch. Damit kann Elisabeth Bronfen Verschiebungen, neue Perspektivierungen und verschiedene Lösungen zeigen, die Shakespeare in seinem gesamten Werk immer wieder »durcharbeitet«. Was denkt Shakespeare über den Krieg? Was über das Tochter-Sein? Was über das Mutter-Sein? Was über Eifersucht? Indem sie diese Motive herauslöst und die verschiedenen Stellen in den Dramen als Serie betrachtet und aufeinander bezieht, wird ein ganz neuer Shakespeare sichtbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elisabeth Bronfen
Shakespeare – und seine seriellen Motive
Über dieses Buch
Eifersucht, Versteckspiel, Mord, das Tochter- oder Mutter-Sein, Kleidertausch, Briefe, Tücher: Über die einzelnen Stücke hinweg bilden diese Motive Serien im Werk von Shakespeare. Die renommierte Zürcher Anglistin Elisabeth Bronfen betrachtet diese Serien als Problemstellungen, die in unterschiedlichen Stücken unterschiedliche Lösungen erhalten. Sie deklinieren gewisse Anliegen durch, als suche Shakespeare immer wieder nach neuen Antworten. Indem Elisabeth Bronfen diese Serien zum Sprechen bringt und in Beziehung setzt, lässt sie uns die Aktualität von Shakespeares Werken neu entdecken.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elisabeth Bronfen ist emeritierte Professorin für Anglistik an der Universität Zürich und Global Distinguished Professor an der New York University. Sie hatte zahlreiche Gastprofessuren und Fellowships in Europa und Amerika inne und kuratierte Ausstellungen u.a. in Deutschland und der Schweiz. 2017 bekam sie die Martin Warnke-Medaille der Aby-Warburg-Stiftung verliehen und 2020 die Ehrendoktorwürde der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 2023 ist ihr Roman »Händler der Geheimnisse« erschienen. Elisabeth Bronfen lebt in Zürich.
Inhalt
Prolog Serielles Lesen als hermeneutisches Verfahren
Zwei Seiten der Serie
Serialität als Nachreife
Dramaturgie des seriellen Lesens
Kapitel 1 Traumwelten und Geistererscheinungen
Träume als Zwischenräume
Dramatische Kraft der Prophezeiung
Schlafwandel und Halluzination
Gespenstergeschichten
Kapitel 2 Der theatrale Charme der Kryptomanie
Meister der geheimen Beeinflussung
Murder will out
In geheimer Mission
Versteckspiel der Liebe
Fatale Ansteckung
Kapitel 3 Eine Tote kehrt zurück
Die Spinne des Verdachts
Torheit der Liebe
Liebe in Zeiten des Krieges
Das grüne Monster der Eifersucht
Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich
Kapitel 4 Krieg als Fortsetzungsdrama
Zyklische Gewalt der Geschichte
Der Streit unter Brüdern, zweite Runde
Zwischen zwei Schlachten
Nur über seine Leiche
Mit den Waffen einer Frau
Kapitel 5 Die Souveränin: Eine Typologie
Verkapselungen der Resistenz
Der verlängerte Arm der Krone
Tochter eines Königs
Im Namen der Mutter
Kapitel 6 Evidenz des zeichenhaften Körpers
Kleidertausch als Mittel zur Flucht
Spielleiterinnen in eigener Sache
Der versehrte Körper als Beweisstück
Körpergesten der Anklage
Kapitel 7 In Folge der Dinge
Tücher mit Botschaften
Zirkulierende Juwelen
Kreislauf der Briefe
Abgeschlagene Köpfe
Kapitel 8 Abschluss als Neuanfang
Der Epilog als Schlussstrich
Die Geschehnisse noch einmal erzählt
Eingehen in die allegorische Heimat
Zurück in die Zukunft
Aufhören ohne Ende
Anhang
Weiterführende LiteraturProlog
Traumwelten und Geistererscheinungen
PrologSerielles Lesen als hermeneutisches Verfahren
If you want a happy end,
that depends, of course,
on where you stop the story.
Orson Welles, The Big Brass Ring
Immer wieder ziehen junge Frauen in Shakespeares Dramen Männerkleider an, um ihre Hochzeit selbst zu regeln. Immerfort werden Schmuckstücke als Zeichen der Treue ausgetauscht, um kurz darauf an jemand anderen weiterverschenkt zu werden. Immer wieder wird eine Heldin von ihrem wankelmütigen Liebhaber verworfen, um in neuer Gestalt zu ihm zurückzukehren. Und immer wieder befinden sich die Dramatis Personae am Ende des Stückes an einem Scheideweg, ohne dass für die Konflikte, die die Handlung durchgespielt hat, eine nachhaltige Lösung gefunden worden wäre. Von Stück zu Stück erscheinen gleiche Figurenkonstellationen, dramaturgische Formen und Sinnbilder in Variationen. Man könnte deshalb den Eindruck gewinnen, Shakespeare hätte immer wieder Stücke geschrieben, in denen ähnliche thematische Anliegen in unterschiedlichen Registern und Tonarten durchgespielt werden. Rückt man diese seriellen Transformationen in den Fokus, lassen sich in seinem Œuvre Reihenfolgen entdecken, die zwar jeweils um eine gleichartige Problematik kreisen, für diese aber unterschiedliche dramatische Gestaltungen anbieten.
Shakespeare in Serie zu betrachten – so die Wette dieses Buches – heißt, den Fokus auf die Denkformen zu richten, die sich durch dieses Werk hindurchziehen, um psychologische, politische, kulturelle und ästhetische Fragen auszuloten, zu reflektieren und miteinander in Verbindung zu setzen. Augenfällig wird dabei nicht nur, wie Shakespeares Stücke gewisse Anliegen in mannigfaltiger Weise jeweils von neuem konfigurieren und durchdeklinieren. Der Umstand, dass als Teil dieser Abwandlungen verschiedene Auflösungsmöglichkeiten für die dramatische Spannung angeboten werden, zeigt auch, dass es eine Vielzahl an Antworten auf die jeweilige Problematik gibt. Ersichtlich wird somit, dass keine Lösung definitiv ist. Jede Lösung wirft neue Fragen auf; sie ermöglicht eine Fortsetzung der dramatischen Umsetzung, lässt diese sogar erwarten. Betrachtet man die sich wandelnden Denkformen als Teil einer Serie, zeigt sich ein ihnen innewohnendes Potenzial, das sich immer wieder neu dramatisch gestalten lässt; uns aber auch auffordert, die Stücke immer wieder neu zu lesen.
Shakespeare seriell zu betrachten heißt, Dramen zu zerlegen und zu einer Reihenfolge neu zusammenzusetzen. Deshalb werden in den folgenden Kapiteln die Stücke nicht in ihrer Gesamtheit behandelt. Vielmehr konzentriert sich jedes der Kapitel auf die Szenen, Wortbilder und Handlungsabfolgen, die die ihnen gemeinsame Problematik betreffen. Es gilt, mit dieser neuen Anordnung eine aus unterschiedlichen Blickwinkeln angesetzte Betrachtung vorzuführen, bei der die Engführung zugleich eine Verdichtung erzeugt. Um welche thematischen Anliegen ist es mir gelegen?
Die Denkformen, die im ersten Kapitel durch solch eine Verkettung beleuchtet werden, befassen sich mit Shakespeares mannigfaltiger Darbietung von Träumen, prophetischen Visionen, Halluzinationen und der Rückkehr von Geistern aus dem Reich der Toten, die für die Hinterbliebenen Botschaften haben. Findet das Träumen dezidiert an einem Schauplatz statt, der sich vom alltäglich Gewöhnlichen absetzt, entspricht es zugleich einer geistigen Haltung. Dinge, die als Einbildungen entdeckt und erfahren wurden, hallen beim Aufwachen nach und bringen die Figuren (sowie auch uns) dazu, mit gespaltenem Auge auf die Welt zu blicken. Die von mir vorgeschlagene Bündelung im zweiten Kapitel lotet die Obsession mit Geheimnissen aus und nimmt Szenen der Überwachung, des Verdachts und der fatalen Missverständnisse, die davon ausgelöst werden, in den Blick. Die These in diesem Kapitel lautet: Wissen wird aus politischen Gründen vorenthalten, damit die eigene Macht gestärkt werden kann. Persönliche Leidenschaften – sei es Vergeltungslust oder Liebesinbrunst – benötigen die Geheimhaltung, um sich entfalten zu können.
Die Denkform, um die das dritte Kapitel kreist, betrifft die Umkehr von Liebe in ihr Gegenteil. Eine Heldin wird von ihrem Geliebten für tot erklärt und durch eine andere ersetzt, um in veränderter Gestalt zurückzukehren und ein zweites Liebesbündnis einzugehen. Was sich in dieser Reihenfolge verdichtet, ist der Umstand, dass erst der Verlust den wahren Wert der Geliebten erkennen lässt. Zugleich ist die Frau, die wiedergewonnen wird, eine andere als die, die verworfen wurde. Das darauffolgende Kapitel rückt die Frage gewaltsamer Leidenschaften auf eine kollektive Ebene und nimmt dafür das fortwährende Wechselspiel von Krieg und Frieden in den history plays in den Fokus. Der britische Rosenkrieg wird von Shakespeare als Geschichte zyklischer Gewalt dargeboten, in der ein noch nicht überwundener Streit der Vergangenheit immer wieder von neuem erinnert und durchgefochten wird. Über die Serialität wird zugleich eine Brücke geschlagen zu den römischen Stücken, in denen politische Kämpfe ebenfalls als serielle Machtergreifung vorgeführt werden. Die Kriegerköniginnen, die im letzten Abschnitt dieses Kapitels behandelt werden, leiten ihrerseits über zu der Typologie der Souveränin, die Shakespeares Œuvre auffächert. Die Reihung, die in diesem Kapitel entfaltet wird, lotet die verschiedenen Positionen aus, die Heldinnen in Shakespeares Dramen gegenüber der männlich kodierten Krone einnehmen können: Königinnen, die sich ganz dem Willen ihres Herrschers fügen. Andere, die sich seiner Macht widersetzen. Andere wiederum, die als Nachfolgerin die Krone übernehmen wollen, und schließlich Herrscherinnen, die ihre Macht als Mütter zum Einsatz bringen.
Das darauffolgende Kapitel greift den sprechenden Körper als Mittel der Evidenzproduktion auf und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie in Shakespeares Œuvre Verkleidungen und Gestik eingesetzt werden. Dabei wird sowohl die affektive Macht, die von einer somatischen Darstellungsweise ausgeht, augenfällig, wie auch jene Situationen hervorgehoben werden, in denen selbst die poetische Sprache ihre Wirksamkeit einbüßt. Die Verkleidungen wie auch die gestischen Darbietungen stellen somit den Höhepunkt einer Theatralik aus, die Worte durch sprechende Körper ersetzt. Der Einsatz von Ausdrucksmitteln, die über die poetische Sprache hinausreichen, von dieser aber zugleich erklärt werden, wird im vorletzten Kapitel dadurch fortgesetzt, als hier ein Blick auf die Gegenstände geworfen wird, die die dramatische Handlung wie Akteure behandelt: Tücher werden wie Schriftstücke eingesetzt. Juwelen wandern von einer Figur zur nächsten. Briefe enthalten verschlüsselte Nachrichten, geraten in falsche Hände oder kommen zum falschen Zeitpunkt an. Abgeschlagene Köpfe überbringen eine grausame Botschaft. Das letzte Kapitel greift auf die Idee der Apotheose als wirkungsmächtiges Schlussbild zurück und breitet die vielfältigen Abschlüsse aus, die Shakespeare für seine Dramen entworfen hat. Diese letzte Reihung lässt zugleich rückblickend einen Wiederholungszwang erkennen, der das Unabschließbare dieser Dramen offenlegt. Die Erwartung, dass alles wieder von vorne beginnen könnte, weil die Auflösung der dramatischen Spannungen neue Fragen aufwirft, ruft unentwegt zur Fortsetzung auf.
Shakespeare in Serie zu behandeln, heißt aber auch, das Lesen dieser Stücke in den Vordergrund zu stellen; nicht als Versuch, Shakespeare in seiner Zeit zu begreifen, sondern die Aktualität des von Shakespeare gestalteten Denkraums für unsere Zeit wiederzuentdecken. In den folgenden Kapiteln werden die Handlungsstränge, Figurenkonstellationen und Szenen nicht immer chronologisch zu Reihungen zusammengesetzt, obgleich es in einigen Fällen durchaus um eine Entwicklung innerhalb seines Œuvres geht. Zudem werden die Dramen nicht streng nach Gattungen aufgeteilt. Die serielle Betrachtung rückt vielmehr die Transformationen in den Vordergrund, die eine Denkform aufgrund der Erwartungen erfährt, die ein Genre mit sich bringt. Entscheidend ist, wie die Komödie, die Tragödie und die Romanze, um ähnliche thematische Anliegen kreisend, für die Probleme, die sie zur Schau stellen, unterschiedliche Auflösungen anbieten.
Auch steht nicht die Frage im Vordergrund, wie diese Stücke die kulturellen Ängste und Wünsche der Frühen Neuzeit gespiegelt und in dieser Welt gewirkt haben mögen. Vielmehr gilt, was Mieke Bal mit dem Begriff »preposterous history« benennt. Das spätere »post« kommt vor dem früheren »pre«. Die Umkehr stellt das, was chronologisch zuerst kam, als Nachwirkung hinter seine spätere Weiterentwicklung und Wiederverwertung. Die von mir vorgeschlagenen seriellen Lektüren verstehen sich dezidiert als ein Revisiting; eine nachträgliche Betrachtung im doppelten Sinn. Zwar kann man Shakespeare nicht ohne einen Sinn für die historische Situation, aus der er stammt, auf die er reagiert und die er in seinen Dramatisierungen reflektiert, behandeln. Wir nähern uns Shakespeare aber immer auch mit einem zeitgenössischen Blick, der diese kanonischen Stücke – samt der kulturellen Patina, die sie in den letzten Jahrhunderten angenommen haben – in einen Dialog mit unseren gegenwärtigen kulturellen Anliegen zusammenfügt. Zudem haben wir immer schon das Spätwerk vor Augen und können somit nicht umhin, die früheren Dramen auf diejenigen zu beziehen, die auf sie gefolgt sind.
Zwei Seiten der Serie
Abgeleitet von dem lateinischen »series« handelt es sich bei der Serie sowohl um eine Reihe wie auch eine Reihenfolge, um eine Anordnung und eine Entwicklung, eine Folge und eine Abfolge. Bezeichnet das Verb »serere« Handlungen, die etwas aneinanderreihen, zusammenfügen oder miteinander verknüpfen, wird damit unterstrichen, dass es sich bei der Serie sowohl um eine gereihte Anordnung handelt als auch den Prozess, durch den diese Ordnungsstruktur erzeugt wird. Auf Shakespeares Œuvre übertragen lässt sich festhalten: Eben weil einzelne Formelemente, die in verschiedenen Stücken auftauchen, eine Beziehung zueinander haben, können sie in Verbindung miteinander gebracht werden. Die Ähnlichkeit, die es erlaubt, sie mit Hinblick auf das Gesamtwerk aneinanderzureihen, macht wiederum unterschiedliche Ordnungsmuster ersichtlich. Dabei ist es lohnend, sich in Erinnerung zu rufen, dass es sich bei dem Fügen und Verknüpfen um ein Spiel zwischen Ähnlichkeit und Differenz, um eine Wiederholung mit Transformationen und Abweichungen handelt. Eine Serie verknüpft Teilstücke, stiftet Verbindungen, in denen das Darauffolgende auf das Vorhergehende aufbaut, etwas Neues sich auf etwas Altes bezieht und dieses zugleich weiterdenkt. Eine Serie setzt Teilstücke in Beziehung zueinander, setzt aber auch voraus, dass sich diese Teilstücke fortsetzen werden.
Für eine serielle Lektüre Shakespeares kommen beide Aspekte zum Tragen: eine auf Vergleichbarem basierende Anordnung und der Prozess, infolgedessen die Möglichkeit des Vergleichens überhaupt erst sichtbar wird. Das Spiel der Denkformen in Shakespeares Œuvre rückt Figurenkonstellationen, Handlungsstränge und Szenen in den Fokus, die sich zwar ähneln, denen aber etwas hinzugefügt worden ist; bei denen auch etwas weggelassen oder etwas verändert worden ist. Jede Formalisierung baut zwar auf die ihr vorhergehende auf, wird im Verlauf der Serie aber unter veränderten Vorzeichen wiederholt. Entscheidend für die serielle Lektüre, die in den folgenden Kapiteln vorgeführt wird, ist somit, dass die von mir isolierten Denkformen und deren dramatische Gestaltungen im Sinne einer Sequenz aufeinanderfolgen. Die festgestellte Beziehung läuft zwar über die Ähnlichkeit, das Gleichartige aber wird fortgeführt, entwickelt und transformiert. Die Denkformen werden wieder erzählt, und sie werden weiter erzählt. Somit gilt eine doppelte Zeitlichkeit. Die in Folge der Lektüre entfaltete Serie ist zukunftsgerichtet und erlaubt zugleich etwas Vergangenes, etwas Vorgängiges zu rekonstruieren. Die einzelnen Formen lassen sich nicht nur fortsetzen, sie rücken den Blick auch auf die ihnen vorhergehenden Formen, mit denen sie verbunden sind. Es braucht sowohl für den Anschluss mit dem Vorherigen wie auch für die Fortsetzung des Darauffolgenden eine erkennbare Wiederholung. Damit ein Wandel in der Abfolge entstehen kann, braucht es zugleich das stete Hinzufügen einer Differenz. Eine Serie beinhaltet somit auch eine gegenläufige Bewegung: Gleichartige Formen sind aufeinander bezogen und schreiten zugleich voran. Dabei hat eine Serie keinen klaren Anfang. Sie hat immer schon begonnen. Sie weist eine Entwicklung vor, deutet eine Fortsetzung an. Sie kann an jeder Stelle nicht nur erweitert, sondern auch unterbrochen werden. Die Verwandlungen und Transformationen, die eine Serie hervorbringt, sind potenziell stets fortsetzbar. Sie kann zu einem Abschluss gebracht werden, muss aber nicht zwingend ein Ende haben.
Das Augenmerk auf Serialität zu werfen heißt somit, sowohl die seriellen Beziehungen innerhalb eines Stückes wie auch zwischen einzelnen Stücken hervorzuheben, um das Spiel der Verwandlungen, das Shakespeares Gesamtœuvre innewohnt, sichtbar zu machen. Zugleich handelt es sich bei diesem Leseverfahren auch um einen Leseprozess, der durch die vorgenommenen Einreihungen in den einzelnen Kapiteln, die jeweils um spezifische Denkformen kreisen, eine übergeordnete Anordnung erzeugt. Shakespeare in Serie zu betrachten heißt demzufolge, sich sowohl mit der Beziehung der einzelnen Elemente eines Stückes oder zwischen verschiedenen Stücken zu beschäftigen, wie auch mit dem hermeneutischen Prozess, der dieses Beziehungsgefüge überhaupt erst in seiner ganzen Vielschichtigkeit und Verkettung deutlich macht. Verbindungslinien werden zwischen den Stücken gezogen, um ein Denken der Verhältnisse, die sich zwischen diesen ergeben, hervorzuheben. Entscheidend ist nicht nur die Feststellung, dass Shakespeares Stücke sich in unterschiedlichen Registern und Tonarten wiederholen. Ebenso wichtig sind die bedeutsamen Beziehungen, die sich dadurch entdecken lassen, dass Stücke entlang einer auf Gleichartigkeit basierenden Gedankenkette überhaupt miteinander in Dialog gebracht werden können. Serielles Lesen ist somit zugleich Gegenstand und Verfahren. Erst durch das Postulieren einer Serie kommt die Verdichtung der von mir isolierten Denkformen zu ihrem eigenen Recht. Man erkennt, wie sich einzelne Formen wiederholen und wandeln und begreift zugleich, dass die thematischen Anliegen, die die Dramen aufgreifen und durchspielen, sich über diesen dem Œuvre inhärenten Wiederholungszwang durch die Brille einer von außen angelegten Serialität weiter konzipieren lassen.
Werden in den folgenden Kapiteln die einzelnen Dramen zerlegt und neu zusammengefügt, dann deshalb, um den Fokus auf Parallelen, Fortsetzungen und Transformationen zu legen. Die Wiederholung von Figurenkonstellationen, Handlungssträngen und Szenen weist darauf hin, dass dramatische Spannungen nochmals und zugleich anders durchgespielt werden können. Es geht somit sowohl um die innere dramatische Serialität, die die Geschichte vorantreibt, wie auch die serielle Reihenfolge, die sich zwischen den Stücken ergibt. Der dramatische Sog, der sich in der Bewegung von einem Akt zum nächsten zeigt, führt über die einzelnen Stücke hinaus, weil trotz der Auflösung der Spannung die Möglichkeiten des Durchspielens der jeweiligen Problematik noch nicht erschöpft worden sind; weil diese sich in weiteren Facetten durchspielen lassen könnten. Die Stücke stellen die Fragen vorgängiger Stücke neu, führen diese anders durch und werfen dabei neue Fragen auf. Entlang einer sie verbindenden Gedankenschnur gedacht, ergeben die von mir erzeugten Reihungen einen selbstreflexiven Kommentar, der den Eindruck erweckt: Shakespeare schreibt nicht nur immer wieder gleiche Stücke um, diese suchen sich zudem gegenseitig heim. Die Betonung auf die Verbindungslinien zu legen, die sich zwischen den Stücken ergeben, bedeutet zugleich, auf eine dramatische Formel oder Standardsituation immer wieder zurückzugreifen, um wie bei einem Kaleidoskop das schillernde Spektrum an wechselnden Formalisierungen zu einer Typologie zusammenzustellen. Dramaturgische Formeln wandern von Stück zu Stück, drängen nach einer Umschrift.
Shakespeare in Serie zu begreifen heißt somit, den Wiederholungszwang zu einem dramaturgischen Prinzip zu erheben, das sowohl einzelnen Stücken innewohnt wie auch einen Bezug zwischen den Stücken erzeugt. Entscheidend dabei sind die Reihungen, die in den einzelnen Kapiteln vorgeführt werde. Sie heben nicht nur hervor, wie die Stücke aufeinander reagieren und aufeinander Bezug nehmen. Die Dramaturgie der durchgespielten Gedankenketten ist bereits Teil des Arguments. Die in Shakespeares Œuvre angelegte Serialität wird nicht nur zum Fokus, sondern wird durch das an diese Stücke herangetragene hermeneutische Verfahren nochmals gespiegelt. Zwar wird mit dem Material – der Sprache, den dramaturgischen Formen, den Figuren und den Handlungen – die Shakespeares Stücke vorgeben, gearbeitet. Doch die Entscheidung darüber, welche Aspekte der Stücke betont, in welcher Reihe und in welcher Reihenfolge diese Serien behandelt werden, liegt bei mir. Die Beziehung zwischen den Stücken, die Fortsetzung, die sie darbieten, wird durch meine Assemblage geregelt. Die Stücke im Hinblick auf Serialität zu lesen, stellt somit wiederum eine Wiederholung dar. Was poetisch verdichtet ist, wird zwar entschlüsselt, zugleich wird diesem Material etwas hinzugefügt. Meine Lektüre, die die Dramen wiedergibt und mit Kommentaren versehen weitererzählt, ist nicht dieselbe wie die Stücke, auf die ich zurückgreife.
Nicht von ungefähr dienen Gestalten aus Ovids Metamorphosen oft als Vergleichsgröße für die Heldinnen und Helden in Shakespeares Denkwelt. Beide Werke bedienen sich einer rhetorisch wirkungsmächtigen Doppelung: Den Variationen der Verwandlungen, die erzählt werden, entspricht die Art, wie die Verkettungen der Geschichten diese zu einer Serie zusammenfügen. Auch in Shakespeares Œuvre spiegelt das Formprinzip, das eine Geschichte als Fortsetzung und Transformation einer vorhergehenden setzt, das thematische Anliegen, das sie verbindet. In den folgenden Kapiteln ergänzt die serielle Struktur die Thematisierung der in der Wiederholung erzeugten Verwandlung. So führt das nachträgliche Erinnern und Kommentieren eines Traums diesen fort. So werden Geheimnisse akkumuliert, setzen immer neue Geheimhaltungen in Gang. So wird nach einer Unterbrechung eine ursprüngliche Liebesbeziehung unter anderen Vorzeichen nochmals eingegangen. So müssen Friedensverträge immer wieder neu ausgehandelt werden, weil sich die Politik als Fortsetzung des Krieges entpuppt. Auch die als Typologien angelegten Serien bieten Verkettungen der Gestaltungen an, die Shakespeare für das Porträt der Königin findet, ebenso wie für den Einsatz des Crossdressing seiner romantischen Heldinnen oder die abschließenden Worte, mit denen die dramatische Handlung am Ende des 5. Aktes einen Abschluss findet. Dabei ist auch hier entscheidend: Es gibt keine Wiederholung ohne Differenz. Das Maß an Abweichung entscheidet lediglich, ob die Repetition eher konstruktiv auf Progression oder destruktiv auf Regression ausgerichtet ist. Der Traum, der erinnert wird, ist nur ein Bruchstück dessen, was der Träumende erfahren hat. Die Phantasiearbeit der Figuren, die die dramatische Handlung vorantreibt, wird von einem Anlass in der Gegenwart ausgelöst. Die Wünsche und Ängste, die alsdann durchgespielt werden, suchen in der Vergangenheit nach ähnlichen Szenen. Die auf eine zukünftige Lösung ausgerichtete Situation, in der sich die Erfüllung des Wünschens vollziehen soll, ist aber eine andere als die, die die Phantasiearbeit überhaupt in Gang gesetzt hat. Wäre sie dieselbe, bräuchte es nicht den Umweg der Einbildungen; die dramatisierte Aushandlung wäre nicht nötig. Diejenige, die sich auf ein Spiel der Geheimnisse einlässt, ist eine andere als diejenige, die diese Täuschung am Ende der Handlung offenlegt. Der wiedergewonnene Frieden ist anders gelagert als der, den der Ausbruch eines Krieges unterbrochen hatte. Jede Königin hat ein eigenes Gesicht, jede Verkleidung eine partikulare Note.
Lässt sich die Serialität in Shakespeares Dramen als Wiederholungszwang verstehen, dann oft auch als Wiederkehr des Verdrängten. Szenen werden nochmals erlebt, Situationen nochmals reproduziert. Die Widerstände, die aufgedeckt werden, die Lücken, die sich erkennen lassen, das Vergessene, das ins Bewusstsein rückt, betrifft entweder die Einbildungen einzelner Figuren oder die kollektiven Phantasien, die sie zusammenhalten. Die Vergangenheit, die die Dramatis Personae nicht loslassen will, wird nicht nur erinnert, sondern auch als Tat wiederholt – sei es als Feindschaft zwischen Gegnern, sei es als sich wandelndes Begehren zwischen Liebenden, sei es als dunkle Machenschaften zwischen Rivalen. Die Wiederholung manifestiert das Problem, das immerfort in einem Stück aufflackert und als Verbindung zwischen den Stücken dient: Sei es vergessenes oder geheim gehaltenes Wissen, das zurückkehrt, seien es unerledigte Ereignisse, die aus der Vergangenheit aufflackern und nochmals ausgetragen werden müssen. Die Wiederholung ist zugleich die Lösung. Sie erlaubt ein dramatisches Durcharbeiten der Problematik, mündet in Verständnis und Deutung. Zugleich macht die Serialität, die sich zwischen den Dramen ergibt, deutlich, dass es in der Denkwelt Shakespeares kein endgültiges Erledigen gibt. Die der Wiederholung inhärente Differenz lässt dem Bemerken von Ähnlichkeiten einen größtmöglichen Spielraum, setzt die Möglichkeit, in der einer Denkform immer wieder etwas Neues entlockt werden kann, frei. Das Durcharbeiten ist nie vollendet, vielmehr kündigt die Auflösung der dramatischen Spannungen eine auf Umwandlung ausgerichtete Weiterführung an.
Serialität als Nachreife
Setzt Shakespeare die Wiederholung von Figurenkonstellationen, Handlungsabfolgen und Szenen ein, weil er die Potenzialität, die in diesen dramatischen Formen liegt, ausschöpfen möchte, ist daran die Frage geknüpft, wie im Zuge dieser Transformation die Stücke sich zueinander verhalten. Immer wieder von neuem bei einer Denkform ansetzen heißt nicht nur, diese immer wieder neu zu denken, sondern auch danach zu fragen, welche Konsequenzen die Abwandlungen haben. Ist der Tod am Ende der dramatischen Spannungen notwendig, oder gäbe es für den Konflikt eine andere Auflösung? Ist die Hochzeit der einzige Ausgang für die Irrungen und Wirrungen der Liebe? Stücke immer wieder in einer anderen Tonlage durchzuspielen lenkt die Aufmerksamkeit auf das Prinzip der Kontingenz, das besagt, die Handlung könnte auch andere Richtungen einschlagen. Andere Entscheidungen könnten gefällt werden. Es könnte alles anders ausgehen. Mit Orson Welles gesprochen: Entscheidend für ein glückliches Ende ist die Frage, wann ein Schlusspunkt gesetzt wird. Die Handlung kann – wie in vielen Komödien – früh genug aufhören, um eine Wende ins Tragische zu verhindern. Sie kann aber auch – wie in den späten Romanzen – lang genug fortgeführt werden, damit die tragische Energie überwunden werden kann. Die Gattung der Tragödie mag eine schicksalshafte Fatalität vorschreiben, der Wiederholungsdrang der seriellen Umschrift aber widersetzt sich dieser Zuschreibung.
In den folgenden Kapiteln wird eine Problematik unterschiedlich durchdekliniert und neu gestaltet, mal innerhalb derselben Gattung, mal in Bezug auf mehrere Gattungen. Rückt die Transformation die Differenz innerhalb der Wiederholung hervor, wird zugleich augenfällig: Geschichten können nicht nur immer wieder neu erzählt oder weitererzählt werden. Sie können auch anders erzählt werden. Was sich fortsetzt, ist auf eine entscheidende Weise von dem Vorhergehenden abgesetzt. Werden in der Fortsetzung die Weichen anders gestellt, wirft dies auch die Frage danach auf, was es für jedes der in Serie gelesenen Stücke heißt, dass sie sich auf eine bestimmte Weise und nicht anders entwickeln. Wann können Heldinnen mit List und Tücke ihr Schicksal selbst bestimmen, und wann bleibt ihnen nur der Wahnsinn oder der Mord, um sich innerhalb einer patriarchalen Kultur zu behaupten? Warum sind gewisse Figuren in eine Wiederholungsschlaufe der Geheimhaltung oder der Gewalt unentrinnbar gefangen, während andere sich dieser Fatalität entziehen können? Warum bereitet es bestimmten Figuren Lust, sich einem vermeintlich unüberwindbaren Schicksal hinzugeben, während andere erkennen, dass ihre Zukunft nicht in den Sternen liegt, sondern in ihren eigenen Händen? Was braucht es, damit Figuren von ihrer verblendeten Liebe oder ihrem gefährlichen Machthunger absehen?
Eine serielle Lektüre lässt somit nicht nur die andere Tonart bemerken, die sich in der Bewegung von einem Stück zum anderen ergibt. Es rückt auch in den Vordergrund, was es heißt, dass ein Drama, seriell gedacht, sich verändert. Erst beim Entfalten einer Reihenfolge ergeben sich die bedeutsamen Unterschiede, die dem Spiel der wandelnden Denkformen zugrunde liegt. Die Wiederholung adjustiert den Blick, rückt etwas Neues in den Fokus, lässt etwas aus dem Blickfeld verschwinden, legt die Betonung anders. So rückt die Typologie der Souveränin dramatische Figuren ins Zentrum der Betrachtung, die, behandelt man die Stücke als Ganzes, oft übersehen werden, weil sie nur wenige Szenen bestreiten. Dadurch, dass diese Figuren in Bezug auf die Möglichkeiten und Beschränkungen weiblicher Macht ein Verhältnis zueinander einnehmen, gewinnen sie an Ausstrahlungskraft. Was entsteht, ist ein facettenreiches Gesamtporträt der Herrscherin.
Zugleich gilt es nicht nur eine Verbindung zwischen dramatischen Gestaltungen festzustellen, sondern danach zu fragen, welche Folgen sich daraus ergeben. Serielles Lesen lädt dazu ein, die Veränderungen, die das Spiel der Variation mit sich bringt, auszuwerten. Stanley Cavell stellt für das Aufflackern von Shakespeares Dramen in den klassischen Hollywood-Komödien fest: Er reicht nicht aus, eine auf Ähnlichkeit basierende Beziehung zwischen diesen beiden Genres, nämlich dem Theaterstück und dem Film, festzustellen. Ausgehend von der Entdeckung, dass dieses Verhältnis existiert, gilt es vielmehr danach zu fragen, welche Konsequenzen für das Verständnis der einzelnen Texte sich daraus ergeben. Dabei ist das Beharren auf den Unterschieden ebenso wichtig wie das Entdecken der Ähnlichkeiten. Es ist nicht allein damit getan, bestimmten Ereignissen, Figurenkonstellationen oder Sinnbildern aufgrund dieser entdeckten Beziehung eine Bedeutung zuzuschreiben. Vielmehr gilt es, danach zu fragen: Was wird durch die erzeugte Reihenfolge ersichtlich? Was drängt nach einer Zuschreibung von Bedeutung? Wie verändert sich die Bedeutungsstiftung, wenn man von einer auf Fortsetzung angelegten Beziehung zwischen den Stücken ausgeht?
Weil die Serie sowohl Teilelemente in Beziehung zueinander setzt als auch eine Fortsetzung erwarten lässt, sind in den folgenden Kapiteln sowohl die Verbindungslinien, die gezogen werden, bedeutsam, wie auch die Zwischenräume; das, was sich zwischen den Zeilen und zwischen den Stücken abspielt. Vorbild für mein hermeneutisches Verfahren ist deshalb auch Aby Warburgs »Mnemosyne Atlas« und die Serialisierung von affektreichen Gesten, die er auf seinen Tafeln inszeniert; jeweils in einem Wechselspiel zwischen imaginärem Zugreifen und begrifflicher Schau. Dabei wählt er Pathosformeln aus dem Speicher des kulturellen Gedächtnisses aus und passt diese seiner Gegenwart an, um ähnlichen zeitgenössischen Ausprägungen einer inneren Bewegtheit Ausdruck zu verleihen. Die Montage legt Beziehungen, Korrespondenzen und Analogien frei, die sonst übersehen oder ausgeblendet werden. Sie erlaubt eine unendliche Assemblage. Ziel ist es, das kulturelle Nachleben dieser affektreichen und wirkungsträchtigen Formalisierungen über eine stets veränderbare Anreihung auf den Bildtafeln zu kartographieren. Der Begriff »Pathosformel« hebt hervor, dass es sich dabei um eine formalisierte Intensität handelt. Die Formel enthält und erhält das Pathos; sie beinhaltet, birgt und umfasst die affektreichen Emotionen. Dank der Formalisierung wird diese Intensität aber auch kontrolliert und gezügelt. Gleichzeitig versteht Warburg die Pathosformel als eine Gedächtnisform, in der affektives Material sowohl zurückgehalten als auch aufbewahrt wird. Somit gewährleistet die Formalisierung, dass diese Intensität aufgegriffen und wieder freigelassen werden kann. Sie sichert nicht nur das eigene Nachleben, sondern macht dieses auch erwartbar.
Weil auf den Warburg’schen Bildtafeln ständig neue Verbindungslinien zwischen ausgewählten Bildformen und ihren nachträglichen Effekten aufgezeigt werden können, lassen sie einen Denkraum entstehen. In diesem führt die Distanz zwischen den einzelnen Pathosformeln zu einem Denken, das sowohl die Bezüge zwischen ihnen wie auch deren Entwicklung reflektiert. Auf Shakespeares Dramen übertragen heißt das: Serielles Lesen dient dazu, in der Begegnung mit den Stücken einen Denkraum entstehen zu lassen, in dem Beziehungen innerhalb der einzelnen Stücke und zwischen ihnen nochmals und zugleich anders greifbar und begreifbar gemacht werden. Einerseits werden in den folgenden Kapiteln dramaturgische Pathosformeln kartographiert, die von einem Stück zum anderen wandern und sich im Zuge dieser Bewegung verändern. Dank der Wiederholung leben die in ihnen enthaltenen Intensitäten innerhalb des Œuvres fort. Andererseits dienen die von mir produzierten Reihungen dazu, das kulturelle Nachleben dieser dramaturgischen Pathosformeln als nachhaltiges Spiel zwischen korrespondierenden und sich fortsetzenden Formalisierungen zu begreifen. Auch für meine Verfahrensweise gilt es, eine produktive Balance zwischen Affiziertsein und Begreifen beizubehalten. Die von mir entworfenen Reihenfolgen zeichnen die in Shakespeares Dramen enthaltenen Leidenschaften empathisch nach und werten sie zugleich im Hinblick auf die Denkformen, denen sie Gestalt geben, analytisch aus. Die dramaturgischen Formeln sind Schemata, die wiedererkannt werden, die aber auch mit jeder Wiederholung an Bedeutungsdichte gewinnen. Als Formgedächtnis erhalten sie mit jedem neuen Einsatz eine weitere Bedeutungsschicht. Erinnert werden in der Fortsetzung auch jene Szenen und Situationen aus vorhergehenden Dramen, in denen die dramaturgische Formel bereits schon einmal zum Einsatz gebracht wurde.
Der Denkraum, der sich mit einem seriellen Lesen öffnet, lotet Zwischenräume aus; er setzt die formalisierten Intensitäten, die weiter zirkulieren, auch in Beziehung zu denjenigen, die in jeder Wiederholung implizit mitschwingen. Die Dramen neu miteinander zu verknüpfen heißt, sie neu zu denken. Es schärft den Blick für die in ihnen enthaltenen Intensitäten wie auch für die Formalisierungen, die diese erhalten. Das Nachleben, das sie ermöglichen, zeigt nicht nur auf, dass sie fortgesetzt werden können. Es macht auch deutlich, dass sie, weil ihr Potenzial nicht ausgeschöpft worden ist, nach neuem Ausdruck drängen, eine Anreicherung anstreben. Somit lässt sich das in der dramatischen Pathosformel angelegte Nachleben mit Walter Benjamins Vorschlag zusammenbringen, dass die Übersetzbarkeit eines Werkes dessen Fortleben betrifft; genauer gesagt dessen stete erneuerte, spätere und umfassendste Entfaltung. Für Benjamin ist der entscheidende Punkt beim kulturellen Nachleben eines Textes, dass es im Fortleben auch eine Nachreife gibt.
Wie bereits ausgeführt wurde, rückt die Shakespeares Œuvre innewohnende Serialität nicht nur die Ähnlichkeit zu vorhergehenden Texten in den Fokus, so dass die späteren Texte als Übersetzung früherer gelesen werden können. Die Fortsetzung bringt auch Wandlung und Erneuerung mit sich, die rückblickend das Vorhergehende verändern. Die in den folgenden Kapiteln dargebotenen Reihungen vollziehen eine Übersetzbarkeit der Dramen in dem Sinne, dass sie den Blick für die Transformationen, die sich zwischen den Stücken ergeben, schärfen wie auch für die Nachreife, die sich abhängig davon, wie man die Reihung zusammensetzt, in den verschiedenen Dramen festmachen lässt. Der Teil der Intensität, der in der dramatischen Pathosform zurückbehalten wird, sucht nach immer neuen Gestaltungen, die diese affektreiche Energie ihrerseits weder erschöpfen noch gänzlich offenbaren, sondern wiedergeben und fortsetzen. In der Persistenz, mit der Shakespeare dramaturgische Pathosformeln immer wieder neu ins Spiel bringt, liegt auch deren Potenzialität. Auch bei der Frage des Nachwirkens und der Nachkommenschaft – die zugleich eines seiner anhaltenden thematischen Anliegen ausmacht – gilt das Prinzip der ›pre-posterous history‹. Eine auf Nachreife ausgerichtete Lektüre bedeutet, die Wirkung, die ein Drama hat, daraufhin zu beleuchten, wie ein nachfolgendes einen Teil des Potentials seines Vorgängers verwirklicht, aber eben nur einen Teil. Was bereits formalisiert worden ist – die Gedanken, Gefühle, Haltungen und Dispositionen –, kann sich weiterentwickeln und zugleich die Patina der Erinnerung weitertragen.
Dramaturgie des seriellen Lesens
Dieses Buch ist selbst als Serie konzipiert. Werden in jedem Kapitel Dramen entlang der sie verbindenden Gedankenschnur besprochen, sind die Kapitel zugleich als Fortsetzung gedacht. Die Ähnlichkeiten und Variationen, die sie abhandeln, ergeben Rückblicke zu den vorhergehenden Kapiteln, schauen auf die folgenden voraus. Mal liegt der Fokus auf den Konsequenzen, die sich aus der unterschiedlichen Auflösung von dramatischen Spannungen ergeben. Mal werden Miniaturen zu einem Gesamtporträt zusammengesetzt. Mal rücken die unterschiedlichen Positionen innerhalb eines Schemas in den Vordergrund. Gewisse Stücke tauchen in mehr als einem Kapitel auf, werden abhängig von der ihnen zugewiesenen thematischen Verkettung aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Die Dramen erscheinen somit selbst in Variationen. Mal rückt die chronologische Fortsetzung einer Denkform in den Vordergrund, mal wird die von mir vorgeschlagene Reihenfolge durch die Facetten der Transformation, die das Thema erfahren hat, bestimmt. Der Offenheit der Serie im Allgemeinen entsprechend können die Analysen aber auch aus der vorgeschlagenen Reihung herausgelöst werden. Die Unterkapitel zu bestimmten Stücken können für sich gelesen werden, wie man auch über eine der Denkformen einsteigen und die anderen Kapitel in einer anderen Reihenfolge lesen kann.
Festzuhalten ist auch: Shakespeare wird auf Englisch zitiert, weil sich meine Lektüren an seinen semantisch vielschichtigen Wörtern und Sinnbildern orientieren. Dabei habe ich mich mit meinen Paraphrasen für jene deutschen Entsprechungen entschieden, die die für mein Argument entscheidende Bedeutung einfängt, nicht für solche, die die poetische Dichte seiner Sprache nachbilden. Weil mir zudem daran gelegen ist, den Stimmen der dramatischen Personen die ihnen gebührende Bühne zu bieten, gibt es kaum andere Stimmen zu hören. Eine Aufstellung der Forschung, auf die meine Analysen zurückgreifen, findet sich im Anhang. Dieser ist als »Theorie-Atlas« konzipiert, in dem die für meine Konzeptualisierung und Durchführung des seriellen Lesens entscheidenden Positionen aufgefächert und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Zwar schwingen in meinen Wiedergaben der Stücke und den weiterführenden Kommentaren zu ihnen diese analytischen Stimmen implizit mit. In jedem der Kapitel liegt jedoch der Schwerpunkt darin, von den Stücken selbst auszugehen, um den Kosmos, den sie gesamtbetrachtet erzeugen, aufzurufen und weiterzuerzählen.
In seinem Gedicht »To the Memory of My Beloved, the Author Mr. William Shakespeare« hält Ben Johnson fest: »He was not of an age, but for all time!« Auch die Beziehung zu Shakespeare, die es jeder Generation von neuem erlaubt, in seinen Dramen etwas Zeitgemäßes zu entdecken, spricht die diesem Œuvre innewohnende Serialität an. Das Fortleben dieser Stücke wirft ein Licht auf die stete Erneuerbarkeit des Kanons, in dem sie seit mehreren Jahrhunderten enthalten und erhalten worden sind. Shakespeare in Serie lesen bedeutet somit auch, seine Dramen als einen vitalen Fundus zu begreifen, der, wenn man sich ihm erneut zuwendet, nicht nur die Nachhaltigkeit seiner Denkformen bestätigt, sondern auch deren Nachreife fruchtbar macht. Die in diesem Buch versammelten Reihenfolgen, die von den Figuren und ihren Beziehungen, von den Geschichten und ihren Entwicklungen, von den Szenen und ihrer Abfolge aus gedacht sind, stellen ein Angebot dar, diese Dramen nicht nur wieder zu lesen und weiter zu denken. Es gilt auch den Denkformen, die durch diese Stücke wandern, nochmals zu begegnen, mit den Anliegen unserer Zeit im Blick: Nicht nur um Antworten zu finden, sondern auch neue Fragen zu stellen.
Der Logik des Seriellen entsprechend, bieten die Dramen für die Probleme, die sie szenisch, gestisch und sprachlich gestalten, zwar mögliche Lösungen an. Weil die Antworten, die sie vorschlagen, jedoch selbst eine Nachreife erfahren, ergeben sich auch stets neue Fragestellungen. Jede Lösung, die hinzugefügt wird, indem man sich Shakespeare in Serie zuwendet, bedeutet auch eine neue Adjustierung der Problematik. Ist der Anfang immer schon eingeholt von dem, was folgt, kündigt jeder Abschluss einer Sequenz – sei es das Ende eines Unterkapitels, sei es der Schlusspunkt der von mir zusammengestellten Gesamtreihung – eine weitere Folge an. Die Lektüre Shakespeares ist nie erschöpfend, weil sie immer wieder von neuem ansetzen kann, weil jede Aussage eine Annäherung, keine endgültige Festlegung ist, weil alles auch nochmals anders gedacht, und anders erzählt, werden könnte. Auf dieses Potenzial zur Fortsetzung setzt dieses Buch.
Kapitel 1Traumwelten und Geistererscheinungen
Am Höhepunkt der romantischen Verwirrungen in Shakespeares Komödie Twelfth Night or What You Will fragt sich der junge Adelige Sebastian: »What relish is this? How runs the stream? Or I am mad or else this is a dream. Let fancy still my sense in Lethe steep: If it be thus to dream, still let me sleep« (4.1.59–62). Wie seine Zwillingsschwester Viola hat auch er den Schiffbruch an der Adriatischen Küste überlebt. Weil er aber an einer anderen Stelle an Land gegangen ist als sie, kommt er erst später im Stück in Illyrien an. Mittlerweile ist Viola davon überzeugt, er sei tot. Deshalb hat sie sich, um ihre prekäre Lage zu verbergen, als Junge verkleidet, sich den Namen Cesario gegeben und mit Hilfe des Kapitäns des untergegangenen Schiffes eine Anstellung als Page am Hof des Herzogs Orsino gefunden. Die Verwechslung von Identitäten, die Sebastian dazu bringt, zwischen Wahnsinn und Traum kaum unterscheiden zu können, ist ferner darauf zurückzuführen, dass Viola sich zwar selbst in den Herzog verliebt hat, jedoch in seinem Namen um die Gräfin Olivia wirbt. Diese verschmäht den melancholischen Grafen schon seit längerem und hat sich stattdessen in den verkleideten Pagen verliebt. Die dramaturgische Spannung lebt somit davon, dass keine der drei Figuren die Person begehrt, von der sie begehrt wird. Damit es zur doppelten Hochzeit kommen kann, welche die Gattung der Komödie fordert, fehlt eine vierte dramatische Person.
Ebendiese Rolle übernimmt der verschollen geglaubte Zwillingsbruder, der unerwartet an dem von Liebeswirrungen beherrschten Schauplatz Illyrien auftaucht. Nur weiß Sebastian nichts von dem, was in seiner Abwesenheit vorgefallen ist. Die anderen halten ihn ganz selbstverständlich für den Pagen Cesario – was ihm wiederum verborgen bleibt. So versteht er weder, warum Feste, der Narr der Gräfin, ihn zu kennen vorgibt, noch warum deren Verwandter Sir Toby Belch und seine Trinkbrüder ihn zum Duell auffordern. Dennoch will Sebastian in dieser verwirrenden Welt verharren, weil das bezaubernde Verhalten der Gräfin ihn betört. Olivia kam beim Streit zwischen ihm und ihrer Gefolgschaft zufällig dazu, zwang die Raufbolde, das Duell abzubrechen, und schickte sie empört weg. Daraufhin lud sie Sebastian mit dem Versprechen, ihm alles zu erklären, in ihr stattliches Haus ein. Im Gegensatz zu seiner Schwester Viola geht er bereitwillig auf die Verführung ein. Noch bevor die Verwechslung der Identitäten aufgeklärt werden kann, wird Olivia – erstaunt und beglückt über den plötzlichen Sinneswandel ihres Liebesobjektes – ihn heiraten.
Der Titel dieser späten Komödie, Twelfth Night, bringt die Denkfigur auf einen Nenner, um die eine Reihe von Shakespeares Traumstücken seriell kreist. Gemeint ist die zwölfte Nacht nach Weihnachten, ein spezieller Zeitraum für die Verschränkung von Wahnvorstellung, Traum und Theater. Es ist die letzte Nacht des Feierns, bevor der gewöhnliche Alltag wieder einsetzt. Die Nähe des Theatralen zur Narrheit wie auch zum Traum ist in dieser karnevalesken Zwischenzeit dadurch gegeben, dass die dramatischen Personen sich einem Rollenspiel hingeben dürfen, von dem sie wissen, dass es ihrem eigentlichen Selbst nicht entspricht. Viola darf unter ihren Männerkleidern nicht nur ihr weibliches Geschlecht und ihre edle Herkunft verstecken. Sie darf auch die Gestalt des totgeglaubten Bruders annehmen und somit den Geist Sebastians an ihrem eigenen verkleideten Körper wieder aufleben lassen. Die von ihr getäuschten Adeligen Orsino und Olivia dürfen ihrerseits in romantischen Phantasien schwelgen, von denen sie ahnen, dass sie im gewöhnlichen Alltag nicht zu realisieren sind. Am letzten Tag des Karnevals – der als eine über fünf Akte ausgedehnte Traumzeit verstanden wird – kann es zudem die verwirrende Aufspaltung einer Erscheinung auf zwei Personen geben, die, nachdem das Zwillingspaar endlich wieder vereint auf der Bühne steht, Orsino staunend feststellen lässt: »One face, one voice, one habit and two persons: A natural perspective, that is and is not« (5.1.212–13).
In diesem klar begrenzten Zeitraum des Feierns kann eine Haltung zur Welt angenommen werden, die verneint, was sie zugleich auch bestätigt findet. Was ist und zugleich so nicht sein kann und dennoch an einem von theatraler Poesie durchdrungenen Schauplatz möglich war – das ist der konzeptionelle Knotenpunkt, der es erlaubt, die Serie an Nachtstücken, die im Folgenden betrachtet werden sollen, miteinander zu verbinden. Dabei gilt es, für Shakespeares Traumwelten zweierlei festzuhalten. Einerseits sind sie als Orte dazwischen konzipiert, die einen provisorischen Zustand ermöglichen. In diesem Zeitraum des Übergangs können dramatische Personen sich auf ebenso schillernde wie beunruhigende Weise verwandeln. Hier dürfen sie Selbsttäuschungen, ehrgeizige Phantasien und transgressives Begehren auskosten. Hier bietet sich ihnen die Möglichkeit, sich selbst zu befragen wie auch gemeinschaftlich gesetzte Regeln zu hinterfragen. Hier können Probleme ausgelotet und Experimente durchgeführt werden. Hier kann die verwirrende und zugleich erkenntnisreiche Erfahrung gemacht werden, dass etwas in Erscheinung tritt, was seinen eigenen Widerspruch in sich trägt.
Andererseits findet in dieser Zeit des Übergangs alles unter dem Vorzeichen statt, dass das Ende des ausgelassenen Rollenspiels in Sicht ist. Die Zeit der reinen Potenzialität ist eine begrenzte, ihr Charme ephemer. Die Vergänglichkeit des Zaubers, der in Erscheinung treten lässt, was sowohl ist wie auch nicht sein kann, bedeutet keine Entwertung dessen, was in diesen Traumwelten erfahrbar wird. Die zeitliche Beschränkung der Möglichkeit des Genusses erhöht vielmehr die Kostbarkeit dieser halluzinatorischen Erfahrung. Somit gehört zur dramaturgischen Logik der Traumgeschehen dieser Stücke, dass es aus dem geistig verwirrenden und zugleich bestrickenden Spiel notwendigerweise ein Erwachen geben muss. Dieses Aufwachen ist auch das Ende aller theatralen Traumdarbietungen, in welche die Zuschauer:innen (oder die Leser:innen der Stücke) miteinbezogen werden. So bezaubernd die Erfahrung, verschiedene Möglichkeiten des Seins zu erproben, auch sein mag: Was sich Sebastian wünscht, ist keinem gegönnt. Über das Ende des dramatischen Ablaufs hinaus darf niemand in dem traumartigen Zwischenraum der Phantasien verharren. Es folgt entweder ein bewusstloser Schlaf, ein Erwachen in einen veränderten Morgen oder der Tod.
Die Traumstücke Shakespeares als Serie zu lesen heißt, in den Fokus zu nehmen, wie sie mit dem Verständnis der Bühne als anderen Schauplatz operieren. Dem psychoanalytischen Konzept folgend fungiert die Bühne als Ort für persönliche wie kollektive Selbsterkenntnis, weil hier vergessene, verdrängte oder verbotene Vorstellungen und Affekte ihren Ausdruck finden. Wie die Traumarbeit bedient sich das Illusionsspiel, das diese Stücke zur Schau stellen, einer anderen Logik des Seins. Hier regiert nicht das Vernunftdenken des gewöhnlichen Alltags, sondern eine mit Entstellungen, Verrückungen und Verdichtungen arbeitende Imagination. Erhalten innere Visionen an diesem anderen Schauplatz eine äußerliche Gestalt, so geht es sowohl um ein anderes Denken und Empfinden wie auch um eine andere Wahrnehmung. Diese zum Alltäglichen querliegende Bewusstwerdung lässt sich deshalb als theatral verstehen, weil sie in zweifachem Sinn eine Szene braucht: sowohl einen ihr geeigneten Ort, an dem sie dargeboten werden kann, wie auch einen zwischen verschiedenen Personen sich abspielenden dramatischen Vorgang. Als geteilte Erfahrungen, die ein Publikum implizit miteinbeziehen (auch dann, wenn keine der Spieler:innen mit asides die Menschen jenseits der Bühne direkt anspricht), ereignet sich in diesen Traumvisionen etwas Entscheidendes sowohl für die einzelnen Figuren wie auch für die Lebenswelt, in der sie sich befinden: Erkenntnisgewinn erfolgt, weil diese Bewusstwerdung einer szenischen Darbietung unterzogen wurde, aber auch weil diese nur als Aufführung erfahrbar ist.
Träume als Zwischenräume
Den Anfang der vorgeschlagenen Serie bildet die Komödie, die als einzige den Begriff »Traum« auch im Titel hat. In Midsummer Night’s Dream wird die Traumwelt explizit als ein heterotopischer Schauplatz zum Hof des Fürsten von Athen konzipiert. Die Ereignisse, die sich dort in der Traumwelt dieser Sommernacht abspielen, bilden eine Verschiebung jener Probleme, die in den vorherigen Tagen aufgeworfen, nicht aber gelöst worden sind. Die Traumwelt erweist sich in dem Sinne als Zwischenraum für Experimente, als der Umweg in den nächtlichen Wald die Möglichkeit bietet, die anfängliche Ordnung ein Stück weit in Frage zu stellen, und zwar indem der Streit, der die dramatischen Ereignisse in Gang gesetzt hat, in einer anderen Tonart durchgespielt wird. Erinnern wir uns an die Ausgangslage: Vier Liebende fliehen am Ende des ersten Aktes vor Anbruch der Dunkelheit in den Feenwald, weil sie sich nicht an das strenge väterliche Gesetz halten wollen. Egeus, Mitglied des Hofstaates von Theseus, Fürst von Athen, will seine Tochter Hermia mit Demetrius verheiraten. Gehorcht sie ihm nicht, muss sie entweder ins Kloster oder aufs Schafott. Hermia aber hat sich eine dritte Option ausgedacht. Mit ihrem Geliebten Lysander will sie bei ihrer verwitweten Tante Obhut suchen, weil deren Haus außerhalb der Gerichtsbarkeit des Hofes liegt. Helena, Hermias Jugendfreundin, hat zufällig von dem Fluchtvorhaben Wind bekommen und Demetrius davon erzählt. Obgleich Helenas früherer Geliebter sie jetzt verschmäht, ist sie Demetrius weiterhin so verbunden, dass sie bereit ist, ihre Freundin seinetwillen zu hintergehen.
An diesem anderen Schauplatz werden die beiden Jugendfreundinnen im Verlauf dieser Nacht nicht nur miteinander kämpfen und dabei in sich eine Gewalt entdecken, von der sie bislang nichts wussten. Sie werden zudem erfahren, wie wankelmütig das Begehren der beiden jungen Männer ist; wie schnell Liebe in Gleichgültigkeit und Verachtung in rasende Lust umschlagen kann. Der nächtliche Wald stellt aber nur deshalb eine Bühne dar, auf der diese Liebenden verborgene Ängste, Liebeswut und mörderische Lust erfahren dürfen, weil der Feenkönig Oberon in das Geschick der vier jungen Athener:innen eingreift. Er steht ein für den Geist der Komödie, der eine Aufteilung der Liebenden in zwei säuberlich voneinander getrennte Paare fordert, und will deshalb seine Zauberkraft einsetzen, damit einer der beiden jungen Männer sein Liebesobjekt wieder austauscht. Deshalb befiehlt er seinem Puck, Robin Goodfellow, er solle, sowie Demetrius eingeschlafen ist, dessen Augen mit dem Saft einer Liebesblume beträufeln, welche ihn in die erste Person vernarrt macht, die er beim Aufwachen erblickt. Dieses Erwachen mit verzauberten Augen kommt einem Erwachen in einen traumartigen Zustand gleich. Weil es sich im Fall von Demetrius aber um die Verwandlung von einer nachträglich aufgesetzten in eine frühere, wahre Liebe handelt, sieht Oberons Plan vor, dass dieser Sinneswandel über die Nacht hinaus anhalten soll. Deshalb befiehlt er seinem Puck, er solle die Augen des Schlafenden erst dann beträufeln, wenn Helena sich ihm nähert.
Robin Goodfellow pflegt, was Shakespeare »night rule« nennt, und hält sich nicht an diese Regieanweisung. Stattdessen produziert er ein neues Ungleichgewicht, indem er die Augen des falschen Jünglings verzaubert. Von der Flucht erschöpft, hatte Hermia ihrem Geliebten den Vorschlag gemacht, den Morgen abzuwarten, um die Reise zum Haus ihrer Tante fortzuführen. Der Sittsamkeit halber besteht sie darauf, sich etwas abseits von ihm schlafen zu legen. Puck beträufelt Lysander (und nicht seinem Rivalen) alsdann die Augenlider, und dieser erblickt beim Aufwachen als Erstes die allein herumirrende Helena. Von deren Anblick sofort bezaubert, läuft er ihr nach und überlässt die schlafende Hermia ihrem Schicksal. Sowie Oberon den Fehler erkennt, wirft er seinem Puck verärgert vor, er hätte seine Schelmerei absichtlich begangen, tadelt ihn dafür, dass er »some true love turned, and not a false turned true« (3.2.91) und ändert der Situation entsprechend sein Skript. Sowie Demetrius eingeschlafen ist, will Oberon nun selbst dessen Augen verzaubern und abwarten, bis Helena aufgetaucht ist. Dieses Mal gelingt sein Vorhaben, und auch Demetrius ist beim Erwachen von einem neuen Liebesobjekt besessen – der ehemaligen Geliebten. Die Wankelmütigkeit der Liebe findet somit eine entlarvende Darbietung, als Helena, die anfangs keiner der beiden Männer wollte, von beiden nun stürmisch umworben wird, während Hermia, um die im ersten Akt gestritten wurde, von allen verlassen ihren Weg allein durch den Wald machen muss. Zugleich wird sichtbar, wie sehr der Liebeszauber einen Widerspruch in sich birgt. Bei Demetrius mögen die Tropfen eine wahre Liebe, die verdrängt wurde, wieder auferwecken, bei Lysander aber zeigt sich die Fragilität der wahren Liebe daran, wie leicht sie sich in eine falsche umkehren lässt.
Als Zeichen seiner Souveränität über alles, was sich an diesem anderen Schauplatz abspielt, greift Oberon mit letzten Regieanweisungen ein: Er lässt seinen Puck zuerst die jungen Männer einander im dunklen Wald jagen, dann, am Waldrand erschöpft angelangt, ein weiteres Mal einschlafen und Lysander – nicht aber Demetrius – kurz vor Morgengrauen von seinem verzauberten Auge befreien. Von magischen Kräften gelenkt werden auch die beiden jungen Frauen am Waldrand einschlafen, jeweils an der Seite der ihnen zugewiesenen Männer. Das wirre Treiben soll ihnen, wenn sie am Morgen wieder erwachen, laut Oberon erscheinen wie »a dream and fruitless vision« (3.2.370). Dabei ist auffällig: Die jungen Frauen erfahren diese Traumwelt anders als ihre Liebhaber. Helena ist die Einzige, die im Verlauf des nächtlichen Treibens nie einschläft. Stattdessen muss sie mit wachem Auge jenen radikalen Sinneswandel ihrer Gefährten über sich ergehen lassen, den sie nur als Spott und Hohn begreifen kann. Hermia schläft zwar ein, doch ihre Augen werden nicht verzaubert. Vielmehr ist sie die Einzige, die mitten im Stück einen Traum hat, dessen szenischen Inhalt sie nach dem Aufwachen nacherzählen kann. Weil sie glaubt, dass Lysander noch in der Nähe sei, ruft sie ihm zu: »Look how I do quake with fear. Methought a serpent ate my heart away, and you sat smiling at his cruel prey« (2.2.149–154). Schnell aber begreift sie, dass ihr Geliebter fortgegangen ist, und sie macht sich, statt dieses Traumbild deuten zu wollen, sofort auf die Suche nach ihm.
Ihr erklärt sich seine Abwesenheit eindeutig damit, dass ihm etwas zugestoßen sein muss, uns aber stellt sie vor ein Deutungsrätsel. Die Schlange, die ihr Herz auffressen will, lässt sich als Bildform der Gefahr interpretieren, in der sie sich befindet. Im Dunkeln des Waldes könnte Hermia von Tieren, aber auch bedrohlichen Nachtwandlern überfallen werden. Die Schlange könnte zudem als männliches Glied gedeutet werden, das, statt ihr Hymen zu zerreißen, an ihrem Herz nagt. Das Traumbild könnte aber auch als Vorahnung der Treulosigkeit ebenjenes Liebhabers interpretiert werden, auf den sie so treuherzig ihr ganzes Glück gesetzt hat. Versteht man den Traum als kodierte Botschaft, die einen verschwiegenen Wunsch erfüllt, könnte man ferner fragen: Warum gibt Hermia sich im Traum dieser Bedrohung hin? Erlaubt er ihr, eine erotische Gewalt zu genießen, die sie sich im wachen Zustand verbieten würde? Oder ist er als Warnung zu verstehen, dass Lysanders Begehren ein anderes ist, als sie meint? Wünscht sie sich ihren zukünftigen Gatten sowohl als Beschützer wie auch als Wüstling? Die Deutung, für die man sich entscheidet, ist weniger wichtig als der Umstand, dass der Traum Hermia erlaubt, sich in eine Szene der Gefährdung zu versetzen, welche sowohl ihre transgressive Flucht vor dem väterlichen Gesetz wie auch ihre Ambivalenz bezüglich der bevorstehenden Eheschließung auf verschlüsselte Weise verarbeitet. Zwar erhält sie ein Wissen über sich selbst, das sie im wachen Zustand nicht gewonnen hätte, doch sie will sich darauf nicht einlassen. Stattdessen führen ihr die traumartigen Umstände, in die sie wieder erwacht ist, ein zweites Mal die Grausamkeit ihres Bräutigams vor. Aus seinem Lachen über ihr verzehrtes Herz wird jene kränkende Abwendung seiner Zuneigung, die ihr das Herz zu brechen droht. Beim Erwachen am nächsten Morgen wird sie nicht alles, was sie in dieser Nacht erfahren hat, belanglos finden, sondern sowohl den Schlangentraum als auch Lysanders Verrat bruchstückhaft erinnern.
Die Liebenden sind allerdings nicht die einzigen, die in dieser Komödie mitten in der Nacht einschlafen, um in eine durch Verzauberung entstellte Szene hinein zu erwachen. Auch der Handwerker Zettel (aka Nick Bottom) befindet sich in einem Zustand sinnlicher Verwirrung zwischen Träumen und Wachen. Zettel ist abends mit seinen Freunden in den Wald gegangen, um ein Theaterstück zu proben, das bei der Hochzeitsfeier des Fürsten aufgeführt werden soll. Weil er nicht nur der Regisseur, sondern auch ein sehr ambitionierter Darsteller ist, würde er am liebsten alle Rollen übernehmen und streitet sich deshalb mit seinen Kumpanen, die für ihn nur die Rolle des Pyramus aus Ovids Metamorphosen vorgesehen haben. Verärgert wendet er sich kurz von ihnen ab, was dem schelmischen Puck, der auf ebendiese Gelegenheit gewartet hat, erlaubt, seinen Kopf in den eines Esels zu verwandeln. Nachdem Zettels Freunde aus Schreck vor seiner körperlichen Verwandlung weggerannt sind, betritt der ahnungslose Handwerker eine andere Bühne. Auf dieser führt nicht er, sondern die Feenkönigin Titania Regie, und sie schreibt ihm eine ganz unerwartete Rolle zu: Den verstellten Sterblichen hat sie zu ihrem Liebhaber auserkoren, weil Oberon auch ihre Augen mit dem Saft der Zauberblume beträufelt hat, nachdem sie in ihrer Grotte eingeschlafen war. Der Feenkönig wünscht sich, dass die Liebesphantasie, der Titania beim Erwachen verfällt, eine verabscheuungswürdige sein soll. Vordergründig ist es ein Ablenkungsmanöver. Er vertraut darauf, dass sie den Knaben, den Auslöser des Ehestreits, leichtfertig abgeben wird, weil ihr Begehren auf ein anderes Wesen übergesprungen ist. Zugleich ist es Ausdruck seines herrschsüchtigen Verlangens, sie für ihren Eigenwillen durch eine peinliche Schmähung zu bestrafen.
In diesem Fall übertrifft Oberons fröhlicher »wanderer of the night« seine Erwartungen. Wie Puck ihm später berichtet, hat er sichergestellt, dass es der eselköpfige Handwerker ist, in den Titania sich mit ihrem verzauberten Auge verlieben musste. Für die Entlarvung des bösartigen Spiels, das der Feenkönig mit der Manipulation ihrer Traumwelt im Sinn hat, ist die Double Vision, auf der ihre erotische Täuschung basiert, entscheidend. Während Titania den verwandelten Zettel als süßen Engel wahrnimmt und, zusammen mit ihren Feen, in ihrer Grotte einen kollektiven Liebeswahn inszeniert, sind wir angehalten, die Täuschung, auf der diese ekstatische Liebesnacht beruht, streng im Blick zu behalten. Wir können es als bezaubernde Verblendung Titanias verstehen, als trickreiche Bestrafung oder als besonders potenten körperlichen Genuss, hebt doch der Eselskopf die animalisch lüsterne Seite des Liebhabers hervor. Auch in diesem Fall ist weniger die Deutung entscheidend, die wir dieser als Szene ausagierten Traumerfahrung zuschreiben. Bezeichnend ist vielmehr der Umstand, dass uns der sexualisierte Verkehr eines Sterblichen mit einer Feenkönigin in einer Weise dargeboten wird, wie er nur in einer theatralisierten Traumwelt möglich ist. Mit einem Seufzer der Verzückung, »O how I love thee! How I dote on thee!« (4.1.44) schläft Titania in der Umarmung ihres Geliebten ein zweites Mal ein.
Die Art, wie die verschiedenen Spieler, deren Treiben Oberon geschickt seinen Wünschen entsprechend gelenkt hat, aus dieser Traumwelt aufwachen, ergibt ein schillerndes Mosaik der Nachwirkungen dieses kollektiven Traums. Die Augen seiner ungehorsamen Königin entzaubert er, noch bevor sein Puck den Eselskopf des Schlafenden, der dicht neben ihr auf dem Boden liegt, wieder entfernt hat. Die glückliche Wiedervereinigung des Feenpaares basiert auf der inszenierten Demütigung der willensstarken Titania. Sie muss sich nicht nur eingestehen, dass das Wesen, das sie im Traum als exquisiten Liebhaber erfahren hat, ihr nun grauenvoll vorkommt. Weil sie sich an das, was vorgefallen ist, nicht mehr zu erinnern erlaubt, muss sie Oberon um Erklärung bitten, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass er sie mit einem so widerwärtigen Sterblichen zusammen schlafend aufgefunden hat. Gefügig verlässt Titania diese Szene der Schmähung und fliegt mit Oberon in einen Morgen, in dem ihr Ehestreit überwunden zu sein scheint, doch nur, weil der Feenkönig die Deutungshoheit besitzt über das, was seiner Königin in dieser Nacht widerfahren ist.
Wenn Zettel seinerseits im frühen Morgengrauen erwacht, wird auch er sich nur daran erinnern, dass ihm eine »rare vision« zuteilgeworden ist. Ergründen kann er diese Traumvorstellung nicht, nur bruchhaft zusammenstückeln, indem er die Empfindungen seiner Sinne vertauscht: »The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man’s hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report what my dream was« (4.1.209–212). Für ihn bleibt all das, was in der vorherigen Nacht geschehen ist, »past the wit of man to say what dream it was« (4.1.204). Aus diesen Fragmenten will er ein Lied komponieren lassen, dem er den Titel »Bottom’s Dream« geben will, »because it hath no bottom«. Auch die vier Liebenden, die kurz vor ihm von der Jagdpartie des Fürsten geweckt worden waren, können halb schlafend, halb erwacht nur ungenau erklären, was ihnen in der Nacht geschehen ist. Sie wissen nicht mehr, warum Demetrius seine Liebe zu Helena wiederentdeckt hat. Einig sind sie sich aber darin, dass diese Traumerfahrung ihre Spuren hinterlassen hat. Deshalb spricht Hermia für alle, wenn sie behauptet, »Methinks I see these things with parted eye, when everything seems double« (4.1.188–189). Den zurückgewonnenen Geliebten vergleicht Helena ihrerseits mit einem Juwel, von dem sie erkennt, es sei »mine own, and not mine own« (4.1.191–192), und spricht somit jenen Selbstwiderspruch an, der Shakespeares Traumwelten seriell als Knackpunkt dient.
Was die jungen Athener:innen aus dieser Nacht mit in den Tag nehmen, ist eine Infragestellung des wiedergewonnenen Bewusstseins. Das Nachklingen ihrer Traumvisionen heißt, auch am Tag mit gespaltenem Auge zu schauen und das Prekäre der glücklichen Paarbildung nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Im Gegensatz dazu nimmt Titania die Deutung der nächtlichen Ereignisse durch Oberon gefügig an. Im wachen Zustand kann sie die vergangene Liebesnacht nur abscheulich finden, kann sie aber auch nicht rückgängig machen. Zettel hingegen bleibt stückweise verzaubert. An seinem Traum hält er fest als eine Vision, die durch seine Sinne nicht greifbar ist und erst in der Übertragung in eine Ballade begreifbar wird. Das Erwachen dieser Spieler aus dem von Oberon inszenierten Traumschauspiel ergibt somit eine Serie an gespaltenen Blicken, die in der Einbildungskraft etwas nachreifen lassen, was an diesem anderen Schauplatz als von ihnen geteilte Phantasie dargeboten werden konnte.
Versteht man das, was sich im Feenwald abgespielt hat, als traumartige Verarbeitung der Konflikte, die am Vortag am Hofe Theseus’ ausgebrochen waren, lässt sich in Shakespeares Komödie noch eine weitere Träumerin entdecken: Hippolyta, deren Hochzeitsfest sich die beiden Liebespaare im 5. Akt anschließen werden. Am Anfang des Stückes wird sie als Amazonenkönigin eingeführt, die Theseus mit seinem Schwert auf dem Schlachtfeld erobert hat. In der ersten Szene des Stückes hört die besiegte Braut schweigend zu, während Egeus seiner Tochter droht, er würde sie entweder ins Kloster schicken oder hinrichten lassen, sollte sie nicht den Mann zum Gatten nehmen, den er für sie ausgesucht hat. Am Ende des Stückes ist Hippolyta diejenige, die den Liebenden Glauben schenkt. Theseus ist zwar von der Liebesbekundung des Demetrius so überzeugt, dass er den Wunsch seines Höflings überstimmt und sich für die neu zusammengesetzten Paare ausspricht. Doch für ihn ist das, was sie von ihren Traumvisionen zu berichten haben, nichts weiter als »shaping phantasies, that apprehend more than cool reason ever comprehends«. Despektierlich verkündet er, »The lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact« (5.1.5–8). Entschlossen hält Hippolyta ihrem Bräutigam entgegen: »But all the story of the night told over, and all their minds transfigured so together, more witnesseth than fancy’s images and grows to something of great constancy but howsoever strange and admirable« (5.1.23.27).
Hippolytas Erwiderung könnte man als Lobgesang auf jenen gespaltenen Blick verstehen, der das Theater mit dem Schlaf und dem Wahn verknüpft: Als Anerkennung des heuristischen Wertes der Erfahrung, dass für die Dauer einer Aufführung in Erscheinung tritt, was im Alltäglichen nicht sein kann. Verfolgt man diese spekulative These weiter, ließe sich mutmaßen: Alles, was wir im nächtlichen Wald an Irrungen, Demütigungen, aber auch ekstatischem Genuss miterleben durften, ist ihr Traum gewesen. Mit Titania, so könnte man fabulieren, verarbeitet sie die Schmach ihrer Hochzeit, muss sie sich doch ganz dem Bräutigam beugen, der sie in der Schlacht besiegt hat. In Hermia hingegen schafft sie sich im Traum die Tochter, der jene glückliche Fügung zuteilgeworden ist, die ihr nicht bestimmt war.
Die Tyrannei, die in Oberons Anspruch auf eine Regiehoheit über die Träume jener Figuren steckt, die er zu Spielern in einem Drama der Zurechtweisungen auserkoren hat, wird augenfällig, wenn man sie seriell mit dem Stück verbindet, in dem Shakespeare ein letztes Mal diese Denkform als kritische Spiegelung seiner eigenen theatralen Macht in Einsatz bringt. In der späten Romanze The Tempest entpuppt sich die Insel, die zwischen Neapel und Tunis liegt, als Traumwelt, in der die Zauberkräfte Prosperos noch wesentlich übergriffiger walten. Auch er ist ein Spielleiter in eigener Sache. Nicht aber einen Ehestreit will er zu seinen Gunsten wenden und zwei Liebespaare neu zusammensetzen, sondern für eine vergangene politische Intrige Rache üben. Kein ungelöster Streit des Vortages wird in diesem Zwischenraum ausgetragen wie im Midsummernight’s Dream, vielmehr gilt es, die illegitime Machtergreifung durch seinen Bruder Antonio, die viele Jahre zurückliegt, rückgängig zu machen. Der Zufall, dass der Herzog, der seine Verbannung aus Milan veranlasst hat, zusammen mit dem König von Neapel und dessen Bruder Sebastian an die Küste seiner Insel gelangt sind, lässt Prospero einen Sturm heraufzaubern, der einen Schiffbruch verursacht. Die Überlebenden treten als Spieler des von ihm ersonnenen Vergeltungsdramas an Land. Eines der Schiffe hat sein Luftgeist Ariel zudem in einen sicheren Hafen geleitet und die Seeleute an Bord in einen tiefen Schlaf versetzt, aus dem sie erst am Ende des Stückes wieder erwachen werden. Es braucht diese verzauberten Statisten, um sichtbar zu machen, dass es sich bei der Insel nicht nur um eine von Prospero flächendeckend beherrschte Bühne handelt, sondern zudem um eine, in der Schlaf und Träume walten.
Es braucht diese schlafenden Seeleute im Hintergrund aber auch, weil Prospero im Gegensatz zu Oberon das Schauspiel, das durchzuführen er vorhat, als Höhepunkt seines theatralen Zaubers versteht. Während wir uns ein serielles Weiterwirken des Feenkönigs vorstellen dürfen, ist Prosperos Regieeingriff in die Träume seiner Spieler ephemer. Ist alles auf ein Ende seiner Beherrschung der Inselbewohner angelegt, so ist die Macht, die er mit aller Wucht ein letztes Mal entfalten will, viel totalitärer als die des herrischen Oberon. Im Gegensatz zu dessen Puck hat der Luftgeist Ariel keine Möglichkeit, als Störfaktor in das Spiel einzugreifen. Ihm bleibt nur die Hoffnung, dass Prospero ihn zur Belohnung für seine treuen Dienste am Ende seiner Regentschaft erlösen wird. Auch gibt es keine Feenkönigin, die Prospero eigenwillig entgegentritt und die überwunden werden muss; nur eine gehorsame Tochter, die so unwissend wie ahnungslos ist ob der tyrannischen Lust ihres Vaters.
Nicht nur die Statisten werden von diesem manipulativen Spielleiter in Schlaf versetzt, sondern als Beweis seiner allumfassenden Macht auch die Hauptdarsteller. Gleich zu Beginn des Stückes fragt Miranda, die dem stürmischen Spektakel von einer Klippe aus ergriffen beigewohnt hat, warum ihr Vater seine Zauberkräfte eingesetzt hat, um solches Leid zu verursachen. Um sich zu verteidigen, gesteht Prospero ihr, die unerwartete Ankunft seiner Widersacher würde ihm Gelegenheit bieten, sich für seine Verbannung aus Milan zu rächen. Von weiteren Fragen aber hält er Miranda ab, indem er sie hypnotisch einschläfert. Geht es auch im Fall seiner Tochter darum, zur Schau zu stellen, wie er über alle, die seinen Machtbereich betreten, verfügen kann, ist das Ziel ein anderes. Nachdem er mit seinem Luftgeist Regieanweisungen durchgegangen ist, die für Miranda die Hauptrolle in einem Liebesdrama vorsehen, wird sie von ihrem Vater wieder aufgeweckt. Auf dieser Insel braucht es keine Zaubertropfen, damit sie sich in den Sohn des Königs von Neapel verliebt, der plötzlich vor ihr in Erscheinung tritt. Hat sie die ganzen Jahre mit ihrem Vater allein auf dieser Insel gelebt, erscheint Ferdinand, der von ihr ebenfalls verzückt ist, wie ein Wunderwesen, dessen seltsame Gestalt sie nur betören kann.