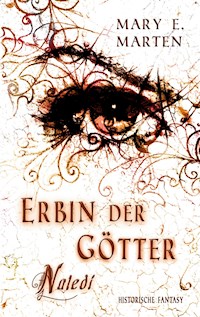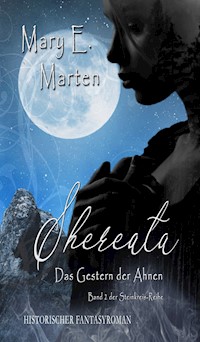
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Steinkreis-Reihe
- Sprache: Deutsch
"ICH SAH DEIN SCHICKSAL, SCHETTAL. DEINE VERANTWORTUNG WIRD GROSS SEIN, ABER AUCH DEINE ERKENNTNIS. DEINE AUFGABEN WERDEN WEITER IN DIE ZUKUNFT REICHEN ALS DIE JEDES ANDEREN, DER NACH DIR KOMMT. UND DIE GEISTER WERDEN DIR ZU GEGEBENER ZEIT JEMANDEN AN DIE SEITE STELLEN. WAS ICH SAH WAREN ZWEI GESICHTSLOSE FRAUEN …" Neriba, tief im Süden. Shereata gerät gemeinsam mit ihrer Tante in die Hände von Menschenhändlern und soll irgendwo jenseits des Meeres versklavt werden. In einem schweren Sturm gelingt ihr zwar die Flucht, doch fortan ist sie auf sich gestellt. Die Geister der Ahnen scheinen zwar ein Zeichen der Hoffnung zu senden, doch das Schicksal schlägt erneut unbarmherzig zu. In Hannan lastet nach dem Tod des Vaters die Verantwortung für die Blutssippe auf Schettal und dessen älterem Bruder Shebmog. Dessen Trachten gilt jedoch gänzlich anderen Dingen; er lässt seine Sippe bedenkenlos im Stich, womit die gesamte Bürde auf Schettals Schultern ruht. Wäre da nicht Saweg, der alte Mittler, der ihn in der geistigen Führung seines Volkes unterweist ... Jahre später tritt Schettal dessen Nachfolge an - und fordert die Sippengemeinschaften seiner Heimat auf, ihm in den Norden zu folgen, in eine ungewisse Zukunft. Vier Schicksale, durch Raum (und Zeit) voneinander getrennt und doch miteinander verflochten? Band 2 der Dilogie nutzt noch einmal die Magie des Steinkreises ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mary E. Marten
Shereata
Das Gestern der Ahnen
Band 2 der Steinkreis-Reihe
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
©2019 Mary E. Marten
Alle Rechte vorbehalten.
Bilder:
Steinkreis: © vencav/Shotshop.com
Silhouette: ©Ales Utouka /123rf.com
Schnörkel: © Bittedankeschön / Adobe Stock
Nebel: coffeemill / Fotolia
Gestaltung. Mary E. Marten
Foto Autorin: © Mary E. Marten Schriften:
The king and queen font: bran / dafont.com
Flanella: Bangkit Tri Setiadi / dafont.com
Herstellung und Verlag:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN:
Taschenbuch 978-3- 7497-5758-9
Hardcover 978-3- 7497-5759-6
E-Book 978-3- 7497-5760-2
Vorwort
Die Geschichte dieses Buches handelt sowohl in einer fiktiven Welt und von fiktiven Personen als auch in einer Vergangenheit und Gesellschaft, in der ein Menschenleben wenig Wert hatte. Insbesondere Frauen gelten zumeist lediglich als Sache und Eigentum – erst des Vaters, dann der Ehemänner – und die Geschichte beleuchtet gleich mehrfach diese niedere Stellung, womit sie sich an die Realität in bronze-/eisenzeitlichen Zeiten anlehnt. Darüber hinaus nimmt sie einen Einblick in die Psyche einer durchaus gewalttätig veranlagten Persönlichkeit.
Die Autorin empfiehlt für den vorliegenden Band der Reihe ein Lesealter von 18+.
Personen der Handlung sowie Nebenfiguren, in alphabetischer Reihenfolge:
Anog
Fischer und Strandräuber, Nebs Mann
Bemon
Eisenschmied
Birgo
Jäger und Fährtensucher
Geshia
Shereatas Tante
Gigor
Anführer einer kl. Sippengemeinschaft
Humo und Lorag
Jäger
Kysom
bester Jäger innerhalb Schettals Sippe, Ruhogs Vater
Margur
Schettals Vater, +
Mena
Schettals jüngere Schwester
Neb
Anogs Frau, Sawegs Tochter
Nesabath
(Mit)Gefangene der Menschenhändler
Nia
Shereatas ältere Schwester
Nitres
Schettals Mutter
Norghu
ein weiterer Sippenanführer
Norvyla
Ruhogs und Menas Tochter
Oresa
Überlebende des Überfalls der Menschenjäger
Perepos
ein weiterer Fischer
Reweg
Schettals Onkel väterlicherseits
Ruhog
Kysoms Sohn, Schettals Freund
Saweg
geistiger Führer des Volkes
Schettal
Protagonist
Shebmog
Schettals älterer Bruder
Sherea
Schettals und Shereatas Nachfahrin
Shereata
Protagonistin
Sinset
Tochter des Eisenschmieds Bemon
Thaja
Shereatas Mutter
Tista
Schettals jüngste Schwester
Tobat
Shereatas Onkel, Geshias Mann
Tog
Shereatas Cousin
Truom
Kapitän eines Sklavenschiffes
Usita
junges Mädchen
Vorogh
Schettals Großvater mütterlicherseits
Woryg
Kapitän eines (Sklaven)Schiffes
Zeret
Nias Mann, Shereatas Schwager
Orte, Flüsse und Begriffe:
Epo
größter Fluss in Neriba
Hannan
Schettals alte Heimat
Haregath, künftig Hergath
neue Heimat für die Sippen
Lartos, künftig Lertos
Fluss
Neriba
Shereatas Heimat, weit südlich von Hannan gelegen
Sertet
Schüler, Lernender
Kapitel 1
Hannan, im Winter …
Die durchdringende Kälte hatte sie nicht davon abgehalten, ihre Opfergabe zum Stein zu bringen und wie stets auf ein Zeichen zu warten. Ein Zeichen, sei es auch noch so klein, dass ihre Bitte zumindest das Gehör der Geister gefunden hatte.
Wie er schon befürchtet hatte, war es auch diesmal ausgeblieben und seine Füße waren erneut umsonst zu Eisklumpen gefroren. Endlich erhob seine Mutter sich und klopfte den Schnee von den Kleidern. Ihr dicker Schafsfellumhang war schon alt und hier und da sichtlich abgeschabt, aber er wärmte. Unschwer war hingegen zu erkennen, dass ihre gefütterten Lederstiefel vom Schnee, der in diesem Jahr noch einmal fast kniehoch lag, nass waren.
Sein älterer Bruder ließ schleunigst eine ungerührte Miene sehen und stieß sich von dem Baumstamm ab, an den gelehnt er widerwillig gewartet hatte. Shebmog wusste seine wahren Gefühle bei Bedarf meisterlich zu verbergen, denn er war genauso ungeduldig gewesen wie er, Schettal. Darüber hinaus jedoch auch geringschätzig und verächtlich.
Gefühle verbergen – etwas, das ihm ungeheuer schwerfiel; seine Miene spiegelte stets das wider, was ihn bewegte.
„Bindet die Pferde los, wir reiten zurück.“, schüttelte seine Mutter die letzten Schneereste aus dem Saum ihres Kleides und als sie kurz darauf ihr Bein über den Rücken ihres Reittiers schwang, war für einen kurzen Augenblick die lederne Hose zu sehen, die sie darunter trug. Zugeständnis angesichts der eisigen Luft. Dieser Winter war überaus kalt.
Frega, sein noch junges Pferd, war wie die meisten von eher kleinem, gedrungenem Wuchs; anspruchslos, kräftig und ausdauernd, ein dichtes, dickes Fell gegen die Kälte. Wie die beiden anderen schien es durchaus erleichtert, nicht länger stillstehen zu müssen, denn auch ohne angetrieben zu werden trabte es sofort an.
„Die Geister waren nicht da?“, hörte er Shebmog fragen. In seinen Ohren klang dies ein wenig zu höhnisch, um als Frage durchgehen zu können.
„Die Geister sind stets da, auch wenn sie uns ihre Gegenwart nicht immer zeigen!“, belehrte Mutter ihn prompt ungehalten, doch anders als früher klang ihre Antwort weniger überzeugt.
Er schwieg dazu, doch in seinem Kopf begannen die Gedanken zu kreisen. Rückblickend war er sich recht sicher, dass seine Mutter ihren Glauben an die Geister erstmals mit weniger Überzeugung vertrat, seit Vater vor jetzt schon über einem Jahr gestorben war. Ein Jagdunfall. Mutter hatte kurz vorher erst ihre jüngste Schwester, Anaris, zu früh geboren und wenig später an den Tod verloren; mit Vaters plötzlichem und unerwartetem Tod stürzte ihre gesamte Blutssippe in eine bedenkliche Lage. Alleine mit vier Kindern brach mit Vater der Ernährer der Familie fort.
Natürlich wurden sie seither wieder von Mutters Vater Vorogh unterstützt, denn noch waren er und Shebmog nicht in der Lage, alleine für Jagd und Feldarbeiten zu sorgen. Als daher vor zwei Wochen Vorogh überraschend vor ihrer Tür gestanden und anschließend vor der Hütte ein ebenso überraschend kurzes Gespräch mit Mutter geführt hatte, war diese anschließend leichenblass gewesen …
‚Sie soll sich wieder verbinden. Mit Kysom.‘, hatte Shebmog ihm kurze Zeit später zugeraunt.
‚Woher … Du hast gelauscht!‘
‚Natürlich! Seit Vaters Tod bin ich der Mann und sollte wissen, was vor sich geht!‘, hatte er sich gebrüstet, aber diesmal hatte er seine Stimme nicht ganz im Griff. Ein leises Schwanken darin zeigte, dass die Pläne ihres Muttersvaters auch ihm nicht sonderlich behagten. Kysom war der beste Jäger des Dorfes, seinerseits seit dem Tod seiner Frau ebenfalls alleine und Vater eines Sohnes, doch er war auch dafür bekannt, dass er jähzornig war. Davon zeugten mehr als einmal die blauen Flecke im Gesicht und die Striemen auf dem Rücken des Jungen, der nur ein halbes Jahr älter war als Schettal.
‚Mutter wird sich nicht darauf einlassen!‘, stieß er voller innerer Überzeugung hervor. Eine Überzeugung, von der er nicht wusste, woher er sie nahm.
‚Das kannst du nicht wissen!‘, kam es prompt schnaubend. ‚Vorogh hat sich überaus deutlich ausgedrückt. Es fällt ihnen selbst mit vereinten Kräften zusehends schwerer, fünf weitere Mäuler zu stopfen. Überdies wird dir die zweite Möglichkeit genauso wenig gefallen!‘
‚Welche zweite Möglichkeit?‘, dehnte er und hob den Kopf endgültig von seiner Arbeit. Inzwischen war er überaus geschickt in der Fertigung von Pfeilen und Pfeilspitzen, doch wie es aussah, konnte die neue Pfeilspitze aus Feuerstein noch eine Weile warten, das hier aber nicht. Shebmog hingegen gab sich nur selten mit solchen Arbeiten ab. Er hielt auch jetzt wieder das Wurfmesser mit der Bronzeklinge – Erbe ihres Vaters – in der Hand und warf es spielerisch in die Luft, wo es sich einmal drehte und dann mit dem Griff zielsicher wieder in seiner Hand landete.
‚Sie soll entweder für einen neuen Ernährer sorgen oder aber die beiden hungrigsten Münder fortschicken, damit sie woanders leben, in einer anderen Sippengemeinschaft. Die Felder sollen gegen entsprechenden Tausch an jemanden gegeben werden, der sie bearbeitet, was wiederum einen nicht üblen Beitrag zu Mutters Ernährung und der unserer beiden Schwestern ergäbe. Wenn wir in drei oder vier Jahren alt genug seien und uns selbst versorgen können, könnten wir immer noch zurückkehren und Vaters Land wieder selbst bearbeiten.‘
Er starrte an ihm vorbei ins Nichts. Fortgehen? In einer anderen Sippengemeinschaft würde man sie so lange wie niederste Tiere behandeln, für die schwersten Arbeiten heranziehen und nur mit den Resten abspeisen, bis sie sich als nützliche Mitglieder erwiesen. Abgesehen davon war er in seiner Vorstellung genau wie Vater für den Rest seines Lebens hier verwurzelt, würde niemals irgendwo hingehen. Alleine der Gedanke erschreckte ihn zutiefst.
‚Du Feigling! Machst du dir jetzt die Hose nass? Bei den Geistern, wenn du dein Gesicht sehen könntest! Was ist schon dabei, wenn wir von hier fortgehen? Alles ist besser als Kysom Vater nennen zu müssen! Abgesehen davon kann ich es gar nicht erwarten! Es gibt weit südlich von hier längst große Sippenzusammenschlüsse, in denen nicht mehr jeder alle Arbeit verrichten muss; sie haben sie unter sich aufgeteilt, je nach Fähigkeiten. Man kann dort ein Handwerk erlernen und indem man seine Zeit nicht mehr aufteilen muss, gelangt man darin zu wahrem Können! Ich jedenfalls habe nicht die Absicht, mein Leben lang Felder zu pflügen oder als Jäger von einem wilden Eber zerfleischt oder von dem Geweih eines Großhirschs …‘
‚Sag Mutter, dass ich bis zum Abend zurück sein werde!‘, hatte er ihn schlichtweg unterbrochen, die begonnene Arbeit, Leder, Knochen und Geweihstück beiseitegelegt, seine dicke Jacke vom Haken gerissen und war nach draußen verschwunden, Shebmogs Rufe und seinen Protest kaum zur Kenntnis nehmend.
Doch auch ihm hatten die Geister eine Antwort verweigert!
Den gesamten Rückweg legten sie schweigend zurück. Shebmog, weil er sich offensichtlich von Mutter unverdient zurechtgewiesen fühlte, Mutter, weil sie in schwere Gedanken versunken war, und er, weil seine Überlegungen sich nun wieder unablässig darum drehten, weshalb die Geister sich in Schweigen hüllten. Vater hatte fast immer ein Zeichen von ihnen erhalten, sei es auch noch so gering gewesen. Und auch Mutter hatte oft genug wenigstens ein sanftes Schimmern des Steins als Hinweis deuten können, dass sie zumindest gehört worden war, wenn auch nicht unbedingt erhört.
Seit einiger Zeit aber schien es so, als ob die Geister sich wahrhaftig von ihnen zurückzuziehen gedachten: Es mehrten sich die Berichte, dass auch die anderen aus dem Dorf – ebenso wie die Bewohner der umliegenden Siedlungen sowie des weiteren Gebiets um ihre heilige Stätte herum – immer seltener einen Beweis der immerwährenden Zuwendung und des Schutzes der Geister erhielten. Warum? Die Mutmaßungen waren vielfältig – ebenso vielfältig wie die Gegenreden.
Die Hütten waren schon in Sichtweite und es war nicht mehr lange hin bis zur Dämmerung, als er aus seinem Nachdenken auftauchte.
„Mutter?“
Sie wandte den Kopf halb zu ihm herum. Die einzige Reaktion. Er lenkte sein Pferd neben ihres und hielt den Speer so, dass dessen Spitze nicht in ihre Richtung zeigte.
„Kann Shebmog dich den Rest des Wegs alleine begleiten? Ich möchte noch kurz bei Saweg vorbeisehen.“
Sie runzelte die Stirn.
„Saweg? Was erhoffst du dir von ihm? Er ist den Geistern offensichtlich nicht mehr näher als jeder andere von uns!“
Offenbar vermutete sie angesichts des Zwecks ihres heutigen Rittes, dass er Saweg um Fürsprache bei den Geistern bitten wolle. Er ging nicht wirklich auf diese Bemerkung ein.
„Das bedeutet nicht, dass er nicht über ein großes Wissen verfügt. Wie du hat auch Vater immer gesagt, dass man die Alten und ihr Wissen ehren soll und ich komme bald nach.“
„Meinetwegen.“, erwiderte sie. „Bevor es dunkel wird, bist du zu Hause!“
„Versprochen.“, nickte er, aber sie sah ihn schon nicht mehr an. Die Sorgen der letzten zwölf Monate hatten ihre vordem noch kaum sichtbaren Falten tiefer und schärfer werden lassen, doch die letzten Tage hatten ihrer Miene etwas Verzweifeltes hinzugefügt.
Er warf dem spöttisch grinsenden Shebmog einen kurzen Blick zu, dann lenkte er Frega in östliche Richtung und zum Rand des Dorfes, wo Sawegs Hütte stand. Abseits der anderen und dicht am Waldrand gelegen, umgeben von einem Halbkreis aus dichtem Dorngestrüpp.
Er hatte Frega kaum angebunden und die Hand gehoben, um an die Tür zu klopfen, als er auch schon Sawegs Stimme hörte, die ihn aufforderte, hereinzukommen.
„Woher wusstest du, dass ich es bin?“, fragte er anstelle einer Begrüßung, neigte hingegen ehrerbietig den Kopf. „Deine Fensterläden sind schon geschlossen!“
Die Dunkelheit im Inneren wurde in der Tat nur von dem Feuer in der Feuerstelle und einem qualmenden Talglicht vertrieben. Wie immer roch es eigenartig im Inneren seiner Behausung, wenn auch nicht unangenehm.
Das Lächeln des Alten fiel wie meist schief und ein wenig rätselhaft aus.
„Setz dich und wärm dich am Feuer auf. Haben die Geister euch angehört?“
Er stieß den Atem mit einem schnaubenden Geräusch aus.
„Ich weiß es nicht. Sie scheinen sich tatsächlich von uns abzuwenden.“, wiederholte er Gehörtes, ohne darüber nachzudenken.
Seinen Umhang legte er mangels Platz über die Bank am Tisch, dann zog er den zweiten Hocker näher ans Feuer und schauderte kurz, als er dessen Wärme spürte.
„Du denkst demnach so wie die anderen.“, kam es zurück, bevor Saweg ihm einen Becher mit heißem Tee füllte und anreichte. Ein intensiver Geruch stieg ihm in die Nase und er fragte auch diesmal nicht, welche eigenartigen Beigaben er für seinen Kräuteraufguss verwendete. Er wärmte wie immer, das war alles, was zählte.
„Was sollen wir denn sonst denken?“ Seine Verteidigung klang wie die Widerrede eines trotzigen Kindes, aber jetzt war es zu spät, die Worte zurückzunehmen.
Sawegs Lächeln verschwand und seine wässrigen Augen bekamen einen stechenden, forschenden Ausdruck.
„Nicht immer ist das Offensichtliche auch das Wahre, mein Junge! Zweifle niemals an den Geistern, denn sie sind uns keine Rechenschaft für ihr Verhalten schuldig. Wohingegen wir ihnen in Zeiten wie diesen unser Vertrauen umso mehr schenken sollten. Worum hat deine Mutter sie gebeten?“
Er runzelte die Stirn.
„Sie hat ihre Bitte nicht laut geäußert.“, versetzte er, halb unwillig, halb verunsichert.
„Schon gut, du brauchst mir keine Auskunft zu erteilen, ich kann es mir denken. Was glaubst du, wie sie sich entscheiden wird?“
Jetzt ruckten seine Augenbrauen nach oben und er ließ den Becher, an dem er soeben nippen wollte, wieder sinken.
„Du weißt?“
„Oh Schettal, ich weiß einiges, aber längst nicht all mein Wissen ist mir von den Geistern mitgeteilt. Ich habe jedoch Augen und Ohren und höre doch, was die Leute im Dorf erzählen! Was also glaubst du, wie deine Mutter entscheiden wird? Wird sie euch beide fortschicken oder sich in ein Los ergeben, das ihr scheinbar vom Schicksal aufgezwungen werden soll?“
„Scheinbar? Schicksal? Doch wohl eher von …“
„Beantworte meine Frage!“, beharrte er und unterbrach ihn so.
„Ich weiß es nicht! Wenn sie schon am heiligen Stein Rat erbittet …“
„Rate!“
„Das kann ich nicht!“
„Dann frage ich anders: Was würdest du ihr raten? Wie würdest du entscheiden, wenn du für sie die Wahl treffen solltest?“
Er wand sich unbehaglich, innerlich und jetzt auch tatsächlich. Er war nicht gekommen, um solchen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Oder doch?
…
Als er diesmal den Atem ausstieß, klang es resigniert. Doch, er war genau deshalb gekommen: Um diese brennenden Fragen mit dem Einzigen zu besprechen, von dem er sich Rat und Hilfe erhoffte.
Verstört starrte er in die Flammen. Egal wie er es drehte und wendete, immer erschien es ihm so, als ob er seine eigenen Interessen vor die seiner Mutter stellen würde.
Eine Verbindung mit Kysom? Wäre sie damit einverstanden und glücklich, würde sie nicht derart zögern, ihn hingegen würde dies zumindest davor bewahren, von hier fortgehen zu müssen, noch dazu wer weiß wohin.
Fortgehen? Um was zu tun und zu erlernen? Er hatte immer nur das tun wollen, was sein Vater getan hatte: irgendwann eine Familie mit Jagd, ein wenig Fischfang und der Bewirtschaftung eines Stückchen Landes ernähren. Land, das schon seinem Vater und dessen Vater gehört hatte, weil deren Vorväter in wenigstens drei Generationen es abgesteckt und eigenständig bewirtschaftet hatten – so war die Regel.
Doch dieser Wunsch und seine Umsetzung waren zwei verschiedene Dinge. Längst schon war er zwar sehr geschickt und erfolgreich, wenn es um die Jagd mit Pfeil und Bogen ging, oft gingen kleine Tiere in seine Fallen. Zudem wusste er, wie und wo man zu den unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten am besten angelte oder wo man Reusen auslegen musste, um etwas darin zu fangen. Doch mit seinen zwölf Sommern war er noch immer zu jung, um zusätzlich die schwere Feldarbeit in ihrer Vollständigkeit zu übernehmen.
Shebmog war ein Jahr älter als er und würde in einem halben Jahr seinen vierzehnten Sommer zählen, doch ihm ging jedes Geschick ab – weil er sich sträubte und keinerlei Anzeichen machte, sich für die anstrengende und gefährliche Pirsch, Jagd oder überhaupt jegliche schwere Arbeit zu interessieren. Er war weder ein erfolgreicher Jäger, noch gab er sich wirkliche Mühe, Fallen zu bauen oder geduldig zu warten, bis die Fische anbissen. Er war größer und kräftiger, ja, aber selbst die Feldarbeit ging er nur und auch nur widerwillig an, wenn ihre Mutter ihm drohte, ihn ansonsten einen ganzen Tag lang hungern zu lassen.
Das Einzige, worin Shebmog wirklich begabt war, war der Umgang mit dem Wurfmesser und den Wurfhölzern. Ersteres übte er in jeder unbeobachteten Minute verbissen, zäh und voller Ehrgeiz; längst schon konnte hierin keiner der Jungen aus dem Dorf noch mit ihm mithalten. Er als ältester Sohn besaß neben seinem eigenen kleinen Messer aus minderwertigem Metall seit Vaters Tod auch dessen erheblich besseres Messer und traf selbst das kleinste Ziel auf die weiteste für seine Wurfkraft noch erreichbare Entfernung. Und nicht erst in letzter Zeit trat dann jedes Mal ein Ausdruck in seine Augen, der ihn, Schettal, mit einem nicht erklärbaren Unbehagen erfüllte …
„Und?“
Sawegs Stimme riss ihn aus seinen Gedanken.
„Mutter darf sich nicht mit ihm verbinden!“, stieß er spontan hervor. „Sie und Vater gehörten zusammen, aber Kysom … Er ist vollkommen anders als Vater und würde sie unglücklich machen. Und uns ganz sicher mit. Aber fortgehen … Shebmog kann es gar nicht erwarten, von hier fortzukommen, um anderswo irgendetwas zu erlernen. Bei den großen Sippengemeinschaften, wenn es nach ihm ginge. Waffenschmied oder was weiß ich, etwas, das er hier nicht lernen kann, denn das Gießen von Kupfer zu Klingen und Pfeilspitzen oder die Herstellung von Werkzeugen genügen ihm nicht; er will mehr. Was immer es aber sein wird, er wird erst zurückkommen, wenn er sich mit irgendeinem Können brüsten kann.“
„Du kennst ihn offenbar gut! Und du?“
„Ich will nicht von hier fortgehen!“, versetzte er trotzig.
„Und warum nicht? Du weißt nie, was dich anderswo erwarten könnte.“, versetzte Saweg.
„Das hier ist mein Zuhause, hier ist, wo ich leben möchte. Ich wollte nie etwas anderes sein als mein Vater!“, ballte er die freie Hand zur Faust.
„Ein achtbares Ziel, mein Junge! Achtbar, aber möglicherweise auch kurzsichtig.“
Auf diese Bemerkung hin hob er den Kopf und starrte den Alten an, hielt entschlossen dessen forschendem Blick stand. Saweg wiederum hielt seinen Blick lange fest, dann nickte er, ließ sich breitbeinig auf seinem Hocker nieder und nickte noch einmal, so als ob er für irgendetwas die Bestätigung erhalten hätte.
„Shebmogs Schicksal liegt im Dunkeln, aber deines kann ich mitunter deutlich sehen. Ich wiederhole: Häng dein Herz nicht zu sehr an das Land, auf dem eure Hütte steht. Ein Fortgehen von vornherein auszuschließen kann kurzsichtig sein!“
„Meine Zukunft? Du kannst meine Zukunft sehen?“, dehnte er atemlos. „Was hast du gesehen?“
Saweg schüttelte gleich noch ein drittes Mal sein greises Haupt.
„Ich besitze nicht die Gabe, die Zukunft zu sehen – etwas, das offenbar keiner hier begreift oder wahrhaben will. Aber ich sehe manchmal etwas vom Schicksal einzelner Menschen. Kleine Bruchstücke, Bilder, mehr nicht. Die Zukunft ist ungeschrieben und unsicher, sie hängt von unseren Entscheidungen ab. Ändern wir unsere Entschlüsse, ändern wir auch unsere Zukunft, wir schlagen einen anderen Weg ein. Welchen Weg du gehen wirst, weiß ich nicht, ich weiß nur, für welchen Weg du … Nein, ich muss es anders ausdrücken, sonst klingt es so, als sei es schon festgelegt: Ich, Saweg, glaube, den Weg zu kennen, den du einschlagen solltest. Denn ich glaube, dass du für etwas ganz Bestimmtes vorgesehen bist.“
„Was? Wofür bin ich bestimmt?“ Er hörte selbst, wie heiser seine Stimme klang.
„Darauf werde ich dir nicht antworten. Eines Tages vielleicht, aber ganz sicher nicht heute. Was immer du aus deinem Leben machst, es ist deine Entscheidung.“, kam es entschieden.
„Wenn es kurzsichtig ist, zu bleiben, sollte ich also von hier fortgehen?“
Sawegs Augen wurden schmal und er beugte sich vor.
„Weshalb nur hörst du niemals zu? Ich sagte lediglich, dass es ehrenwert ist, in die Fußstapfen seines Vaters treten zu wollen, aber dass es kurzsichtig sein kann, ein Fortgehen von vornherein auszuschließen! So, und jetzt sag mir, wie du entscheiden würdest, wenn du entscheiden dürftest!“, forderte er eindringlich. „Was wäre für alle die derzeit beste Lösung, Schettal?“
Er runzelte die Stirn und versuchte angestrengt, in Sawegs Augen die Antwort zu finden – vergebens. Also wandte er den Kopf und sah wieder in die Flammen.
„Shebmog soll gehen, ihn zieht es in die Fremde. Das ist das, was er will. Mutter soll Kysom abweisen und warten, was das nächste Jahr bringt. Und ich werde bleiben, zumindest vorerst. Shebmogs Beitrag zu unserer Versorgung ist … unzureichend und ohne ihn haben wir schon einen Esser weniger zu ernähren. Ich werde meine Bemühungen bei der Jagd verdoppeln und umso härter auf dem Feld arbeiten. Wir werden es nicht leicht haben, aber wir werden es schaffen.“
„Gut. Sag ihr das.“
„Sie wird nicht auf mich hören.“, schnaubte er.
„Mag sein, aber einen Versuch ist es wert. Was, wenn ihre Wünsche die gleichen sind wie deine? Und wenn nicht: Vielleicht hört sie ja auf mich! Sag ihr also auch, dass du das mit mir besprochen hast.“, forderte er nachdrücklich.
Skeptisch runzelte er die Stirn.
„Und wenn mein Rat falsch ist?“
„Ein Vorschlag ist immer nur ein Vorschlag, ein Weg ist immer nur ein Weg. Wenn er sich als falsch erweist, ändert man die Richtung.“
„Und wenn es zu spät ist, die Richtung zu ändern?“
„Es ist selten zu spät, Junge. Und noch hast du gar keine Richtung eingeschlagen, oder?“, war alles, was er darauf erwiderte, während seine Miene reglos blieb. Dann deutete er auf seine Hand mit dem Becher, meinte, er solle austrinken und fortan so oft es seine Zeit zulasse bei ihm vorbeisehen.
Die Frage nach dem Warum lag ihm schon auf der Zunge, doch er schluckte sie herunter, trank gehorsam den noch warmen Tee aus und warf sich dann seinen Umhang wieder über.
Das kommende Jahr würde offenbar vielerlei Veränderungen mit sich bringen. So oder so.
Im darauffolgenden Sommer …
Er war todmüde und fühlte sich wie zerschlagen. Alles tat ihm weh, seine Muskeln brannten, die Blasen an den Händen wollten sich schon gar nicht mehr schließen, geschweige denn, zu Schwielen werden, und die Sonne, die auch heute unbarmherzig vom Himmel gebrannt hatte, hatte ihm trotz seiner längst gebräunten Haut die eine oder andere Stelle leicht gerötet.
Das kühle Wasser des Flusses tat weh, als er sich nach getaner Arbeit darin wusch und zuletzt ganz untertauchte. Die am Morgen vorsorglich mitgenommenen frischen Kleidungsstücke klebten anschließend unangenehm auf Schultern und Rücken, bevor es langsam besser wurde.
Seinen Durst hatte er gelöscht, doch sein Magen knurrte vernehmlich. Dennoch missachtete er wie jeden Abend die Aufforderung seines Muttersvaters, mitzukommen und gleich nach Hause zu gehen. Und wie jedes Mal entging ihm keineswegs dessen missbilligender Gesichtsausdruck, wenn er erklärte, dass Saweg schon auf ihn warte.
Heute warf Vorogh auf diese Erwiderung hin sogar wütend sein getragenes Hemd auf den Boden.
„Es missfällt mir, dass du ständig bei diesem einfältigen Alten herumlungerst, Schettal!“, hob er die St imme – was nun auch die Aufmerksamkeit seines Vatersbruders Reweg weckte. Dieser hatte sich soeben seine zweite Hose über die nackten Beine gezogen und hielt jetzt inne, um ihnen den Kopf zuzuwe nden. Schweigend, wie meist.
„Mutter weiß Bescheid, ich habe ihre Erlaubnis.“, rollte er seine schmutzigen und verschwitzten Sachen zusammen und klemmte sie unter den Arm. Bis morgen würden sie gewaschen und getrocknet sein – Aufgabe seiner Schwester.
„So? Mag sein! Mag sein, dass deine Mutter weiter an ihrem irrigen Glauben festhalten will, aber noch habe ich als der Älteste der Familie ein Wort mitzureden! Solange sie sich keinen neuen Mann sucht jedenfalls! Und ich habe etwas dagegen, dass du fast jeden Abend in Sawegs stinkender Hütte hockst und er dir deinen Kopf mit irgendwelchem Unsinn vollstopft!
Das hier ist, was du lernen und schaffen musst, wenn ihr überleben wollt! Du wolltest die Verantwortung für dich, Nitres und deine beiden Schwestern übernehmen? Dann tu das gefälligst! Das Feld beackert sich nicht von selbst, Ernten bringen sich nicht alleine ein und abends gehörst du nach Hause, wo du allenfalls deiner Mutter bei deren schweren Arbeiten noch zur Hand zu gehen hast!
Noch bist du nur ein unbedarfter Junge, kein Mann, und nicht in der Lage, euch ausreichend zu ernähren. Wenn Reweg und ich auch weiterhin zusätzlich zu unserer eigenen Arbeit helfen sollen“, machte er eine ausholende Handbewegung in Richtung des heute mit viel Schweiß abgemähten Getreidefeldes und den sorgfältig aufgestellten Garben, „dann hast du dich fortan nach meinem Wort zu richten! Hast du das verstanden?“
Er holte tief Luft, ignorierte seinen schmerzenden Rücken, als er sich bewusst gerade aufrichtete, und hielt Voroghs Blick stand. Die Entschlossenheit und Ruhe, die er so auszustrahlen hoffte, erfüllte ihn dabei jedoch in keiner Weise. Der Moment, für den er sich schon lange die Worte zurechtgelegt hatte, war gekommen.
„Ich weiß durchaus, wie sehr ich … wie sehr wir euch zu Dank verpflichtet sind, und ich weiß ebenfalls, dass wir auch noch weiterhin auf eure Hilfe angewiesen sind. Doch für mich ist Mutters Wort maßgebend. Abgesehen davon zähle ich seit drei Tagen dreizehn Sommer und auch wenn noch zwei Sommer fehlen, bis ich als Mann gelte, bin ich unseren Regeln und Sitten gemäß alt genug, um solche Entscheidungen selbst treffen zu dürfen. Und ich habe mich entschieden: Saweg bringt mir alles bei, was er über die Geschichte unserer Gemeinschaft und unsere Vorfahren weiß – und über die Geister. All die alten Überlieferungen, die alte Sprache und all das alte Wissen, das sonst mit ihm sterben würde, weil es niemanden mehr interessiert. Jedenfalls nicht genug interessiert, um es bewahren und weitergeben zu wollen.
Du magst dich seit dem Tod deiner Frau und Vaters Tod von den Geistern abgekehrt haben, aber das bedeutet nicht, dass sie deshalb nicht doch mit dir sind. Ich glaube fest an ihre Führung und ihren Beistand und ich werde von Saweg lernen, solange er bereit ist, sein Wissen mit mir zu teilen!
Solltest du das als Respektlosigkeit dir gegenüber werten, bedauere ich dies aufrichtig und aus tiefstem Herzen, doch es wird nichts an meinem Entschluss ändern. Meine Arbeit wird wie bisher nicht darunter leiden! Ich bin jung, gesund und kräftig genug, um mit wenig Schlaf und Erholung auszukommen. Ich danke also für eure großherzige Hilfe, auf die ich auch weiterhin hoffe, doch jetzt werde ich aufbrechen, um zeitig genug zu Hause zu sein; die dortige Arbeit kann ich auch bei Nacht noch erledigen. Schon jetzt eine erholsame Nacht, Vorogh. Und auch dir, Reweg.“
Eine Zornesader schwoll an Voroghs Schläfe an und die Sehnen an seinen kräftigen Armen traten hervor, als er die Hände zu Fäusten ballte und auf ihn zutrat. Dann aber war es Reweg, der ihn am Arm festhielt – was beide gleichermaßen mit einiger Verwunderung registrierten.
„Lass ihn gehen, Zweitvater. Nicht an die Geister zu glauben oder sie, die möglicherweise doch existieren, auch noch zu verärgern, sind zwei verschiedene Dinge. Was schadet es schon? Soll er doch Sawegs langweiligen Geschichten lauschen und bis in die Nacht arbeiten …“
Vorogh schüttelte unwillig Rewegs Hand ab, er jedoch wartete nicht auf eine weitere Reaktion, sondern wandte sich ab, um mit weit ausgreifenden Schritten loszumarschieren.
Er, Schettal, war todmüde und alles tat ihm weh, doch je länger er Sawegs Sertet war, sein Lernender, desto mehr fesselte ihn, was dieser ihm beibrachte.
Es war schon fast dunkel, als er die Tür der Hütte aufstieß. Sie saß mit der Handspindel in der Hand auf der Bank und sah nur kurz auf, um den Faden nicht abreißen zu lassen. Seine Schwestern schliefen schon oben in ihrem kleinen Winkel unter dem Dach, sie war alleine.
„Es wird jedes Mal später!“, empfing sie ihn und gab der Spindel einen neuen Schwung. „Auf dem Herd steht kalter Brei und etwas Brot und Speck sind auch noch da. Iss etwas, dann geh schlafen.“
„Essen? Nur zu gerne! Aber danach werde ich noch Holz spalten wie versprochen. Ich halte ein gegebenes Wort.“
Sie ließ die Hände sinken und musterte ihn. Er war in den letzten Monaten ein deutliches Stück in die Höhe geschossen, wirkte hager und die Müdigkeit in seinem Gesicht sprang sie an wie ein wildes Tier. Er schlief zu wenig, arbeitete zu hart und forderte zu viel von sich. Seit Shebmog mit Beginn der Schneeschmelze das Haus verlassen hatte, erledigte er neben der Jagd und dem Fallenstellen alleine fast alle schwere Arbeit, auch wenn ihr Vater ihnen nach wie vor auf den Feldern half. Und ganz gleich wie zunehmend sehnig Schettal wurde, wie seine Muskeln von Woche zu Woche kräftiger hervortraten und wie sonnengebräunt er inzwischen auch war, all das verbarg nicht seine Erschöpfung, nicht die dunklen Schatten unter seinen Augen. Und sie fragte sich zum sicher hundertsten Mal, ob es richtig gewesen war, nachzugeben!
„Das habe ich schon erledigt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Axt in die Hand nehme, Schettal. Also iss etwas und dann …“
„Ich möchte nicht, dass du meine Arbeit übernimmst, du hast selbst genug zu tun!“, unterbrach er sie verärgert und legte seine schmutzigen Kleidungsstücke neben der Tür ab. Da seine Schwestern schon schliefen, würde er morgen wohl wieder nur in seinem Schurz arbeiten, um seine letzte, saubere Kleidung zu schonen. Es war Zeit, ihm eine der noch verbliebenen ledernen Hosen und ein Hemd seines Vaters zu geben, er war ohnehin bald so groß wie dieser, auch wenn sie noch an ihm herabhängen würden. Sie sah zu, wie er an den Herd trat, um sich eine gehörige Portion des steif gewordenen Breis in eine Schale zu klatschen, und hörte, wie er weitersprach: „Ich hätte durchaus im Licht der Laterne noch eine Stunde …“
„Shebmog ist verschwunden.“, fiel sie ihm ins Wort. Anders würde sie seinen Protest nicht ersticken können und früher oder später musste er es ohnehin erfahren. Besser von ihr als von ihrem Vater!
Er ließ den vollen Löffel sinken, den er sich auf dem Weg zum Tisch schon in den Mund hatte schieben wollen.
„Was meinst du damit, er ist verschwunden?“, kam es entgeistert.
„Damit meine ich, dass er vor knapp vier Wochen des Nachts davongeschlichen ist. Er hat seine wenigen Habseligkeiten gepackt und ist verschwunden, hat Gruff zudem noch bestohlen, indem er Vorräte nahm und gleich mehrere Kupferstücke sowie zwei seiner Wurfmesser.“
„Was? Was hat er sich dabei gedacht? Wohin ist er gegangen? Was sagt Gruff dazu?“
Sie registrierte durchaus, dass auch er sich weniger um Shebmogs Sicherheit sorgte als vielmehr darum, dass dieser ihrer aller Zukunft riskierte, indem er verschwand und seine Sippe bedenkenlos im Stich ließ. Sie selbst war zu ihrer eigenen Verwunderung weitaus weniger überrascht von dieser Nachricht. Verwundert über ihre mangelnde Verwunderung war sie dieser Überlegung gedanklich nachgegangen … und hatte sich endlich eingestanden, dass ihr Erstgeborener damit letztlich nur ein weiteres Mal sein wahres Wesen gezeigt hatte. Shebmog hatte sich stets nur für sich selbst interessiert, war schon immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht und so manche Seite an ihm hatte sie mit den Jahren mit beklemmender Furcht erfüllt. Das Gefühl der Erleichterung hingegen beschämte sie dennoch und so beruhigte sie sich damit, dass Shebmog alt genug war, um selbst auf sich aufzupassen. Doch ihrem zweiten Sohn diese zusätzliche Sorge aufzubürden fügte ihr einen körperlich spürbaren Schmerz zu. Weitere Jahre, in denen er das schwere Joch, der alleinige Ernährer von Mutter und Schwestern sein zu müssen, zu tragen hatte. Doch den brutalen Kysom in ihr Bett zu holen erfüllte sie nach wie vor mit Grauen …
„Mutter?“, holte er sie aus ihren Gedanken zurück.
„Gruff hat getobt. Erst habe er sich wider besseren Wissens dazu überreden lassen, Shebmog aufzunehmen und ihm sein Können beizubringen, dann habe der ihm von Anfang an nur Schwierigkeiten bereitet und jetzt das! Shebmog ist fort. Und niemand weiß, wohin er verschwunden ist.“
„Vier Wochen!“, dehnte er und ließ sich schwer auf den Hocker fallen. „Seit wann weißt du es?“
„Gruff war erst heute Mittag hier. Er hat gewartet, ob Shebmog zurückkommen würde, weil er unsere Lage kennt und eurem Vater freundschaftlich verbunden war. Nachdem aber ein ganzer Mondmonat ins Land gegangen ist … Hätte Shebmog nach Hause zurückkehren wollen, wäre er längst wieder hier und würde dir Arbeit abnehmen. So aber fehlt jede Spur von ihm. Und jede Nachricht über seinen Verbleib …“
Die Sorge stand ihr ins Gesicht geschrieben, aber dahinter lag auch noch etwas anderes: Ärger. Verbitterung. Enttäuschung. Und verbunden mit nicht unerheblichen Selbstvorwürfen und Angst auch eine Art bange Hoffnung, dass er nicht wiederkehren würde! Letzteres teilte er mit ihr, denn auch wenn Shebmog sein Bruder war, war da etwas in ihm, das sie alle zuletzt immer wieder beklommen vor ihm zurückweichen ließ.
„Waffenschmied zu werden war das, was er wollte und Gruff hätte ihm zumindest die Herstellung und Bearbeitung von Kupfer beigebracht!“, murmelte er dennoch mehr zu sich selbst. „Wieso gibt er diesen Wunsch auf? Was in aller Welt hat ihn geritten, …“ „Wenn ich das wüsste, wäre ich klüger!“, schnaubte sie, packte ihre Arbeit zur Seite und nahm nach kurzem Zögern ihm gegenüber am Tisch Platz.
„Shebmog kann auf sich aufpassen, ihm wird nichts passieren.“, betonte er sofort. „Er wird sich bald besinnen und sich melden, entweder hier oder bei Gruff.“
Er log sie an und konnte kaum ihrem Blick standhalten. Wenn er seit vier Wochen schon fort war, war er auf dem Weg in den Süden. Ihm hatte es nicht genügt, in einer der nicht weit entfernt gelegenen Siedlung zu leben und die Erzschmelze zu erlernen.
„Was das Erste angeht, stimme ich dir zu. Shebmog zieht das Unheil jedoch an wie das Licht die Motten und ich habe noch nie verstanden, was in seinem Kopf vorgeht. Aber melden? Nein. Was immer er vorhat, er wird sich nicht melden. Und offenbar war es ihm nicht genug, die Arbeit eines einfachen Schmieds wie Gruff zu erlernen. … Iss endlich, es ist spät!“
Gehorsam schob er sich einen ersten Löffel Brei in den Mund.
„Du machst dir keine Sorgen um ihn?“, fragte er zwischen zwei Löffeln vorsichtig.
Sie runzelte die Stirn, dann zuckte sie unschlüssig die Schultern.
„Ich werde niemals damit aufhören, mir um jeden von euch Sorgen zu machen. Aber was Shebmog angeht, war mir schon sehr früh klar, dass er seinen Platz nicht hier finden würde. Nicht hier in Hannan, nicht in unserem Dorf, nicht in dieser Gegend und schon gar nicht in unserer Sippe, ihn bindet nicht das gleiche Band an uns wie wir es fühlen. Ihn hält hier nichts, hat es nie. Also ja, ich sorge mich, aber weit weniger, als ich als seine Mutter wohl sollte. Ich wusste tief in mir längst, dass es so kommen musste. Wo immer er ist, er wollte es so und es kehrt ihn nicht, dass wir davon erfahren. Also werde ich die Geister bitten, auf ihn zu achten, mehr kann ich nicht tun. Ich bin es müde, ihn ändern zu wollen.“, gab sie zu.
Unheil, ja. Shebmog zog das Unheil nicht nur an, er forderte es heraus. Und wenn er zudem jetzt zum Dieb geworden war, noch dazu von weiteren Wurfmessern …
Nur zu deutlich waren ihm die vielen, sich häufenden Begebenheiten im Gedächtnis, wenn sein älterer Bruder wieder einmal das Werfen und Zielen übte. Wie oft hatte er mit Absicht nur knapp an ihm, an irgendeinem Kind, einem Hund, einer Katze oder was immer sich anbot, vorbeigeworfen. Und mehr als einmal hatte er bewiesen, wie ungemein zielsicher und präzise er tatsächlich zu treffen imstande war, denn so manches Eichhörnchen, so mancher Vogel war auf diese Weise von ihm erlegt worden. Nicht aus Hunger, sondern ganz einfach, weil sie ihm im rechten Moment ins Auge fielen, weil sie leichtsinnig genug gewesen waren, Shebmog über den Weg zu laufen oder zu flattern. Und was dann jedes Mal in seinen Augen stand, hatte ihm zuletzt ein unheilvolles, beunruhigendes Kältegefühl beschert. Unheil, ja.
Schweigend löffelte er weiter, füllte sich dann noch eine zweite Portion ein und verschmähte zuletzt auch nicht ein großes Brotstück mit einem ähnlich großen Stück Wildschweinspeck. Und nachdem er alles mit zwei Bechern Wasser heruntergespült hatte, musterte er seine Mutter forschend.
„Und ich?“
Sie schien aus irgendwelchen Gedanken aufzutauchen.
„Was, und du?“
„Hättest du mich ebenfalls gerne anders? Würdest du mich auch ändern wollen?“
Sie konnte gar nicht erstaunter dreinschauen!
„Warum fragst du das? Habe ich je den Eindruck erweckt, dass es so sein könnte?“
Er unterdrückte ein Gähnen und schüttelte den Kopf.
„Nein.“
„Weshalb dann? Es muss doch einen Grund geben für deine Frage!“
„Vorogh.“
„Vater!“, nickte sie begreifend. Dann überlegte sie kurz und begegnete wieder seinem Blick. „Vater ist ein harter, unnachgiebiger Mann, der sich noch nie gut mit irgendwelchen Schicksalsschlägen abfinden konnte. Was immer geschah, er gab den Geistern die Schuld. Ich habe ebenfalls so manches Mal an ihnen gezweifelt, aber es ging nie so weit, dass ich sie verleugnet oder mich von ihnen abgekehrt hätte.
Ich bin dankbar dafür, dass du ihren Weg beschreitest, Schettal, und dass du meinen Glauben an sie teilst. Was Vater nicht wahrhaben will, ist, dass immer noch die überwiegen de Anzahl an Menschen hier ebenso fest an sie glauben wie wir.“
Er nickte. Er hatte seine Antwort.
„Ich habe Vorogh heute die Stirn geboten, Mutter. Wir sollten damit rechnen, dass er uns über kurz oder lang seine helfende Hand nicht mehr zu reichen gewillt ist.“
Sie hob das Kinn und streckte den Rücken durch.
„Verstehe. Nun, dann werden wir eben ohne ihn auskommen! Deine Schwestern sind inzwischen alt genug, dir bei der einen oder anderen Arbeit auf dem Feld zu helfen. Und ich bin nicht so ungeschickt, dass ich nicht das Aufstellen und Kontrollieren der Fallen übernehmen könnte.“
„Dann bleibst du dabei, dass ich des Abends zu Saweg gehe?“
„Natürlich! Saweg mag langsam zu alt sein, um den Menschen hier noch eine wirkliche Brücke zu den Geistern sein zu können, aber sein Wissen ist vielfältig, weitreichend und kostbar und seine Weisheit ist groß. Was immer er dir beibringen kann, es sollte bewahrt werden. Lerne von ihm, Schettal. Und lass Vorogh meine Sorge sein.“
Er erhob sich, trug Schale und Teller fort und wandte sich ihr dann wieder zu.
„Ich möchte in Sawegs Fußstapfen treten, Mutter! Ich weiß nicht, ob er mich dessen überhaupt für würdig befindet, aber ein anderer findet sich weit und breit nicht und ich könnte den Menschen hier irgendwann wenigstens mit meinem Rat dienen. Ich bin weit davon entfernt, wie er eine Brücke darzustellen, aber …“
Er zögerte, dann gab er sich einen Ruck. „Da ist etwas in mir, ein … Gefühl … Es sagt mir, dass ich weitermachen soll. Ich soll nicht aufgeben. Und ich werde nicht aufgeben.“
Ihre Augen wurden groß.
„Hast du das mit Saweg besprochen?“
Er verneinte.
„Noch nicht. Ich wollte damit warten, bis ich in den Augen aller und nach unseren Regeln und Sitten als erwachsen gelte. Noch bin ich ein Junge, allenfalls zu gewissen Entscheidungen berechtigt, die meine eigenen Wünsche betreffen, und noch sieht auch Saweg nicht mehr in mir als das. Aber in zwei Jahren, wenn ich fünfzehn Sonnenjahre zähle und das sechzehnte beginne …
Gibst du mir deine Einwilligung und deinen Segen? Ich verspreche, ich werde härter arbeiten denn je und niemals meine Arbeit darunter leiden lassen! Dir, Mena und Tista, wird es an nichts mangeln.“
Sie erhob sich langsam und atmete einmal tief durch.
„Du hast beides, wie auch unsere Unterstützung. Und es würde mich wundern, wenn Saweg anders denkt.“
Neriba, weit entfernt im Süden, fünf Jahre später
„Shereata? Wo bist du? Es ist Zeit!“
Ich zwängte meinen Arm noch etwas weiter durch den Spalt zwischen den beiden rauen Brettern hindurch. Auf keinen Fall würde ich ohne meinen Anhängergehen, den Tog – nur um mich wieder einmal zu ärgern – vor wenigen Augenblicken hohnlächelnd über das Gatter in den Schweinepferch geworfen hatte. Pech für ihn und Glück für mich: Er war dicht vor der Bretterwand des Windschutzes im Matsch gelandet und mit ein wenig Anstrengung würde ich ihn erreichen. Meine Fingerspitzen ertasteten schon die Schnur, aber der Spalt war zu eng, um meinen Arm bis ganz zur Schulter vorschieben zu können. Und durch ein Astloch in Augenhöhe sah ich schon den gewaltigen, borstigen Eber auf mich aufmerksam werden. Er sollte dieser Tage ein paar Sauen besteigen und es war nicht angeraten, sich mit ihm anzulegen!
„Shereata! Antworte gefälligst!“, ertönte der erneute Ruf meiner Mutter.
Jetzt zu rufen wäre fatal, also schob ich verbissen meinen Arm noch weiter vor, was meine Haut nun endgültig aufscheuerte. Das Schnauben und Grunzen wurde lauter und jeden Moment würde dieser stinkende Fleischberg herankommen … Da! Ich fühlte die Schnur zwischen den Spitzen von Zeige- und Mittelfinger, presste sie so fest wie möglich zusammen und zog …
„Bei allen Göttern! Bist du wahnsinnig geworden oder lebensmüde? Du solltest alt genug sein, um zu wissen, dass ein Eber deinen Arm ohne jede Mühe zerquetschen oder sogar abreißen könnte!“ Ich landete der Länge nach auf dem Boden und ein paar nasse, stinkende Matschklümpchen spritzten auf mein Gesicht und das bis vorhin noch saubere Kleid. Mutter hatte mich mit einem einzigen Ruck zurückgezogen, doch ich hatte es geschafft: An der dreckigen Schnur baumelte mein völlig verschmutzter Anhänger und Tog, der an die Ecke gelehnt feixend zugesehen hatte, verzog enttäuscht das Gesicht, dann wandte er sich ab und verschwand eiligst.
„Ich hab ihn! Ich wasche ihn nur schnell ab, dann können wir …“
Ihre Ohrfeige kam unerwartet und fast wäre ich erneut hingefallen.
„Du riskierst Leib und Leben wegen eines dummen Anhängers?“, schrie sie mich aufgebracht an.
„Nicht Leib und Leben, ich konnte den Eber sehen und hätte meinen Arm schon rechtzeitig wieder herausgezogen!“, widersprach ich und rieb meine brennende Wange. Glücklicherweise mit der sauberen Hand.
„Und wenn er in dem Spalt steckengeblieben wäre? Dieses Monstrum da drin verspeist jemanden wie dich innerhalb kürzester Zeit! Es braucht drei erwachsene Männer, ihn im Zaum zu halten!“, hob sie die Hand erneut. Ich duckte mich sofort, doch der Schlag blieb aus. Sie deutete lediglich auf unser Haus. „Verschwinde! Geh, wasch dich und geh dann für den Rest des Tages deiner Tante zur Hand! Für dich ist der Gang zum Handelsplatz gestrichen! Dummheit wie deine gehört bestraft!“
„Was? Nein, Mutter, bitte! Ich …“
„Hast du nicht gehört? Hast du nicht verstanden? Geh mir aus den Augen! Und bete darum, dass ich mir nicht noch eine weitere Strafe für dich ausdenke! Verschwinde!“
Gekränkt und enttäuscht wirbelte ich herum und rannte los, direkt auf den Wassertrog zu, über den ich mich beugte und hastig alle Spuren des Matsches zu beseitigen versuchte. Ich musste mehrmals heftig blinzeln, um meine Tränen zu unterdrücken, dann klärte sich das Bild wieder und als ich aufsah und den Kopf drehte, sah ich gerade noch, wie Mutter, Tog, meine ältere Schwester Nia und deren Mann Zeret mit dem vollgeladenen Wagen davonfuhren. Die Dämmerung wich längst dem Tageslicht und sie trieben die beiden Pferde zur Eile an, um die verlorene Zeit aufzuholen.
Tog war der Sohn meines Onkels und er konnte mich nicht leiden. Es war seine Absicht gewesen, mich in Schwierigkeiten zu bringen, und jeder Ärger, den er mir bereiten konnte, erfüllte ihn mit Genugtuung. Er hatte genau gewusst, wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, heute mit zum großen Markt zu gehen, wo sich seit ein paar Jahren noch aus weiter Entfernung kommende Menschen trafen, die alle ihre mitgebrachten Waren verkauften oder tauschten, darunter auch reisende Händler mit seltenen Dingen. Wir hatten den ganzen Winter über eifrig gesponnen und gewebt und die fertigen Stoffe waren in vielen kräftigen Farben gefärbt, würden gewiss etliche Kupferstücke einbringen. Oder einen guten Tausch! Bestimmt hätte ich mir ebenfalls etwas aussuchen dürfen. Eine Spange womöglich für meine Haare. Oder einen neuen Hornkamm, nachdem mein alter halb durchgebrochen war.
Unsere Nachbarin trat aus ihrem Haus und warf mir einen prüfenden Blick zu. Rasch drehte ich mich um und lief auf unser großes Langhaus zu, in dem ich meine Tante vermutete.
Wir waren zurzeit zwanzig Personen und erst letzten Monat hatten wir eine leichte Trennwand aus geflochtener Weide eingeschoben, um Nia und Zeret ein wenig eigenen Raum zu geben. Sie waren erst seit sechs Wochen verbunden und wohnten einander Nacht für Nacht eifrig bei, oft genug sogar mehr als einmal. Etwas, was diesmal sogar meine Tante zum Schmunzeln brachte – und etwas, das Tog nur zu gerne heimlich beobachtete.
Als ich Geshia in ihrem Teil des Hauses entdeckte – gleich hinter meinem Schlafplatz, den ich mir bis vor Kurzem mit Nia geteilt hatte – sah sie auf und musterte mich. Offenbar hatte sie sich eben erst erhoben, denn sie zog noch ihr Kleid zurecht.
„Shereata? Solltest du nicht längst mit den anderen auf dem Weg sein?“, nahm sie noch einmal Platz.
Ich schwieg, kniete hinter ihr nieder und begann damit, ihre Haare zu entwirren.
„Keine Antwort? Was ist los?“, hakte sie nach und reichte mir ihren Kamm, an dem nur ein einziger Zinken fehlte.
„Nichts.“, dehnte ich. „Ich soll dir heute helfen.“
„Nichts? Du hast dich seit Wochen darauf gefreut!“
Mein Onkel, Togs Vater, kam herein, sein muskelbepackter Oberkörper glänzte noch nass vom Wasser. Er nickte uns lediglich zu, warf sein ledernes Hemd über und verschwand sofort wieder.
Unbeirrt kämmte ich weiter, dann flocht ich einen festen Zopf und wand das dunkelgrüne Lederband mehrfach um dessen unteres Ende, bevor ich es zuband. Ich würde Tog nicht verraten, denn das würde ihm wiederum die Genugtuung verschaffen, mich eine Verräterin zu nennen und umso mehr zu ärgern.
„Also?“
„Ich war so dumm und habe sie warten lassen. Also sind sie ohne mich gegangen.“, erwiderte ich knapp.
Sie drehte den Kopf und wandte sich mir dann vollends zu.
„Und woher stammt dann der Handabdruck auf deiner linken Wange?“
„Mutter war wütend, weil ich dem Eber zu nahe gekommen bin.“
„Dem Eber! Du sprichst von dem Koloss aus der Kethena-Siedlung, der unsere leeren Sauen decken soll?“
Ich murmelte etwas Unverständliches, dann wechselte ich eiligst das Thema: „Möchtest du etwas essen? Wir haben noch etwas übrig von heute früh, ich kann es dir holen …“
„Offenbar willst du nicht mit der Sprache heraus. Na gut, wie du meinst, lenken wir also vom Inhalt meiner Frage ab: Ja, ich hätte gerne etwas. Ich habe gestern Abend nicht viel gegessen und bin entsprechend hungrig. Hungriger als gewöhnlich, denn es könnte sein, dass ich noch einmal ein Kind erwarte. Dein Onkel hat offenbar noch immer nicht genug davon, nachts mein Lager zu teilen. Entweder bin ich schwanger oder ich habe das Alter erreicht, in dem ich keine Kinder mehr empfangen kann. Wir werden es abwarten müssen!“, lächelte sie mich breit an – was wiederum mir ein Lächeln entlockte.
Oh ja, Tobat schien es gerade jüngst wieder darauf anzulegen, sich mit dem bedeutend jüngeren Zeret zu messen. Erst letzte Nacht hatte ich das leise Seufzen und die eindeutigen Geräusche auf der anderen Seite der Wand aus Weidenruten hören können. Und als ich mich umgedreht hatte, um weiterschlafen zu können, hatte der Schein des winzigen Talglichts den Schatten meiner Schwester an die Schräge des Daches geworfen, die offenbar rittlings auf Zeret saß – ebenfalls eindeutig beschäftigt.
„Du bist noch nicht alt genug, um die Monatsblutung nicht mehr zu bekommen. Und ich würde mich freuen, auf ein kleines Mädchen aufpassen zu dürfen!“
Ihr Lächeln wurde noch etwas breiter, dann erhob sie sich und zog mich mit sich hoch.
„Ein Mädchen, hm? Shereata, ich weiß sehr wohl, dass Tog dir das Leben schwermacht. Tobat wird ihn daher heute ein letztes Mal warnen. Es ist eine Sache, wenn Kinder sich streiten, eine gänzlich andere jedoch, wenn ein heranwachsender junger Mann eine junge Frau ständig in Schwierigkeiten bringt. Oder in Gefahr. Es scheint dir ehrenhaft zu sein, seine Vergehen zu verschweigen, aber er muss lernen, dass auch er Verantwortung zu tragen hat! Was er in letzter Zeit sehen lässt, passt nicht in eine Gemeinschaft, viel weniger in eine Familie! Wenn er sich nicht ändert und am Riemen reißt, wird er unser Haus verlassen und woanders um Aufnahme bitten müssen!“
Ich hielt den Atem an. Das war eine Maßnahme, die eigentlich erst mit dem Eintritt in das Alter eines vollwertigen Erwachsenen nötig wurde. Ihn jetzt schon, mit noch nicht ganz fünfzehn Sommern, wegzuschicken, war eine harte Maßregel. Und noch etwas dämmerte mir…
„Ihr wisst davon? Was er getan hat?“
„Was denkst du?“, erwiderte sie. „Es gibt wenig, was den Bewohnern eines gemeinsamen Hauses verborgen bleibt und seit Togs erstem Verstoß haben wir ein besonderes Auge auf ihn. Insbesondere entgeht uns nicht, wie er den Paaren zusieht, wenn sie einander beiliegen. Oder wie er dich ansieht, wenn du nicht hinsiehst. Oder wie er dir den Anhänger deines Vaters entreißt und in den Schweinepferch wirft.“ Ich schluckte hart, zog ihn über den Kopf und legte ihn auf mein Lager, damit die Lederschnur trocknen konnte. Sie war mir gefolgt und nickte nun.
„Tobat war vorhin draußen, weil ihn das Wasser drückte. Er hat alles mit angesehen und mir davon erzählt, bevor er zum Waschtrog ging. Dich trifft keine Schuld, aber es war in der Tat überaus waghalsig, den Arm durch die Bretterwand zu stecken! Deshalb hielt er sich zwar bereit, ist aber anschließend nicht eingeschritten, du hattest eine Art Strafe für deinen Leichtsinn verdient. Das nächste Mal wartest du, bis ein paar kräftige Männer da sind und du den Pferch gefahrlos betreten kannst! Oder noch besser: Du lässt sie dein Eigentum herausholen! Am Besten wäre natürlich gewesen, wenn Tog es hätte holen und dazu bis an die Knöchel im Schweinemist hätte waten müssen!“, endete sie.
Ich lächelte schief bei dieser Vorstellung und nun lächelte auch sie wieder.
„Gut, dann ist das ja geklärt. Du sollst mir also heute zur Hand gehen? Was würdest du davon halten, wenn wir Wildkräuter und -blumen sammeln gehen? Der Tag heute verspricht wieder warm zu werden und ich würde mich freuen, ihn mit dir zu verbringen! Nehmen wir uns etwas zu Essen mit.“
Das jährliche Händlertreffen war … Nun ja, es war nicht vergessen, aber es war in den Hintergrund gerückt.
Der Tag verging um einiges zu schnell, doch der Nachmittag war kaum halb vorüber, als wir unsere mitgebrachten Körbe und Stoffbeutel schon gefüllt hatten. Wir hatten sie alle unter den frisch begrünten Ästen einer riesigen Eiche gestapelt und nutzten nun die kostbare Zeit der Muße, um an einem nahen Tümpel von einem flachen, im Wasser liegenden Felsen aus unsere Füße in das kühle Nass zu halten.
Anders als mit Mutter konnte ich mich mit Geshia unterhalten wie mit einer gleichwertigen Frau. Gleichwertig im Sinne von gleichaltrig. Zumindest behandelte sie mich so und ihr hatte ich im Laufe der Zeit schon so manches anvertraut, was ich meiner Mutter niemals erzählen würde.
Umgekehrt beantwortete Geshia mir seit jeher jede meiner Fragen mit einer unendlichen Geduld und ohne das geringste Zeichen von gutmütiger Nachsicht. Sie lachte mich niemals aus, belächelte nicht einmal meine teils sicher auch heute noch hin und wieder kindlichen Ansichten.
Sie war es gewesen, die mir vor inzwischen gut zwei Jahren alles erklärte und beschrieb, was zwischen einem Mann und einer Frau stattfand. Mutter hatte dies zwar ebenfalls bereits getan, aber ihr fehlte die Geduld und Nachsicht und sie befand meine weitergehenden Fragen als überflüssig, denn ‚ich lerne ja schließlich auch durch Zuhören und Zusehen‘.
Heute hatte ich Geshia wieder die eine oder andere Frage gestellt, insbesondere in Anbetracht von Nias und Zerets noch so neuer Verbindung.
„Liebe und Leidenschaft, Shereata! Sie ist besonders zu Beginn groß und ich kann dir nur wünschen, dass du einmal einen Mann findest, der rücksichtsvoll und leidenschaftlich zugleich ist! Nichts gleicht dem Erlebnis, wenn es dich am Ende eines Beischlafs mitreißt, nichts erfüllt deinen ganzen Körper derart mit einer Brandung voller Lust wie das! Versage dir dies nicht, aber wähle den Mann, mit dem du dies erleben willst, mit viel Bedacht!“
„Das werde ich.“, erwiderte ich ernst. „Ich wünsche mir nicht weniger als das, was ich zwischen dir und Tobat sehe und das zu erleben, was du mir beschrieben hast.“
Sie schmunzelte, dann erhob sie sich und hob den Saum ihres Kleides höher, um ein paar Schritte weiter etwas tiefer ins Wasser gehen zu können, ohne dass es nass werden würde. Ihre Beine waren wie der Rest ihres Körpers noch immer wohlgeformt und wären auf ihrem Kopf nicht hier und da ein paar erste, weiße Haare und ein paar Fältchen um die Augen und auf der Stirn, wäre sie noch immer als junge Frau durchgegangen.
„Ich möchte so gerne so sein wie du!“, seufzte ich, ohne nachzudenken.
„Wie ich?“, ruckten ihre Augenbrauen hoch. „Wie bin ich denn?“
„Stark!“, versetzte ich mit nicht wenig Neid und noch mehr Bewunderung. „Du bist eine so starke, selbstbestimmte Frau! Andere Frauen ordnen sich ihren Männern meist unter, du aber nicht. Tobat behandelt dich als ebenbürtig. Meistens zumindest und anders als die anderen Männer unserer Sippe ihre Frauen behandeln. Du stehst für das ein, woran du glaubst und für das, was du für richtig hältst. Ich möchte das auch, aber ich weiß nicht, wie ich dahin gelangen soll. Wo hast du gelernt, so zu sein?“
Ihr Lächeln war zusehends kleiner geworden und zuletzt wirkte es fast ein wenig wehmütig. Sie war längst stehengeblieben, watete nun zu mir zurück und ließ sich wieder neben mir nieder, um ihre Beine in der Sonne trocknen zu lassen. Ich zog meine Füße ebenfalls aus dem Wasser und tat es ihr gleich.
„Das Leben ist es, das einen dies lehrt, Shereata! Unsere Mutter war nicht so stark – um bei deiner Bezeichnung zu bleiben. Thaja, deine Mutter, ähnelt ihr weit mehr als ich; erst der Tod eures Vaters hat sie verändert, hat sie hart gemacht. Wenn sie so streng zu dir ist, dann nur deshalb, weil sie auch deinen Vater ersetzen muss. Sie hat ihn sehr geliebt und sie liebt auch dich!“
„Ich weiß. Und ich weiß. Dennoch wünschte ich, ich könnte mit ihr so reden wie mit dir! Nia ist ihr viel ähnlicher.“
Sie seufzte. „Offenbar gibt es nichts Unterschiedlicheres als Geschwister! … Wie auch immer: Was ich bei Mutter sah, war dazu angetan, dass ich es in meinem Leben anders haben wollte. Wo oder wie ich es gelernt habe? Man lernt es, indem man es versucht! Immer und immer wieder, bis es einem in Fleisch und Blut übergegangen ist. Es ist nicht leicht, glaub mir! Weder es zu üben, noch es zu leben. Stark zu sein und einem Mann in allem ebenbürtig bedeutet auch, mehr Verantwortung zu tragen und diese Tag für Tag einzufordern und zu meistern.
Ich kann die Frauen durchaus verstehen, die sich den Männern lieber unterordnen, denn sie geben damit auch die Verantwortung und deren Last ab an Schultern, die mehr tragen können. Ich dagegen wollte gehört werden. Meine Meinung sollte anerkannt werden, mein Wille etwas zählen und meine Entscheidungen sollten genauso schwer wiegen wie die eines Mannes. Vor Tobat gab es zwei andere Männer, die mich gerne an ihre Seite geholt hätten, aber die konnten sich nicht damit abfinden. Sie fühlten sich gekränkt, minderwertig, in ihrer Männlichkeit gestutzt. Ergebnis war, dass sie mich zu unterdrücken versuchten. Es braucht schon einen wirklichen Mann, um mit einer starken Frau leben zu können! Es braucht einen Mann, der sich und anderen nicht ständig seine Männlichkeit beweisen muss, einen, den es nicht kränkt, wenn eine Frau sich als ihm gleichgestellt beweist, der andere nicht kleinmachen muss, um selbst groß dazustehen. Du willst sein wie ich? Nichts könnte mich glücklicher machen! Aber vergiss nie, was ich dir gerade erzählt habe!“
„Das werde ich nicht!“, flüsterte ich ernst.
„Gut. … Ich denke, wir sollten so langsam aufbrechen. Nehmen wir jetzt nur das mit, was wir tragen können, den Rest können die Kinder holen.“
Innerhalb kürzester Zeit hatte ich meine Sandalen wieder an den Füßen und zwei der großen Stoffsäcke geschultert. Sie hob den Tragesack auf den Rücken, zog dessen breiten Riemen quer über die Stirn, nahm zwei der Körbe hoch und marschierte vor mir her den Hang hinauf.
…
Es sollte das letzte Mal sein, dass ich einen Blick zurück und auf diesen Tümpel werfen würde! Und es sollte der letzte Morgen gewesen sein, an dem ich unsere Siedlung gesehen hatte …
Mein Kopf schmerzte höllisch und mein Körper wurde durchgeschüttelt, stieß immer wieder auf eine harte, stinkende Unterlage. Das Licht hinter meinen geschlossenen Lidern schien zu flackern, aber es dauerte eine Ewigkeit, bis ich die Augen einen kleinen Spalt weit öffnen konnte. Jemand stöhnte unablässig und es dauerte erneut einige Zeit, bis ich erkannte, dass ich das war.
„Shereata? Den Geistern sei Dank, du kommst wieder zu dir! Öffne deine Augen, streng dich an!“
Es war Geshias Stimme, die so flehend und eindringlich klang. Dicht an meinem Ohr. Jemand streichelte unablässig meine Wange und ich stöhnte gleich noch einmal laut, als eine Hand meinen Kopf drehte.
„Es tut so weh!“, krächzte ich heiser. „Durst!“
„Hier, trink das. Schön langsam, vergeude nichts!“
Eine fremde Stimme. Etwas Nasses lief über meine Lippen und schnell öffnete ich den Mund und schluckte. Das Wasser schmeckte abgestanden und war warm, aber es linderte die Trockenheit in meiner Mundhöhle.
„Das muss reichen! Wir müssen es einteilen; wer weiß, wann wir wieder etwas bekommen! Jeder nur einen Schluck.“
„Dann bekommt sie meinen Anteil! Sie ist verletzt und braucht es dringender als ich!“, forderte Geshia hart.
„Solange wir nicht wissen, ob sie durchkommt, wird nichts davon verschwendet! Auch du musst deine Kräfte erhalten!“
Ich blinzelte erneut. Die fremde Stimme gehörte offenbar einer etwa gleichaltrigen Frau mit noch roteren Haaren als den meinen. Sie hatte sie zu unzähligen dünnen Zöpfchen geflochten und die daher freie, hohe Stirn war verärgert gerunzelt. Beide maßen sich mit ihren Blicken, dann gewann Geshia.
„Meinetwegen. Aber glaub nicht, dass es jetzt beständig Ausnahmen gibt für euch! Wir sind schon seit zwei Wochen in diesem Gatterwagen eingesperrt und wissen, was kommt. Ihr dagegen seid gestern erst gefangen worden; du tätest dementsprechend gut daran, auf mich zu hören! Mein Name ist Nesabat, ich war unter den ersten Frauen, die sie fingen.“
„Du wirst keine Widerworte von mir hören, Nesabat, aber Shereata ist meine Schwestertochter, ich bin für sie verantwortlich! Gib ihr noch einen Schluck aus dem Kübel, ich trinke erst morgen wieder. Und mein Name ist Geshia.“
Ein weiteres Mal berührte eine hölzerne Kelle meine Lippen und ich trank sie vorsichtig Schluck für Schluck Ieer.
„Geht es jetzt besser?“, fragte Geshia besorgt. Noch immer war ihr Gesicht über mir ein wenig verschwommen.
„Was ist passiert? Wo sind wir?“
Ihre Miene verzog sich. „Du wurdest von einem geschleuderten Stein am Kopf getroffen …“, begann sie zögerlich.
„Menschenfänger.“, kam es sofort von Nesabat. „Wie wir alle seid ihr Menschenfängern in die Hände gefallen. Das hier ist ein Beutezug mit vier inzwischen zum Bersten gefüllten Gatterwagen. Allesamt nur Frauen und Mädchen, die wenigen Jungen und Männer müssen laufen. Wie es aussieht, sind sie auf dem Weg Richtung Küste, mit unbekanntem Ziel. Irgendwohin, wo es anscheinend an Frauen mangelt. Anders können wir uns dieses Verhältnis nicht erklären.“
Mir wurde schlagartig übel und als ich würgte, warf Geshia ihr einen wütenden Blick zu.
„Es hat wenig Sinn, ihr das Offensichtliche zu verschweigen, oder? Ich halte ebenfalls nichts von Beschönigungen. Sie muss sich darauf einstellen, was hier geschieht, das ist ihr bester Schutz – gleiches gilt für dich. … Du hast eine üble Platzwunde am Kopf, Mädchen. Woran erinnerst du dich noch?“
„Wir haben Kräuter gesammelt. Wir wollten gerade nach Hause gehen … Die anderen?“, krächzte ich angstvoll.
Geshia schüttelte den Kopf.
„Sie waren nur zu zweit, Späher vermutlich. Sie waren beritten und haben offenbar nur uns beide aufgegriffen. Unsere Siedlung war immer zu groß und ist seit etlichen Jahren nicht mehr Opfer irgendwelcher wie auch immer gearteter Raubzüge geworden. … Es ist ewig her, seit hier Menschenräuber gewesen sind!“, wandte sie sich wieder an Nesabat.
„Diese Männer sind nicht von hier. Hast du sie dir mal angesehen und angehört? Manche von ihnen haben fremdartige Tataus, dann ihre Sprache …“
„Tataus?“
„Die Ritzzeichnungen in ihrer Haut! Ich kenne diese Zeichen nicht. Ich konnte zudem nur einzelne Worte verstehen und auch nur die von denen, die die Befehle geben. Wenn ich raten sollte, dann werden wir schon sehr bald auf Schiffe verladen. Die Pferde und Wagen werden dann sicher zu weiteren Beutezügen genutzt.“
„Schiffe?“, krächzte ich.