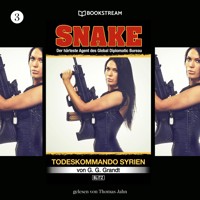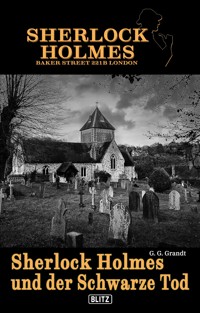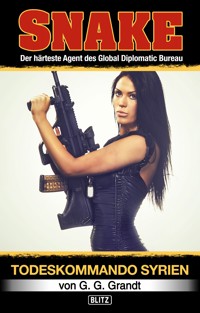Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes (London, Bakerstreet 221b)
- Sprache: Deutsch
September 1903. In London treibt ein Serienkiller, der sich selbst Jack nennt, sein Unwesen. Er hinterlässt rätselhafte Botschaften. Dieser Mörder bringt nicht nur den Tod, sondern auch die Pest. Zusammen mit Dr. Watson und dem deutschen Virologen Dr. Adelbert Meyfried versucht Sherlock Holmes, die sich anbahnende Katastrophe zu verhindern. Doch das Unheil scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SHERLOCK HOLMESBAKER STREET 221B LONDON
In dieser Reihe bisher erschienen
3901 G. G. Grandt Sherlock Holmes und der Zorn Gottes
3902 G. G. Grandt Sherlock Holmes und der Schwarze Tod
G. G. Grandt
SHERLOCK HOLMESBaker Street 221B London
Sherlock Holmes und der Zorn Gottes
Basierend auf den Charakteren vonSir Arthur Conan Doyle
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerLogo: Mario HeyerVignette: iStock.com/neyro2008Satz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-381-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Editorische Notiz:
Die in diesem Roman beschriebene Architektur, Gebäudestruktur und Einrichtung des Buckingham Palace erfuhr in den Jahren der Regentschaft König Edwards VII. (1901 – 1910) eine Modernisierung, die sich bis etwa zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 fortsetzte. Obwohl der vorliegende Roman im Jahr 1904 spielt, handhabt der Autor die Beschreibung des modernisierten Palastes, die sich mitunter mit dem wahren Fortgang der Renovierungsarbeiten überschneidet. Eine bildliche Ausstellung der Leibärzte gibt es allerdings in der Gemäldegalerie nicht, sondern ist – im Gegensatz zu der ansonsten möglichst detailgetreuen Schilderung der übrigen Räumlichkeiten – freie Erfindung. Außerdem wird für den im Handlungsraum regierenden König die britische Namensnennung Edward und nicht die deutsche Eduard verwendet. Der geneigte Leser möge dies nachsehen.
Vorrede von Dr. Watson
Gewiss, in der Eigenschaft als Chronist meines Freundes Sherlock Holmes habe ich schon viele Fälle niedergeschrieben, die kompliziert, entsetzlich, scheinbar unlösbar erschienen oder mitunter fassungslos machten. Allerdings ist die vorliegende Aufzeichnung von eigenem, von persönlichem Grauen der Ereignisse geprägt, die mich sprichwörtlich an den Rand des Todes brachten. Und nicht nur mich. Ein ganzes Stadtviertel versank regelrecht in einer Katastrophe, in Chaos und Aufruhr. Von einem Moment zum anderen galten die errungenen moralischen Eigenschaften der Zivilisation nicht mehr, geschweige denn die Gesetze. Dieser Fall zeigt aber auch erneut den scharfsinnigen Geist meines Freundes auf und das nicht nur in kriminalistischer Hinsicht.
Während ich diese Zeilen zu Papier bringe, zittert die federführende Hand, so dass ich Schwierigkeiten habe, das Gekritzel vernünftig niederzuschreiben. Die Erinnerung an das Geschehen, in dem der Zorn Gottes regelrecht über einen Teil Londons hereinbrach, wird mich mein Leben lang begleiten.
1. Kapitel
September 1903, Whitechapel, Buck’s Row, London.
Verhungern oder sündigen!
Diese drei Worte nisteten noch immer laut und deutlich in Molly Bayhearts Gehörgängen, als wären sie erst gestern ausgesprochen worden. Dabei waren schon fünf Jahre vergangen, seit die harte Stimme ihres dreimal verfluchten Vaters ihr eine Zukunft vorhergesagt hatte, die dem Verweilen in der Hölle gleichkam. Fünf harte entbehrungsreiche Jahre voller geistiger und körperlicher Pein, Hunger, Armut, Hoffnungslosigkeit, ohne echte Liebe. Und das inmitten des verruchten, vor Dreck strotzenden East End mit seinen überbevölkerten Elendsvierteln, in denen es überall vor Flöhen und Ratten nur so wimmelte, mit den öffentlichen Tränken, die sich Mensch und Vieh zum Waschen und Trinken teilen mussten. Dazwischen schlachteten Metzger ihre Schweine auf offener Straße, faulten Berge von Unrat vor sich hin, verrichteten die Ärmsten der Armen ihre Notdurft in den jämmerlichen Latrinen oder Abwasserrinnen. Der strenge und scharfe Geruch von menschlichen Fäkalien und Blut hing fortwährend über den Slums, als wären sie in Wirklichkeit Friedhöfe, die nach verwesenden Leichen stanken.
Angewidert verzog die hochgewachsene, schlanke Frau, die mit ihrer blassen Haut, dem blonden Haar und den erstaunlich blauen Augen fraglos eine Schönheit war, das Gesicht, obwohl ihre Erscheinung genauso vor Schmutz starrte, wie alles um sie herum.
Doch nicht die klägliche Umgebung, die für sie normal war, nötigte sie zu dieser Gefühlsregung, sondern die unsägliche Erinnerung an das unendliche Leid, das sie in ihren jungen Jahren schon erfahren hatte.
Molly trug einen an vielen Stellen zerrissenen Mantel über einem knielangen, speckigen Kleid aus Sackleinen, das sie eng über der üppigen Brust zusammengeschnürt hatte, um ihre weiblichen Reize provozierend zu präsentieren. Dieser hielt jedoch nur ungenügend den steifen, kühlen Wind ab, der durch die Straßen und Gassen des East End wehte und wie unsichtbare Geisterfinger an ihren blonden Haarsträhnen zerrte. Milchig graue Nebelschleier dämpften das Mondlicht wie durch einen gigantischen Wattebausch. Die Giebel der Elendswohnungen waren nur als Schattenrisse zu erkennen.
Der dumpfe Glockenschlag der Turmuhr der Pfarrkirche St. Mary’s schlug zehnmal hintereinander.
Zwei Stunden bis Mitternacht und noch immer war kein Freier in Sicht. Die wenigen heruntergekommenen Männer, die Molly in den engen Gassen begegneten, waren zumeist völlig betrunken und bereits von den Dirnen in den umliegenden Wirtshäusern ausgenommen worden. Doch in diesen Schenken hatte sie selbst Zutrittsverbot, weil sie vor Wochen einem äußerst brutalen Freier mit der Polizei drohte. Das hatte sich schnell herumgesprochen. Von diesem Moment an war sie für die Tavernen-Besitzer schlecht fürs Geschäft. Deshalb musste sie draußen vor den Türen bleiben und sich ihre langen, schlanken Beine wie jede Nacht sprichwörtlich an einer Ecke der Buck’s Row, die sie ganz für sich alleine hatte, in den Bauch stehen. Die schmale Straße verlief durch zweistöckige, vermietete Wohnhäuser und hoch gebaute Lagergebäude.
Verhungern oder sündigen!
Mollys Mutter war bei ihrer Entbindung gestorben. Der Vater hatte sie schon mit dreizehn Jahren auf die Straße geschickt, um aus ihrer Jugend und Frische Kapital zu schlagen. Denn 1885 war ein Gesetz zum Schutze von Kindern erlassen worden, welches besagte, dass ein unziemliches Verhältnis mit einem jüngeren Mädchen als Straftat galt. Der Verkehr eines Erwachsenen mit einem zwischen dreizehn und sechzehn Jahre alten Gör hingegen wurde lediglich als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Mollys Erzeuger hatte zeit seines Lebens ziemlichen Respekt vor der Gerichtsbarkeit gehabt, bevor er mit fünfunddreißig Jahren völlig betrunken von einer Baustelle in den Tod stürzte.
Gedämpfte Schritte, die jetzt auf dem Kopfsteinpflaster aufklangen, rissen sie aus ihren düsteren Erinnerungen. Sie war erfahren genug, um zu wissen, dass das schwergewichtige Klacken der Absätze von Männerschuhen herrührte.
Instinktiv strich sich die blutjunge Frau eine verfilzte blonde Haarsträhne aus der Stirn und setzte ein geschäftsmäßiges Lächeln auf. Durch die Nebelschwaden, die dick wie schmutzige Watte waren, sah sie lediglich einen Schatten.
Und dann ging plötzlich alles blitzschnell!
Noch bevor sie überhaupt einen Schrei ausstoßen konnte, spürte sie die Stiche einer wuchtig geführten Messerklinge in ihrem Oberkörper. Der grelle, pochende Schmerz sprang sie an wie ein wildes Tier. Jäh explodierten tausend Sonnen vor ihren Augen.
Schwer stürzte die junge Frau zu Boden, schlug sich die Knie blutig. Instinktiv riss sie die Arme in die Höhe, allerdings war ihre Gegenwehr kaum nennenswert.
Der Angreifer über ihr hielt nicht inne, stach wieder und wieder zu, so lange, bis die lodernde Korona von Molly Bayhearts Leben zur Größe eines Stecknadelkopfs zusammenschrumpfte.
Und dann war da nur noch der eisige Tod, der sie tief hinabzerrte in sein grausiges, finsteres Reich aus ewiger Pein und Verdammnis ...
Der Crystal Palace war tatsächlich, wie der Name schon besagte, ein Palast! Nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern vor allem wegen seiner architektonischen Einzigartigkeit und seiner baulichen Extravaganz, die seinesgleichen suchte. Er war 1852 auf dem Sydenham Hill im späteren Stadtteil Bromley erbaut worden, nachdem er zuvor im Hyde Park gestanden hatte. Überall fanden sich beeindruckende Glasplattenstrukturen und Gusseisenbauteile, so dass die größte Glasfläche entstand, die jemals in einem Gebäude zu sehen war. Die gigantischen Platten aus billigem, aber starkem Glas an Wänden und Decken machten eine Innenbeleuchtung unnötig. Die Hauptgalerie mit dem vergrößerten und hohen zentralen Querschiff, an deren beiden Enden zwei kleinere Transepte hinzugefügt wurden, war mit einem Tonnengewölbedach bedeckt. Das ursprüngliche Bauwerk, in dem 1851 die Weltausstellung mit mehr als 14.000 Präsentatoren aus der ganzen Welt stattgefunden hatte, war dreimal so groß wie die St.-Pauls-Kathedrale.
„Die sogenannte Beaux-Kunst bezeichnete einen Baustil der École des Beaux-Arts in Paris, die starke Bezüge zur italienischen Renaissance, neobarocken Prachtbauten und neoklassizistischen Bauwerken aufweist“, klärte mich mein Freund und Partner Sherlock Holmes diesbezüglich auf, als wir das gigantische Gebäude betraten. „Die Betonung von Form und Effekt, eine Überdimensionierung in den Proportionen sowie die reiche und exklusive Ausführung zielten einzig auf das Prestige ab und waren dementsprechend wirkmächtig.“
„Ich hatte bislang keine Ahnung, dass Sie in Architektur so versiert sind“, entgegnete ich sichtlich beeindruckt.
Holmes ging nicht darauf ein, sondern stellte mich einmal mehr auf die Probe, während wir gemächlichen Schrittes einem der unzähligen Säle zustrebten.
„Wissen Sie, woher der Name des Crystal Palace herrührt, Watson?“
Ich verneinte wahrheitsgemäß.
„Es wird vermutet, dass dieser aus einem Stück von Douglas Jerrold herstammt“, klärte mich mein Partner auf. „Der Dramatiker schrieb 1850 in einer satirischen Zeitschrift über die bevorstehende große Ausstellung und bezog sich dabei auf einen Palast aus sehr Kristall. Genauso pflegte er sich auszudrücken.“
„Aha“, entfuhr es mir, neuerlich verwundert darüber, dass Holmes, der lediglich ungeheurere Kenntnisse in der Sensationspresse, jedoch gänzlich keine in herkömmlicher Literatur aufwies, dennoch davon wusste. Doch bevor ich dementsprechend nachfragen konnte, betraten wir den Saal, in dem der Internationale Kongress zur Seuchenbekämpfung stattfand. Dieser sollte von neun Uhr in der Frühe bis achtzehn Uhr dauern.
Der Saal war bereits so gut wie voll besetzt. Hätte uns Dr. Adelbert Meyfried nicht Plätze in einer der vordersten Reihen reserviert, müssten wir wohl genauso stehend ausharren wie die anderen Fachbesucher, die dieses Privileg nicht besaßen.
Herzlich begrüßten wir den Wissenschaftler, mit dem Holmes über Jahre hinweg einen Briefkontakt aufgebaut hatte. Jedes Mal, wenn Dr. Meyfried nach London kam, freute er sich, genauso wie wir, auf eine persönliche Begegnung. Auch mich, als stetigen Begleiter und Freund des Detektivs, hatte er zwischenzeitlich wertgeschätzt.
Mit seinem Einfluss ermöglichte er es Holmes, der sich für die Bakteriologie und gleichsam für die noch junge Virologie interessierte, und mir, an diesem Kongress teilzunehmen.
Dr. Meyfried war hochaufgeschossen, überragte mich um annähernd einen Kopf, hager von Statur, mit kurzem Oberkörper, langen Armen und Beinen, schmalen Schultern und dünnen, schwarzen Haaren. Das knochige Gesicht mit den blassen Augen, der Hakennase und dem bleistiftdünnen Mund erinnerte an ein neugieriges Wiesel. Bekleidet war er mit einem fast gänzlich unzerknitterten Gehrock, darunter einem Hemd mit makellosem Kragen und silbernen Manschetten sowie einer hellen Hose. In seinen feingliedrigen Händen hielt er einen gut gepflegten Zylinder.
Dr. Meyfried forschte am Königlich Preußischen Institut für Infektionskrankheiten in Berlin-Wedding. Er war ein Kollege des berühmten Mediziners, Mikrobiologen und Hygienikers Robert Koch, der unter anderem den Erreger der Tuberkulose, also der Schwindsucht, die auch als Weiße Pest bezeichnet wurde, entdeckte.1
Nach der Begrüßung setzten wir uns auf die reservierten Plätze. Die Vortragenden bestanden aus den besten Experten der Bakteriologie und Virologie aus verschiedenen Ländern. Allesamt zeigten sie bisherige, aber auch mögliche Maßnahmen und Anregungen auf, wie man der Ausbreitung von Infektionskrankheiten ohne die vorherrschenden spirituellen Vorstellungen begegnen konnte. Am Ende des Kongresses unterzeichneten Wissenschaftler aus Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und vierzehn weitere Nationen eine Konvention bezüglich gezielter Strategien zur Seuchenbekämpfung. Ein wichtiger Meilenstein vor allem zur Eindämmung der Pest.
Im Anschluss daran fanden wir uns mit Dr. Meyfried in einer der zahlreichen Gaststuben ein, die es im Crystal Palace gab. Dicke Schwaden von Pfeifen- und Zigarettenrauch durchzogen den gut besetzten Schankraum mit der hohen Decke. Zu dritt gesellten wir uns um einen runden Tisch. Während der Virologe ein Ginger Beer bestellte, genehmigten Holmes und ich uns einen Brandy.
Schnell kamen wir auf die vorherrschende Thematik, die uns schon den ganzen Tag über begleitete: die Pest.
Als ehemaliges Mitglied des medizinischen Dienstes der Armee, dem Erwerb des Grades eines Doktors an der Londoner Universität sowie einer Ausbildung zum Militärarzt hatte ich am Rande Erfahrungen mit dieser Plage gemacht.
Einmal, als ich zu den fünften Nordthumberland-Füsilieren nach Indien versetzt wurde, das andere Mal in Afghanistan. Bekanntlich zog ich mir im Sommer 1880 im Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg eine Schussverletzung zu. Das geschah bei der Schlacht in Maiwand, einem Ort in der Provinz Kandahar, den die Berkshire-Einheit, zu der mich meine Brigade abkommandiert hatte, gegen die mörderischen Ghazis führte. Beim anschließenden Krankenhausaufenthalt im Basis-Hospital in Peshawar infizierte ich mich mit Typhus, so dass ich schließlich aus der Armee ausgemustert wurde und nach London zurückkehrte. In diesem Lazarett begegnete ich einigen Pestkranken, die selbstredend isoliert wurden.
„Wissen Sie eigentlich, woher das Wort Pest stammt?“, erkundigte sich Dr. Meyfried, dabei Holmes und mich abwechselnd betrachtend. Doch bevor einer von uns auf diese Frage antworten konnte, fuhr er selbst fort.
„Das Wort Pest kommt aus dem lateinischen pestis. Es bedeutet nichts anderes als Seuche. Deshalb setzten beispielsweise schon um das Jahr 1800 vor Christus die Erzähler des altorientalischen Gilgamesch-Epos bis hin zur Bibel die Pestilenz auch mit Typhus, Fleckfieber, Cholera und selbst mit den Masern gleich. Oft wurde die Beulen- und Lungenpest mit den Schwarzen Pocken verwechselt.“
„Die Pest wird ebenso mit Unglück, Verderben, Qual und Leiden gleichgesetzt“, ergänzte Holmes.
„Persische Ärzte bezeichneten sie mit dem Namen Ta un“, gab ich nun zum Besten, um ebenfalls zu zeigen, dass mir diese Thematik nicht fremd war. Gegenüber meinem Partner besaß ich zumindest dahingehend eine weiterführende Erfahrung mit dieser Seuche, da ich ihr, wie bereits erwähnt, in Indien und in Afghanistan begegnete. Wenn auch, dem Himmel sei Dank, aus der Ferne.
Wir tauschten uns noch eine ganze Weile über den Schwarzen Tod aus.
„Oftmals wird vergessen, dass es zwei verschiedene Arten der Seuche gibt. Zum einen die sogenannte Bubonenpest, also die Beulenpest. Zum anderen die Lungenpest.“
Interessiert beugte sich Holmes zu dem Deutschen vor. „Ich habe davon gehört. Aber welcher Unterschied besteht da genau?“
„Bei der erstgenannten Art bildet sich nach der Infektion eine Nekrose, die sich blau-schwarz verfärbt. Tage später kommt es zu einer Schwellung der regionalen Lymphknoten, die zu eitrigem Aufbrechen neigen. Nach etwa einer Woche folgen rasender Kopfschmerz, Benommenheit, Fieberschübe und allgemeine Erschöpfung, die letztlich zu einer Septikämie ...“
„... einer Blutvergiftung ...“, erklärte ich mehr unabsichtlich.
„... führt. Diese bedeutet fast immer den Tod. Falls eine solche jedoch ausbleibt, sind anhaltende Pusteln, diffuse Lymphknotenschwellungen, die als Pestbeulen bekannt sind, Hautunterblutungen, Verdauungsstörungen, Schwindel, Halluzinationen und psychische Auffälligkeiten typisch. Dementsprechend kann über ein Delirium oder Koma jederzeit noch der Tod eintreten. Sitzen die primär zugehörigen Lymphknoten jedoch tief im Körper, kann der Patient auch ohne sichtbare äußere Symptome sterben.“
„Eine durchaus schreckliche und gottlose Plage“, bemerkte Holmes.
„Warten Sie nur, bis ich Ihnen Details zur Lungenpest ausführe“, entgegnete der Virologe und versenkte sich erneut in sein Fachgebiet, um dieses bis zu einem gewissen Grad vor uns auszubreiten. „Diese Art der Pestilenz ist weitaus bedrohlicher, überträgt sie sich doch wie eine Grippe oder ein herkömmlicher Schnupfen über den Nasen-Rachen-Raum. Die Inkubationszeit ist mit ein bis zwei Tagen auch wesentlich kürzer als bei der Beulenpest und daher gefährlicher und tödlicher. Eine derartige Infektion äußert sich durch Herzrasen, Bluthusten, Atemnot und schließlich durch Erstickung. Dabei kommt es zu einer Nervenlähmung sowie der Zerstörung des Lungengewebes. Mitunter kann das Ende schon nach wenigen Stunden eintreten. Vor allem Alte und Neugeborene, also solche mit einer herabgesetzten Resistenz, einer verminderten Widerstandsfähigkeit, sind von dem Lungenbefall gefährdet.“
Ich trank einen kleinen Schluck Brandy. „Dabei stellen Beulen- und Lungenpest nur verschiedene Verlaufsformen derselben Krankheit dar.“
„Genauso ist es, Dr. Watson“, pflichtete mir der deutsche Wissenschaftler bei. „Jederzeit kann die Beulenpest in die gefährliche Lungenpest übergehen.“
Holmes verzog nachdenklich das Gesicht. „Damit wäre eine viel schnellere Ausbreitung gewiss.“
„In der Tat, mein lieber Freund, das wäre es!“
„Gibt es denn Menschen, die die Pest überlebten?“, versuchte ich, die Stimmung mit einer hoffentlich positiven Antwort zwangloser zu gestalten.
„Wenn Sie mit der Beulenpest Infizierte meinen, dann ja. Bereits im 14. Jahrhundert wurde darüber berichtet, etwa vom Kanoniker Johannes von Parma in Trient.“
„Wenigstens ein Hoffnungsschimmer.“
„Wenn auch ein verschwindend geringer.“
„Und wie sieht es mit einem wirksamen Mittel oder einer Behandlung aus?“, legte ich nach.
„Bislang ist mir ein einziger Fall bekannt, der klinisch nachweisbar erfolgreich behandelt wurde.“ Der Virologe zog die Augenbrauen zusammen, als er zu einem anderen Aspekt derselben Thematik wechselte. „Immer wieder wurde Europa in der Vergangenheit von Pestepidemien heimgesucht. Im Mittelalter fielen ihnen zwischen 1348 und 1350 fünfundzwanzig Millionen Menschen zum Opfer. Eine unfassbare Zahl.“
Der deutsche Virologe bestellte sich ein zweites Glas Ginger Beer, als Zeichen dafür, dass er diese interessante und lehrreiche Unterhaltung im Freundeskreis längst nicht für beendet hielt.
„Bis zum 18. Jahrhundert wütete die Pest in Europa. Den ausbrechenden Epidemien standen die Nationen zumeist machtlos gegenüber. Und noch vor ein paar Jahren, nämlich 1894, erreichte die Seuche Südchina, genauer gesagt Kanton und Hongkong, und forderte erneut Hunderttausende Tote.“