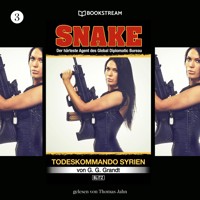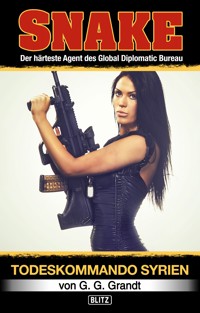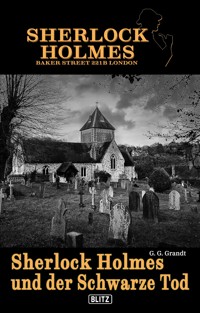
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes (London, Bakerstreet 221b)
- Sprache: Deutsch
Der abgeriegelte Londoner Stadtteil Whitechapel ist in Aufruhr. Immer mehr Menschen sterben an der Pest. Die Kriminalität steigt. Krone, Politik und Ermittlungsbehörden sind überfordert. Inmitten dieses Hexenkessels versuchen Sherlock Holmes, Dr. Watson und Dr. Meyfried alles, um das Rätsel des Serienkillers zu lösen. Dabei stoßen sie auf ein gigantisches Komplott. London steht vor dem Untergang
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SHERLOCK HOLMESBAKER STREET 221B LONDON
In dieser Reihe bisher erschienen
3901 G. G. Grandt Sherlock Holmes und der Zorn Gottes
3902 G. G. Grandt Sherlock Holmes und der Schwarze Tod
G. G. Grandt
SHERLOCK HOLMESBaker Street 221B London
Sherlock Holmes und der Schwarze Tod
Basierend auf den Charakteren vonSir Arthur Conan Doyle
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerLogo: Mario HeyerVignette: iStock.com/neyro2008Satz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-382-7Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Was bisher geschah:
In der Londoner Buck’s Row wird die junge Prostituierte Molly Bayheart bestialisch ermordet und verstümmelt. Der Täter hinterlässt einen kryptischen Zettel, den Sherlock Holmes dechiffriert: Des Namen heißt Schwarzer Tod. Unterschrieben mit Jack. Der Detektiv und der befreundete Virologe Dr. Adelbert Meyfried gehen zunächst davon aus, dass das Opfer eventuell mit der Pest infiziert sein könnte. Bei einer dementsprechenden Inaugenscheinnahme der Leiche durch den deutschen Wissenschaftler bestätigt sich dies jedoch nicht. König Edward VII. ist empört darüber, dass Scotland Yard es zuließ, dass ein Ausländer Molly Bayheart begutachtete. Er beauftragt seinen stellvertretenden Leibarzt Sir Ernest Waddell mit der weiteren Untersuchung, der dabei Inspektor Bradstreet das Leben schwer macht. Sir Ernest strengt eine ganz eigene Intrige an, will er doch den Ersten Leibarzt, Sir Clark Baryn, aus dem Amt treiben, um dessen Position sowie die des Vorsitzenden des Royal College of Surgeons of England zu übernehmen. Kurze Zeit später stirbt im Elendsviertel der Taschendieb Timothy Hanson an der Seuche. Neben ihm wird erneut ein Stück Papier gefunden: Der Mann lag nackt bei der Nackten. Wieder gezeichnet mit Jack. Daraufhin werden sämtliche Bordelle in Whitechapel geschlossen, die Dirnen medizinisch untersucht. Allerdings lehnen der Polizeipräsident, Commissioner Curran, sowie Premierminister Arthur James Balfour trotz Drängen von Bradstreet, Holmes und Dr. Meyfried es ab, das ganze Armenviertel abzuriegeln. Dr. Watson entnimmt dem Toten Hanson eine Pestgewebeprobe, die der deutsche Virologe analysieren will, um den Infektionsweg herauszufinden. Nur so können die seuchenprophylaktischen Maßnahmen gezielt durchgeführt werden. Nach einer kurzfristigen Audienz der Freunde bei König Edward VII. wird schließlich Whitechapel, in dem immer mehr Menschen der Pest zum Opfer fallen, abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. Dr. Watson hingegen wird selbst mit dem Pesterreger infiziert ...
1. Kapitel
Während ich diese Zeilen zu Papier bringe, steht mir noch immer das namenlose Grauen vor Augen. Genauso wie jene verhängnisvolle Nacht in der Baker Street in der ich, geplagt von fiebrigem Delirium und den Halluzinationen eines Kranken, gewahr wurde, von der Pest befallen zu sein! Ich sehe mich selbst aus der Vogelperspektive, wie ich in unserem gemeinsamen Wohnzimmer vor Sherlock Holmes im Ohrensessel sitze. Wie ich langsam den Morgenmantel aufschlage, den rechten Arm hebe und seitlich auf das starre, was sich dort unter der Achsel gebildet hat: Eine blauschwarz verfärbte Pestbeule!
Dieser Moment gehört unzweifelhaft zu den schrecklichsten meines Lebens. Mehr weiß ich jedoch von diesem nicht, verlor ich doch sofort nach dieser grausigen Entdeckung erneut die Besinnung. So bin ich bei dem Nachfolgenden, das ich an dieser Stelle schildere, auf die Schilderungen meines Partners und Freundes angewiesen. Dadurch bin ich heute in der Lage, als Chronist darüber zu berichten.
Natürlich entdeckte in jener Nacht auch Holmes die Pestbeule an mir. Doch anstatt in heillose Panik oder in Angst zu verfallen, sich eventuell selbst anzustecken, reagierte er in gewohnter Weise sehr ruhig. Um nicht unseren Hausarzt konsultieren zu müssen, der mit dieser Situation ganz sicher überfordert gewesen wäre, weil er hinsichtlich dieser Krankheit keinerlei Erfahrungen besaß, schickte der Detektiv einen Boten zu Dr. Meyfried. Der deutsche Freund war nach wie vor im Hotel Savoy untergebracht.
Wie ich ebenfalls später erfuhr, war der Virologe zu dieser Zeit erst vor kurzem aus dem Privatlabor von Dr. Frederic Sinclair zurückgekehrt, das in der Nähe des St. Bartholomew’s Hospital lag. Dort untersuchte Dr. Meyfried die Autopsieproben des Taschendiebes Timothy Hanson, des ersten Pesttoten in Whitechapel.
Als der Bote die Nachricht von Holmes überbrachte, mit der Bitte, sich aus dringlichsten Gründen unverzüglich in der Baker Street einzufinden, und zwar geschützt, kam Dr. Meyfried, trotz der nächtlichen Zeit, diesem Anliegen sofort nach. Nachdem er in unserer Wohnung eintraf, zog er sich den mitgeführten Mundschutz sowie die Handschuhe an, tief betroffen und besorgt bezüglich meines Gesundheitszustandes, der zum Glück nicht lebensbedrohlich war. Mit einer Spritze entnahm er mir eine Probe aus dem Eiter der Pestbeule unter der Achsel.
Gleich darauf untersuchte er Sherlock Holmes, stellte bei ihm, dem Himmel sei Dank, jedoch keine Krankheitssymptome fest. Das besagte allerdings noch nicht, dass er sich nicht doch mit der Pest angesteckt hatte. Um dahingehend ganz sicher zu sein, bat der deutsche Virologe meinen Partner, ihn zu Dr. Sinclairs Privatlabor zu begleiten. Natürlich war er damit einverstanden.
Mit Mrs. Hudson hatten wir in der letzten Zeit keinen persönlichen Kontakt gepflegt, so dass sie wohl kaum einem Risiko ausgesetzt war. Dennoch wollte Holmes, sobald er hoffentlich mit positivem Befund wieder zurück war, ein waches Auge auf unsere Vermieterin werfen. Freilich, ohne ihr den wahren Grund dafür zu nennen, um sie nicht unnötig zu verängstigen.
Sodann fuhren wir mit Dr. Sinclairs Privatkutsche, mit der unser deutscher Freund hergekommen war, zu dem Privatlabor in der Giltspur Street. Dort wurde ich zunächst in einem isolierten Raum untergebracht.
Dr. Sinclair ließ mir, selbstredend mit dem nötigen Schutz, jegliche medizinische Hilfe angedeihen, um meinen Zustand, der weiterhin keineswegs lebensbedrohend war, zu überwachen. Währenddessen nahm Dr. Meyfried eine Blutprobe von Sherlock Holmes, die er danach mit Argusaugen unter einem Mikroskop untersuchte. Der Detektiv saß neben ihm.
Gleich darauf zierte ein zaghaftes Lächeln den bleistiftdünnen Mund des Virologen. Die blassen Augen über der Hakennase strahlten.
„Dem Himmel sei Dank, Mister Holmes. Sie sind nicht infiziert! Sehen Sie selbst.“ Er ließ meinen Partner einen Blick durch das Mikroskop werfen.
„Und was soll ich da erkennen?“, fragte dieser.
„Behalten Sie für einen Moment im Kopf, was Sie soeben gesehen oder nicht gesehen haben“, bat Dr. Meyfried und tauschte die Probe aus. „Das ist aus dem Eiter der Pestbeule von Dr. Watson. Stellen Sie einen Unterschied fest?“
Der Detektiv lugte erneut durch das Okular. „Das ist unfassbar“, rief er auf einmal so bestürzt aus wie ein Kind, das soeben mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen hatte. Tatsächlich sah er vor seinen Augen massenhaft kleine Stäbchen, die sich im hängenden Tropfen als unbeweglich erwiesen. Die Befürchtungen, die ihn beschlichen, bestätigten sich, als Dr. Meyfried sagte: „Das ist die wahrhaft schreckliche Fratze der Pest!“
„Also gibt es keinen Zweifel daran, dass Dr. Watson infiziert ist!“
Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
Dennoch schüttelte der hagere Virologe mit dem knochigen Gesicht und den dünnen, schwarzen Haaren den Kopf. „Nicht den geringsten, Mister Holmes.“
„Und was gedenken Sie jetzt zu tun?“
„Ich werde um das Leben unseres Freundes kämpfen. Und zwar mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen!“
Welcher Schrecken wäre größer als der des Schwarzen Todes, der Junge und Alte, Reiche und Arme, Böse und Gute, Starke und Schwache holte? Jedenfalls kroch in diesen Tagen die unselige Pest durch die Straßen und Gassen in den Elendsvierteln Londons, welche die Gemeinden Whitechapel mit Spitalfields, Stepney, St. George’s in The East mit Wapping, Limehouse, Poplar, Mile End Old und New Town miteinschloss. Dort regierten Chaos und Furcht.
Um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, hatte die Metropolitan Police, unterstützt von der britischen Armee, die Slums hermetisch mit Schranken und Schlagbäumen von den angrenzenden Bezirken abgeriegelt. Es gab keine Straße, keine Gasse und keinen noch so kleinen Winkel, der nicht von den übrigen Stadtgebieten abgeschottet wurde. Niemand kam mehr hinein oder hinaus. Die Übertretung der Demarkationslinien wurde mit dem Tode bestraft. Nur mit Pässen und Gesundheitsbescheinigungen, die jenen glichen, die bereits in den Jahren 1665 und 1666 ausgestellt worden waren, als gleichsam die Pest in London grassierte, durfte man passieren.
Derweil wurden in den betroffenen Gemeinden die Totenlisten der Kirchengemeinden länger und länger, die Sterblichkeitsziffer stieg und stieg. Immer mehr Bewohner wurden von der Plage Gottes dahingerafft. Einige von ihnen lagen nur zwei oder drei Tage in ihren Betten, bei anderen dauerte es etwas länger, bis sie elendig zugrunde gingen. Viele Hinterbliebene verheimlichten die wahre Todesursache vor ihren Nachbarn und Bekannten, um nicht geächtet zu werden, sprachen davon, dass die Familienmitglieder am Fleckfieber ihr Leben ausgehaucht hatten, was natürlich die allerwenigsten glaubten.
Hunderte tote Ratten säumten die Gassen und Abwasserkanäle. Jene Kadaversammler, die auf Geheiß der Verwaltung umherzogen, um die verendeten Nagetiere gegen ein paar Schillinge einzusammeln und zu verbrennen, erkrankten zumeist selbst an der Pest und verstarben schließlich.
In jenen schicksalhaften Tagen hatte sich Gott wahrlich von London abgewandt. Die Separierten waren verflucht. Ihre Wut über die alltägliche Gefahr einer Pestinfektion sowie der Tatsache, dass man sie eingesperrt hatte, entlud sich immer mehr.
Natürlich wurden Schuldige für die Seuche gesucht, so wie es schon in der Vergangenheit gewesen war. Denn im Angesicht solcher Krisen, wenn die Furcht allzu groß war und das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit unerträglich wurde, suchten Leidtragende nach Sündenböcken. Nach Menschen, die sie dafür verantwortlich machen und an denen sie ihre ohnmächtige Wut auslassen konnten. Schließlich, so dachten sie, musste jemand für diesen Erdenjammer büßen.
Zunächst waren es, wie so oft in der Geschichte, die Juden, auch wenn nur wenige in dem betroffenen Bezirk lebten. Diejenigen anderen, die sich schon längst an deren fremden Sitten und Gebräuchen, mit einer eigenen Sprache und Schrift, gestört hatten, erinnerten sich daran, was Vertreter der römischen Kirche ihnen vorwarfen: Dass sie einst Jesus Christus verraten hätten, der dafür ans Kreuz genagelt wurde.
Nun hieß es, die Juden seien schuld an der Seuche, weil sie danach trachteten, Unglück zu bringen über all jene, die nicht ihres Glaubens waren. Dabei gab es keinerlei Beweise dafür, dass von den jüdischen Mitbürgern irgendeine Gefahr ausging. Und was die Hygiene anbelangte, standen sie mit ihren speziellen Reinheitsgeboten ohnehin weit über den anderen.
Doch die Gründe für den Zorn gegen sie lagen ganz woanders. Denn etliche Bürger waren bei jüdischen Geldhändlern oder Pfandverleihern verschuldet. Die Gläubiger sahen nun die Zeit für gekommen, sich auf diese schändliche Art und Weise von den gewährten Krediten zu befreien. Ohne Zins und Zinseszins. So wurden erstmals wieder jüdische Mitbewohner durch die Straßen gejagt und ihnen Gewalt angetan.
Als die Behörden davon erfuhren, versuchten sie mit aller Härte, den Übergriffen Herr zu werden. Allerdings gelang es nicht überall.
Nach den Juden traf es die Alten. Vor allem Greisinnen wurde vorgeworfen, dass sie mit dem Teufel buhlten und mit ihrem Schadzauber die Slums verflucht hätten. Eine wahre Hexenjagd wie im Mittelalter brach aus, nur die Scheiterhaufen fehlten noch. Auch dahingehend musste die Polizei alles unternehmen, um die Betagten und zumeist Schwachen vor dem aufgebrachten Mob zu schützen.
Selbst die Brüder des Schmerzes tauchten angesichts des Massensterbens wieder auf. Fanatische Christen, eingesperrt in den Ghettos, verfielen in eine verzweifelte Frömmigkeit. Zu Dutzenden zogen die Flagellanten durch die Straßen, schlugen sich als bußfertige Sünder mit Peitschen blutig, um so Gottes Gnade zu erflehen. Doch der Allmächtige erhörte sie nicht, schien in diesen Tagen blind und taub. Die schmerzhafte Sühne, die vermeintlich vor der göttlichen Strafe schützen sollte, versagte genauso kläglich wie alles andere.
So also fiel, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein ganzer Bezirk einer der modernsten Städte der Welt zurück ins dunkle Mittelalter. Die Kriminalität stieg und das Sterben verbreitete sich immer mehr. Die Pesttoten fanden ihre letzte Ruhe in Massengräbern, die eiligst geschaufelt wurden, fernab von den längst überfüllten Friedhöfen. Zumeist in der Nähe von Schlachthöfen.
Die Sicherheitsbehörden unter der Anleitung von Commissioner Curran, der wiederum im Namen von Premierminister Arthur James Balfour und König Edward VII. agierte, taten alles, um den Auswüchsen der Gottesplage im East End Einhalt zu gebieten. Infizierte wurden zu Hause isoliert oder in spezielle Quarantänestationen oder Pestkrankenhäuser verbracht.
Dennoch bestand weiterhin die Gefahr, dass die Tumulte auch auf das restliche London übergegriffen, vielleicht sogar auf das ganze Land. Gerade deshalb mussten Polizei und Armee alles Menschenmögliche unternehmen, um genau dies zu verhindern.
Es gab jedoch noch einen anderen Aspekt, der den Bewohnern in den Slums verborgen blieb, weil die normalen Nachrichtenketten nicht mehr funktionierten. Viele der Adligen, Reichen und Wohlhabenden aus dem Westteil der Stadt versuchten, samt ihren Familien und ihrer Dienerschaft hektisch London zu verlassen. Freilich wurde ihnen das nicht verwehrt, schließlich wohnten sie nicht in einem der Quarantäneviertel. Allerdings durften sie die angrenzenden Straßen um Whitechapel nicht mehr passieren, sondern mussten Umwege in Kauf nehmen.
Die Kutschen waren voll mit Leuten der besseren Gesellschaft besetzt, begleitet von Reitern oder den Dienst- und Hausmädchen in einfacheren Wagen und Karren mit Gepäck. Mitunter wurden sie in der Presse Pestflüchtlinge genannt.
Fürwahr, die langen Kutschenkolonnen waren ein trauriger und schauerlicher Anblick, der den Betrachter mit trüben Gedanken des Elends erfüllte, unmittelbar aber auch mit Gedanken an jene, die in ihrem jämmerlichen Zustand zurückbleiben mussten: Die Armen und die Kranken.
Die Priester in den nicht von der Pest betroffenen Stadtgebieten versuchten, ihren Pfarrkindern zu vermitteln, dass die Plage eine Prüfung Gottes sei, dass Flucht davor nichts nützte. Denn die Hand des Allmächtigen konnte einen fortwährend erreichen, wo und wann es ihm beliebte.
Während Dr. Meyfried alles dafür tat, mich von der Pest zu heilen, und Holmes weiterhin um meinen Gesundheitszustand bangte, geschah inmitten des pestverseuchten, von Tumulten aufgewühlten Whitechapel ein neuer grausiger Frauenmord. Dies war auch der Grund, warum Inspektor Bradstreet am Morgen danach die Baker Street aufsuchte und meinen Partner darum bat, ihn zum Tatort zu begleiten. Schließlich war es Holmes, der in dem rätselhaften Mord an der Prostituierten Molly Bayheart die vom Täter zurückgelassene verschlüsselte Botschaft mit der Unterschrift Jack dechiffrierte. Und ein solcher war erneut neben der nun gefundenen Frauenleiche entdeckt worden, wie ein Constable Bradstreet zuvor gemeldet hatte.
Normalerweise war es Zivilisten nicht mehr gestattet, die Elendsviertel von London aufzusuchen, in denen die Pest wütete. Außer natürlich in Begleitung des Inspektors sowie einer Eskorte von einem Dutzend Polizisten, als Schutz vor eventuellen Übergriffen durch den Mob.
Der Tatort lag ganz in der Nähe der Bishopsgate-Polizeistation in südlicher Richtung der Bishopsgate Street zum Houndsditch. Genauer am Mitre Square, dem etwa 400 Quadratmeter großen Platz im Westen des East End.
Als Holmes nach Bradstreet aus der Droschke stieg, warf er zunächst einen Rundblick in die nähere Umgebung. Zum Mitre Square führten drei kleine Gassen. Vom Norden her ein Durchgang vom St. James Place, der eigentlich nur Orange Market genannt wurde, weil hier fliegende Händler zu normalen Zeiten ihr Obst verkauften. Von Osten die Church Passage, nicht mehr als ein dunkler, schmaler Durchlass. Und vom Westen ein kurzer, dafür aber recht breiter Weg von der Mitre Street aus.
Rundherum gab es gewerblich genutzte Gebäude, wie beispielsweise die Lagerräume von Kearley & Tonge’s, einem Teeimporteur, sowie einige wenige Wohnhäuser. Jene waren jetzt allerdings unbewohnt, hatten sich die Mieter doch zumeist mit der Pest angesteckt, waren gestorben oder in Quarantäne gesteckt worden, wie Bradstreet erklärte.
Normalerweise war der Mitre Square recht stark frequentiert, da er von den Einwohnern als Abkürzung zum Bishopsgate genutzt wurde. Durch die Abriegelung, die nicht unweit von hier begann, war der Platz völlig verwaist. Abgesehen von der Frauenleiche, zu der Bradstreet und Holmes samt Eskorte nun schritten. Sie lag in der südwestlichsten Ecke des Squares.
Während die Beamten die Umgebung im Auge behielten, unterhielten sich der Inspektor und der beratende Detektiv mit den Constables, die hier vor wenigen Stunden Streife gelaufen waren.
„Mit unseren Laternen haben wir jede Ecke des Platzes ausgeleuchtet, aber nichts Außergewöhnliches entdeckt“, sagte einer von ihnen, ein großer, stämmiger Bursche, dem die Uniform wie auf den Leib geschneidert schien. „Alles war ruhig und verlassen.“
„Wann war das genau?“, fragte Holmes nach.
„Gegen 3:30 Uhr, Sir“, antwortete der andere Constable, blass, klein und zierlich.
„Was geschah dann?“
„Wir kehrten etwa eine halbe Stunde später nach dem Rundgang in der Duke Street zurück, die schräg gegenüber dem Einga
ng der Church Passage liegt. Da haben wir in dieser Ecke hier, übrigens die dunkelste des gesamten Platzes, die Tote entdeckt.“
„Und zuvor haben Sie nichts Verdächtiges gesehen oder gehört?“, vergewisserte sich Bradstreet noch einmal.
„Nein, Sir“, erwiderten beide Constables wie aus einem Mund. Ganz sicher sagten sie die Wahrheit, wie Holmes für sich feststellte.
„Nachdem wir das Opfer in Augenschein genommen hatten, informierten wir den wachhabenden Sergeant sowie den Polizeiarzt“, berichtete der stämmige Polizist weiter. „Dieser stellte in dieser Ausnahmesituation lediglich den Tod fest. Inzwischen wissen wir, dass die Frau Selma Brown heißt und als Dirne arbeitete. Freilich vor dem Pestausbruch. Was sie um diese Zeit hier wollte, konnten wir nicht herausfinden.“
Holmes sezierte die mit Mantel und Rock bekleidete, verstümmelte Leiche geradezu mit seinem Blick. Der Mörder hatte sie zurückgelassen wie ein abgeschlachtetes Stück Vieh. Anders konnte man es nicht ausdrücken, selbst wenn ihm dieser Vergleich zuwider war.