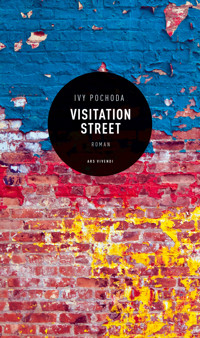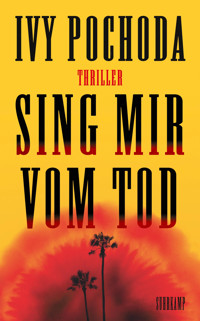
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2025
Eine tödliche Jagd von Arizona bis Los Angeles
Florence »Florida« Baum ist alles andere als die arme, verfolgte Unschuld, für die sie sich im Frauengefängnis von Arizona ausgibt ‒ zumindest behauptet das ihre ehemalige Zellengenossin Diosmary »Dios« Sandoval. Denn Dios kennt die Wahrheit über Floridas Verbrechen und weiß, was diese sogar vor sich selbst verbirgt: dass sie nie ein Opfer der Umstände war, eine glücklose Zuschauerin, die von einem üblen Typen auf Abwege geführt wurde. Dios weiß, dass Dunkelheit auch in Frauen lebt, selbst wenn die Welt sich weigert, sie zu sehen. Und sie ist entschlossen, Florida die Augen zu öffnen und deren wahres Ich zum Vorschein zu bringen.
Als beide Frauen auf Bewährung freikommen, wird Dios' Fixierung auf Florida zu einer gefährlichen Besessenheit, und es beginnt eine tödliche Jagd von Arizona bis in die trostlosen Straßen des Los Angeles, wo Detective Lobos, auch sie eine Frau mit Gewaltpotential, schon wartet. Es kommt zu einem atemberaubenden Showdown.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
Cover
Titel
Ivy Pochoda
Sing mir vom Tod
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Stefan Lux
Herausgegeben von Thomas Wörtche
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5462.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024Copyright © 2023 by Ivy Pochoda
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von Sara Wood. Umschlagfotos: Laura Fay/Getty Images (Palmen), Jose A. Bernat Bacete/Getty Images (roter Fleck)
eISBN 978-3-518-78085-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Louisa Hall – leidenschaftlich, weise und unermesslich loyal
Motto
Und schlechte Menschen lassen sich überhaupt nicht bei der Stange halten. Wenn, habe ich jedenfalls noch nie davon gehört.
Corman McCarthy, Kein Land für alte Männer
Doch das war bloß eine Geschichte, etwas, was die Menschen sich erzählen, etwas, womit man sich die Zeit vertreiben kann, die die Gewalt in einem Mann braucht, um ihn zu verschleißen oder selbst verzehrt zu werden, je nachdem, wer die Kerze ist und wer das Licht.
Denis Johnson, Engel
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
PROLOG
KACE
TEIL1
DIOS
FLORIDA
KACE
FLORIDA
KACE
TEIL2
LOBOS
FLORIDA
LOBOS
FLORIDA
KACE
LOBOS
FLORIDA
KACE
FLORIDA
DIOS
LOBOS
FLORENCE
KACE
FLORIDA
LOBOS
KACE
DANKSAGUNGEN
Zitatnachweis
Informationen zum Buch
Sing mir vom Tod
PROLOG
KACE
Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen.
Ich kenne die Geschichten von allen. Hab sie über Jahre gesammelt – eine gottverdammte Bibliothek aus Stimmen, die in meinem Kopf eingestellt sind. Manchmal gibt es nicht viel zu erzählen.
Aber diese hier müssen Sie sich anhören.
Sie handelt von zwei Frauen, zwei Frauen in einer Welt von Frauen, die mit der Welt der Männer lange nichts zu tun hatten. Bis eines Tages …
Man glaubt nicht, wozu Frauen in der Lage sind.
Diese Frauen … Ihr Fehler war, dass sie glaubten, in ihnen würde ein ganz einzigartiger Hass brennen. Etwas Tieferes und Schwärzeres, als wir anderen empfinden.
Ich will Ihnen etwas sagen – im Inneren rasen wir alle auf dieselbe Weise. Der Unterschied besteht darin, wie wir es rauslassen.
Diese Geschichte endet sieben Stunden westlich von hier, wenige Meilen vor dem Ozean. Wie die Frauen, die darin vorkommen, hat auch die Geschichte nicht die ganze Strecke geschafft. Sie ist hier in der Wüste losgegangen, aber nicht bis zum Wasser gekommen. Dumme Sache, wenn man schlappmacht, bevor man die Brise des Ozeans riecht. Man sollte denken, das Zeug wäscht eine Menge Sünden ab. Der Versuch könnte jedenfalls nicht schaden.
Aber vielleicht wollten sie gar nicht so weit. Vielleicht gehörte das nicht zu ihrem Plan. Zu ihrer Geschichte.
Bei beiden nicht.
Ich weiß nicht genau, was zwischen hier und dort alles passiert ist. Ich weiß nur, was ich gehört hab.
Ich habe von einem Mural gehört.
Wahrscheinlich halten Sie das für Blödsinn. Dass ich nur Ihre Zeit verschwende, wenn ich von einem Bild erzähle, das irgendjemand auf eine Wand gesprüht hat, in einer Stadt, in der ich kein einziges Mal gewesen bin. Aber ich sag’s Ihnen – nach allem, was ich gehört hab, ist es etwas ganz Besonderes.
Eines Tages werde ich es sehen. Dann haue ich ab aus diesem Knast und schaue es mir mit eigenen Augen an.
Die Wand mit dem Bild steht jedenfalls hinter einer Tankstelle an der Kreuzung von Olympic Boulevard und Western Avenue in Los Angeles. Bis vor Kurzem haben mir diese Straßennamen nichts gesagt. Aber langsam bekommen sie ihre Bedeutung.
Soweit ich weiß, ist es bloß eine dieser Kreuzungen von Schlimm und Schlimmer – in jeder Richtung droht Ärger.
Und soweit ich weiß, endet die Geschichte genau dort.
Es ist so: Das Mural ist nicht irgendein Mural. Die Leute sagen, es lebt. Die Leute sagen, es hüpft und bewegt sich. Die Leute reden immer irgendwelchen durchgeknallten Scheiß. Was mich angeht, ich höre Stimmen im Kopf, aber ich mache kein Geheimnis draus.
Wissen Sie, was ich dachte, als ich zum ersten Mal von diesem lebenden Wandbild gehört hab, von diesem Gemälde, das sich bewegt? Ich dachte, die Idioten waren derart zusammengepfercht, so auf ihre Sicherheit zu Hause, aufs Flachhalten der Welle fixiert, dass sie den Verstand verloren haben.
Die Idioten hätten so lange durch ihre scheiß Masken geatmet, dass sie unter Sauerstoffmangel litten.
Ein lebendes Mural, na sicher.
Aber dann wurde mir klar, dass etwas dran sein musste.
All diese Stimmen in meinem Kopf – all die Opfer der Frauen hier im Knast –, sie leben in mir weiter. Was zum Teufel spricht also dagegen, dass auch ein Wandbild lebendig sein kann? Warum sollte diese Geschichte sich nicht erzählen können?
Im Lauf der Zeit hab ich einiges gesehen, was weniger einleuchtet.
Meine Tochter Cassie hat mir endlich ein Foto geschickt. Den ganzen letzten Monat hab ich sie drum gebeten, hab Briefmarken und Telefonzeit geopfert, um sie zu erreichen.
Ich hab gesagt: Wenn du das nächste Mal in Los Angeles bist, musst du mir ein Foto von diesem Ding machen, diesem Mural.
Wozu brauchst du ein scheiß Foto von einer Wand?, hat sie gefragt.
Das ist doch wohl das Mindeste, was du für eine Frau wie mich tun kannst, die hier drin versauert. Mach einfach das scheiß Foto.
Also hat sie es gemacht. Hat ihren Arsch zu dieser Kreuzung geschleppt und mit ihrem Handy ein Bild gemacht. Wie gesagt, das ist doch wohl das Mindeste.
Die Arschlöcher haben Ewigkeiten gebraucht, um es auszudrucken und mir zu zeigen.
Bis dahin hatte ich Cassie längst telefonisch erreicht und sie gefragt, wo zum Teufel mein Foto bleibt.
Bitch, sagt sie zu mir. Du glaubst es nicht. Ich hab gedacht, du bist bekloppter als bekloppt, mich mitten in einer scheiß Pandemie zu diesem Bild zu jagen. Aber das verdammte Mural bewegt sich. Auf meinem Foto siehst du das nicht, aber ich schwöre, eine dieser Frauen geht auf die andere zu.
Am nächsten Tag haben sie mir den Ausdruck gegeben. Ohne Ende verschwommen, aber trotzdem.
Los Angeles kenne ich nur aus Filmen, aber auf dem Mural sieht es aus wie eine Geisterstadt. Scheiß tot. Leer. »Hohl«, ist vielleicht das richtige Wort. Sogar verschwommen sieht man das.
Keine Ahnung, warum Kunst etwas zeigen kann, was nicht da ist, statt dem, was da ist.
Und das muss ich sagen: Man hört die Leere fast. Den Klang von herumgewehtem Müll und Echos. Den Klang von nichts.
Plus all die Masken und den Mist, der wie Wüstensträucher über die Straßen wirbelt. Mein Granddad hat sich immer dieses Zeug mit John Wayne und Henry Fonda angesehen, ich weiß also, wovon ich rede.
Wie gesagt, der Künstler hat eine Geisterstadt gemalt.
Ehrlich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber sogar auf dem miesen Ausdruck scheint das Ding sich zu bewegen.
Zuerst dachte ich, es ist das Licht in meiner Zelle.
Dann dachte ich, es liegt an meiner zerkratzten Scheibe.
Aber es ist das verdammte Foto. Ganz sicher.
Ganz sicher, ganz sicher. Ich mag eine Mörderin sein. Ich mag Stimmen hören. Aber das heißt nicht, dass ich verrückt bin.
Auf dem Bild sind zwei Leute zu sehen, zwei Frauen. Dios und Florida. Sie werden alles über die beiden erfahren.
Die Kreuzung ist der Endpunkt ihrer Tour.
Florida geht die Western Avenue Richtung Norden. Vor ihr, auf dem Hügel, thront das Hollywood Sign und schaut zu.
Dios blockiert ihr den Weg. Sie stützt die Hände in die Hüften. Ihre kohlschwarzen Haare sind geflochten und glatt. Ich kenne ihren Blick. Sie meint es ernst. Sie meint: Leg dich nicht mit mir an, oder trau dich, und finde raus, was passiert.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie der Wind eine einzelne Haarsträhne anhebt. Ehrlich.
Dios’ Augen sind wie die einer Schlange, sie blinzelt nicht. Da bewegt sich nichts, egal wie lange ich das Foto anstarre. Das Starren ist fix. Kalt wie Stein.
Florida ist diejenige, die sich bewegt, sie kommt die Straße hoch, genau in der Mitte. Keine Autos. Keine Leute. Nur diese beiden Frauen. Als hätte die Stadt für die beiden Platz gemacht. Für das, was kommt.
Man sieht Florida im Profil. Ihr Gesicht sieht seltsam aus, als hätte sie sich für Halloween geschminkt. Ihre Haare sind nach hinten frisiert. Fast zwölf Monate hab ich mit ihr die Zelle geteilt, ohne ein einziges Mal den Gesichtsausdruck mitzubekommen, den sie auf dem Bild hat.
Ein Teil von mir möchte glauben, dass der Maler Scheiße gebaut hat.
Aber der andere Teil … Na ja, der andere Teil glaubt, dass es diese Seite von Florida immer schon gegeben hat.
Überraschend, wie lange wir brauchen, bis wir uns selbst kennen. Manchmal so lange, bis es zu spät ist.
Ich selbst bin eigentlich keine Mörderin, auch wenn ich jemanden umgebracht hab. Trotzdem erzählen mir Leute – eine Menge Leute –, dass ich genau das bin. Das und nichts anderes.
Bei Florida bin ich nicht ganz sicher, wer sie ist. Aber die Frau auf dem Gemälde scheint es zu wissen. Auf dem Bild trägt sie immer noch die vom Staat gestellten Stiefel.
Fast kann man sie auf dem Asphalt hören.
Sie macht einen Schritt.
Und noch einen.
Sie hat was in der Hand, aber das Bild zeigt nicht, was es ist.
Alles, was ich sehe, ist das bevorstehende Patt. Das endlose Sich-Annähern. Das letzte Durchatmen. Die letzten Augenblicke von Dios und Florida.
TEIL1
DIOS
Schau dir deinen Baum an, Florida. Schau, wie er sich unter dem bedeckten Himmel biegt und krümmt. Schau ihn dir durch das zerkratzte Glas an – durch das Werk von Klingen und Fingernägeln und endlosen verzweifelten Nächten. Vom Regen geprügelt und vom Sturm gequält.
Du hast wieder mal den White-Girl-Blues, Florida. Ich weiß es. Ich merke es durch diese Mauern hindurch. Ich kann es in meiner Zelle gleich nebenan spüren. Ich empfange die Schwingungen deines Schmerzes – eine tiefe Saite, die den Betonstein zum Zittern bringt wie Basstöne aus einem Autoradio.
Du steckst tief in der Ich-gehöre-nicht-hierhin-Scheiße.
Aber du gehörst genau hierhin.
Reiche Mädels wie du, Florida – ihr seid viel blinder als der Rest.
Du hast keine dieser mitleiderregenden Geschichten zu erzählen, die den Privilegierten beim Zuhören das Gefühl geben, Teil einer raueren Welt zu sein. Deine Geschichte bringt Frauen wie deine Mutter nicht dazu, wenigstens für einen Moment Krokodilstränen über die Ungerechtigkeit der Welt zu vergießen.
Man muss nicht allzu genau hinsehen, um zu merken, dass dieses Lied hier drin zu oft gesungen wurde – in praktisch jedem Bett liegt eine Frau, die draußen ungerecht behandelt wurde, vom System ungerecht behandelt wurde, hier drin ungerecht behandelt wurde. Auf dem Weg nach unten stößt eine Ungerechtigkeit die nächste an, es ist ein Domino der Ungerechtigkeiten.
Wer wird unsere Geschichten erzählen, Florida?
Wer wird dem Lied über ein kaltes Herz lauschen?
Wer wird singen: »Pero nunca se fijaron / En tan humilde señora«?
Schau, wie dein Baum sich hinunterbeugt, bis er fast zerbricht. Mit seinem Aufkeimen, Blühen und Blätterabwerfen markiert er die Zeit. Schau dir deinen Baum zwei Jahre, fünf Monate, zweiundzwanzig Tage und ein paar Stunden lang an. Schau dir an, wie deine Haftzeit langsam verstreicht, bis sie irgendwann vorbei ist.
Heute Nacht, in der Agonie des Unwetters und der Gewalt, die deine Träume erfüllt – schau dir an, wie dein Baum gegen den Wind, den Regen und den Sand kämpft, die rasend durch diesen flachen Wüstenstaat ziehen. Wie Daphne, die fest verwurzelt ihrem unerwünschten Liebhaber widerstand.
»Schaust du noch hinaus? Schaust du noch hinaus, Florida? Bist du …« Ich höre Kace’ Geschwafel bis hier. »Denn Marta sagt, es ist nicht gut, hinauszuschauen. Marta sagt, so kommt der Teufel rein. Marta sagt, er beobachtet dich aus dem Baum heraus. Marta sagt, du lädst ihn ein. Willst du den Teufel, Florida? Willst du ihn?«
»Hör auf mit Marta«, sagst du zu ihr.
Ich höre den dumpfen Schlag, als Kace mit den Fäusten auf das Bett hämmert, dich durch die Federn und die dünne Matratze hindurch schlägt. Ich spüre, wie du gegen die Wand prallst.
Jetzt hör zu.
Hör Kace zu, die Stimmen hört. Hör zu, wie sie ihnen antwortet und für sie spricht. Einen Teil der Nacht oder, schlimmer, die ganze Nacht. Hör zu, bis du die Stimmen selbst erkennst, als wären sie deine Freundinnen. Ein wirrer Chor, der vor den Mauern einer gefallenen Stadt klagt. Ein ganzer Haufen verrückter Furien.
Also hör ihnen und ihr zu, und vermiss sie, wenn sie nicht da sind. Dann ist Kace tödlich still und in dieser Stille erst recht furchteinflößend. Hör ihnen zu, weil du glaubst, es ist besser, als mir zuzuhören.
Ich habe Angst vor Frauen mit nichtlinearer Wut, hast du gesagt, als wir noch eine Zelle geteilt haben. Bevor du ausgezogen bist und deine alte Zellengenossin Tina bei mir eingezogen ist.
Glaubst du, Wut bewegt sich nach einem festen Schema von Punkt A zu Punkt B?, hab ich gefragt. Du glaubst, es gibt immer eine klare Kausalkette. »Kausalkette« hat dich zum Schweigen gebracht.
Du dachtest, du hättest als Einzige hier drin ein bisschen Bildung genossen.
Aber Kace ist alles andere als linear. Also lass sie die ganze Nacht reden, wenn sie das braucht. Mich macht es verrückt, obwohl ich eine Zelle weiter wohne.
Weil es nur diese eine Tauschmöglichkeit gab, hast du zugegriffen. Hauptsache, ein bisschen Abstand zwischen uns beide bringen, hast du gedacht. Hauptsache, weg von mir – weg von dem Teil von dir, den du in mir gesehen hast.
Du hättest bei den alten Erzählungen ein bisschen besser aufpassen sollen. Dein Schicksal ist dein Schicksal.
Daran kannst du verdammt nichts ändern.
Wir treffen uns an der Kreuzung.
Du hältst dich für einzigartig, weil du ein Auge für schöne Dinge hast – Kondensstreifen, die sich bei Sonnenuntergang am Himmel kreuzen, ein zufälliges Muster aus Knospen an deinem Baum, das sanfte Geräusch des auf den trockenen Boden fallenden Wüstenregens.
Ich weiß, wie sehr du dich an diesen Dingen festhältst, denn ich habe dir zugehört, wenn du gar nicht mehr davon aufhören konntest, dass du nicht hier sein solltest. Dass du nicht atmen, nichts spüren, nichts richtig wahrnehmen kannst – als wären deine Sinne normalerweise schärfer als die von uns anderen. Ich weiß, dass du glaubst, die Leute hier sind nicht deine Leute, deine Verbrechen sind nicht deine Verbrechen. Ich hab zugehört, wie du alle anderen für das verantwortlich gemacht hast, was du getan hast. Nur dass ich weiß, dass deine Schuld tiefer geht als in der Geschichte, die du dir zurechtgelegt hast. Da ist ein winziges Detail, nicht größer als eine Streichholzschachtel. Ich weiß es, weil Tina es mir erzählt hat. Und ich weiß noch mehr.
Du bist kein Opfer, Florida.
Es gab diesen Sommer, den du in Israel verbracht und mit dem Schmuggeln von Diamanten nach Luxemburg finanziert hast. Das Jahr im Ausland, in Amsterdam, wo du in vollem Bewusstsein einen Hypothekenvertrag unterschrieben hast, der faule Kredite von Gaunern absicherte.
Und natürlich gab es die Angelegenheit, wegen der du hier bist – Beihilfe zum Mord. Du hast das Fluchtfahrzeug gefahren, als bei einem Brand in der Wüste zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Als hättest du von alldem nichts gewusst.
Drinnen wirst du Florida genannt. Wegen des Tons, in dem deine Haare gefärbt sind – gefängnisblond.
Florence ist kein Name, den man hier trägt. Also ruinierst du dir die Haare mit billiger Tönung.
Draußen fällt ein heftiger Wüstenregen, ein derart mächtiger Monsun, dass man ihn durch die dicken Fenster zu spüren glaubt – ein ungestümer Rhythmus, den wir innerlich spüren. Das Unwetter prescht heran wie ein angreifendes Bataillon und reinigt die Luft vom nächtlichen Lärm hier im Block. Eine Grundreinigung.
Kace redet. Marta antwortet. Der Baum schwankt still hin und her.
Blitze durchziehen den Himmel, der an eine von einem Stein getroffene Windschutzscheibe erinnert. Sie röntgen den Gefängnishof und den Zaun.
Jetzt kann ich euch beide über das Unwetter hinweg kaum noch hören. Ich schließe die Augen und lege mich aufs Bett, dankbar, dass ich heute Nacht nicht zuhören muss.
Am Morgen hat das Unwetter eine tiefliegende Wolkendecke zurückgelassen. Wegen des Regens haben wir alle gut geschlafen und konnten einander für einen Augenblick vergessen.
Beim Aufwachen erwarten uns die üblichen Geräusche der durch die Gänge schreienden Frauen. Sie rufen von Bett zu Bett, von Zelle zu Zelle. Und das Husten – auch das erwartet uns.
Das Fenster ist schmutzverschmiert und voller Wasserflecke.
Der Hof ist voll Matsch.
Der Baum ist weg.
Den Rest lasse ich dich erzählen.
FLORIDA
Seit dem Unwetter letzte Nacht ist die Hölle los. Die elektrische Energie der Blitze ist in den Blocks noch spürbar, sie strahlt von den Gitterstäben jeder einzelnen Zelle ab, an der Florida vorbeikommt. Fast glaubt man die angestaute Spannung vibrieren zu sehen. Mehr Zellen als sonst bleiben während der Mahlzeiten besetzt – mehr und mehr ältere Frauen halten sich von gemeinsamen Aktivitäten fern, holen sich ihr Essen in der Kantine und nehmen es dann auf den Betten zu sich.
Aber selbst bei reduzierter Belegung ist die Cafeteria mit einer Energie aufgeladen, die sich in plötzlichen Ausschlägen und sich ausbreitenden Wellen offenbart. In kleinen Geräuschexplosionen – fallen gelassene Tabletts und verschüttete Getränke. Aber als Florida ihren Teller füllt, bemerkt sie, dass der Raum mit einem Mal seltsam still geworden, dass vom üblichen Geplauder kaum etwas zu hören ist. Nur ein Husten durchbricht die Stille.
Sofort zucken die Frauen zusammen und bringen sich in Sicherheit, als hätten sie einen Schuss gehört. Dann ist es wieder still – sicheres Zeichen für einen sich zusammenbrauenden Sturm.
Floridas Blicke huschen hin und her, sie bemüht sich, nichts und niemanden zu fixieren. Kopf runter. Sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern. Sie setzt sich auf den freien Platz neben Mel-Mel, die trotz ihrer mächtigen Statur nicht bedrohlich wirkt, und widmet sich ihrem sogenannten Frühstück.
»Entweib mich, Miststück!«
Diana Diosmary Sandoval erhebt sich mit ausgebreiteten Armen von ihrem Platz und stampft mit dem Fuß auf, um sich die allgemeine Aufmerksamkeit zu sichern. Die Wärter heben angesichts des sich anbahnenden Ärgers den Blick, aber kaum, dass sie steht, schauen sie wieder weg.
Was jetzt passiert, wird schnell und schmerzhaft werden. Dios hat Stacheldraht in den Venen. Oder Quecksilber, man weiß es nie.
»Ich hab gesagt, entweib mich, Drecksstück.«
Florida sitzt zu nah am Geschehen. Plötzlich spürt sie Dios’ Blick auf sich.
Dann lächelt sie, freudlos und gemein, dabei blitzen ihre perfekten Zähne auf. Ohne die orangefarbene Gefängniskluft könnte man meinen, Dios käme geradewegs aus einer anderen Welt – einem Ort der Sauberkeit und der Ordnung, an dem man sich dem Luxus hingeben darf, sich auf oberflächliche Details zu konzentrieren. Die Stirn unter ihren pechschwarzen Haaren ist eine polierte Kugel, die Augenbrauen sind gemalte Gewölbe, die Augen kalte grüne Steine. Ihre Haut schimmert von der inneren Hitze golden.
Sie tritt an Floridas Tisch und stellt sich gleich hinter Mel-Mel. Florida zuckt zusammen, als sie die Gabel in Dios’ Hand bemerkt.
Wenigstens sitzt Mel-Mel wie ein schützendes Gebirge neben ihr – eine wellenförmige Kette kleiner Gipfel, die Mel-Mels Persönlichkeit perfekt widerspiegelt: weich und leichtgläubig, eine Spielfigur, nie die Spielerin.
Florida weiß, dass manche Schließer unaufmerksam sind oder absichtlich wegschauen, weil in der Küche oder in der Kapelle ein schneller Deal gemacht wurde. Ein Tauschgeschäft, ein Geben und Nehmen, ein schmutziger Handel. Manche schauen vielleicht sogar mit perversem Vergnügen zu, warten auf den Kampf, können es nicht abwarten, Diana Diosmary Sandoval in ihrem Element zu sehen.
Sie können nicht verbergen, dass sie auf prügelnde Frauen stehen, besonders auf jemanden wie Dios, die Männer wie sie draußen keines Blickes würdigen würde, hier aber durch ihren Status gezwungen ist, die Anzüglichkeiten der Schließer über sich ergehen zu lassen. Florida glaubt, dass die Schließer sie unbehelligt prügeln lassen, weil es Dios auf ihr eigenes animalisches Niveau reduziert.
Dios hebt die Faust mit der Gabel. Über Mel-Mels Kopf hinweg täuscht sie eine Attacke auf Florida an. Dann setzt sie wieder ihr gemeines Grinsen auf. Florida zuckt nicht mit der Wimper.
Man nimmt die Prügel, wie sie kommen. Manchmal erfährt man den Grund erst im Nachhinein.
Wie schmerzhaft wird es? So schlimm wie die wiederholten Prügel in Floridas erster Zeit hier – die Schläge, die von ihrem Hals bis zur Hüfte hinab ein einziges Aquarell in Blau und Lila hinterließen? Wird es wochenlang brennen und pochen, sich im eigenen pulsierenden Sound bemerkbar machen, eine brutale, rhythmische Kakophonie wie nach der Gehirnerschütterung, die sie einem Wärter oder einer Wärterin in der Dusche verdankte? Oder wird es ein Kunstwerk ganz eigener Art? Ein metallisches Kontrastprogramm – die kalten, scharfen Zacken der Gabel tief unter der Haut, der Eisengeschmack des Bluts auf ihrer Zunge?
Dann folgt eine unerwartete, kaum wahrnehmbare Veränderung der Atmosphäre. Dios lockert ihren Griff um die Gabel, dreht sich ein Stück zur Seite und fixiert Mel-Mel. Jäh begreift Florida, dass das, was jetzt kommt, nicht sie betrifft.
In diesem Moment streckt Dios ihr die Gabel entgegen. Ihr Blick fordert Florida unmissverständlich heraus, die Initiative zu ergreifen und zu beenden, was Dios angefangen hat.
»Komm schon, Florida«, sagt Dios. Ihr Tonfall impliziert, dass das Zufügen von Schmerz Vergnügen bereitet. »Du weißt, dass du es willst.«
Florida verzieht keine Miene.
»Wie du meinst«, sagt Dios. Mit einem kurzen Hochziehen der Augenbraue packt sie die Gabel wieder fester. Ohne Florida aus den Augen zu lassen, greift Dios um Mel-Mel herum und stößt ihr die Gabel tief in die Wange, woraufhin das Blut sofort zu fließen beginnt. Sie drückt noch fester zu, dann zieht sie die Gabel an Mel-Mel Kiefers hinunter.
Florida malt sich das Geräusch reißenden Fleischs aus, als würde eine Stoffnaht mit einem grässlichen Platzen der einzelnen Stiche aufgetrennt. Aber sie hört nur Mel-Mels kurzen Aufschrei, der schnell erstickt, als Dios ihr mit der freien Hand den Mund zuhält. Dann dreht sie die Gabel und wickelt das zerfetzte Fleisch zu einer grausigen Spirale.
Mel-Mels Blut strömt über Dios’ Hand. Dios dreht weiter, als wolle sie sämtliche Hautfetzen in einem blutigen Strudel versinken lassen, der Doppelkinn und Tränensäcke immer dichter an sein zerfleischtes Zentrum zieht.
Dios hört auf, lässt die Gabel aber in Mel-Mels Wange stecken. Sie tritt vom Tisch weg. Mel-Mel hebt die Hand an ihr traktiertes Fleisch, dabei öffnet und schließt sie den Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Dios lässt Florida nicht aus den Augen. »Dann beim nächsten Mal«, sagt sie.
Florida liegt auf ihrem Bett. Es sind noch wenige Wochen bis zum längsten Tag des Jahres. Die Sonne ist nicht mehr zu sehen, durch das bedrohliche Schwarz der ans gestrige Unwetter erinnernden Wolken dringen nur vereinzelte orange Strahlen.
»Teufelshimmel«, sagt Kace. »Wüstenregen ist ein deutliches Zeichen des Teufels. Wenn er fertig ist, lässt er sein Mal zurück, vergiss das nicht.«
Florida blinzelt in den Himmel. Tatsächlich sieht er wie die Hölle oder das Feuer der Hölle aus.
Man muss nicht lange suchen, um hier drin den Teufel zu entdecken. Ein Teufel steckt in allem und jedem.
»Ständig siehst du Zeichen des Teufels«, sagt Florida. »Dreimal niesen, und er hat dich.«
»So denkt Marta. Das sind ihre Gedanken«, sagt Kace und kreist in ihrem Zehn-Schritte-Rhythmus durch die Zelle, von dem Florida glaubt, dass sie ihn noch Jahre später nicht aus dem Kopf bekommen wird.
Florida ist klug genug, um Martas Existenz nicht zu hinterfragen. Es ist ratsam, die unsichtbare Frau hinter Kace’ heftigsten Gewaltausbrüchen zu ignorieren.
»Kletterst du auf einen Baum, wenn du hier rauskommst? Ich wette, du kletterst als Erstes auf einen Baum«, sagt Kace. »Auf eine ganze Bande von Bäumen.«
Ein knappes Jahr noch, bis sie zum ersten Mal die Chance auf bedingte Entlassung erhält – genug Zeit, um Pläne zu schmieden, sie wieder und wieder umzuwerfen.
»Ich klettere nicht auf Bäume«, sagt Florida. »Und ich verlasse den Staat, sobald das Tor hinter mir zufällt.«
Zehn Schritte – eine volle Runde. »Und dann?« Kace schlägt mit beiden Händen gegen das obere Bett.
Florida seufzt. »Dann gehe ich nach Kalifornien«, sagt sie.
»Florida geht nach Kalifornien«, sagt Kace. »Schade, dass du während deiner Bewährungszeit hierblieben musst.«
»Ich beantrage vorher eine Überstellung«, erklärt Florida. »Damit ich einen Bewährungshelfer in Los Angeles bekomme.« Sie erfüllt die nötigen Kriterien – geeignete Unterkunft, Behandlungspläne für ein Problem, dass sie eigentlich nicht hat, finanzielle Unterstützung.
»Und dann?«, fragt Kace.
»Dann hole ich mir mein Auto.«
»Du glaubst, dass nach all der Zeit ein Auto auf dich wartet? Du glaubst, dass niemand den Wagen für hartes Bargeld verkauft hat? Eine Spritztour damit gemacht hat? Ihn geschrottet hat? Ihn wegen unbezahlter Raten zurückgeholt hat? Du vergisst, dass man uns vergisst, wenn wir weg sind.«
»Das Auto ist noch da«, sagt Florida.
»Und du glaubst, die Karre fährt noch?«
Die Karre – Florida kann ihr nur raten, noch zu fahren. Ein Jaguar E-Type von 1968. Florence’ Mutter hat ihn von ihrem Vater geerbt. Im selben Jahr, in dem sie aufgehört hat, Freeways zu benutzen. Bevor sie ganz mit dem Fahren aufgehört hat. Ihre Therapeuten haben von einer vorübergehenden Paranoia gesprochen. Ihre Angst, einen Unfall zu bauen, die Kontrolle zu verlieren, das Gaspedal bis zum Boden durchzudrücken oder das Bremsen zu vergessen, würde vorbeigehen. Sie haben gesagt, so etwas passiere Frauen im mittleren Alter gelegentlich. Sie haben gesagt, sie werde sich wieder reinfinden.
Stattdessen verkaufte ihre Mutter den Mercedes und den BMW und brachte Florence nirgends mehr hin.
Der Jag stand einfach vergessen in der für sechs Autos konstruierten Garage und sammelte Staub. Bis Florence anfing, ihn ohne Führerschein und ohne erwachsene Begleitperson für den Schulweg zu benutzen. Ihrer Mutter war es egal. Hauptsache, sie musste ihre Tochter nicht selbst fahren.
Florida starrt an die Decke, auf das Spinnennetz aus feinen Rissen. Wenn sie die Augen ein Stück zusammenkneift, verwandeln sie sich in die Freeways ihrer Teenagerjahre. Nicht die durch Los Angeles führenden Hauptadern – die 10 zum Strand, der PCH an der Küste entlang, die 101 von Echo Park nach Santa Barbara, die 405 von der Westside ins Orange County –, sondern die Straßen, auf die ihre Freunde und ihre Mutter sich nicht getraut haben – die 105, die 710, die 605. Die Freeways, die vom respektablen Los Angeles nach Vernon, Commerce, Bell und Carson geführt haben – kleine, in der Metropolenregion aufgegangene Städte, die von all denen ignoriert werden, die zwischen Hancock Park und der Westside wohnen. Was zunächst als Abkürzung oder als Schleichweg bei Staus gedacht war, verwandelte sich in Strecken von eigenständigem Wert. Dort konnte Florence, gerade mal fünfzehn, den Motor des Jag hochjagen und kreuz und quer über die schmalen Freeways brettern, an Casinos, Kraftwerken, Rennbahnen und Kiesverladeplätzen vorbei. Schnell wurde die unvertraute Umgebung so vertraut wie die Kurven der Straßen.
Wo treibst du dich den ganzen Tag nach der Schule rum?, fragte ihre Mutter einmal, mehr neugierig als besorgt.
Nirgendwo, antwortete Florence.
Ihrer Mutter reichte das aus.
»Was hast du mit dem Auto vor? Wo fährst du hin?«, fragt Kace.
»Überallhin«, antwortet Florida.
»Hast du mal Nachrichten gesehen? Niemand darf irgendwohin. Wir müssen im sicheren Zuhause bleiben.«
Bis zu Floridas bedingter Entlassung würde sich das geändert haben. Ihr erstes Ziel ist das Haus ihrer Mutter. Dort holt sie sich den Wagen und fährt los.
Dann bist du also eine, die es zurück an den Tatort zieht, hat Dios gesagt, als Florida ihr von dem Auto erzählt hat. Du bist eine, die ins Auge des Sturms zurückkehrt. Nach all der Zeit hier drin suchst du gleich Ärger und reißt dir als Erstes das Fluchtfahrzeug unter den Nagel.
Es ist bloß ein Auto, sagte Florida.
Du bist ein gemeines Miststück, auch wenn du anders tust. Dann stieß Dios ihr typisches scharfes, kaltes Lachen aus. Ich wette, der Jag ist eine Menge Kohle wert. Vielleicht verkaufst du ihn besser, statt ihn zu fahren.
Mindestens zweihundert Riesen, schätzt Florida. Davon hat sie Dios nichts gesagt. Wozu auch? Dios hat keine Ahnung.
»Fahr einfach«, sagt Florence laut. Wie Carter, ihr Komplize, kurz nachdem er die selbstgebastelte Bombe in den Trailer geworfen hatte. Er hatte es ihr nicht zweimal sagen müssen. Sie war high vom MDMA, ihr Fuß spielte schon mit dem Gaspedal.
»Verdammt, mit wem sprichst du?«, fragt Kace.
»Mit niemandem.«
»Mädchen, der Laden hier lässt dich noch durchdrehen.« Kace wirft Florida einen Blick von der Seite zu. Seit der Randale, seit Tina, wirft Kace ihr diese Blicke häufiger zu. »Alles cool, Florida?«
»Alles cool.«
»Du bist im Kopf nur ganz woanders?«
Florida wackelt mit den Zehen und versucht, den Widerstand des Gaspedals zu spüren, das sie tiefer, tiefer, tiefer drückt. Sie fährt immer schneller und fühlt, wie das Lenkrad an ihren Handflächen vibriert. Selbst jetzt noch, nach allem, was sie mit dem Auto erlebt hat – nach der rasenden Flucht von dem explodierenden Trailer –, will sie den Druck in der Wade spüren, das durch den ganzen Körper aufsteigende, ihr fast den Atem raubende Gefühl der Beschleunigung.
»Sag mir, wo du mich hinbringst, Florida. Sag mir, wohin wir mit dem Auto fahren.«
»Warst du schon mal in Los Angeles, Kace?«
»Großstädte sind nicht mein Ding.«
»Dann fahren wir aus der Stadt raus«, sagt Florida. »Ich bringe dich raus.
Über die 110 zur 105. Dann auf die 605, durch Norwalk, Bellflower, Los Alamitos, dann bei Seal Beach zurück auf die 405.«
»Ich mag den Strand«, erklärt Kace. »Das klingt genau richtig.«
Florida schert sich nicht um den Strand. Was zählt, ist die Fahrt, der Weg durch das Spinnennetz von Freeways, nicht das Ziel. Als sie zum ersten Mal ins Orange County gefahren ist, ohne die 5 oder die 405 zu benutzen, kam sie sich vor, als hätte sie den Code zu einer geheimen Stadt geknackt. Als hätte sie den Code zu sich selbst geknackt. Als könnte sie sehen, wie sie innerlich funktioniert, statt nur ihr Bild im Spiegel zu betrachten.
Sie tickte anders als alle anderen.
Sie schließt die Augen, spürt die Schwingungen des Autos in ihrem Bein, die leichte Anspannung im linken Handgelenk, sobald sie schneller als siebzig Meilen pro Stunde fährt. Sie stützt die Hand auf das imaginäre Lenkrad, greift nach der Gangschaltung und tritt mit dem anderen Fuß auf die imaginäre Kupplung.
Auch nach allem, was geschehen ist – fahr einfach. Denn was sonst sollte sie tun?
Dann aber verändert sich die Atmosphäre in der Zelle, Kace schaltet in einen anderen Gang.
»Du hast bei der Scheiße heute Morgen ja in der ersten Reihe gesessen. Was zum Teufel wollte Dios damit sagen? Das Miststück muss sich immer beweisen. Wir wissen ja, weshalb sie hier ist. Wegen einer Kleinigkeit. Körperverletzung. Notwehr, die aus dem Ruder gelaufen ist.«
Florida legt einen Finger auf die Lippen und deutet zur Lüftungsöffnung, durch die Dios sie hören kann. Aber es ist zu spät. Auf der anderen Seite wird gegen die Wand gehämmert.
»Immer musst du dich beweisen, Dios. Immer musst du uns zeigen, dass du so ein krasses Verbrechen begehen könntest wie wir. Bloß dass es nicht so war. Stinklangweilige Körperverletzung. Und nicht mal besonders schlimm.«
»Schsch«, beharrt Florida.
Kace verdreht die Augen. »Was kümmert’s dich, ob sie uns hört? Egal, was hat Mel ihr überhaupt getan? Da kann sie mit ihrer Gabel gleich auf einen armen Zoo-Elefanten losgehen. Man kann einer Frau keinen Vorwurf machen, nur weil sie dumm wie Brot ist.«
»Doch, wenn man Dummheit für ein Verbrechen hält.«
»Aber das ist es nicht. Ein Verbrechen ist ein Verbrechen. Wenn man Leute für ihre Persönlichkeit bestrafen würde, bekämen wir alle Probleme«, sagt Kace. »Dann wäre es im Knast so voll, dass es kein Knast mehr wäre.« Sie schweigt einen Moment und deutet mit dem Kopf zur Wand. Dadurch hat Florida freie Sicht auf das Kobra-Tattoo, das sich von Kace’ Hals hinauf bis in die wüsten braunen Locken zieht. »Ich weiß, dass du zuhörst, Diana«, sagt sie und zieht Dios’ Taufnamen in die Länge. »Marta hat es mir verraten.« Sie hämmert gegen die Wand. »Sie hört dich sogar, wenn du nicht redest.«
»Wir sind cool, Kace«, meldet sich Dios’ gedämpfte Stimme. »Red einfach weiter.«
Kace dreht eine Runde, dann senkt sie die Stimme. »Hast du sie danach gesehen, Florida? Hast du Mel-Mel gesehen? Hast du ihr Gesicht gesehen?«
Florida hatte es gesehen. Und sie hatte noch etwas anderes gesehen – den herausfordernden Blick von Dios. Bring zu Ende, was du angefangen hast.
»Ich war dabei, schon vergessen?«
»Rat mal, was Mel-Mel den Schließern erzählt hat. Dass sie beim Abräumen mit dem Tablett gestolpert ist. Dass die Gabel sie wie eine Bärenfalle erwischt hat. Die Kerle haben es geglaubt.«
Bevor Florida antworten kann, dröhnt ein bellendes Husten durch den Gang. Kace erstarrt mit verzerrter Miene. Als das Husten aufhört, scheint sie sich zu entspannen. »Mel-Mel hat sich nicht mal auf die Krankenstation bringen lassen. Alles cool, hat sie gesagt. Aber hast du sie gesehen?«
»Es war schlimm, Kace, richtig übel. Ihre Wange sah aus wie Spaghetti. Dünne Streifen und Blut. Und man konnte etwas Weißes sehen, an der Innenseite der Haut. Das, was man eigentlich nicht sehen sollte.«
Florida weiß, dass Kace so etwas liebt. Nicht den Schmerz, aber die Details. »Das meine ich doch«, sagt Kace. Sie atmet tief durch, saugt alles in sich auf und entspannt sich.
Schon bald wird ihr Tagtraum von einem weiteren Hustenanfall unterbrochen.
Kace stampft zur Tür. »Schnauze!«
»Ruhig«, sagt Florida. »Ganz ruhig.«
Die Husterin ignoriert Kace’ Anweisung.
»Schnauze, hab ich gesagt.«
»Ganz ruhig.«
»Nein, halt du die Schnauze. Halt deine verdammte Schnauze«, ruft jemand von draußen.
Kace brüllt zurück. Aber der Streit wird von neuerlichem Husten übertönt.
»Gott-ver-dammt«, schreit Kace. »Jetzt gib endlich Ruhe.« Sie hämmert mit den Fäusten gegen die Wand.
»Ganz ruhig«, wiederholt Florida. »Ruhig, ruhig, ruhig.«
Aber Kace ist nicht mehr zu bremsen. Ihre Stimme klingt mit einem Mal viel tiefer. »Du willst uns alle umbringen. Hör endlich auf mit deinem Husten. Du gottverdammte Mörderin. Mörderin!«
Einen Moment lang bleibt es still. Florida spürt, wie alle den Atem anhalten. Eine erstickende Anspannung hält den Block in eiserner Umklammerung. Erst der nächste Hustenanfall setzt dem Schweigen ein Ende.
Kace schlägt mit erhobenen Fäusten gegen die Wand. »Dein Atem ist tödlich. In dir wohnt der Tod. Behalt ihn drin. Behalt ihn drin, sonst sorge ich dafür, dass du deinen Atem nie wieder brauchst.«
Florida liegt auf dem Bett, so reglos wie möglich. Am liebsten würde sie sich hinausschleichen. Im Gang hört sie die schweren Schritte von Stiefeln, dann schlägt jemand gegen ihre Tür.
»Baldwin! Schluss jetzt!«
Als sie die Stimme des Schließers hört, tritt Kace einen Schritt von der Tür zurück, legt den Kopf zur Seite und denkt nach, denkt nach.
»Schluss damit, Baldwin«, wiederholt der Schließer und klopft noch einmal gegen die Tür.
Kace rennt zur Tür, als wollte sie den Beamten durch das kleine Fenster hindurch attackieren.
»Baldwin.«
Kace lässt die Halswirbel knacken, rollt ihre Schultern und tritt wieder zurück. Kurz darauf entfernen sich die Schritte des Wärters. »Scheiß Arschloch.« Sie dreht sich zu den Betten um. »Arschloch«, wiederholt sie und schlägt auf Floridas Matratze.
»Wer war es?«, fragt Florida.
»Bergman. Er lässt sich von Mel-Mel einen blasen. Ob es ihn wohl stört, dass ihr Gesicht wie Spaghetti aussieht? Wahrscheinlich gefällt es ihm sogar. Kranker Dreckskerl. Marta sagt, Männer wie er bekommen ihre Strafe in der Hölle. Marta sagt, der Teufel hat sich für sie was ausgedacht. Marta sagt …«
Sie wird von lautem Husten unterbrochen. Als Kace zur Tür prescht, fährt Florida sich mit den Fingern durch die Haare.
»Halt die Schnauze«, brüllt Kace. »Halt die Schnauze.«
Aber sie wird von einer anderen, lauteren Stimme übertönt, die sich gegen das Husten und das Gezeter behauptet. »Frau am Boden.«
Frau am Boden. Der Satz hallt den Gang auf und ab. Alle sind an ihren Türen, skandieren die drei Worte, mit denen sie den Schließer und das ganze System wegen allem verdammen, was schiefläuft.
Schon bald sind jede Menge Stiefel zu hören. Florida schaut durch das kleine Fenster in der Tür und sieht drei Wärter mit Masken vorbeilaufen.
Sie hört, wie eine Zellentür geöffnet wird. Die Gefangenen schweigen. Die Stille draußen wird nur vom Knistern der Walkie-Talkies und kurz darauf vom Klappern einer fahrbaren Krankentrage unterbrochen.
Normalerweise halten die Frauen sich bei Notfällen zurück und verzichten darauf, das Chaos durch ihren Lärm und ihre Wut noch anzufachen.
Diesmal ist es anders. Irgendwo weit weg von Florida und Kace fangen die Schläge an – ein einfacher Zweierrhythmus. Ein Herzschlag.
Bam, bam.
Bam, bam.
Eine weitere Zelle stimmt ein. Und noch eine. Bald hämmert der ganze Gang im Gleichtakt. Kace und Florida postieren sich zu beiden Seiten der Tür und schlagen jeweils mit einer Handfläche gegen das Metall.
Bam, bam.
Bam, bam.
Florida hört, wie sich die Trage nähert, die Räder rollen jetzt langsamer. Immer noch schlagen die Frauen an die Türen, als könnten sie den Puls der Patientin mit ihren Händen unterstützen.
Bam, bam.
Florida weiß, dass es ein Zeichen der Solidarität sein soll. Aber es klingt nach etwas anderem.
Sie hat gehört, dass männliche Gefangene in den Nächten vor Exekutionen Totenwache halten – dass sie mit ihren Fäusten, Stimmen oder irgendwelchen Lichtern versuchen, den Verurteilten so lange wie möglich am Leben zu halten, seine Seele und seinen Geist bis zum unausweichlichen Moment zu stärken.
Die Trage rollt an ihrer Zelle vorbei, die Identität der Patientin wird von einer Sauerstoffmaske verborgen.
»Todesmarsch«, sagt Kace. »Sie kommt nicht zurück. Sie kommen nie zurück.«
Der Himmel flimmert vor Hitze – ein Blau, das schon wehtut. Die Sonne brennt in den Härchen auf Floridas Armen. Der Gefängnishof ist voller Frauen, die versuchen, Abstand voneinander zu halten, obwohl sie doch bald alle wieder dieselbe Luft atmen.
Florida sieht Mel-Mel auf einer Bank gegenüber sitzen. Ihre Wange ist notdürftig mit einem blutigen Verband bedeckt.
»Baum.«
Florida schreckt auf, als ihr Name durch den Lautsprecher dringt.
»Baum. Rapport.«
Florida merkt, dass alle sie anstarren, dann aber schnell den Blick abwenden, als wäre der Ärger, der sie erwartet, ansteckend.
Sie stemmt sich von der Bank hoch, wischt sich den Wüstensand vom Hosenboden und den Beinen und geht hinein.
Kace eilt an der Bank vorbei.
»Florida«, ruft sie. »Sie kommen nicht zurück. Das soll ich dir von Marta ausrichten.«
Ein Sergeant erwartet sie mit einer Miene, die so undurchdringlich ist wie eine Totenmaske. »Baum, gehen wir.«
»Wohin?«
»Wollen Sie dem Befehl gehorchen oder Fragen stellen?«
Florida folgt dem Sergeant in einen Bereich des Gebäudes, wo Kurse und Veranstaltungen stattfinden. »Setzen Sie sich«, sagt er und deutet auf eine Bank, auf der schon zwei andere Häftlinge sitzen. »Sie werden abgeholt.«
»Worum geht es denn?«, fragt Florida.
»Ich bekomme Befehle. Ich gebe sie an Sie weiter. Sie gehorchen.«
Florida setzt sich auf die Bank. Die beiden anderen Frauen kennt sie nur vom Sehen. Mavis Jackson ist schon ewig hier, eine ideale Kandidatin für eine Haftentlassung aus humanitären Gründen. Sie hat lange genug gesessen, für sich und für andere gleich mit. Man findet ihr Gesicht auf Broschüren und Websites verschiedener Organisationen. Sie sitzt seit sechsundzwanzig Jahren, weil sie ihren Dealer umgebracht hat – und Frauen wie sie gibt es hier zu viele. Niemand hier hält ihre Schuld für größer als die von Florida.
Die andere Frau ist neu hier. Sie wirkt auffällig zurechtgemacht, als habe sie die Welt draußen noch nicht richtig abgeschüttelt. Ungedeckte Schecks, Identitätsdiebstahl, irgendeine Abzocke, wenn Florida raten sollte. Sie ist jung, Mitte zwanzig, und strahlt eine provozierende Frische aus, die Florida ihr am liebten aus dem Gesicht klatschen würde.
»Weißt du, worum es hier geht?«, wendet sich die Neue an Jackson.
»Keine Ahnung«, antwortet Jackson. Ihr schleppender Ton klingt halb frustriert, halb geduldig.
Die Neue dreht sich zu Florida um. »Und du? Weißt du Bescheid?«
»Was glaubst du denn?«, blafft Florida sie an und rutscht ein Stück weiter die Bank hinunter.
Sie sitzen den Kursräumen gegenüber, in denen alles Mögliche stattfindet, von Erziehungstraining über Creative Writing bis hin zu Bürotraining.
»Und? Was soll das?«, fragt die Neue. »Wir kriegen Ärger. Was haben wir gemacht? Einen Scheiß hab ich gemacht. Überhaupt nichts.«
»Du bist im Knast«, stellt Jackson fest. »Irgendwas wirst du schon gemacht haben.«
Die Tür des Kursraums öffnet sich, ein Schließer steckt den Kopf heraus. »Baum?«
Florida verdreht die Augen. Sie ist als Letzte gekommen und muss als Erste aufs Schafott.
»Hast du Angst?« fragt die Neue. »Glaubst du, es wird schlimm?«
»Halt die Klappe«, sagt Florida. »Warte einfach, bis du dran bist.«
Marta richtet dir aus, dass sie nicht zurückkommen.
Florida geht auf die offene Tür zu.
Als sie eintreten will, steht sie plötzlich Auge in Auge einer anderen Gefangenen gegenüber, die herauskommt. Dios.
Florida erstarrt und weicht einen Schritt zurück. Dios bleibt stehen, legt den Kopf zur Seite und mustert sie von oben bis unten. Sie verzieht die Lippen – amüsiert, wütend, frustriert, wer weiß? Schließlich setzt sie ein breites, grausames Grinsen auf. »Florida«, sagt sie, »anscheinend haben wir beide sie verarscht.«
Ihre schwarzen Haare sind zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden, die Locken fallen ihr über die Schulter. Ihre Wangenmuskeln zucken.
»Wir sehen uns, wo auch immer.« Dios verzieht den Mund, dann formt sie mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole und richtet sie auf Floridas Schläfe. Mit einem unnötigen Rempler schiebt sie sich an Florida vorbei.
»Baum«, blafft der Schließer, als wäre es ihre Schuld, dass sie den Raum nicht längst betreten hat.
Alles ist freigeräumt. Die Tische hat man bis auf einen an die Wände geschoben. Mitten im Raum sitzt Officer Markum, dem die Wärter in ihrem Trakt unterstellt sind. Er starrt auf die oberste Mappe eines kleinen Stapels, neben dem ein Telefon steht. Das Kabel zur Dose an der Wand ist maximal gespannt.
Hinter Florida schließt sich die Tür. Der andere Schließer postiert sich davor, als rechne er mit einem Fluchtversuch.
»Nummer«, bellt Markum. Er ist im mittleren Alter, seine bleiche Haut verrät, dass er den größten Teil seines Lebens in geschlossenen Räumen verbracht hat. Das Gesicht ist von Narben und Kratern überzogen, ein permanentes düsteres Schattenspiel, das den abweisenden, mondartigen Eindruck noch verstärkt.
Florida rattert die Ziffern herunter, die zu ihrer Ersatzidentität geworden sind.
»Setzen«, sagt Markum.
Die Wände sind mit Materialien aus verschiedenen Kursen tapeziert. Ein verblasstes Poster mit einem Gedicht von Langston Hughes. Auf einem anderen sind in penibler Kursivschrift Zeilen von Walt Whitman festgehalten. Gegenüber hängt ein Diagramm mit einfachen Yogastellungen. Die hintere Wand ziert ein Whiteboard mit halb abgewischten Zahlen, die von einem Anfängerkurs in Buchhaltung oder Betriebswirtschaft übriggeblieben sind. In der linken oberen Ecke des Boards steht ein einzelnes Wort: Trust.
Florida lässt sich auf den harten Plastikstuhl fallen. Markum blickt von seiner Mappe auf. »Florence Baum?« Seine Stimme klingt lustlos und erschöpft, als liege eine unangenehme, beschwerliche Pflicht vor ihm.
Florida hält sich an der Sitzkante fest. Sie spürt, wie ihre Handflächen feucht werden.
»Wissen Sie, warum Sie hier sind?«
Florida hält Markums Blick stand. Aber sie sieht ihn nicht, nicht richtig. Stattdessen sieht sie Tinas zerschlagenes Gesicht vor sich wie eine faulige, zertrampelte Aubergine.
Scheiß Dios. Immer diese scheiß Dios.