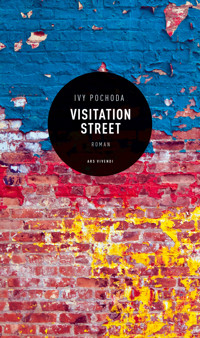Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als ein Teenager aus der mysteriösen Heiler-Kommune seines Vaters in der Mojave-Wüste flüchtet, setzt er damit eine spektakuläre Reihe von Ereignissen in Gang, an deren Ende sich die Wege von mehreren Personen kreuzen, die allesamt ihrer Vergangenheit entfliehen wollen. Da ist der Mörder Ren, der in L. A. seine Mutter sucht, Britt, die ein dunkles Geheimnis mit sich trägt, Tony, ein unglücklicher Anwalt kurz vor dem Nervenzusammenbruch, und da sind die Gewalttäter Sam und Blake, die sich im Wonder Valley verstecken. Unter der gnadenlosen Sonne Kaliforniens knallen die Schicksale der verlorenen Seelen auf eine schockierende Weise aufeinander, wie es nur in dieser so betörenden wie gefährlichen Metropole möglich ist - ein mit visionärer literarischer Kraft geschriebenes Porträt von Los Angeles, eine Bestandsaufnahme der Hoffnungen unserer Gegenwart, aber auch ein Thriller voller Twists mit einem grandiosen Finale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ivy Pochoda
Wonder
Valley
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Roth und Rudolf Hermstein
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
Wonder Valley bei ecco/HarperCollins Publishers.
Die Arbeit der Übersetzer an diesem Buch wurde durch ein Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e. V. gefördert.
Copyright © 2017 by Ivy Pochoda
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage April 2019)
© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-995-1
Den Schriftstellern und Künstlern des Lamp Arts Program gewidmet
inhalt
prolog
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
danksagung
die autorin, die übersetzer
When they said repent repent
I wonder what they meant.
Leonard Cohen, The Future
prolog
Los Angeles, 2010
Als Bild ist es schön – ein joggender Mann, über seiner einen Schulter die San Gabriel Mountains, über der anderen der Anstieg des Hollywood Freeway, der zum Bogen über den Pasadena Freeway ansetzt. Sein Oberkörper ist nackt, unter der gebräunten Haut spielen Schwimmermuskeln, die Arme pumpen im Takt zum Eins-Zwei der Füße. Man könnte ihn direkt beneiden.
Sieben Uhr früh, und im Stadtzentrum staut sich schon der Verkehr, kommt zum Erliegen, während Autos fünf Fahrspuren zu queren versuchen, sich so stockend vorwärtsarbeiten, dass ihr Vorankommen mit dem Auge kaum wahrnehmbar ist. Vom Pasadena Freeway her fädeln sie sich auf den Hollywood oder den Santa Ana Freeway ein, und das dauert. Nur er bewegt sich frei, läuft entgegen dem Pendlerfluss zwischen den eingekeilten Autos hindurch.
Die Fahrer hinter ihren Lenkrädern starren ihn an, kurzzeitig abgelenkt von ihrem Gefummel mit den Radiosendern, dem Make-up, das sie im Rückspiegel auflegen, den Telefonaten mit Freunden an der Ostküste, deren Tag schon voll ausgeformt ist. Sie sind extra früh aufgebrochen, um dem Stoßverkehr zu entrinnen, diesem fatalen Ausgebremstsein am Morgen. Sie haben alles durchgerechnet, die Dauer ihres Wegs nach der Formel veranschlagt: Strecke durch Geschwindigkeit. Dennoch stehen sie nun Stoßstange an Stoßstange. Für diese Stadt der Autofahrer ist der Mann eine Ohrfeige.
Er läuft unberührt von all den Opfern, die diese Pendler zu Hunderten gebracht haben, um pünktlich im Stau festzustecken – das Frühstück ausgefallen, die Kinder nicht mehr gesehen, der Ehemann allein daheim im Bett, die Nacht viel zu kurz, der Tankstellenkaffee eine dünne Plörre, die Fahrgemeinschaft ein Quell des Verdrusses, dazu der entgangene Schlaf, die eilige Dusche, die Kleider von gestern, das Make-up von gestern.
Er ignoriert die Autofahrer, die in ihre klimatisierten Wagen eingekapselt sind, gefangen im ersten Nachrichtenzyklus und der Leier von Radio Top 40. Er zieht vorbei an den kleinen Verzweiflungen des Morgens, den schon im Keim angelegten Problemen, der Sehnsucht danach, anderswo zu sein, egal wo, nur nicht hier, heute und morgen und all die anderen Tage, die verklumpen zu einem stadtweiten Gewirr von Freeways und gesperrten Fahrspuren und Staumeldungen – ein ganzes Dasein, verengt aufs Stop-and-go.
Sein Blick ist gelöst, ein Marathonläufer auf halber Strecke, aufs Ziel fokussiert und noch nicht überwältigt von der Entfernung. Er läuft unangestrengt. Aber die Frau in dem verbeulten Cabrio wird später sagen, er hätte ganz klar irgendetwas genommen. Der Mann mit dem frisierten Hatchback wird erzählen, dass er mega high war, die volle Dröhnung, total durchgeknallt, ey. Ein paar junge Mädchen in einem SUV weit über ihre Verhältnisse, die ihn kaum wahrgenommen haben, werden berichten, dass er aussah wie ein Superheld, aber keiner von den coolen.
Der Tag ist von einem unbestimmten, wetterlosen Grau. Die Sonne verspätet sich wie alles andere an diesem Morgen. Über den Bungalows von West Adams und Pico-Union, südlich der 10, hat die Luft eine apokalyptische Trübheit. Die Farbe übler Entwicklungen oder ihres Nachspiels.
Die Stadt, an die man immer denkt, erstreckt sich im Westen, jenseits der wuchernden Ausländerviertel, wo Koreaner Seite an Seite mit Salvadorianern leben, Armenier Rücken an Rücken mit Thais. Sie beginnt bei den langen Boulevards mit den klingenden Namen, die gesäumt sind von altmodischen Kinos, abgehalfterten Tropenmotels und Restaurants mit livrierten Türstehern, und endet, wo die Straßen in den Strand auslaufen. Aber hier in dem Einschnitt, den sich die 110 durchs Zentrum gräbt, ist diese andere Stadt kaum eine Erinnerung. Hier gibt es nur die Blechlawine der Autos und die spiegelnden Flächen verglaster Wolkenkratzer.
Der Läufer müsste eine Acht-Minuten-Meile hinlegen, schätzt der Mann am Steuer eines SUV, der verschlafen hat und deshalb auf seine Joggingrunde verzichten musste. Ihm fehlt die frühmorgendliche Tour durch Beverlywood, das leere Schweigen des Vororts, wo er Sackgassen bis an ihr Ende folgt, in die Wohnzimmer dunkler Häuser späht, während das Pedometer seine Schritte mitzählt, Kalorien und Strecken aufzeichnet, bis das Ritual des Morgens abgeschlossen ist. Was mag ihm alles entgangen sein?, fragt er sich – Kojoten, die im Morgengrauen heimwärts schleichen, ein schief in einer Einfahrt geparktes Auto, dessen Fahrer wohl ein paar Drinks zu viel hatte, ein schlafender Mann im bläulichen Schein seines Fernsehers, ein Mädchen, das zur elterlichen Hintertür hineinhuscht, vor einem fremden Gartentor abgestellte Plastiktüten mit leergetrunkenen Schnapsflaschen darin. Während dieser gestohlenen Stunden, bevor seine Frau und die Kinder ihn in Beschlag nehmen, meint er einen Blick in die verborgene Seele seines Viertels zu tun, meint hinter den Fassaden der Bungalows, den getrimmten Rasenflächen austauschbarer Vorgärten heimliche Unzufriedenheiten zu entdecken.
Niemand spornt ihn an bei dieser frühen Laufrunde, niemand bekommt seine keuchenden Atemzüge auf der sechsten Meile mit, den heroischen Triumph über seine erlahmende Willenskraft. Während er den Läufer zwischen den stehenden Autos hindurchsteuern sieht, spürt dieser Fahrer die Lahmheit in seinen Beinen nach dem alkoholreichen Vorabend gleich doppelt.
Er möchte die Stunde zurückholen, um die er sich selbst betrogen hat, indem er sich vorhin im Bett, statt in die Laufschuhe zu steigen, lieber noch einmal umgedreht hat, ehe die Pflicht endgültig rief. Ohne das Laufen wird der heutige Tag den Pendlern in ihren Wagen gehören, dem Team, das in der Arbeit auf ihn wartet, und nun diesem hemdlosen Jogger, der an den Autos auf der 110 vorbeizieht.
Er lässt das Fenster herunter und reckt sich hinaus, um dem Jogger nachzuschauen. Der Mann läuft gut – Oberkörper aufrecht, Schultern locker, Hände nicht zu Fäusten geballt. Der Fahrer wölbt die Hand um den Mund zu einem anfeuernden Ruf. Dann sieht er, dass der Jogger nackt ist. Rasch taucht er zurück ins Wageninnere, fährt das Fenster hoch und nimmt sein Handy zur Hand, geht über zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung.
Die Schnellstraßen sind immer für ein Spektakel gut. Dieses Jahr hat schon eine unentdeckte Rockband die 101 zwischen Sunset und Hollywood Boulevard abgeriegelt, um auf der Ladefläche eines Pritschenwagens ein Konzert zu geben, auf der 5 sind aus einem stehenden Kombi drei Pudel entwischt, die sich zwischen Burbank und Los Feliz Boulevard ein Wettrennen lieferten, und auf der 405 Richtung Norden hat sich eine verlorene Ladung Zwiebeln über alle vier Spuren verteilt. Es gab zwei Autoverfolgungsjagden, die mit Schüssen und lodernden Flammen endeten, und auf der 10 kurz vor dem Flugplatz von Santa Monica musste eine Propellermaschine notlanden. Immer wieder legen hier das Unerwartete, das Bizarre und das Tragische den Verkehr lahm und vereinen die Blicke der Stadt auf sich.
Doch auch die, die feststecken, wollen in der Geschichte vorkommen. Sie wollen ihr Erlebnis im Radio gemeldet hören, wollen hautnah dabei gewesen sein, anstatt abgeschlagen hinten im Stau. Schon jetzt formen diese Pendler den Anblick des nackten Joggers zu einer Anekdote um, die sie erzählen werden, wenn sie endlich angekommen sind, bereiten sie für ihre Zuhörerschaft auf, schmücken ihren eigenen Anteil daran aus, kehren das Empörende, das Verrückte oder das Bewegende daran hervor, je nachdem.
Ein Hubschrauber steigt über die Bürotürme im Zentrum auf und steht über der Gabelung 101/110. Er verweilt kurz über dem Läufer, bevor er nach rechts abschwenkt und einen Kreis über der Kreuzung dreht. Das an- und abschwellende Knattern des Propellers trägt zusätzlich bei zu der angespannten Stimmung des Morgens, ein aggressives Geräusch, das weit Bedrohlicheres suggeriert als einen Mann, der durch den Verkehr joggt.
Zwei Autos blockieren sich gegenseitig – das eine will auf die Überholspur wechseln, das andere sie verlassen. Der Läufer setzt über die dicht an dicht stehenden Stoßstangen hinweg; »Scheißperverser«, schallt es hinter ihm her.
Eine Frau hält ihrer Tochter die Augen zu. Eine andere lässt die Hand mit dem Lippenstift sinken und dreht den Kopf, um seinen Hintern zu bewundern, während der Läufer weitertrabt Richtung Süden. Die Leute lehnen sich aus den Fenstern, halten Smartphones hoch, machen Videos, die hoffentlich massenweise Klicks bekommen werden.
Der Mann, der sich um seine Laufrunde gebracht hat, ruft seine Frau an. Es ist eine Reflexhandlung, gedankenlos ausgeführt. Sein Handy steckt in seiner Hemdtasche, auf Lautsprecher geschaltet. Als seine Frau abhebt, sagt er nichts, lauscht stattdessen den Morgengeräuschen seiner Familie. »Tony? Tony?«, sagt sie. »Tony!« Pling, macht die Mikrowelle, dann klappert ein Teller auf der Granitplatte. »Tony, deine Tasche ruft mich an.« Er hört die Mikrowelle aufgehen. »Anthony, deine Tasche ruft mich an. Schon wieder«, sagt sie, obwohl sie beide wissen, dass auf seinem Telefon kein früherer Anruf verzeichnet sein wird. Er fasst in die Tasche, unterbricht die Verbindung. Er schaltet auf Parken und dehnt seine Wadenmuskeln.
Rings um ihn nesteln die Leute an ihren Radios herum, suchen nach der Story zu ihrer Verspätung. Sie recken die Hälse nach dem Hubschrauber, beobachten sein enges Kreisen, versuchen zu sehen, ob es die Presse ist oder die Polizei.
Die ersten Radiodurchsagen sind wenig informativ, Teil einer wachsenden Liste von Staumeldungen im Stadtgebiet. Ein liegen gebliebenes Fahrzeug in der rechten Spur der 710 Nähe Artesia Boulevard. Ein Unfall auf der 5 Richtung Norden Höhe Colorado Boulevard. Auf der 110 durch die Innenstadt zwischen Fourth und Hill Street Stillstand; hier kommt Ihnen ein Jogger entgegen.Auf der 101 Richtung Süden zähflüssiger Verkehr am Cahuenga Pass. Auf der 405 fünfzehn Minuten Fahrzeit zwischen Getty Drive Center und der 10. Nichts Ausführlicheres. Keine Erklärung. Eine Tatsache unter vielen.
Ren fährt nicht gern, er hat spät angefangen und ist nie warm damit geworden. Er hat keinen Führerschein, von einem Auto ganz zu schweigen. Weshalb dieses hier heiße Ware ist, frisch geklaut aus einer Seitenstraße der Mateo Street. Ren setzt darauf, dass das Universum einen Ausgleich schaffen wird.
Nicht, dass er es für sich tut, er will ja keine Spritztour machen oder den Honda zu einer Ramschwerkstatt bringen und die Teile versilbern. Er braucht ihn nur ganz kurz, zwei Stunden maximal, um Wort zu halten und mit Laila zum Meer zu fahren. Dann wird er den Wagen irgendwo abstellen, wo die Bullen ihn ohne einen Kratzer wiederfinden, so als hätte die Karre sich ganz von selbst auf die Socken gemacht.
Aber der Stau war nicht eingeplant. Beim ersten Sirenenjaulen schwitzen seine Handflächen, und sein Herz wummert im Gleichtakt mit den Propellern. Keine gute Tat – das weiß er auch selbst!
Sein Instinkt befiehlt Ren zu türmen, den Honda stehen zu lassen, sich zwischen den Autos durchzuschlängeln, über die Leitplanke zu setzen und im Straßengeflecht der Innenstadt unterzutauchen. Aber Familie ist Familie, und er kann sich bestens Lailas Ton vorstellen, wenn er abhaut: Kann nicht ein gottverdammtes Versprechen halten, egal wie einfach. Sagt, wir fahren zum Strand, und kaum wird’s brenzlig, macht er die Biege.
Er schaut auf die Zeitanzeige am Armaturenbrett. Keine halbe Stunde, seit er den Accord kurzgeschlossen hat.
»Alles gut«, sagt er zum Rückspiegel.
Ren lebt nicht im L. A. der Autos, sondern an einem Ort, wo die Menschen zu Fuß gehen, kriechen, humpeln. Wo sie auf die Straße hinausstolpern und vom Bordstein torkeln. Wo niemand ein Haus hat und erst recht niemand einen Wagen. Einem Ort, wo zu viele Besitztümer nur Probleme machen.
Schau sie dir an, diese Leute in ihren Wagen, die überquellen von Sachen: Rücksitze vollgehäuft mit Ersatzkleidung und Notfallsnacks, und unter den Sitzen so viel verlorenes Zeug, dass es für ein ganzes Leben reichen würde. Kabel zum Aufladen der Geräte, die beim Fahren verboten sind. Fernsehbildschirme an der Rückseite der Sitze. Alles nur dazu da, sie abzulenken vom Hier und Jetzt. Ren wischt sich die Handflächen an der Jeans ab. Er drückt an den Knöpfen herum, stellt das Gebläse von ganz heiß auf ganz kalt, ein komplettes Wettersystem im Drehen eines Rädchens.
In den Autos vor ihm fahren die Leute ihre Fenster runter, beugen sich heraus, um auf etwas zu schauen, das den Freeway entlangkommt. Ren lässt den Gurt an, das Fenster zu, die Augen auf der digitalen Radioanzeige – ein Pendler unter vielen, der die Zeit absitzt, bis er erlöst wird. Er ist wie du oder ich, fingert an Knöpfen und Schaltern herum, sucht nach einer Kombination von Temperatur und Musik, die diesen Moment schneller vergehen lässt. Vor lauter Konzentration aufs Nichtauffallen verpasst er um ein Haar die Show: einen nackten Jogger, der den stehenden Autos entgegenkommt. Ren blickt gerade noch rechtzeitig auf, um ihn von vorn zu sehen. Er kennt den Läufer, ein weißes Gesicht im Panorama der Skid Row. Nicht direkt zu dem Viertel gehörig, aber zu seinem Umfeld. Ehe Ren das Fenster herunterlassen, sich dem Jogger bemerkbar machen, ihm Zuflucht bieten kann, ist er zwischen zwei Lastern verschwunden.
Der Läufer passiert die Ausfahrt Sixth Street und wechselt auf die Überholspur. Dann flankt er über die Mittelplanke, sodass er jetzt mit dem Verkehr läuft, die 110 hinab Richtung Süden. Er hält Schritt mit dem stetigen Strom von Autos, die auf die Ausfahrt zur 10 zurollen. Aber hinter ihm gehen die Fahrer vom Gas, bremsen, trauen sich nicht recht an ihm vorbei.
Scheißkerl.
Zieh dir erst mal was an!
Sag mal, tickst du noch?
Geiler Arsch.
In den Lokalnachrichten tauchen die ersten Bilder auf, der Läufer ein beiger Strich in den grauen Straßen von Downtown L. A.
Der Verkehr Richtung Norden staut sich inzwischen bis zu der Rampe, wo die 110 von der 10 abzweigt und nach Westen führt, vorbei an Hoover, Western, Arlington, stockt schon ein Stück vor Crenshaw, weshalb auch niemand mehr auf die Abbiegespur kommt. Bald werden sie bis nach La Brea stehen.
Ein Mann mit Tattoos bis zur Schulter hinauf, der in einem gelben Mercedes Diesel auf der 10 ostwärts fährt, auf dem Heimweg von der Party nach der Party, schaut einem zweiten Helikopter nach, der Richtung Zentrum fliegt. Hören kann er ihn nicht, aber er sieht ihn über dem Freeway Kreise ziehen wie ein Raubvogel. Der Anblick erinnert ihn an die Wüstenranch, wo er seine Jugend verbracht hat, an die Bussarde, die über dem Land seiner Eltern Jagd auf Kaninchen und Mäuse machten, an die Schatten ihrer ausgespannten Flügel, die so lautlos über Sand und Strauchwerk glitten. Ihm graute immer schon vor dem Moment, wenn sie zuschlugen, mit vorgereckten Fängen herabstießen, sodass ihre Schatten rasend schnell größer wurden, ihre Flügel raschelnd wie zerreißender Stoff.
Der Fuß rutscht ihm von der Bremse, und er fährt auf den Wagen vor ihm auf; ein Stau im Stau, während er und der andere Fahrer sich zum Seitenstreifen hinübermanövrieren, um Daten auszutauschen.
Das Telefonklingeln in seiner Hemdtasche schreckt Tony auf. »Hast du das mitgekriegt?«, fragt seine Frau. »Irgend so ein Psychopath rennt die 110 entlang. Nackt. Wer macht so was? In der Stoßzeit?« Aus der Gegenrichtung hört er einen Streifenwagen heranjaulen, sich seinen Weg durch den Verkehr bahnen, der in Erwartung des drohenden Staus im Schneckentempo dahinkriecht.
»Tony? Hast du ihn gesehen?«
»Ja, hab ich.«
»Und?«
»Er lief da.«
»Und sonst nichts?«
Tag für Tag dieselbe Strecke. Über die breiten Boulevards zur 10 West. Die 10 West zur 110 Nord durch Downtown. Die 110 Nord zur 5 Nord bis nach Burbank, während sein Wagen durch Viertel hindurch oder an ihnen entlang oder über sie hinwegfährt, deren Namen er nur halb weiß, deren Straßen ihm nichts sagen. Eine Stadt, gedankenlos durchquert.
»Tony? Du solltest deine Türen verriegeln. Das haben sie in den Nachrichten gesagt.«
Von Fernseher zu Fernseher, Computerbildschirm zu Computerbildschirm wird der Jogger die Stadt erobern. Er wird in Wohnzimmern auftauchen, auf Arbeitsplatten in Küchen. Die Leute werden ihn joggen sehen, während sie auf dem Laufband die Kalorien des Vorabends verbrennen. Er wird auf Smartphones aufpoppen, sein Weg durch die Stadt zu Handtellergröße geschrumpft.
»Hast du deine Türen verriegelt? Man weiß nie, was passiert.«
»Ich verriegle meine Türen nicht.«
Es macht ihn irr, hier im Stau zu stecken, während der Läufer sich frei bewegt, nicht im Transit begriffen, sondern Teil der Stadt, Teil des Geschehens.
»Was denkst du, wann du heimkommst?«
Der Läufer verlässt den Freeway und erklimmt die Böschung gleich nach der Seventh Street. Nur wenige Autofahrer sehen ihn den Hang mit seinen abgasverseuchten Bäumchen hochtraben und einen Bogen um die kümmerlichen Büsche schlagen, die eine knallbunte Wohnanlage im mediterranen Stil abschirmen. Er kommt auf der Bixel Street heraus, hält einen Moment inne, bevor er auf die Seventh zurückschwenkt und ihr nach Westen folgt.
Langsam bleibt das Zentrum hinter ihm zurück, weicht dem Niemandsland von Klinikbauten, freudlosen Mietshäusern und Schnellrestaurants. Er läuft an Geschäftsleuten in protzigen Schlitten vorbei, die unterwegs zu den gläsernen Türmen des Bankenviertels sind, an Lieferwagen auf der Rückfahrt zum Lager, Radfahrern, die sich zwischen den ständig stoppenden Bussen durchfädeln.
Es ist eine seltsame Zuschauermenge, durch die er joggt: Billigarbeiter auf dem Weg zur Frühschicht, Obdachlose von der Skid Row eine gute Meile weiter östlich, Krankenhauspersonal – MTAs und müde Schwestern – frisch von der Nachtschicht, Bewohner der wenigen baufälligen Häuser, Illegale, die auf einen Job im Baumarkt hoffen. Denen, die ihn hier sehen, kommt der Läufer wie eine Erscheinung vor.
Sie jagen ihn im Helikopter, über die Wilshire Street weiter zum Park, der Polizeihubschrauber mit minimalem Vorsprung vor den Nachrichtenleuten. Auf der 110 im Innenstadtbereich nach wie vor Stillstand. Der Auffahrunfall auf der 10 blockiert nicht mehr die Fahrbahn. Fahrzeit über den Pass zwanzig Minuten. Auf der 5 Richtung Süden stockender Verkehr zwischen der 710 und der 605. Achtung auf der 105: Auf Höhe des Flughafens liegt eine Matratze auf der rechten Fahrspur.
Tony sieht die beiden Hubschrauber nach Westen abschwenken. Er schnallt sich ab und stößt die Tür auf. Er hievt sich aus seinem Sitz und lässt den Schlüssel stecken. Die Aufwärmübungen schenkt er sich. Er läuft los, folgt dem Kurs des Joggers zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch und weiter in die Straßen der Stadt.
Tony ist ein Ausstattungsfreak: Trailrunning-Schuhe, Barfußschuhe, Energy-Boost-Schuhe, wärmespeichernd im Winter, feuchtigkeitsregulierend im Sommer, iPod, Sportkopfhörer, GPS-Uhr, Kalorienzähler, Herzfrequenzmonitor, Dutzende von Outfits und technischen Mätzchen, um sein Laufen temporeicher zu machen, professioneller, bedeutsamer. Dennoch spürt er bei seinen Morgenrunden ein Ziehen im Quadrizeps, das bis zu den Waden hinunterstrahlt, bis er sich eingelaufen hat. In seiner Hüfte knackst es, und das rechte Knie sticht. Ganz gleich, wie viel er für seine Ausrüstung ausgibt, er fühlt sich nie so gut, wie er sollte.
Aber als er nun in Buttondown-Hemd, Anzughose und Slippern die 110 entlangjoggt, knarzt nichts. Seine Glieder sind locker. Er ist nicht eingekapselt in die Musik aus den Kopfhörern, sondern wird getragen von den Geräuschen der Stadt. Selbst das harte Klappen seiner dünnen Schuhsohlen auf dem Asphalt beschwingt ihn.
Verdammt, noch einer?
Sie können doch nicht Ihr Auto alleinlassen. Sie können doch Ihr Scheißauto nicht alleinlassen!
Ist dir dein Lover abgehauen?
Die Rufe spornen ihn an. Nach der Seventh läuft er die Böschung hoch und dann Richtung Westen. An der Kreuzung Seventh/Lucas Avenue erblickt er eine Ecke weiter den nackten Jogger und setzt die Verfolgung fort.
Der Jogger hat die Ausläufer von Pico-Union erreicht, ein Gewirr aus salvadorianischen und honduranischen Läden, Tauschmärkten und Callcentern. Er läuft bis zur nächsten Kreuzung und schwenkt dort in den MacArthur Park, wo Obdachlose und Leute, die es nicht mehr nach Hause geschafft haben, im Gras hingestreckt liegen wie Leichensäcke.
Auf dem Standstreifen der 10 kommt derweil der Tätowierte in dem alten Mercedes zunehmend ins Schwitzen. Er versucht nachzurechnen, wie viele Stunden sein letzter Drink her ist, versucht, seine Promillezahl abzuschätzen, die Kosten dieses Unfalls zu überschlagen. In seiner Hosentasche vibriert sein Handy so beharrlich, dass ihm schon das Bein kribbelt. Es ist seine Mutter. Er hält das Telefon ans Ohr.
»Das ist dein Bruder.«
»Was?«
»Der Mann in den Nachrichten. Hörst du überhaupt keine Nachrichten? Sie bringen es auf allen Sendern. Er läuft. Auf der 110. Das heißt, jetzt schon nicht mehr. Jetzt ist er irgendwo in der Innenstadt.« Seine Mutter seufzt ins Telefon. »Aber das Beste kommt noch«, sagt sie.
Der Mann fasst das Lenkrad fester und zieht sich ein Stück hoch, verrenkt den Hals Richtung Downtown, als müsste er seinen Bruder durch die Straßen dort rennen sehen.
»Er ist nackt.«
Ren bricht der Schweiß aus, als der Polizeihubschrauber über ihm kreist und zwei Streifenwagen sich hupend und sirenenheulend zwischen den stehenden Autos durchzwängen. Er sagt sich die Wegbeschreibung vor: die 110 bis zur 10, und die bis ans Ende. Kurzer Kontrollblick nach hinten – ist seine Mom noch zugedeckt, liegt sie bequem? Er kann nur hoffen, dass es das erst mal war mit den Bullen. Aber er wird immer hibbeliger, will nichts wie raus aus dem Stau. Cool bleiben, befiehlt er sich. Er kann es sich nicht leisten, aggressiv zu fahren, aufzufallen, selbst in dieser Nullachtfünfzehn-Karre.
»Alles im Griff, Mama«, sagt er. »Alles im Griff.«
Tonys Herz schlägt in schweren Stößen. Er sieht den nackten Läufer in den Park abbiegen. Er sieht ihn einen Bogen um den Teich machen. Tony trabt schräg über die Straße. Er hat den Gehsteig noch nicht erreicht, da kommt hinter ihm quietschend ein Polizeiauto zum Stehen, ein zweites holpert über den Bordstein und schneidet ihm den Weg ab.
Tony tänzelt auf der Stelle. Dann bringen die Cops ihn zu Fall.
»Ich hatte ihn fast«, sagt er noch, da schlägt seine Wange auf dem Asphalt auf.
Die Beamten legen ihm Handschellen an, aber er schafft es, den Oberkörper so weit hochzurecken, dass er vor sich den Park sieht.
»Wo ist er?«, fragt er.
Denn der Läufer ist weg. Gerade war er noch da, auf der Ostseite des Teichs, den er gegen den Uhrzeigersinn umrundet hat. Tony könnte es schwören. »Wo …«, sagt er noch einmal, als die Handschellen zuschnappen.
Er kann zuschauen, wie eine Handvoll Polizisten in den Park stürmen, wie sie sich in zwei Gruppen aufteilen, die von beiden Seiten um den Teich laufen. Durch das Knistern der Funkgeräte hört er die Meldung hereinkommen – der Jogger ist spurlos verschwunden.
Die Augen der Stadt waren auf ihn gerichtet, und dann waren sie es nicht mehr. Ein Waldbrand bedrohte den Malibu State Park. Im Peninsula Hotel wurde eine Sängerin tot aufgefunden. Und die Aufmerksamkeit verlagerte sich weiter westwärts, weg von dem nackten Mann auf der 110. Aber er war da – Tony und Ren wissen es beide. Und er ist immer noch irgendwo, laufend, nackt. Er wird wieder auftauchen. Er muss. Denn niemand verschwindet für immer. Nicht in Los Angeles. Nicht, während so viele zuschauen.
eins
Britt, Twentynine Palms, 2006
Sie konnte vermutlich dankbar sein, dass der Trucker bisher nur auf das schattige Dreieck unter dem Saum ihres Minirocks geschielt hatte, dieses dunkle V am Ansatz der Oberschenkel, auf denen der Schweiß glitzerte. Jetzt spielte seine Hand am Funkgerät herum, deutlich öfter als notwendig. Bald würde es das Handschuhfach sein. Dann ihr Knie.
Britt kannte das. Sie kannte dieses beiläufige Näherrücken von Männerhänden, die schubartigen Vorstöße, von denen ihre Besitzer glaubten, sie fielen nicht auf. Immer die gleiche Masche, ob Tenniscamp, Verbindungsparty, Mannschaftsbus oder Hörsaal. Ihre Hände krochen an ihr herum, als wäre sie zu verpeilt, es zu merken.
Am Straßenrand ein Circle K-Markt. Dann ein Schild mit der Warnung NÄCHSTE TANKSTELLE 100 MEILEN. Die Sonne war hinter ihnen untergegangen, und nun fuhren sie auf dem zweispurigen Highway in die hereinbrechende Dunkelheit. Britt reckte den Hals, versuchte, in der dämmrigen Wüste irgendwelche Konturen auszumachen.
Das Funkgerät war auf Mittelwelle gestellt, durch Krachen und Knistern drang viel gutturale Entrüstung. Eine scharfe Kurve, der Laster legte sich nach rechts. Der Fahrer sicherte Britt mit dem Arm ab, damit sie nicht gegen das Fenster prallte. Und dann lag seine Hand auf ihrer Hüfte. Als wäre nichts. Sie sah kurz zu ihm hinüber: Wassermelonenbauch, der auf den Schenkeln auflag, rötlich-graue Bartstoppeln, die Augen verquollen von zu vielen Nächten hinterm Steuer. Sein Blick blieb auf die Straße geheftet, als hätte die Hand nichts mit ihm zu tun. Als wäre sie aus eigenem Antrieb auf Britts Hüfte spaziert.
Britt drückte sich ans Fenster und starrte aus dem Führerhaus nach draußen, wo die soliden Lehmziegelhäuser und Bungalows von Joshua Tree und Twentynine Palms zusammengestoppelten Behausungen wichen, abenteuerlichen Kreuzungen aus Fertighütten, Wellblech, Frachtcontainern und Trailern. Die Vorplätze, an denen sie vorüberfuhren, waren übersät mit dem Abfall des Wüstenlebens – Haufen von Eisenschrott, alte Karosserien, durchgerostete Wassertanks –, wie zur Mahnung an all die Dinge, die hier draußen schiefgehen konnten.
»Hier bist du echt ab vom Schuss«, sagte der Fahrer.
»Das ist der Plan«, sagte Britt.
»Ein Mädchen mit einem Plan.« Sein Griff um ihre Hüfte verstärkte sich.
Sie kamen an einem winzigen Flugplatz mit lila blinkenden Lichtern vorbei. Und danach nichts mehr.
Wieder eine Kurve und gleich darauf noch eine, ein dramatischer Schwenk nach rechts.
»Stopp«, sagte Britt. »Da ist es.«
Der Laster donnerte weiter.
»Stopp!«
Der Fahrer bremste scharf. Die Reifen quietschten, der Laster schlingerte und kam von der Straße ab, ruckelte auf dem sandigen Bankett aus. Britt schrie auf.
»Mann, Mädel«, sagte der Fahrer. »Hat uns doch keiner gerammt.«
Britt packte ihren Matchsack und stieß die Beifahrertür auf. Sie stolperte die Stufe hinunter, landete auf den Knien.
Der Fahrer lehnte sich über seinen Sitz. »Gar kein Danke fürs Mitnehmen?« Er knallte ihre Tür zu. Die Räder spuckten Sand und Geröll, und der Laster rumpelte davon.
Nur im Westen blieb noch ein dünner Lichtsaum, der rötlich auf die fernen Bergrücken abstrahlte. Britt ging das Stück zurück bis zur Kurve. Wenn sie sich in der Abzweigung vertan hatte, dann mochte der Himmel wissen, wer sie als Nächstes aufgabeln würde.
Britt war Cassidy und Gideon am Vormittag auf dem Bauernmarkt in Joshua Tree begegnet, wo sie dilettantisch abgepackte Hähnchen verkauften. Während sie ihren Kunden von der Schönheit der Seele und der Gesundheit des Geistes vorschwärmten, sickerte ihnen Hühnerblut über die Unterarme, rann an ihren Flechtschnüren und Perlen herab.
Ihre Haut hatte diese schmutzige Bräune, die von zu viel Wüstensonne herrührt, als hätte sich der Sand tief in ihre Poren gearbeitet. Ihre Dreadlocks waren teils so verfilzt, dass die hineingeflochtenen Perlen in den Zotteln verschwanden. Cassidy trug zwei Halsketten – eine mit einer großen Feder daran, die andere mit einem Zahn. Gideon hatte eine Vogelkralle an einem Lederband umhängen. Das Leben ist selbst im Tod noch schön, hatte er gesagt, als er Britts Blick auf-fing.
Gideon und Cassidy bewegten sich beide, als würden sie ihre Gliedmaßen durch weiche Butter ziehen; mit einer langsamen, bedächtigen Schwere griffen sie in ihre blaue Kühlbox, tüteten die Vögel ein, gaben Wechselgeld heraus. Kopfrechnen war nicht ihre Stärke.
Britt wartete auf eine Mitfahrgelegenheit – ein Typ, den sie aus einem Tennisclub in Palm Springs kannte, hatte ihr in Aussicht gestellt, er würde auf seinem Weg nach Arizona durch Joshua Tree fahren. Aber die Sonne krebste von Osten nach Westen, ohne dass er aufgetaucht wäre.
Sie schaute gerade wieder den Highway entlang, da gruben sich Cassidys Finger in ihr Haar. »Bist du auf einem Trip, oder willst du nur einfach von A nach B?«
»Ich warte auf jemanden«, sagte Britt.
»Die Welt dreht sich, während wir warten«, erwiderte Cassidy. Dann forderte sie Britt auf, mit ihr und Gideon einen Joint zu rauchen. Sie fuhren in den Joshua Tree Nationalpark, zu einer Stelle, die Jumbo Rocks hieß und die, so erklärte Cassidy, ihr und Gideons Kraftort war. Das Dope verlieh der Landschaft mit ihren roten Felsen und Reihen spillriger Josuabäume etwas von einer Halluzination.
Cassidy hob einen kleinen Stein auf und legte ihn auf Britts Handfläche. »Spürst du das? Das Universum ist ein Herzschlag in deiner hohlen Hand.«
»Wenn du zu uns auf die Farm kommst, wirst du merken, dass noch dem kleinsten Sandkorn der Geist eines Kriegers innewohnt«, sagte Gideon.
Und dann erzählte ihr Cassidy von der Howling Tree Ranch, der Hühnerfarm, auf der sie und Gideon zusammen mit irgendwelchen anderen Leuten lebten, die sie als Praktikanten bezeichnete. Aber es klang nicht nach einer Farm, keiner richtigen jedenfalls. Und der Besitzer, Patrick, klang nicht wie ein Farmer. Mehr wie ein Swami oder ein Sektenführer, einer dieser Typen, über die Dokumentationen gedreht wurden, wenn wieder jemand entkommen war und überall von den Omeletts aus Zauberpilzen erzählte, den täglichen Nackttaufen und tantrischen Gesängen.
»Du stellst dir das falsch vor«, sagte Gideon. »Er greift in dich hinein und holt Dinge aus dir heraus, die du so tief begraben hattest, dass du selbst nichts mehr davon wusstest.«
»Er heilt dich, ohne dich zu berühren«, versprach Cassidy. »Er schaut in dein Inneres, findet heraus, was zerbrochen ist, und kittet es wieder.«
Für Britt hörte sich das eher schmerzhaft als heilsam an. Sie sagte nicht, dass die Erde ganz bestimmt nicht, wie Cassidy verkündet hatte, »in Blumen lachte«, weil das keinerlei Sinn ergab. Und sie wandte auch nicht ein, dass für den Garten ihrer Seele im Zweifelsfall jede Hilfe zu spät kam. Stattdessen bat sie die beiden, nachdem der Joint zu Ende geraucht war, sie wieder in der Stadt abzusetzen, damit sie auf ihren Fahrer warten konnte. »Vielleicht sind ja wir deine Fahrer«, sagte Gideon, als er sie in einer langen Umarmung an sich zog, um Energien auszutauschen.
Cassidy zupfte ihn am Arm. Aber er wedelte sie weg. »Alles gut, Cassidy. Ich geb nur was von meinem High an sie ab.«
Britt sah ihnen zu, wie sie in einen Volvo Kombi stiegen.
Ihre Mitfahrgelegenheit war nicht aufgetaucht. Und nun stand sie hier, zwanzig Meilen hinter Joshua Tree, und schaute sich nach dem umgestürzten Schild der Howling Tree Ranch um, das laut Cassidy gleich nach der Haarnadelkurve kommen musste.
Fast hätte sie es übersehen – ein Haufen splitternder Bretter mit aufgesprühter Beschriftung, auf denen im letzten Abendrot das Wort Ranch zu ahnen war.
Die Farm lag eine Meile abseits der Straße – zu weit, um vom Highway aus sichtbar zu sein. Der Abglanz der Sonne war erloschen, und die Wüste lag düster-violett da. Ohne den Matchsack und mit Turnschuhen an den Füßen hätte Britt für die Strecke nicht viel mehr als eine Viertelstunde gebraucht. Aber im Dunkeln, mit ihren Sandalen und dem Minirock, die Tasche über der Schulter, würde es eine ziemliche Plackerei werden.
Sand rieselte ihr über die Zehen und drang unter die Riemen ihrer Sandalen. Sie hielt ihr Handy vor sich, sodass sein schwacher bläulicher Schein den Fahrweg beleuchtete – oder das, was hoffentlich der Fahrweg war, eine leichte Vertiefung, in der sich undeutliche Reifenspuren in Sand und Geröll verloren.
Sie hatte an ein paar Turnieren auf der anderen Seite des Nationalparks teilgenommen, wo Golfplätze, verspielte Architektur, Happy Hours und Wellnessbereiche die Schroffheit der Landschaft abmilderten. Sie hatte geglaubt, die Wüste zu kennen. Aber schon wenige Schritte weg vom Twentynine Palms Highway reichten aus, um sie ihren Irrtum erkennen zu lassen.
Etwas bewegte sich im Gebüsch, ein Kratzen und Schlurren und Scharren, das gleichauf mit ihr zu bleiben schien. Sie fasste den Beutel fester und versuchte schneller zu gehen. Dann fingen die Hunde an zu heulen, sandten ihr einsames Rufen und Antworten hin und her durch die dichte Nacht.
Es war stockfinster, finsterer, als sie es für möglich gehalten hatte. Die Silhouetten der fernen Berge und der Sträucher gleich in ihrer Nähe klumpten zusammen zu einer undurchdringlichen Schwärze, die das Licht ihres Handys kaum anzukratzen vermochte. Sie spürte ihren Herzschlag in der Handinnenfläche, da, wo der Riemen des Matchsacks einschnitt.
Die Sonne hatte die Hitze nicht mit sich genommen. Schweiß rann Britt den Rücken hinab. Er kroch ihre Beine entlang, sickerte ihr über die Knöchel. Der Weg führte bergauf, eine schwache Steigung, die ihr die Wadenmuskeln straffte und ihre Füße bei jedem Schritt zurückrutschen ließ. Ein Stück abseits der Fahrspur hörte sie Palmen rascheln.
Seit ihrer Flucht aus dem College hatte sie es immer verstanden, an Orten zu landen, wo man sie nicht fand oder, besser, wo niemand, schon gar nicht ihre Eltern, nach ihr suchen würde. Bis jetzt hatte sie sich noch nie verloren gefühlt.
Ein Mädchen, das trampt, ein Mädchen, das mit einer Clique Besoffener eine Spritztour die Küste entlang macht, ein Mädchen, das an eine Haustür tief in South Central L. A. klopft, weil irgendwer auf dem Campus erzählt hat, die wahre Party geht hier ab – ein Mädchen, das alles dies tut, darf keine Furcht zeigen. Aber jetzt, in der Wüstennacht, ging Britts Atem flach, und ihr Herz jagte auf eine Weise, die sie nur schwer hätte überspielen können.
Das Gelände wurde eben. Und sie sah die Ranch – ein unscheinbares Farmhaus ein Stück weiter rechts und eine Ansammlung kleiner Häuschen geradeaus. Irgendwie hatte sie es den ganzen Weg von Joshua Tree hierher geschafft, sich einen Milchbetrieb aus dem Mittleren Westen vorzugaukeln. Sie hatte sich rote Scheunen und grüne Felder vorgestellt. Darauf gehofft, besser gesagt. Aber was das Licht aus den Fenstern der Howling Tree Ranch hier beschien, wirkte kaum weniger abschreckend als die Anwesen entlang dem Highway – zusammengewürfelte Bauten, behelfsmäßig mit Strom versorgt, dazu Wälle von Unrat.
Irgendwoher drang das rhythmische Quietschen von Metall, ein gleichmäßiger Zweiertakt, und das Stampfen eines Lüftungsgebläses oder eines Verdunstungskühlers. Hinter sich konnte sie die Hühner hören, ihr hektisches Scharren, das den Eindruck von Ausweglosigkeit noch verstärkte. Ein beißender Gestank nach Heu und Ammoniak wehte herüber. Nicht auszudenken, wie das in der prallen Mittagssonne riechen musste. Die Tiere hatten den Eindringling bemerkt; sie schlugen klatschend mit den Flügeln, gackerten laut, krachten in die Drahtumzäunung.
Jenseits der Einfahrt leuchtete das Verandalicht auf, dann schwenkte der Strahl einer Taschenlampe in Richtung des Geheges und erfasste Britt.
»Bist du neu?«
Britt beschirmte ihre Augen und blinzelte ins Licht.
Zwei Jungen saßen auf der Veranda, jeder in einem metallenen Schaukelstuhl. Britt überquerte die schottrige Einfahrt. Der mit der Taschenlampe leuchtete sie immer noch an.
»Bist du neu?«, wiederholte er, als sie näherkam.
»Neu wobei?«
Es waren Zwillinge, vierzehn oder fünfzehn. Ihre Haut hatte die gleiche schmutzige Wüstenbräune wie die von Gideon und Cassidy. Sie waren beide barfuß. Der mit der Taschenlampe saß ohne Hemd da. Sein Bruder trug ein Tanktop, das eine Nummer zu klein war.
»Die neue Praktikantin«, sagte der Junge mit der Taschenlampe. Der Lichtstrahl malte enge, schnelle Kreise auf Britts Gesicht. »Eine von den anderen hat gesagt, wir kriegen eine Neue.«
»Seit wann redest du mit den Praktikanten?«, wollte sein Bruder wissen.
»Halt den Mund.« Er knipste seine Lampe aus. »Mom«, rief er, »da ist wer in der Einfahrt.« Er knipste das Licht wieder an. »Hier ist es übrigens voll scheiße. Wir wüssten echt gern, warum ihr Leute kommt.«
»Ich habe nicht vor, zu bleiben«, sagte Britt.
»Was willst du dann hier?« Er schaltete das Licht aus, boxte seinen Bruder gegen die Schulter. »Komm, James.«
James schaukelte ein paar Takte weiter, bis sein Bruder ihn erneut boxte. Dann verschwanden sie im Haus und ließen die Fliegentür hinter sich zuklappen. Das Verandalicht erlosch.
Britt wartete in der Einfahrt. Die Hühner in ihrem Gehege kamen allmählich zur Ruhe. Nur ein Hund heulte noch in der Ferne, sein Geheul klang jetzt, wo es ungehört verhallte, umso trostloser.
Schließlich öffnete sich die Fliegentür. Das Verandalicht flammte wieder auf. Eine Frau in abgeschnittener Jeans und einem weiten T-Shirt mit dem Bild eines Hasen auf der Brust trat heraus und starrte auf Britt herab. Ihr Haar musste einmal blond und wellig gewesen sein, aber die Sonne hatte es zu bleichen Kräuseln gedörrt. Nicht auszuschließen, dass sie hübsch gewesen war, bevor die raue Witterung ihr Werk an ihr verrichtet hatte – ihr die Haut gegerbt und die vollen Lippen und hellen Augen mit Runzeln umzogen hatte. Jetzt glich sie all den anderen Geschöpfen, die Britt hier draußen schon gesehen hatte – jeder Weichheit beraubt, reduziert auf das Wenige, das zum Überleben nötig war.
Die Frau streckte ihr die Hand hin. Ihr Griff war fest, ihre Handfläche trocken und schwielig. An ihrem Unterarm standen dicke Adern hervor. »Grace«, sagte sie. »Bist du die neue Praktikantin?« Ihr Atem roch säuerlich nach Wein.
»Vielleicht«, sagte Britt.
»Oder bist du nur wegen Patrick da?«
»Ich heiße Britt.«
Grace ließ ihre Hand los, und Britt bemerkte den Türklopferring, der an ihrem Finger schlackerte. »Du bist die, die Cassidy in der Stadt aufgetan hat. Da wird sie sich wundern.«
»Hat sie gedacht, ich komme nicht?«
»Sie dachte, sie will dich hierhaben. Sie wird schon sehen, was sie davon hat. Wie Patrick sagt: Was wir in der Welt säen, trägt oft andere Früchte als gedacht.«
»Aber wollte sie denn nicht, dass ich komme?«
Grace lachte. »Seid ihr nicht alle dafür hier? Um euch von meinem Mann erzählen zu lassen, was ihr wirklich wollt?«
»Ich weiß eigentlich gar nicht, wozu ich hier bin.«
»Das wirst du schon rausfinden. Das tun sie alle früher oder später. Oder sie bleiben und warten auf die Erleuchtung.«
»Mal sehen.« Aber Britt war sich ziemlich sicher, dass sie nichts dergleichen tun würde.
»Mein Mann wird dir erklären, dass die Seele eine Blume ist, die du täglich gießen musst, sonst welkt sie und verdorrt.«
»Im Ernst jetzt?«
Grace legte Britt die Hand auf den Arm. »Du meinst, du wärst anders als die anderen. Aber das bist du nicht.« In der Ferne heulte wieder ein Hund. Britt zuckte zusammen. »Du kannst froh sein, dass es kein Wolf ist«, sagte Grace. »Dann komm, ich führ dich rum.« Sie knipste die Taschenlampe an, die die Jungen liegen lassen hatten, und ließ den Lichtkegel im Hof herumwandern. »Das ist die Howling Tree Ranch. Zum Haupthaus hat niemand Zutritt außer Patrick, den Jungs und mir. Unser Land reicht von hier die ganzen zwei Meilen bis zum Park.« Das Licht zickzackte über die südlichen Außengebäude hinweg und ließ eine endlose schwarze Weite ahnen. »Ich kann mir den Mund fusslig reden, ihr rennt ja doch in der Wüste herum. Aber es gibt Kojoten hier, Rotluchse und sogar Wölfe. Mein Mann mag ein Heiler sein, aber ein paar Dinge kriegt nicht mal er wieder hin.«
Die meisten Häuschen lagen inzwischen im Dunkeln. »Du hast dir einen besonderen Abend hier ausgesucht«, sagte Grace. »Morgen ist unser größter Schlachttag im ganzen Jahr. Die Hühner hast du beim Reinkommen gesehen?«
Britt folgte Grace zu dem gewaltigen hölzernen Hühnerstall in seiner Maschendrahtfestung. Grace zeigte ihr das Gehege für die Masthähnchen und den Holzblock, auf dem die Tiere morgen geschlachtet werden würden. »Nach den ersten zwanzig gewöhnst du dich an das Blut. Nach den ersten fünfzig an den Geruch«, sagte Grace.
Vom Stall und dem Schlachtbereich wandten sie sich in Richtung der Häuschen. Sie kamen zu einer großen Feuerstelle und dann zu einem toten Josuabaum, wo eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte mit Ausgusstülle die Dusche ersetzte. »Die meisten von euch waschen sich einfach in der Oase.«
Grace deutete weg von den Häusern, zu einer Gruppe hoher Palmen, die Britt zuvor nicht bemerkt hatte. Zwischen den Stämmen spiegelte ein ölig-glatter Tümpel das Mondlicht. »Normalerweise sind um die Zeit noch ein paar Leute im Wasser, aber vor einem Schlachttag ordnet Patrick immer eine ruhige Nacht an.«
Grace brachte Britt zu ihrem Häuschen, einem kleinen Lehmziegelbau zwischen zwei Fertigschuppen. »Das ist eins von den komfortablen«, sagte sie. Und ohne ein weiteres Wort ging sie.
Britt warf den Beutel ab und ließ sich auf das schmale Bett fallen. Die Sprungfedern bogen sich ächzend durch. Hinter dem großen Fenster neben dem Bett gähnte die Wildnis, die sich bis zum Nationalpark erstreckte.
Die Luft in dem Zimmer klebte ihr auf der Haut, kroch ihr die Kehle hinab. Der Ventilator neben dem Bett quirlte die Hitze nur durch. Sie hatte wenig Lust, das Fenster aufzumachen, und noch weniger Lust, die Tür zu öffnen, obwohl das vielleicht für Durchzug gesorgt hätte. Sie wollte nicht wissen, was da in der Nacht alles des Weges kam – was sie womöglich dort draußen vorbeischleichen hörte.
In einer Viertelstunde könnte sie den Highway erreichen. In dreieinhalb Stunden Vegas, in viereinhalb Stunden Phoenix – alles Orte, wo Lichter und klimatisierte Luft die Wüste zurückdrängten. Aber sie musste sich eingestehen – zumindest im Stillen –, dass sie nicht den Mumm hatte, den Weg wieder zurückzugehen, und ihr grauste bei dem Gedanken, wer wohl für sie anhalten würde, wenn sie sich einmal bis zur Straße durchgeschlagen hatte.
Sie schloss die Augen, drückte sich das windige Kissen aufs Gesicht, um die Schwärze dahinter auszublenden, und lauschte dem eiernden Schwirren des Ventilators. Sie war nicht bescheuert – sie begriff gut, dass Grace ihr Angst machen wollte mit ihrem Gerede von Hühnerblut und all den tödlichen Gefahren da draußen. Überall sonst wäre sie geblieben, um es Grace zu zeigen. Aber von hier würde sie gleich morgen abhauen.
zwei
Ren, Los Angeles, 2010
Neun Tage hatte er im Greyhound-Bus gesessen, die kalte, muffige Luft geatmet und sich das Kinn an der Fensterschiene angeschlagen. Passagiere kamen und gingen. Manche redeten stundenlang. Manche schliefen tief und fest, andere verschütteten ihr Trinken und ihr Essen, sodass der Boden noch mal klebriger war als bei der Abfahrt im Busbahnhof von New York.
Ren hatte eine Zickzackroute von Küste zu Küste gebucht, eine geschlängelte Strecke, erst mal ein Stück nach Süden runter, dann nach Westen. Er hatte ein bisschen Geld, an die siebenhundert, von seinen verschiedenen Jobs. Da müsste der Umweg drin sein, dachte er sich.
Acht Jahre Jugendknast, und er hatte keine Peilung mehr von der Außenwelt. Die Jungs hatten die ganze Zeit bloß vom Rauskommen geredet, davon, wie sie durch die Welt gondeln würden und alles das sehen, was sie drin vermissten. Das Problem ist, wenn du mit zwölf einfährst, wird das Draußen abstrakt. Die Maßstäbe verschieben sich. Groß war schon der Gemeinschaftsraum, verglichen mit der Zelle. Und richtig groß der Gefängnishof.
Die Außenwelt schrumpfte, bis sie in den Fernseher im Gemeinschaftsraum passte, wo der Himmel blau war und das Wetter wetterfrei. Das ewige Drinnenhocken machte es auch so schon schwer, sich an die Stille bei Schnee und die Regenspritzer auf der Haut zu erinnern. Aber die anderen Jungs wollten andauernd nur Polizeiserien gucken oder Filme, wo Kriminelle die Kings waren. Wenn es nach Ren gegangen wäre, hätten sie die Gemeinschaftsglotze auf den Natursender eingestellt, auf irgendetwas, das eine echte Erinnerung daran wachhielt, wie sich Freiheit anfühlt. Denn drinnen roch alles gleich, schmeckte gleich, fühlte sich gleich an – nichts davon besonders. Nichts davon gut.
Deshalb wechselte er oft den Bus, schlief auf freiem Feld oder auf Campingplätzen. Manchmal wusste er nicht, in welchem Staat er war. Er sah Sümpfe und Flussdeltas. Wie sie hießen, sagten ihm Mitreisende. Er sah Gegenden, die so staubig waren wie Wüsten. Dann kamen sie in die richtige Wüste mit abgeplatteten Tafelbergen und so fantastisch bizarren Felsgebilden, dass er sich vorstellte, Gott hätte sie gebaut.
Die letzte Greyhound-Haltestelle: Downtown Los Angeles, ein Ort, mit dem Ren nichts verband als die Bilder aus dem Fernseher im Gemeinschaftsraum – Palmen und Strände, weiß verputzte Häuser und ein riesiger, konturloser Himmel. Und natürlich der glitzernde Ozean, wo Surfer sich in die Wellen hängten, als würden sie U-Bahn fahren.
Aber als er aus dem Bus stieg, war von dieser Stadt nichts zu ahnen. Der Busbahnhof, klein, austauschbar, hätte zu einem x-beliebigen Kaff im Landesinneren gehören können. Ren hatte sich eine Art Tor zum Westen vorgestellt, beschienen von einer orangeroten Sonne, wo Spaliere aus Palmen zu wunderschönen blauen Wellen führten. Stattdessen starrte er auf eine abgehängte Decke und die gleichen Automaten, aus denen er sich seit Wochen ernährte.
Ein anderer Bus hielt in der Nachbarbucht. Ren sah den Fahrgästen beim Aussteigen zu, alle in Jeans, alle mit Pappschachteln oder großen Umschlägen mit ihrem Namen und einer Nummer drauf in der Hand. Aber auch so hätte er den typischen Ex-Knacki-Gang erkannt, die Art, wie die Männer zum Himmel hochsahen, als könnte er beißen. Wie sie über die Schultern zurückschauten, als würde sie jeden Moment jemand von hinten anspringen.
Er trat zur Seite, um den entlassenen Häftlingen Platz zu machen. Ein paar von ihnen fingen seinen Blick auf und nickten kurz: Ich kenn dich zwar nicht, Bruder, aber ich weiß Bescheid. Er griff in seine Tasche nach dem Bündel Scheine und wölbte die Hand darum, und als keiner hersah, steckte er es in seine Socke, sodass es an seiner Fußsohle anlag.
Am Ausgang standen zwei Kirchentanten. Sie sahen aus wie die Sozialarbeiterinnen, die ihn in seinen letzten Monaten im Knast mit ihrer Jobbörse genervt und ihm alle möglichen Hilfsleistungen angedient hatten, die er nicht wollte. Die Frauen hier drückten den Ex-Knackis Broschüren in die Hand und erzählten ihnen etwas über die Gefahren der Straße, wie leicht man wieder einrücken konnte, wie wichtig es war, sauber zu bleiben, stolz zu sein, aber nicht dumm. Ein paar von den Jungs nahmen die Schriften. Manche blieben stehen, um sie zu lesen, aber die meisten ließen sie ein paar Schritte vom Ausgang entfernt auf den Boden flattern.
Ren öffnete den Reißverschluss an seinem Rucksack und zog einen verblichenen, speckigen Zettel heraus. Er hatte ihn so oft gelesen, dass sich ihm die Worte ins Hirn eingebrannt hatten. Er zeigte den Zettel der einen Frau. »Entschuldigung«, sagte er. »Wissen Sie, wo das ist?«
Die Frau beugte sich über den Zettel mit der verblassten Schrift und kniff die Augen zusammen. »Das Cecil Hotel? Da gehen Sie einfach hier auf der Seventh bis zur Main Street. Sie können es gar nicht verfehlen.« Sie zeigte auf die Straße vor dem Busbahnhof. Dann streckte sie Ren ein Faltblatt hin. »Kommen Sie zu mir ins Pfarramt«, sagte sie. »Wenn Sie deprimiert, verloren oder einsam sind.«
Als Ren aus dem Jugendgefängnis kam, holte ihn niemand ab. Es gab kein Zuhause, in das er zurückkehren konnte. Er war in sein altes Viertel in Brooklyn gefahren, nur um festzustellen, dass seine Eltern sich nach Troy, New York, abgesetzt hatten. Eine Zeit lang war er dageblieben, in einem Obdachlosen-Camp am Fluss, hatte zugesehen, wie sich die Gegend von früher vor seinen Augen veränderte, und sich darüber klar zu werden versucht, wo zum Teufel er hingehörte. Dann war ihm eines Tages eine entfernte Cousine seiner Mutter über den Weg gelaufen. Erst hatte sie ihn giftig angeschaut, so als könnte das, was er getan hatte, auf sie abfärben, als würde sie hinterher nach Verbrecher riechen.
Aber eines erfuhr er immerhin von ihr. »Das mit Troy, das war nichts für deine Mom. Also ist sie alleine los. Ist in L. A. gelandet. Und was man so hört, kommt sie da auch nicht klar.«
Ren mochte nicht um Auskünfte betteln, aber er wollte eine Adresse, um seine Mutter im Notfall finden zu können. Er musste einen Tag vor der Wohnung der Cousine rumhängen, bis sie den Namen des Hotels ausspuckte, in dem Laila wohnte – das Cecil. Wenn’s dazu diente, ihn loszuwerden …
Ob die Auskunft stimmte, war nicht rauszukriegen. In dem Hotel gab es kein Telefon auf den Zimmern, und als er anrief, hieß es, die Namen von Gästen würden nicht herausgegeben. Er hinterließ keine Nachricht.
Die ersten zwei Jahre im Jugendknast hatten ihn seine Eltern drei- oder viermal besucht. Dann zweimal im Jahr – an seinem Geburtstag und um Weihnachten rum. In seinem sechsten Jahr kamen sie einmal. Und in den letzten beiden Jahren überhaupt nicht mehr.
Aber bloß weil sie ihn verlassen hatten, musste er den Spieß ja nicht umdrehen. Genau das war es schließlich, was man in der ganzen Zeit im Knast lernen sollte, wo man Ruhe hatte zum Nachdenken und Bereuen. Nicht dass die anderen Kids das gemacht hätten. Die meisten wollten draußen ein großes Ding drehen, die Möglichkeiten dafür schienen Ren ziemlich begrenzt.
Er war anders, auch wenn seine Eltern das nicht mehr sahen, als er erst mal weggesperrt war. Sie vergaßen komplett das kleine Kind, das er einmal gewesen war, und konzentrierten sich ganz auf den Kriminellen, für den sie ihn hielten. Wenn er also eine Chance hatte, seine Mutter vom Gegenteil zu überzeugen, und dabei noch das ganze Land sehen konnte, dann schien das doch ein Abenteuer zu sein, das sich lohnte.
Der Busbahnhof lag in einem Industrieviertel – Verladerampen, Großhandlungen und Lagerhäuser. Unmöglich zu sagen, ob die Gegend auf dem auf- oder absteigenden Ast war.
Ren ging die Seventh entlang. Die Straßen waren trist, lauter Geschäfte, die entweder an dem Tag zu oder für immer geschlossen waren – Famous 99 Cent Diner, Hollywood Banquet Hall (verfügbar für Dreharbeiten). Zelte standen an den Gehsteigrändern, Menschen schoben Einkaufswagen vollgetürmt mit Sachen, die aussahen wie von der Müllkippe zusammengeklaubt. Je weiter er ging, desto voller wurden die Straßen, flossen über von einem wild zusammengewürfelten Volk, Weiße, Schwarze, Latinos.
Ein Mann in einem ausgeleierten roten Sweatshirt und schwarzen Jeans stand an der Ecke, offenbar auf irgendwelche Geschäfte aus. Er nickte Ren zu. »Was läuft, Bruder? Was brauchst du? Brauchst du was?«
Um ihn herum lärmten und murmelten Leute, stritten sich mit unsichtbaren Feinden. Manche lagen ausgeknipst am Bordstein oder lehnten zusammengesackt an Mauern. Und dann gab es wieder andere, die einfach ihr Ding machten, zwischen den Junkies und den Verrückten – Bücher lasen oder mit einem Nachbarn tratschten, als säßen sie in einem Coffeeshop oder bei irgendwem im Wohnzimmer und nicht im Freien auf dem dreckigen Pflaster von Downtown L. A.
Er kam an einer Frau vorbei, die in einem improvisierten Freiluftsalon Cornrows flocht. Zwei Männer saßen über ein Kreuzworträtsel gebeugt. Ein kleiner, fast kahlköpfiger Prediger beschallte durch ein Megafon eine Versammlung von sechs Leuten mit spanischen Bibelsprüchen. Um den Hals trug er eine Tafel, auf der JESUS ES EL BUEN PASTOR stand. Ein Mann zog eine Spritze auf, neben einer Frau, die eine überreife Banane aß und in einer jahrzehntealten Zeitschrift las. Gegenüber dem Eingang der Nazarene Christian Mission verkauften zwei Typen in schmuddeligen Trainingsanzügen Drogen. Eine Frau röhrte den »Backlash Blues«, den Rens Mutter, als er klein war, immer unter der Dusche gesungen hatte.
Im Knast hatten die anderen Jungs pausenlos mit den Penthäusern angegeben, die sie irgendwann haben und, sobald sie genug Kohle hätten, supercool einrichten würden, sie mit lauter Zeug aufmotzen, das kein Schwein brauchte. Ständig hatten sie diese imaginären Buden mit protzigen Flatscreen-Fernsehern und monströsen Hi-Fi-Anlagen ausstaffiert, einem Mordshaufen Equipment, um die reale Welt auszuschließen. Sie wollten Kingsize-Betten und swimmingpoolgroße Whirlpools. Sie wollten alles so haben, dass sie nie mehr aus dem Haus mussten.
Ren ging es genau andersrum. Jetzt, wo er draußen war, wollte er auch draußen bleiben, nicht nur aus dem Knast, sondern ganz und gar draußen. Er wollte kein Dach überm Kopf. Er wollte sich in keiner Wohnung einsperren, und wenn sie auch noch so geil war, hammermäßig, der Hit. Seine Luft sollte frisch sein, nicht klimatisiert. Er wollte Himmel, keine Decke. Aber das hier war ein Freiluftleben anderer Art, und keins, das ihm taugte.
Niemand verschwendete einen Gedanken oder auch nur einen Blick an ihn. Manche Straßenabschnitte sahen postapokalyptisch aus – und rochen auch so –, als überlebten die Menschen hier in den Nachwehen einer Katastrophe, eines Bombenangriffs oder eines Erdbebens. Eine Straße schien Transsexuellen zu gehören, eine andere Junkies. Als die Sonne allmählich verschwand, stellten sich die Leute vor einer Mission an, für einen Schlag Suppe und einen Schlafplatz. Irgendwelche Kirchenleute teilten Essen auf dem Gehsteig aus – Makkaroni auf Papptellern.
Er kam an einem Stadtteilzentrum vorbei, in dem eine Open-Mike-Veranstaltung lief. Alle möglichen Leute standen an, die etwas vortragen wollten. Draußen auf der Straße tanzten welche zu der Musik, die durch die offene Tür kam, wiegten sich zu einer brüchigen, hoffnungsvollen Stimme, die Stevie Wonder sang.
Schließlich erreichte Ren die Main Street, wo die Slums heruntergekommenen Geschäftsstraßen mit billigen Schmuckläden und halb leerstehenden Loft-Gebäuden wichen. Er fühlte sich befangen, als er die Lobby des Cecil Hotel betrat, so als hätte er hier nichts verloren und jeder wüsste es. War diese Halle jetzt richtig feudal oder tat sie nur so? Sie war mit Marmor und noblem Holz rausgeputzt, roch aber trotzdem nach dem Industriereiniger, den sie auch im Jugendknast benutzten.
Ren ging zum Empfang, wo ein kleiner Hispano mit einem buschigen Schnurrbart auf einem tragbaren Fernseher Fußball schaute. Der Mann blickte nicht auf. »Wollen Sie ein Zimmer?«
»Ich suche eine Frau, die hier wohnt.«
»Keine Auskünfte über Gäste.«
»Hören Sie zu«, sagte Ren. »Das haben Sie mir schon am Telefon gesagt. Aber ich bin extra aus New York hergekommen.«
»Erwartet sie Sie?«
»Nein.«
»Na also«, sagte der Mann. »Noch ein Problem.«
»Vielleicht soll es ja eine Überraschung werden.«
»Ich kann Sie nicht in der Lobby rumhängen lassen, und ich kann Ihnen keine Auskunft geben, ob sie da ist.«
»Aber?«
»Hinterlassen Sie eine Nachricht oder Ihre Telefonnummer. Oder nehmen Sie sich ein Zimmer. Was Sie dann machen, kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Wie viel?«, fragte Ren.
»Wenn’s ein Bad auf dem Gang tut, siebzig.«
Das war mehr, als Ren jemals für irgendwas ausgegeben hatte, abgesehen von dem Greyhound-Ticket. Und für ein Dach über dem Kopf hatte er eigentlich überhaupt nicht zahlen wollen. Schließlich lockte das L. A. aus dem Fernsehen mit massenweise Möglichkeiten zum Draußen-Schlafen – im Sand, in Strandnähe, unter einer Palme. Aber diese Straßen hier vor dem Hotel? Das war eine andere Nummer.
Der Angestellte tat so, als sähe er nicht hin, als Ren ein paar Scheine aus seiner Socke zog. Er gab ihm vier schmierige Zwanziger und füllte ein Formular aus. Ren nahm den Schlüssel, den der Mann über den Tresen schob.
»Also«, sagte er. »Die Frau, zu der ich will, heißt Laila Davis.«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Wie jetzt?«, fragte Ren. »Sie kennen sie nicht, oder Sie wollen’s mir nicht sagen?«
Der Mann schaute wieder auf seinen Fernseher.
»Und wenn ich Ihnen sage, dass sie meine Mutter ist und dass ich sie seit Jahren nicht mehr gesehen habe?«
Der Mann befingerte die Spitze seines Schnurrbarts. »Ich kenn sie nicht«, sagte er. Er deutete ans andere Ende der Lobby. »Der Lift ist da drüben.«
Ren schulterte seinen Rucksack und ging zu der Messingtür, auf die der Mann gezeigt hatte. Ein weißer Junge, ungefähr so alt wie er, drückte gerade auf den Knopf. Er hatte glatt runterhängende blonde Haare und trug ein kurzärmliges T-Shirt über einem langärmligen. Seine Fingernägel hatten schwarze Ränder.
»Willste ’n Zug?« Er zog einen zerdrückten Joint aus seiner Jeans.
»Muss nicht sein«, sagte Ren.
Der Lift kam. Die kleine Kabine füllte sich mit dem Grasgeruch von dem weißen Jungen.
»Man sieht sich«, sagte der Junge, als die Tür zu Rens Etage aufging.
Der Flur war dämmrig, der Teppich voller Brandlöcher und alter Kaugummis. Ren musste ein paarmal umkehren, bis er sein Zimmer fand. Der Schlüssel klemmte im Schloss. Er dachte schon, er müsste die ganze Klinke abreißen, um das blöde Ding aufzukriegen.
Ein grünlicher Vorhang war halb vor ein Fenster gezogen, und das Licht von draußen musste sich durch grau verschmierte Scheiben kämpfen. Der Teppich war rote Industrieware mit kratzigen Fasern. Am Fußende des Bettes hing ein alter Heizkörper an der Wand, darüber in einem Metallrahmen ein ausgebleichter Kunstdruck mit dem Gemälde eines Teichs.
Es gab bessere Hotels auf der Welt, da war Ren sicher, mit besser aussehenden Betten und Wänden ohne Flecken vom Leben anderer Leute. Aber als er die Tür hinter sich zumachte, war es, als ob etwas von ihm abfiel, das er, ohne es zu merken, auf den Schultern getragen hatte. Er schloss ab, schob den Riegel vor und ließ sich bäuchlings aufs Bett fallen.
Er würde schlafen wie ein Stein, so viel stand fest. Endlich einmal eine Nacht, in der er kein Auge offenhalten musste für den Fall, dass einer von den anderen Jungs in der Zelle übergriffig wurde, während Ren schlief, oder einer seiner Camp-Nachbarn am Flussufer in Brooklyn es sich einfallen ließ, in seinem Container herumzuschnüffeln, oder ein Busreisender ihn zu beklauen versuchte, solange er außer Gefecht war. Ausnahmsweise konnte er schlafen, wie er wollte, allein und ungestört. Erst mal schlafen, und morgen würde er rauskriegen, wo Laila steckte.
drei
Blake, Wonder Valley, 2006
Auf dem Highway waren zwei Männer und viel mehr nicht. Die Straße war ein zweispuriges Asphaltband. Manchmal gingen die Männer zusammen, manchmal durch die Fahrbahn getrennt. Bis auf gelegentliche Autos oder Laster waren sie das Einzige, was sich in der Landschaft bewegte. Aus der Entfernung hätte man sie fast für eine Luftspiegelung halten können. Aber sie waren real.
Sie hatten beide gebräunte Gesichter, ein Rotbraun wie rostige Eisenrohre mit noch dunkleren Runzeln um Augen und Backenknochen. Ihre Nägel und Fingerknöchel waren schwarz gerillt. Sie trugen jeder einen zerlumpten Rucksack. Auf dieser gottverlassenen Strecke hier würde keiner für sie bremsen, so viel war Blake klar. Also versuchte er es bei den wenigen Fahrzeugen in ihre Richtung erst gar nicht.
Sie gingen schon so lange so, dass Blake sich ihren Weg inzwischen aus der Vogelperspektive vorstellte, als würden sie in der Luft fliegen statt unten über den Teer zu stiefeln. Er hatte sich den Rangerhut über die fettigen schwarzen Haare gestülpt. Es war heiß unter dem Ding, aber es hielt die Sonne ab. Seit vier Meilen starrte er jetzt auf Sams Rücken, auf den dunklen Zopf des Dicken, der bei jedem Schritt zwischen den Schulterblättern hin- und herschwang. Dieser Zopf machte ihn noch rasend. Dass irgendein Mensch bei dieser Affenhitze so viel Haar haben konnte!
Aufgebrochen waren sie von einer Hütte in Lake Havasu, wo sie sich seit September vor den Bullen versteckt hatten, die hinter Sam her waren, wegen einem Mord in Nevada, der laut Sam ein reines Versehen war. Sie hatten in dem Durchgang hinter einer Kneipe in der Nähe von Vegas geraucht, als so ein zappliger kleiner Speedjunkie in Sam reingelaufen war. Zack, hatte Sam sein Messer draußen, und zack, steckte das Messer im Hals des Junkies, dummerweise direkt an der Gurgel. Ausgerechnet – wo Sam es nicht mal drauf angelegt hatte. Alles war voller Blut, eine fette Blutspur, die die Cops geradewegs zu Blakes und Sams Trailer führte.
Sam schwor Blake hoch und heilig, dass es Notwehr gewesen war. Aber bei seinen Vorstrafen würden die Geschworenen das nie im Leben gelten lassen. Also waren sie noch in derselben Nacht abgehauen. Elf Jahre zuvor hatte Sam ihn bei sich aufgenommen, da konnte Blake ihn jetzt schlecht allein untertauchen lassen. Er kam mit, das war er dem Dicken schuldig.