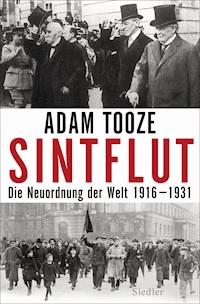
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie aus den Trümmern des Ersten Weltkriegs eine neue Welt entstand
Wie eine Sintflut riss der Erste Weltkrieg die alte Ordnung hinweg, wirbelte gesellschaftliche, politische und ökonomische Vormachtstellungen durcheinander, ließ ganze Reiche zerbrechen und neu entstehen. In einem weltumspannenden Panorama beschreibt Adam Tooze die fundamentalen Verschiebungen der Zwischenkriegszeit und legt dar, wie fatal sich vor allem die Rolle der USA auswirkte: Die neue Weltmacht scheiterte letztlich daran, dauerhaft für Frieden zu sorgen.
In seiner beeindruckenden Darstellung der Zwischenkriegszeit zeigt Adam Tooze, wie in den Jahren von 1916 bis 1931 eine neue Weltordnung entstand. Auch als das Töten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs schon lange vorbei war, tobte der Kampf um Macht und Einflusssphären weiter. Am Ende der Epoche hatte sich die Welt fundamental verändert: Die Vereinigten Staaten waren Weltmacht – und wollten doch keine Verantwortung für die von ihnen geschaffene Friedensordnung übernehmen. So konnten radikale Kräfte, Kommunismus und Faschismus zunehmend an Einfluss gewinnen und die Welt bald unaufhaltsam einem zweiten globalen Konflikt entgegentreiben. Mit seinem glänzend erzählten Buch liefert Tooze eine neue Deutung der großen Umwälzungen und des verlorenen Friedens nach dem Ersten Weltkrieg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1116
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ADAM TOOZE
SINTFLUT
Die Neuordnung der Welt 1916 – 1931
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Thomas Pfeiffer
Siedler
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »The Deluge. The Great War and the Remaking of Global Order, 1916 – 1931« bei Allen Lane, London.
Erste AuflageMärz 2015
Copyright © Adam Tooze, 2014
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Lektorat: Teresa Löwe-Bahners, Brooklyn, NY
Grafiken: Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-13676-5
www.siedler-verlag.de
Für Edie
»Die heikelsten Fragen werden somit früher oder später dem Historiker anvertraut. Es ist sein Problem, dass sie deshalb nicht aufhören, heikel zu sein, weil sie von den Staatsmännern bereits erledigt und als pragmatisch geregelt ad acta gelegt worden sind … Es ist ein Wunder, dass Historiker, die ihre Arbeit ernst nehmen, bei Nacht ruhig schlafen können.«
WOODROW WILSON1
»Die Chronik ist abgeschlossen. Mit welchen Gefühlen blättert man Herrn Churchills zweitausendste Seite um? Dankbarkeit … Bewunderung … ein wenig Neid, vielleicht, um seine unerschütterliche Überzeugung, dass Grenzen, Rassen, patriotische Gesinnungen, notfalls sogar Kriege letzte Wahrheiten für die Menschheit sind, die in seinen Augen den Ereignissen eine Art Würde und selbst Vornehmheit verleihen, für andere hingegen lediglich ein alptraumartiges Zwischenspiel sind, etwas, das konsequent vermieden werden muss.«
JOHN MAYNARD KEYNESin einer Rezension von Winston Churchills Buch The Aftermath2
1 W. Wilson, »The Reconstruction of the Southern States«, in: Atlantic Monthly, Januar 1901, Bd. lxxxvii, S. 1 – 15.
2 J. M. Keynes, »Mr Churchill on the Peace«, in: New Republic, 27. März 1929.
Inhalt
EINLEITUNG – Sintflut: Eine neue Weltordnung entsteht
TEIL I – Die Krise Eurasiens
Ein Krieg in der Schwebe
Frieden ohne Sieg
Die Totenglocke der russischen Demokratie
China in den Kriegswirren
Brest-Litowsk
Ein brutaler Frieden
Ein Riss geht durch die Welt
Intervention
TEIL II – Für einen Sieg der Demokratie
Neuer Schwung für die Entente
Die Arsenale der Demokratie
Waffenstillstand: Die Bühne für Wilsons Drehbuch
Demokratie unter Druck
TEIL III – Der unvollendete Frieden
Ein weltweiter Flickenteppich
»Die Wahrheit über den Vertrag«
Reparationen
Vertragserfüllung in Europa
Vertragserfüllung in Asien
Das Fiasko des Wilsonianismus
TEIL IV – Die Suche nach einer neuen Ordnung
Die große Deflation
Das Empire in der Krise
Eine Konferenz in Washington
Die Neuerfindung des Kommunismus
Genua: Das Scheitern der britischen Hegemonie
Europa am Abgrund
Die neue Kriegs- und Friedenspolitik
Die Weltwirtschaftskrise
SCHLUSS – Der Einsatz wird erhöht
ANHANG
Dank
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Grafiken und Tabellen
Personenregister
EINLEITUNGSintflut: Eine neue Weltordnung entsteht
Ende 1915, am Morgen des ersten Weihnachtstags, stellte sich der einstige Radikalliberale David Lloyd George, nun britischer Munitionsminister, einer aufgebrachten Menge von Gewerkschaftern in Glasgow. Er war gekommen, um weitere Einberufungen an die Front zu fordern, und begründete das mit apokalyptischen Worten. Der Krieg, warnte er seine Zuhörer, werde die Welt völlig umgestalten. »Er ist die Sintflut, er ist ein Aufbäumen der Natur … und bringt beispiellose Veränderungen im gesellschaftlichen und industriellen Gefüge mit sich. Er ist ein Zyklon, der die Zierpflanzen der modernen Gesellschaft samt Wurzel ausreißt … Er ist ein Erdbeben, das selbst die Felsen des europäischen Lebens noch emporhebt. Er ist eine jener seismischen Störungen, in deren Verlauf Nationen auf einen Schlag um Generationen nach vorn katapultiert oder zurückgeworfen werden.«3 Wie ein Echo dieser Rede klangen die nicht einmal vier Monate später auf der anderen Seite der Schützengräben gesprochenen Worte des deutschen Kanzlers Theobald von Bethmann Hollweg. Am 5. April 1916, sechs Wochen nach Beginn der entsetzlichen Schlacht um Verdun, erklärte er im Reichstag ohne jede Beschönigung: »Nun muss der Friede Europas aus einer Flut von Blut und Tränen, aus den Gräbern von Millionen erstehen. Zu unserer Verteidigung sind wir ausgezogen. Aber das, was war, ist nicht mehr. Die Geschichte ist mit ehernen Schritten vorwärts gegangen; es gibt kein Zurück.«4 Die Gewalt dieses Krieges war zu einer weltverändernden Kraft geworden. 1918 hatte der Erste Weltkrieg die alten Reiche Eurasiens zerschlagen: das Zarenreich, das Habsburgerreich und das Osmanische Reich. In China tobte ein Bürgerkrieg. Anfang der 1920er Jahre waren die Grenzen Osteuropas und des Nahen Ostens neu gezogen worden. So dramatisch und umstritten diese Veränderungen schon für sich genommen waren, erlangten sie ihre volle Bedeutung doch erst, weil sie mit einem tieferen, aber nicht so offensichtlichen Umbruch gekoppelt waren. Eine neue Weltordnung ging aus diesem Krieg hervor, die trotz allem Gezänk und nationalistischen Brimborium der neuen Staaten die Hoffnung auf eine grundlegende Neugestaltung der Beziehungen zwischen den Großmächten – Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Deutschland, Russland und den Vereinigten Staaten – weckte. Es bedurfte einiger geostrategischer und historischer Vorstellungskraft, um das Ausmaß und die Bedeutung dieser Veränderung des Machtgefüges zu erkennen. Die entstehende neue Ordnung wurde zu einem großen Teil bestimmt durch die »eigenartige Mischung von offizieller Abwesenheit und effektiver Anwesenheit«5 ihres prägendsten Bestandteils: der neuen Macht der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch auf diejenigen, die die Gabe hatten, diese tektonische Verschiebung wahrzunehmen, übte diese Aussicht eine sie geradezu gefangen nehmende Faszination aus.
Im Winter 1928/29, gut zehn Jahre nach dem Ende des Weltkriegs, blickten drei mit solchem Gespür für die Veränderungen ausgestattete Zeitgenossen zurück auf das, was geschehen war – Winston Churchill, Adolf Hitler und Leo Trotzki. Am Neujahrstag 1929 schloss Churchill, damals Schatzkanzler unter dem konservativen Premierminister Stanley Baldwin, den letzten Band seiner monumentalen Geschichte des Ersten Weltkriegs ab; The World Crisis ist der Titel des fünfbändigen Werkes, The Aftermath der des letzten Bandes. Wer die Bücher Churchills zum Zweiten Weltkrieg kennt, erlebt in diesem Band zur Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine Überraschung. Churchill, der nach 1945 vom »zweiten Dreißigjährigen Krieg« sprach, um die langjährige Auseinandersetzung mit Deutschland als eine historische Einheit zu beschreiben, schlug 1929 noch einen ganz anderen Ton an.6 Damals blickte er nicht mit grimmiger Resignation, sondern mit einigem Optimismus in die Zukunft. Aus den Gräueln des Weltkriegs waren, so schien es, eine neue internationale Ordnung hervorgegangen und ein weltweiter Frieden, der auf zwei großen Verträgen ruhte: dem europäischen Sicherheitspakt, der im Oktober 1925 in Locarno ausgehandelt (und im Dezember in London unterzeichnet) worden war, und dem im Winter 1921/22 auf der Washingtoner Konferenz geschlossenen Flottenabkommen der Seemächte Großbritannien, USA, Japan, Frankreich und Italien. Diese beiden Verträge seien, so Churchill, »Zwillingspyramiden des Friedens, die massiv und unerschütterlich aufragen … die Bündnistreue der führenden Nationen der Welt und all ihrer Flotten und Heere einfordern«. Sie erst hätten dem 1919 in Versailles unvollendeten Frieden zu Substanz verholfen. Sie erst hätten dem Völkerbund, der zunächst nur ein weißes Blatt gewesen sei, Konturen verliehen. Man müsse in der Geschichte lange nach einer Parallele für ein solches Unterfangen suchen. »Die Hoffnung«, schrieb Churchill, »ruht nunmehr auf einer sichereren Grundlage … Die Phase des Zurückschreckens vor den Gräueln eines Krieges wird lange anhalten; und in diesem gesegneten Zeitraum können die großen Nationen ihre Schritte in Richtung einer Weltorganisation in der Überzeugung tun, dass die Schwierigkeiten, die ihnen noch bevorstehen, nicht größer sein werden als jene, die sie bereits überwunden haben.«7
Weder Hitler noch Trotzki hätten ihre Sicht auf die Zukunft zehn Jahre nach dem Krieg in diese Begriffe gefasst. Der Kriegsveteran und gescheiterte Putschist Adolf Hitler, der sich nun als Politiker versuchte, aber gerade eine Reichstagswahl verloren hatte, verhandelte 1928 mit seinen Verlegern über einen Folgeband seines ersten Buches Mein Kampf. Dieser sollte seine Reden und Schriften seit 1924 enthalten. Da die Verkaufszahlen des Erstlings 1928 jedoch ebenso enttäuschend waren wie das Wahlergebnis, ging dieses Manuskript nie in den Druck. Der Forschung ist es unter dem Titel »Hitlers Zweites Buch« bekannt.8 Auch Leo Trotzki hatte damals Zeit zum Schreiben und Nachdenken, denn er war, nachdem er den Machtkampf mit Stalin verloren hatte, zunächst nach Kasachstan und im Februar 1929 in die Türkei deportiert worden. Von dort aus schrieb er weiterhin seinen fortlaufenden Kommentar zur Revolution, die seit Lenins Tod im Jahr 1924 eine verheerende Wendung genommen hatte.9 Churchill, Trotzki und Hitler sind ein schlecht zusammenpassendes, um nicht zu sagen feindseliges Dreigespann. Schon allein, sie in einem Atemzug zu nennen, mag manchem als Provokation erscheinen. Sie sind nicht miteinander vergleichbar, weder als Schriftsteller, noch als Politiker, noch als Intellektuelle und schon gar nicht in ihren moralischen Persönlichkeiten. Desto mehr erstaunt es, wie sehr sich Ende der 1920er Jahre ihre Interpretationen der Weltpolitik wechselseitig ergänzen.
Hitler und Trotzki sahen denselben Tatsachen ins Auge wie Churchill. Auch sie waren überzeugt, dass der Erste Weltkrieg eine neue Phase der »Ordnung der Welt« eingeläutet hatte. Aber während Churchill diese Entwicklung freudig begrüßte, bedrohte sie den kommunistischen Revolutionär Trotzki wie den Nationalsozialisten Hitler mit nichts weniger als dem Ende all ihrer Hoffnungen. Oberflächlich mochten die Bestimmungen des Versailler Vertrags von 1919 die souveräne Selbstbestimmung fördern, eine Vorstellung, die im europäischen Spätmittelalter aufgekommen war. Im 19. Jahrhundert hatte diese Idee Pate gestanden bei der Gründung neuer Nationalstaaten auf dem Balkan und der Vereinigung Italiens sowie Deutschlands. Nun hatte diese Souveränitätsvorstellung sogar die Auflösung des Osmanischen Reiches, des Russischen Reiches und des Habsburgerreichs bewirkt. Aber obwohl die Zahl der Souveräne kräftig wuchs, wurde der Inhalt der Idee ausgehöhlt.10 Unwiderruflich hatte der Weltkrieg alle kriegführenden Länder Europas geschwächt, auch die stärksten und selbst die Siegermächte. Dass die französische Republik ihren Triumph über Deutschland 1919 in Versailles, dem Palast des Sonnenkönigs, feierte, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreich nicht länger den Rang einer Weltmacht beanspruchen konnte. Der Kriegsverlauf hatte das bestätigt. Und die kleineren Nationalstaaten, die im Lauf des vorangegangenen Jahrhunderts entstanden waren, verbanden mit dem Krieg noch traumatischere Erlebnisse. Belgien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Serbien drohte zwischen 1914 und 1919, als das Kriegsglück sich mal der einen, mal der anderen Seite zuneigte, mehrfach die Auslöschung. Anno 1900 hatte der deutsche Kaiser großspurig einen Platz auf der Bühne der Weltpolitik beansprucht. Zwanzig Jahre danach bedeutete deutsche Außenpolitik Zank mit Polen um die Grenzen Schlesiens – ein Streit, der von einem japanischen Grafen geschlichtet wurde. Statt zum Akteur war Deutschland zum Gegenstand der Weltpolitik geworden. Italien war auf der Seite der Sieger in den Krieg eingetreten, aber trotz der feierlichen Versprechungen seiner Verbündeten bestätigte der Frieden nur das Gefühl der Zweitrangigkeit. Wenn es in Europa einen Sieger gab, so war es Großbritannien, deshalb auch Churchills relativ rosige Einschätzung. Allerdings hatte es sich nicht als europäische Macht behauptet, sondern an der Spitze eines weltumspannenden Imperiums. Für die Zeitgenossen bestätigte der Eindruck, dass das Britische Empire noch vergleichsweise glimpflich davongekommen war, lediglich die Schlussfolgerung, dass das europäische Zeitalter zu Ende war. In einem Zeitalter der Weltmacht war Europa in politischer, militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht unwiderruflich zur Provinzialität herabgestuft worden.11
Die einzige Nation, die augenscheinlich unbeschadet und um ein Vielfaches mächtiger aus dem Krieg hervorging, waren die Vereinigten Staaten. Ihre Dominanz war in der Tat so überwältigend, dass man meinen konnte, es stelle sich die Frage, die im 17. Jahrhundert aus der Geschichte Europas verdrängt worden war, wieder: Waren die Vereinigten Staaten ein universales, weltumspannendes Reich, vergleichbar dem, das die katholischen Habsburger einst zu errichten drohten? Diese Frage überschattete das ganze folgende Jahrhundert.12 Bereits Mitte der 1920er Jahre hatte Trotzki den Eindruck, dass sich das »balkanisierte Europa« gegenüber den Vereinigten Staaten in der gleichen Lage befinde wie in der Vorkriegszeit die Länder Südosteuropas gegenüber Paris und London.13 Sie besaßen zwar die Insignien der Souveränität, aber nicht die Sache selbst. Sofern es den politischen Führern Europas nicht gelinge, ihre Bevölkerungen aus der üblichen »politischen Gedankenlosigkeit« zu reißen, warnte Hitler im Jahr 1928, werde es nicht gelingen, »einer drohenden Welthegemonie des nordamerikanischen Kontinents vorzubeugen«, was die europäischen Staaten allesamt auf den Status der Schweiz oder der Niederlande degradieren würde.14 Von Whitehall aus betrachtet hatte Churchill die Kraft dieser Überzeugung nicht als spekulative Zukunftsvision, sondern ganz konkret als praktische Realität der Macht gespürt. Die britischen Regierungen der 1920er Jahre mussten sich, wie wir sehen werden, immer wieder mit der schmerzlichen Tatsache auseinandersetzen, dass die Vereinigten Staaten eine Macht ganz neuen Ausmaßes waren. Sie hatten sich auf einmal als ein neuartiger »Überstaat« entpuppt, der ein Vetorecht über die finanziellen und sicherheitspolitischen Interessen der anderen Mächte ausübte.
Die Entstehung dieser neuen Weltordnung nachzuzeichnen ist das zentrale Anliegen dieses Buches. Es verlangt eine besondere Vorgehensweise, weil sich Amerikas Macht auf eine merkwürdige Weise äußerte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts legte die amerikanische Führung keinen sonderlichen Wert darauf, sich jenseits der großen Schifffahrtsrouten als Militärmacht zu präsentieren. Ihr Einfluss machte sich häufig indirekt und in Form latenter Kraft bemerkbar statt durch unmittelbare und offensichtliche Präsenz. Nichtsdestotrotz war diese Kraft real. Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Frage, wie die Welt sich mit der neuen Schlüsselrolle der USA arrangierte, einer Schlüsselrolle, die ihren Ausdruck fand im Kampf um die Etablierung einer neuen Ordnung. Dieser Kampf wurde stets auf mehreren Ebenen geführt: auf der wirtschaftlichen, der militärischen und der politischen. Begonnen hatte diese Auseinandersetzung schon mitten im Krieg, und sie erstreckte sich bis weit hinein in die 1920er Jahre. Es ist wichtig, sich ein korrektes Bild dieser historischen Entwicklung zu verschaffen, um die Ursprünge der sogenannten Pax Americana zu verstehen, die noch heute die Welt definiert. Auch die gewaltige zweite Phase des »zweiten Dreißigjährigen Krieges«, auf den Churchill 1945 zurückblickte, ist nur vor diesem Hintergrund zu begreifen.15 Die spektakuläre Eskalation der Gewalt in den 1930er und 1940er Jahren zeugt von dem Glauben derer, die den neuen Status quo nicht akzeptierten, dass sie es mit einer neuartigen, bedrohlichen Kraft zu tun hatten – mit der befürchteten künftigen Dominanz der amerikanischen, kapitalistischen Demokratie. Eben diese war es, die Hitler, Stalin, die italienischen Faschisten und ihr japanisches Pendant zu so radikalen Taten veranlasste. Ihren häufig unsichtbaren, nicht zu greifenden Gegnern schrieben sie konspirative Absichten zu und witterten ein die ganze Welt umspannendes, bösartigen Netz der Einflussnahme. Das waren zum großen Teil Wahnvorstellungen. Doch um zu begreifen, wie die ultragewalttätige Politik der Zwischenkriegszeit auf dem Boden des Ersten Weltkriegs und seinen Folgen entstanden ist, muss diese dialektische Beziehung zwischen Ordnung und Auflehnung ernst nehmen. Man erfasst Bewegungen wie den Faschismus oder den Sowjetkommunismus nur sehr unzureichend, wenn man sie als bekannte Äußerungen der rassistisch-imperialistischen Strömungen der modernen, europäischen Geschichte verbucht oder ihre Geschichte vom Höhepunkt der Eskalation in den Jahren 1940 bis 1942 aus rückwärts erzählt, als sie in ganz Europa und Asien siegreich wüteten und ihnen die Zukunft zu gehören schien. Welch anheimelnde Wunschbilder ihre Anhänger auf sie auch projiziert haben mögen, die Führer des faschistischen Italien, des nationalsozialistischen Deutschland, des kaiserlichen Japan und der Sowjetunion hielten sich allesamt für radikale Insurgenten gegen eine machtvolle repressive Weltordnung. Trotz all ihres Großsprechertums in den 1930er Jahren hielten sie die Westmächte im Grunde nicht für schwach, sondern für faul und scheinheilig. Hinter einer Fassade aus Moral und grenzenlosem Optimismus verbargen die Westmächte die massive Stärke, dank derer sie das deutsche Kaiserreich zerschlagen hatten und eine dauerhafte Hegemonie zu errichten drohten. Gegen die lähmende Vorstellung vom Ende der Geschichte half nur eine beispiellose Anstrengung, die zudem mit ungeheuren Risiken verbunden war.16 Das war die furchteinflößende Lektion, die die Rebellen gegen den Status quo aus dem Gang der Weltgeschichte von 1916 bis 1931 zogen – aus der Geschichte, von der dieses Buch erzählt.
I
Was waren die wesentlichen Bausteine dieser neuen Ordnung, die ihren potenziellen Gegnern so beängstigend vorkam? Nach allgemeiner Meinung waren dies drei Elemente: moralische Autorität gestützt auf militärische Macht und wirtschaftliche Überlegenheit.
Der Erste Weltkrieg, der in den Augen vieler Teilnehmer als ein Aufeinanderprallen von Reichen, also als ein klassischer Krieg zwischen Großmächten begonnen hatte, endete als ein moralisch wie politisch viel stärker aufgeladenes Unterfangen: als ein historischer Sieg einer Koalition, die sich selbst zur Verfechterin einer neuen Weltordnung ausgerufen hatte.17 Mit einem amerikanischen Präsidenten an der Spitze, führte sie »Krieg, um alle Kriege zu beenden«, und gewann diesen Krieg, um die Herrschaft des Völkerrechts zu wahren und Autokratie und Militarismus zu stürzen. Ein japanischer Augenzeuge bemerkte dazu: »Die Kapitulation Deutschlands hat den Militarismus und den Bürokratismus von Grund auf in Frage gestellt. Als natürliche Konsequenz hat die Politik, die sich auf das Volk stützt, die den Willen des Volkes wiedergibt, nämlich die Demokratie (minponshugi), wie ein Himmelsstürmer das Denken der ganzen Welt erobert.«18 Churchill wählte folgendes Bild, um die neue Ordnung zu beschreiben: »die Zwillingspyramiden des Friedens ragen fest und unerschütterlich auf«. Pyramiden sind vor allem eins: Stein gewordene Zeugnisse der Vereinigung von spiritueller und materieller Macht. Sie versinnbildlichten für Churchill auf schlagende Weise die heeren Vorstellungen, die seine Zeitgenossen mit diesem Projekt der Zivilisierung zwischenstaatlicher Gewalt verbanden. Trotzki beschrieb die Welt wie immer deutlich nüchterner. Wenn Innenpolitik und internationale Beziehungen tatsächlich nicht länger voneinander zu trennen waren, so ließen sich beide, zumindest in seinen Augen, auf eine einzige Logik reduzieren: Das »ganze politische Leben«, selbst von Staaten wie Frankreich, Italien und Deutschland, bis hin zum »Wechsel der Parteien und Regierungen wird letzten Endes durch den Willen des amerikanischen Kapitals bestimmt werden …«19 Mit dem ihm eigenen sarkastischen Humor beschwor Trotzki nicht die Ehrfurcht gebietenden Pyramiden herauf, sondern eine Komödie, in der Chicagoer Fleischhändler, Provinzsenatoren und Hersteller von Kondensmilch einem Regierungschef Frankreichs, einem britischen Außenminister oder einem italienischen Diktator einen Vortrag über die Tugenden der Abrüstung und des Weltfriedens hielten. Das waren die ungehobelten Herolde des amerikanischen Strebens nach »Weltherrschaft«, mit seinem internationalistischen Ethos von Frieden, Fortschritt und Profit.20
So unpassend sie auch in der Form gewesen sein mögen, diese Moralisierung und Politisierung der internationalen Beziehungen waren ein hochriskantes Spiel. Seit den Religionskriegen im 17. Jahrhundert hatte sich die Auffassung durchgesetzt, in der internationalen Politik und dem Völkerrecht streng zwischen Außen- und Innenpolitik zu trennen. Moralische Bewertungen und nationale Rechtsvorstellungen hatten keinen Platz in der Welt der Großmachtdiplomatie und der Kriege. Indem die Architekten der neuen »Weltordnung« diese Grenze überschritten, spielten sie ganz bewusst das Spiel von Revolutionären. Genaugenommen war seit 1917 die revolutionäre Absicht immer deutlicher zum Ausdruck gebracht worden. Ein Regimewechsel war zur Voraussetzung für Waffenstillstandsverhandlungen geworden. Der Versailler Vertrag schrieb die Kriegsschuld fest und stempelte den Kaiser zum Verbrecher. Und die Reiche der Osmanen und der Habsburger waren von Woodrow Wilson und der Entente längst zum Tod verurteilt worden. Ende der 1920er Jahre war, wie wir sehen werden, der »Aggressionskrieg« ganz generell geächtet worden. Aber so ansprechend diese liberalen Grundsätze gewesen sein mochten, sie warfen grundlegende Fragen auf. Was gab den Siegermächten das Recht, das Gesetz in dieser Form festzulegen? Gestaltete Macht das Recht? Wie hoch war ihr Einsatz gewesen, damit sie recht bekamen? Konnten Ansprüche dieser Art ein dauerhaftes Fundament für eine internationale Ordnung sein? So schrecklich auch die Vorstellung war, einen weiteren Krieg in Erwägung zu ziehen, bedeutete die Ausrufung eines ewigen Friedens nicht eine zutiefst konservative Festlegung auf die Bewahrung des Status quo, ganz unabhängig von dessen Rechtmäßigkeit? Churchill konnte sich seinen Optimismus leisten. Sein Land zählte seit langem zu den erfolgreichsten Verfechtern einer internationalen Moral und des Völkerrechts. Aber was, wenn man sich, wie ein deutscher Historiker in den 1920er Jahren schrieb, unter den Entrechteten und »Geschlagenen« wiederfindet, unter den niederen Spezies in der neuen Ordnung, als »Fellachenstaat« im Schatten der Friedenspyramiden?21
Für wahre Konservative lautete die einzig befriedigende Antwort: die Zeit zurückdrehen. Nach ihrer Auffassung sollte der liberale Trend zum moralisch aufgeladenen überstaatlichen Zusammenschluss umgekehrt werden; die internationale Politik sollte wieder fußen auf dem in idealisierten Farben gemalten Bild des Jus Publicum Europaeum, in dem die europäischen Herrscherhäuser in einer wertfreien, nicht hierarchischen Anarchie Seite an Seite lebten.22 Doch das war nicht nur eine Geschichtsverklärung, die wenig mit der Realität der internationalen Politik im 18. und 19. Jahrhundert zu tun hatte. Es ließ auch die Kräfte außer Acht, von denen Bethmann Hollweg im Frühjahr 1916 vor dem Reichstag gesprochen hatte. Nach diesem Krieg gab es kein Zurück.23 Die wahren Alternativen waren weit radikaler: entweder eine neue Form des Konformismus oder ein Aufstand in der Art, wie ihn Benito Mussolini unmittelbar nach dem Krieg anzettelte. In Mailand rief er im März 1919 die Faschistische Bewegung ins Leben, die sich gegen die entstehende neue Ordnung richtete. Mussolini diffamierte diese als »einen pathetischen ›Betrug‹ der Reichen« – damit meinte er Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten – »an den proletarischen Nationen« – sprich Italien –, »um die jetzigen Bedingungen des weltweiten Gleichgewichts für immer und ewig festzuschreiben …«24 Anstelle einer Rückkehr zu einem imaginären ancien régime versprach er eine weitere Stufe der Eskalation. Mit dieser Art der Politisierung der internationalen Beziehungen zeigte sich auch wieder das hässliche Gesicht unversöhnlicher Wertkonflikte, das sowohl die Religionskriege des 17. Jahrhunderts als auch die revolutionären Kriege Ende des 18. Jahrhunderts so tödlich hatte werden lassen. Angesichts der Schrecken des Ersten Weltkriegs gab es nur zwei Möglichkeiten: entweder ein dauerhafter Frieden oder ein noch radikalerer Krieg als der letzte.
Die Gefahr einer solchen Konfrontation war eindeutig gegeben, aber das damit verbundene Risiko hing nicht allein von der geschürten Verbitterung oder den sich bekämpfenden Ideologien ab. Letztlich hingen die Risiken, die mit dem Versuch verbunden waren, eine neue internationale Ordnung zu schaffen und zu bewahren, von der Glaubwürdigkeit der ethischen Prinzipien ab, die eingeführt werden sollten, und davon, ob diese Prinzipien aus sich selbst heraus allgemein akzeptiert würden, sowie von der Kraft, die zu ihrer Unterstützung aufgeboten wurde. Nach 1945, als die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sich im Kalten Krieg feindlich gegenüberstanden, wurde die Welt Zeugin einer bis zum Äußersten getriebenen Logik der Auseinandersetzung. Zwei globale Bündnissysteme mit selbstbewusst widerstreitenden Ideologien und gigantischen Atomwaffenarsenalen bedrohten die Menschheit mit dem Gleichgewicht des Schreckens. Die Jahre 1918/19 erscheinen vielen Historikern als ein Vorläufer des Kalten Krieges, wobei sich Wilson angeblich Lenin entgegenstellte. Aber diese Analogie, so plausibel sie klingen mag, führt in die Irre, weil nichts an der Situation des Jahres 1919 mit der Symmetrie von 1945 vergleichbar gewesen wäre.25 Im November 1918 lag nicht nur Deutschland am Boden, sondern auch Russland. Das Kräfteverhältnis von 1919 ähnelte viel stärker dem einseitigen Zustand von 1989 als der geteilten Welt von 1945. Wenn die Idee, die Welt um einen einzigen Machtblock und eine Reihe liberaler, »westlicher« Werte neu zu ordnen, wie eine radikale Neuerung erschien, so macht gerade das den Ausgang des Ersten Weltkriegs so dramatisch.
Die Niederlage von 1918 war für die Mittelmächte desto bitterer, weil die militärische Initiative im Verlauf des Krieges mehrfach gewechselt hatte. Durch eine bemerkenswerte Stabsarbeit war es den Generälen des Kaisers wiederholt gelungen, vor Ort eine Überlegenheit herzustellen und mit einem entscheidenden Durchbruch zu drohen: im Jahr 1915 in Polen, bei Verdun 1916, an der italienischen Front im Herbst 1917, an der Westfront selbst noch im Frühjahr 1918. Doch diese dramatischen Momentaufnahmen dürfen nicht davon ablenken, dass sich die Mittelmächte nur gegen Russland tatsächlich durchsetzten. An der Westfront erlebten sie vom Sommer 1914 bis zum Sommer 1918 eine Enttäuschung nach der anderen – nicht zuletzt aufgrund der Größe des Einsatzes militärischen Materials: Seit dem Sommer 1916, als die britische Armee eine gigantische transatlantische Nachschublinie auf den europäischen Schlachtfeldern einsetzte, war es nur eine Frage der Zeit, bis jede von den Mittelmächten errichtete Überlegenheit vor Ort in ihr Gegenteil umschlug. Sie wurden in einem Zermürbungskrieg aufgerieben. Obwohl noch in den letzten Tagen des Krieges im Oktober 1918 eine dünne Kruste des Widerstands existierte, war dann der Zusammenbruch fast total. Als die Großmächte sich in Versailles zu einer Weltkonferenz von noch nie dagewesenen Ausmaßen trafen, waren Deutschland und seine Verbündeten am Boden zerstört. In den kommenden Monaten wurden ihre einst stolzen Heere aufgelöst. Frankreich und seine Verbündeten in Mittel- und Osteuropa waren nun die Herren der europäischen Bühne, aber damit hatte, wie den Franzosen schmerzlich bewusst war, der Prozess der Neuordnung erst begonnen. Am dritten Jahrestag des Waffenstillstands, im November 1921, kam in Washington zum ersten Mal ein exklusiver Klub von Regierungschefs zusammen und akzeptierte eine auf beispiellose Weise von Amerika bestimmte Weltordnung. Die Währung, mit der auf dieser Flottenkonferenz in Washington Macht gemessen wurde, war die Anzahl der Schlachtschiffe, die, wie Trotzki spöttisch kommentierte, in »Rationen« zugeteilt wurden.26 Hier war von der Doppeldeutigkeit des Versailler Friedens nichts zu sehen, geschweige denn von den nebulösen Bestimmungen der Völkerbundakte. Die Anteile an der geostrategischen Macht wurden nach folgendem Schlüssel festgelegt: 10 : 10 : 6 : 3 : 3. An der Spitze standen gleichgewichtig Großbritannien und die Vereinigten Staaten, die einzigen Mächte mit Flottenpräsenz auf allen Weltmeeren. Japan als eine auf den Pazifik, also nur auf einen Ozean beschränkte Macht, folge auf Platz drei. Und die Machtsphäre Frankreichs und Italiens wurde auf die Atlantikküste und das Mittelmeer begrenzt. Deutschland und Russland wurden nicht einmal als potenzielle Konferenzteilnehmer in Betracht gezogen. Das also war das Ergebnis des Ersten Weltkriegs: eine alles umfassende Weltordnung, in der strategische Macht strenger überwacht wurde als heutzutage die Verbreitung von Atomwaffen. Es handle sich um eine Wende in den internationalen Beziehungen, merkte Trotzki an, die man durchaus mit der Kopernikanischen Wende im Mittelalter vergleichen könne.27
Die Washingtoner Flottenkonferenz war eine krasse Manifestation jener Kraft, welche die neue internationale Ordnung garantieren sollte, aber schon im Jahr 1921 fragten sich manche, ob die großen »Burgen aus Stahl« der Schlachtschiffära wirklich die Waffen der Zukunft seien. Solche Überlegungen waren jedoch unerheblich. Welchen militärischen Nutzen Schlachtschiffe auch haben mochten, sie waren die teuersten und technologisch höchstentwickelten Instrumente der globalen Machtausübung. Nur die reichsten Länder konnten sich eigene Schlachtschiffflotten leisten. Dabei baute Amerika nicht einmal die volle ihm zustehende Zahl an Schiffen. Es genügte schon, dass alle wussten, dass es dazu imstande war. Die Wirtschaft war das dominierende Medium des amerikanischen Einflusses, militärische Stärke war ein Nebenprodukt. Das erkannte Trotzki nicht nur, sondern legte auch großen Wert darauf, die Dominanz an konkreten Zahlen festzumachen. In einem Zeitalter des verschärften internationalen Wettbewerbs war die dunkle Kunst der vergleichenden Wirtschaftsstatistik eine charakteristische Hauptbeschäftigung. Im Jahr 1872 hatten Trotzki zufolge die Volkseinkommen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs in etwa gleichauf gelegen; sie alle hatten über ein Einkommen von 30 bis 40 Milliarden Dollar verfügt. 50 Jahre danach herrschte eine gewaltige Diskrepanz. Nachkriegsdeutschland war verarmt, laut Trotzki gar ärmer als im Jahr 1872. Im Gegensatz dazu sei »Frankreich – etwa doppelt so reich (68 Milliarden), England – ebenfalls (etwa 89 Milliarden), während das Volksvermögen [der] U.S.A. jetzt nach vorsichtiger Schätzung 320 Milliarden Dollar beträgt«.28 Diese Zahlen waren zwar reine Spekulation, aber niemand bestritt, dass die britische Regierung zur Zeit der Flottenkonferenz den amerikanischen Steuerzahlern 4,5 Milliarden Dollar schuldete, die Franzosen 3,5 Milliarden und Italien 1,8 Milliarden. Die japanische Zahlungsbilanz hatte sich dramatisch verschlechtert und das Land wartete angstvoll auf Unterstützung der US-Bank J. P. Morgan. Um die gleiche Zeit wurden zehn Millionen Sowjetbürger durch die amerikanische Hungerhilfe vor dem sicheren Tod bewahrt. Keine Macht hatte jemals eine so weltumspannende wirtschaftliche Dominanz ausgeübt.
Wenn wir die Entwicklung der Weltwirtschaft seit dem 19. Jahrhundert mithilfe heutiger statistischer Methoden veranschaulichen, wird deutlich, dass die Geschichte zweigeteilt ist (Grafik 1).29 Seit Beginn des 19. Jahrhunderts war das Britische Empire die größte Wirtschaftseinheit auf der Welt gewesen. Im Laufe des Jahres 1916, dem Jahr der Schlachten bei Verdun und an der Somme, wurde die gesamte Produktion des Britischen Empire von der der Vereinigten Staaten von Amerika überholt. Von da an bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts blieb die amerikanische Wirtschaftsmacht der entscheidende Faktor für die Gestaltung der Weltordnung.
Grafik 1. Das BIP der Reiche (nach dem Wert des Dollar von 1990)
Insbesondere für britische Autoren bestand stets die Versuchung, die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts als eine Geschichte der Nachfolge zu präsentieren, der zufolge die Vereinigten Staaten das Zepter der britischen Vormachtstellung erbten.30 Das schmeichelt zwar Großbritannien, führt aber in die Irre, weil damit eine Kontinuität der Probleme der internationalen Staatenordnung und der Methoden, diese zu lösen, angedeutet wird. Die Probleme der Weltordnung, die sich durch den Ersten Weltkrieg stellten, waren aber nicht vergleichbar mit vorangegangenen internationalen Herausforderungen, sei es der Briten, der Amerikaner oder einer anderen Macht. Und zugleich war die amerikanische Wirtschaftsmacht sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr viel größer als diejenige, über die Großbritannien jemals verfügt hatte. Die wirtschaftliche Vorherrschaft Großbritanniens hatte sich innerhalb des von ihm geschaffenen »Weltsystems« entfaltet, das sich von der Karibik bis zum Pazifik erstreckte und sich mit den Mitteln des Freihandels, der Bevölkerungswanderung und des Kapitalexports »informell« noch sehr viel weiter ausdehnte.31 Und im Rahmen dieses Weltsystems entwickelten sich auch all die anderen Volkswirtschaften, die im späten 19. Jahrhundert die fortschreitende Globalisierung des Handels und der Wirtschaft vorantrieben. In Anbetracht des Aufstiegs anderer Nationen zu bedeutenden Wettbewerbern sprachen sich einige Verfechter des Empire, Fürsprecher eines »greater Britain«, nachdrücklich dafür aus, aus diesem heterogenen Konglomerat einen in sich geschlossenen Wirtschaftsblock zu schmieden.32 Aber dank der im britischen Bewusstsein verankerten Kultur des Freihandels wurden Schutzzölle für den Handel zwischen Großbritannien, seinen Kolonien und überseeischen Herrschaftsgebieten nur während der verheerenden Weltwirtschaftskrise eingeführt. Nicht das britische Weltreich, sondern die Vereinigten Staaten verkörperten all das, wonach die Fürsprecher eines wirtschaftlichen Großraums strebten: Was als eine Ansammlung verschiedenartiger kolonialer Siedlungen begonnen hatte, hatte sich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts zu einem expandierenden, hochgradig integrativen Reich entwickelt. Im Gegensatz zum britischen Empire gliederte die amerikanische Republik die neuen Territorien im Westen und Süden uneingeschränkt in die föderale Verfassung ein. Bedenkt man die schon bei der Staatsgründung bestehende Kluft zwischen dem auf Sklavenarbeit basierenden Süden und dem die Sklaverei ablehnenden Norden, war dieser Zusammenschluss mit Gefahren verbunden. Im Jahr 1861, nicht einmal 100 Jahre nach seiner Gründung, wurde das sich rasant ausdehnende Gemeinwesen von einem furchtbaren Bürgerkrieg erschüttert. Vier Jahre danach war der Bundesstaat zwar gerettet worden, aber zu einem vergleichbar schrecklichen Preis wie dem, den die Hauptakteure des Ersten Weltkriegs zahlten. Die politische Klasse der Vereinigten Staaten bestand 1914, fünfzig Jahre nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, also aus durch die blutigen Kriegserfahrungen ihrer Kindheit traumatisierten Männern. Um die Friedenspolitik des Weißen Hauses unter Woodrow Wilson zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass der 28. Präsident der Vereinigten Staaten das erste Kabinett aus Demokraten der Südstaaten anführte, das seit dem Sezessionskrieg regierte. In ihrem eigenen Aufstieg sahen diese Männer die Versöhnung des weißen Amerika und die Neugründung des amerikanischen Nationalstaats bestätigt.33 Unter furchtbaren Kosten war aus Amerika ein historisch beispielloses Staatswesen geworden. Das war nicht mehr das landhungrige, nach Westen expandierende Reich. Aber es war auch nicht Thomas Jeffersons neoklassisches Ideal einer »Stadt auf einem Hügel«. Ein Gemeinwesen war entstanden, das nach der klassischen politischen Theorie als nicht realisierbar gegolten hatte. Es war ein stabiler Bundesstaat von kontinentaler Größe, ein gigantischer Nationalstaat. Zwischen 1865 und 1914 wuchs die amerikanische Volkswirtschaft, die von den Märkten, Verkehrs- und Kommunikationsnetzen des britischen Weltsystems profitierte, schneller als irgendeine Volkswirtschaft jemals zuvor. Allein durch die beherrschende Stellung entlang der Küsten der beiden größten Weltmeere erhob der neue Staat einen einzigartigen Anspruch auf weltweiten Einfluss und verfügte auch über die dazu nötigen Mittel. Wer die Vereinigten Staaten als Erbe der britischen Vorherrschaft beschreibt, verhält sich ähnlich wie diejenigen, die noch 1908 hartnäckig daran festhielten, Henry Fords »Model T« als »pferdelose Kutsche« zu bezeichnen. Diese Formulierung war zwar nicht falsch, aber sie war anachronistisch. Es handelte sich nicht um eine Erbfolge, sondern um einen Paradigmenwechsel, der einherging mit dem Eintreten der Vereinigten Staaten für eine neuartige Vorstellung einer Weltordnung.
In diesem Buch wird noch oft von Woodrow Wilson und seinen Nachfolgern die Rede sein. Doch ein absolut elementarer Punkt lässt sich schon ohne weiteres festhalten: Nachdem sich die USA durch einen aggressiven Expansionsprozess kontinentalen Ausmaßes, der jedoch jeden Konflikt mit anderen Großmächten mied, zu einem Nationalstaat von globalem Einfluss entwickelt hatten, verfügten sie über eine ganz andere strategische Ausrichtung als die alten Mächte Großbritannien und Frankreich oder deren unlängst aufgetauchte Rivalen Deutschland, Japan und Italien. Die Vereinigten Staaten erkannten, als sie Ende des 19. Jahrhunderts die Weltbühne betraten, dass es in ihrem Interesse lag, die heftige internationale Konkurrenz zu beenden, die seit den 1870er Jahren das neue Zeitalter des weltweiten Imperialismus geprägt hatte. Gewiss, im Jahr 1898 im Spanisch-amerikanischen Krieg begeisterte sich auch die politische Klasse Amerikas für eine Expansion nach Übersee. Doch angesichts der tatsächlichen Erfahrung der Kolonialherrschaft auf den Philippinen verpuffte die Begeisterung rasch, und eine grundlegende strategische Einsicht setzte sich durch. Amerika konnte nicht von der Welt des 20. Jahrhunderts losgelöst bleiben. Der Aufbau einer großen Flotte war bis zum Auftreten der strategischen Luftwaffe die Hauptachse der amerikanischen Militärstrategie. Amerika achtete auf das Wohlverhalten seiner Nachbarn in der Karibik und Mittelamerika und auf die Einhaltung der Monroe-Doktrin, der Schranke gegen externe Intervention in der westlichen Hemisphäre. Anderen Mächten musste der Zugang verwehrt werden. Amerika legte zahlreiche Militärbasen und Stützpunkte zur Ausübung seiner Macht an. Doch auf ein Sammelsurium zusammengewürfelter kolonialer Besitztümer konnten die Vereinigten Staaten gut und gerne verzichten. In diesem Punkt bestand ein grundlegender Unterschied zwischen den auf ihrem eigenen Großraum basierenden Vereinigten Staaten und dem »liberalen Imperialismus« Großbritanniens.34
Die wahre Logik der amerikanischen Macht wurde zwischen 1899 und 1902 in drei Noten artikuliert, in denen Außenminister John Hey zum ersten Mal die sogenannte Politik der offenen Tür skizzierte. Als Basis für eine neue internationale Ordnung schlugen diese Noten ein täuschend einfaches, aber weitreichendes Prinzip vor: gleichen Zugang für Waren und Kapital.35 Um Missverständnissen vorzubeugen: Diese »offene Tür« war kein Aufruf zum Freihandel. Unter den großen Volkswirtschaften setzten die Vereinigten Staaten am stärksten auf Protektionismus. Und sie begrüßten auch keineswegs jeden Wettbewerb um seiner selbst willen. Sobald weltweit die Türen geöffnet waren, würden, so die zuversichtliche Annahme der US-Strategen, amerikanische Exporteure und Bankiers alle Rivalen aus dem Feld schlagen. Langfristig sollte die Politik der offenen Tür somit die exklusive Herrschaft der Europäer in deren Besitzungen untergraben. Es ging den USA ebensowenig darum, an der imperialistischen Rassenhierarchie oder der Trennung der Hautfarben zu rütteln. Handel und Investitionen verlangten Ordnung, nicht Revolution. Nicht gegen Imperialismus im Sinne einer ertragreichen kolonialen Expansion oder der Herrschaft der Weißen über farbige Völker richtete sich also die amerikanische Strategie, sondern gegen Imperialismus im Sinne der »selbstsüchtigen«, gewaltsamen Rivalität zwischen Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Russland und Japan. Denn diese drohte, die ganze Welt in abgeschlossene Interessensphären aufzuteilen.
Der Krieg machte Woodrow Wilson zu einer internationalen Berühmtheit, seither wurde der amerikanische Präsident als bahnbrechender Prophet des liberalen Internationalismus gefeiert. Dabei waren die Grundelemente seines Programms nichts weiter als vorhersehbare Erweiterungen der auf der amerikanischen Macht basierenden Politik der offenen Tür. Wilson wollte internationale Schlichtung, freie Schifffahrt auf den Weltmeeren und die Gleichbehandlung in der Handelspolitik. Und dem Wettstreit der imperialistischen Mächte sollte der Völkerbund ein Ende setzen. Das war die antimilitaristische, postimperialistische Agenda eines Landes, das sich seines weltweiten Einflusses sicher war – eines Einflusses, den es aus der Entfernung und über »weiche« Machtmittel ausüben wollte: Wirtschaft und Ideologie.36 Bislang ist allerdings nicht hinreichend bedacht worden, inwieweit Wilson überhaupt bereit war, diese Agenda der amerikanischen Hegemonie gegen sämtliche Spielarten des europäischen und japanischen Imperialismus durchzusetzen. Die ersten Kapitel dieses Buches werden zeigen, dass Wilson Amerika 1916 keineswegs mit dem Ziel an die vorderste Front der Weltpolitik geführt hatte, dafür zu sorgen, dass die »richtige« Seite diesen Krieg gewann, sondern dass keine Seite gewann. Er lehnte jede offene Verbindung mit der Entente ab und tat alles in seiner Macht Stehende, um die von London und Paris angestrebte Eskalation des Krieges zu verhindern, mit der diese hofften, Amerika auf ihre Seite zu ziehen. Nur ein Frieden ohne Sieg – das Ziel, das er im Januar 1917 in einer wegweisenden Rede vor dem Senat verkündete – konnte die Vereinigten Staaten zum unumstrittenen Schiedsrichter der Weltpolitik machen. Trotz des Scheiterns dieser Politik schon im Frühjahr 1917 und trotz des widerwilligen Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg blieb dies, wie wir sehen werden, das Hauptziel Wilsons und seiner Nachfolger bis in die 1930er Jahre. Und genau hier liegt auch der Schlüssel zur Beantwortung der daraus folgenden Frage: Wenn die Vereinigten Staaten tatsächlich eine Welt der offenen Tür etablieren wollten und ihnen dafür so eindrucksvolle Ressourcen zur Verfügung standen, warum ging dann alles so furchtbar schief?
II
Die Frage nach dem Scheitern des Liberalismus ist die Standardfrage der Historiographie zur Zwischenkriegszeit.37 Diese Frage erscheint in einem anderen Licht, und genau da setzt deshalb dieses Buch an, wenn man sich vor Augen führt, wie dominant die Sieger des Ersten Weltkriegs mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten an der Spitze wirklich waren. In Anbetracht der Ereignisse der 1930er Jahre wird dies allzu leicht vergessen. Auch ließ die unmittelbare Antwort, die die Verfechter des Wilsonianismus gaben, das Gegenteil vermuten, also dass von einer Dominanz keine Rede sein konnte.38 Schon bevor es dazu kam, ahnten sie bereits das Scheitern der Versailler Friedenskonferenz und stilisierten Wilson zum tragischen Helden, der vergeblich versuchte, sich aus den Machenschaften der Alten Welt herauszuhalten. Dieses Narrativ fußte auf der Unterscheidung zwischen dem amerikanischen Propheten einer liberalen Zukunft und der korrupten Alten Welt, der er seine Botschaft verkündete.39 Letzten Endes fügte sich Wilson den Kräften der Alten Welt, allen voran den britischen und französischen Imperialisten. Das Ergebnis war ein »schlechter« Frieden, der vom amerikanischen Senat und einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt wurde, nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen englischsprachigen Welt.40 Es kam noch schlimmer. Die von Verfechtern der alten Ordnung in Gang gesetzten Nachhutgefechte blockierten nicht nur den Weg zu einer neuen Welt, sondern öffneten zudem noch weit gewalttätigeren politischen Dämonen Tür und Tor.41 Während Europa von Revolutionen und gewaltsamen Konterrevolutionen erschüttert wurde, fand sich Wilson mit Lenin konfrontiert, eine erste Andeutung des Kalten Krieges. Zugleich belebte das Schreckgespenst des Kommunismus die extreme Rechte. Zunächst in Italien und dann auf dem ganzen europäischen Kontinent trat der Faschismus in den Vordergrund, am tödlichsten in Deutschland. Die Gewalt und der zunehmend rassistisch und antisemitisch geprägte politische Diskurs der Krisenjahre 1917 bis 1921 kündigten auf beklemmende Weise die noch größeren Schrecken der 1940er Jahre an. Für diese Katastrophe konnte die Alte Welt keinem anderen als sich selbst die Schuld geben. Europa war, mit Japan als seinem tüchtigen Schüler, wirklich der »dunkle Kontinent«.42
So erzählt, hat die Geschichte eine hohe dramatische Wirkung und auch eine bemerkenswert reichhaltige historische Literatur hervorgebracht. Aber auch über den Nutzen für die Geschichtsdarstellung hinaus ist dieses Narrativ wichtig, weil es tatsächlich die transatlantischen Diskussionen über die Ausgestaltung der Politik seit der Jahrhundertwende geprägt hat. Wie wir sehen werden, wurden sowohl die Haltung der Regierung Wilson als auch die ihrer republikanischen Nachfolger bis hin zu Herbert Hoover von dieser Wahrnehmung der europäischen und japanischen Geschichte geprägt.43 Zudem hatte diese Version nicht nur für Amerikaner, sondern auch für Europäer ihren Reiz. Den Linksliberalen, Sozialisten und Sozialdemokraten in Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan lieferte Wilson Argumente, die sie gegen ihre politischen Gegner im eigenen Land einsetzen konnten. Tatsächlich gewann Europa während des Ersten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit im Spiegel der amerikanischen Macht und Propaganda einen neuen Begriff von der eigenen »Rückständigkeit« – eine Selbsteinschätzung, die nach 1945 noch stärker zum Tragen kam.44 Doch gerade weil diese historische Wahrnehmung Europas als eines dunklen Kontinents, der sich hartnäckig dem historischen Fortschritt widersetzt, tatsächlich Einfluss auf die Geschichte hatte, birgt dieses Narrativ zugleich Gefahren für die Historiker. Das totale Fiasko des Wilsonianismus hat einen langen Schatten geworfen. Sein Konstrukt der Geschichte der Zwischenkriegszeit durchdringt die Quellen so sehr, dass eine bewusste Anstrengung nötig ist, will man es sich vom Leib halten. Eben deshalb kommt dem ungewöhnlichen Trio zu Beginn dieser Einleitung – Churchill, Hitler und Trotzki – eine so hohe korrektive Bedeutung zu. Ihr Blick auf die Nachkriegszeit war ein völlig anderer. Sie waren überzeugt, dass sich tatsächlich ein grundlegender Wandel in der Weltpolitik vollzogen hatte. Sie waren sich ferner einig, dass die Bedingungen dieses Umbruchs von den Vereinigten Staaten diktiert wurden, mit Großbritannien als bereitwilligem Gehilfen. Angenommen, es gab eine Dialektik der Radikalisierung, die hinter den Kulissen wirkte und extremistischen Aufständen Tür und Tor öffnete, so war diese im Jahr 1929 weder Trotzki noch Hitler ersichtlich. Eine zweite dramatische Krise, die Weltwirtschaftskrise, war erforderlich, um die Lawine des Aufstands auszulösen. Sobald die Extremisten ihre Chance bekamen, nährte eben dieses Gefühl, es mit einem mächtigen Gegner zu tun zu haben, die Gewalt und die tödliche Energie, mit der sie gegen die Nachkriegsordnung aufbegehrten.
Das führt zum zweiten wichtigen Interpretationsmuster der Katastrophe der Zwischenkriegszeit, der These von der Hegemoniekrise.45 Diese Deutung beginnt an exakt dem gleichen Punkt, an dem wir hier ansetzen, nämlich mit dem vernichtenden Sieg der Entente und der Vereinigten Staaten im Ersten Weltkrieg, und fragt nicht, warum man sich diesem Schwergewicht der amerikanischen Macht widersetzte, sondern warum die Sieger, die doch infolge des Großen Krieges ein so großes Machtübergewicht hatten, nicht die Oberhand behielten. Immerhin war ihre Überlegenheit nicht eingebildet. Ihr Sieg im Jahr 1918 war kein Zufall. 1945 brachte eine ähnliche Koalition Italien, Deutschland und Japan eine noch verheerendere Niederlage bei. Darüber hinaus hatten die Vereinigten Staaten nach 1945 in ihrer Machtsphäre eine äußerst erfolgreiche politische und wirtschaftliche Neuordnung in Angriff genommen.46 Was ist also nach 1918 schiefgelaufen? Warum ist die amerikanische Politik in Versailles fehlgeschlagen? Warum ist die Weltwirtschaft im Jahr 1929 zusammengebrochen? Das sind die Fragen, von denen dieses Buch seinen Ausgang nimmt und die bis heute nachwirken. Warum spielt »der Westen« seine Trümpfe nicht besser aus? Wie steht es um die Organisations- und Führungsfähigkeit des Westens?47 Mit Blick auf den Aufstieg Chinas gewinnen diese Fragen offensichtlich an Bedeutung. Doch nach welchem Maßstab soll man dieses Scheitern beurteilen, und woher nimmt man eine überzeugende Erklärung für den fehlenden Willen und das mangelnde Urteilsvermögen, die immer wieder die reichen, mächtigen Demokratien heimsuchen?
Konfrontiert mit diesen beiden grundlegenden Erklärungsmustern – »dunkler Kontinent« versus »Scheitern der liberalen Hegemonie« –, strebt die vorliegende Studie eine Synthese an. Das kann jedoch nicht durch einfache Kombination der beiden gelingen. Vielmehr möchte dieses Buch die beiden historischen Deutungsmuster für eine dritte Frage öffnen, eine, die den blinden Fleck aufzeigt, den sie gemeinsam haben. Beide Interpretationen lassen die radikale Neuartigkeit der Situation außer Acht, der sich die politischen Führer der Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts konfrontiert sahen.48 Der blinde Fleck steckt in dem primitiven »Neue Welt, alte Welt«-Deutungsmuster der »Dunkler Kontinent«-Schule. Dieses Muster schreibt Innovation, Offenheit und Fortschritt den »externen Kräften« zu, seien es die Vereinigten Staaten oder die revolutionäre Sowjetunion. Gleichzeitig wird die zerstörerische Kraft des Imperialismus vage mit einer »alten Welt« oder einem »ancien régime« identifiziert, einer Epoche, die nach Ansicht mancher Historiker bis in das Zeitalter des Absolutismus oder gar noch weiter in die Tiefen der blutgetränkten europäischen und ostasiatischen Geschichte zurückreicht. Damit werden die Katastrophen des 20. Jahrhunderts der Last der Vergangenheit zugeschrieben. Mag sein, dass das Modell einer Hegemoniekrise die Zwischenkriegsjahre anders deutet. Aber diese Schule holt noch weiter in der Geschichte aus und schert sich noch weniger darum, dass im frühen 20. Jahrhundert womöglich tatsächlich ein neuartiges Zeitalter begann. Die Hegemonietheorie in Reinkultur betont ausdrücklich, dass sich die kapitalistische Weltwirtschaft seit ihren Anfängen im 16. Jahrhundert stets auf eine zentrale, stabilisierende Macht gestützt habe – seien es die italienischen Stadtstaaten, die Habsburgermonarchie, die Republik der Niederlande oder die viktorianische Royal Navy. Die Intervalle zwischen der einen und der nächsten Hegemonialmacht seien typische Krisenzeiten gewesen. Die Krise der Zwischenkriegszeit sei lediglich die letzte derartige Zäsur, gewissermaßen das Intervall zwischen der britischen und der amerikanischen Hegemonie.
ENDE DER LESEPROBE





























